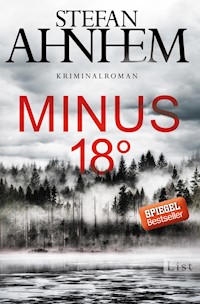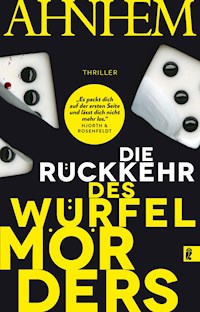12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Stockholm, Metropole des Nordens. Fabian Risk wollte eigentlich mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Doch dann taucht die brutal zugerichtete Leiche des Justizministers auf, und Risk wird um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten. Es bleibt nicht bei einem Opfer. Die einzige Verbindung zwischen den Toten: Jedem wurde ein Organ geraubt. Als ein Verdächtiger Selbstmord begeht, glauben Risks Kollegen, den Fall gelöst zu haben. Nur Risk hat Zweifel. Er hat eine Vermutung, was eigentlich hinter alldem steckt. Und er ahnt, dass der Mörder mit seinem Rachefeldzug noch lange nicht fertig ist … Herzsammler ist der zweite Teil der Fabian-Risk-Serie und erzählt die spannende Vorgeschichte zu dem großen Spiegel-Bestseller Und morgen du.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Stockholm, kurz vor Weihnachten. Schnee und eisige Kälte haben die Stadt fest im Griff. Kommissar Fabian Risk hat mit Eheproblemen zu kämpfen, seine Frau Sonja möchte sich scheiden lassen. Risk muss sich alleine um die beiden Kinder kümmern. Aber dann wird er zu einem brisanten Fall gerufen: Der Justizminister ist verschwunden. Er hat nach einer Debatte den Reichstag verlassen, kam aber nie bei dem auf ihn wartenden Auto an. Risk findet den Minister, doch zu spät: Er wurde brutal ermordet. Und es bleibt nicht bei dieser einen Entführung.
Gleichzeitig wird in Kopenhagen eine Frau umgebracht. Die junge Polizistin Dunja Hougaard ermittelt, muss sich dabei aber mit den unwillkommenen Avancen des Polizeichefs herumschlagen. Der sabotiert den Fall, wo er nur kann. So fällt keinem die Ähnlichkeit zu der Mordserie im Nachbarland Schweden auf. Bis es fast zu spät ist.
Zwei Länder. Zwei Ermittler. Ein Fall.
Der Autor
Stefan Ahnhem ist ein bekannter schwedischer Drehbuchautor, unter anderem für die Filme der Wallander-Reihe. Er lebt mit seiner Familie in Stockholm.
Herzsammler ist der zweite Teil seiner erfolgreichen Krimiserie um den Kommissar Fabian Risk.
Stefan Ahnhem
Herzsammler
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen von Katrin Frey
List
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Die schwedische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Den nionde graven bei Forum, Stockholm
ISBN: 978-3-8437-1156-2
List ist ein Verlag
der Ullstein Buchverlage GmbH
© 2015 by Stefan Ahnhem
© 2015 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Nach einem Konzept der Zero Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Mike Dobel / Arcangel Images
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
PROLOG
14. Juni–8. November 1999
Es war so dunkel, dass er fast nichts sah. Außerdem schwankte und schaukelte der Gefangenentransport auf dem Weg durch das unwegsame Gelände so heftig, dass man die Buchstaben, die er zu schreiben versuchte, kaum lesen konnte. Doch es nützte nichts. Dies war seine letzte Chance, alles niederzuschreiben, bevor die Blutlache unter ihm zu groß war. Die Geschichte seiner Verliebtheit, die ihn dazu getrieben hatte, alles Vertraute hinter sich zu lassen und sich ins Unbekannte zu stürzen, wo er angeschossen und von seinen eigenen Leuten gefangenen genommen worden war, nun unterwegs in den sicheren Tod.
Den Stift hatte er bei sich, seit er das israelische Militärlager an der Straßensperre verlassen und die Grenze nach Palästina überschritten hatte. Im Tagebuch in Tamirs Rucksack hatte er noch ein paar leere Seiten gefunden. Und einen benutzten Briefumschlag, der sich umstülpen ließ. Als der Brief fertig war, faltete er ihn mit seinen blutigen Händen zusammen, steckte ihn in das Kuvert und klebte es zu, so gut es ging.
Er hatte weder eine Briefmarke noch die Adresse des Empfängers. Nur den Namen wusste er. Trotzdem zwängte er ihn ohne Zögern durch den schmalen Spalt und ließ los. So Gott wollte, würde der Brief ankommen, dachte er und gab der Müdigkeit nach.
Der Umschlag hatte die Erde noch nicht berührt, als die kräftigen Winde ihn erfassten und immer höher hinauf in den sternlosen Nachthimmel trugen. Über die Berge von Nablus, Jarzim und Ebal rollte ein weiteres Unwetter, und der Abstand zwischen den hellen Blitzen und dem dumpfen Grollen wurde immer kürzer. Regen hing in der Luft, und es war nur eine Frage von Sekunden, wann die ersten Tropfen das Kuvert zu Boden hämmern und die trockene Erde in feuchten Lehm verwandeln würden. Doch es fiel kein einziger Tropfen, und der blutverschmierte Umschlag mit dem handgeschriebenen Brief setzte seinen Aufstieg über die Berge und die Grenze nach Jordanien fort.
Saladin Hazaymeh lag auf seiner ausgerollten Matte und sah in den Himmel, wo das Morgengrauen einen ersten zaghaften Versuch unternahm. Die kräftigen Winde im Zuge des nächtlichen Unwetters waren endlich abgeflaut, ein herrlicher Tag kündigte sich an. Die Sonne hatte offenbar beschlossen, den Himmel für seinen siebzigsten Geburtstag zu putzen. Doch nicht das Wetter beschäftigte Saladin Hazaymeh. Obwohl sein Geburtstag der Grund für die zehntägige Wanderung gewesen war, hatte er etwas anderes im Kopf.
Anfangs hatte er geglaubt, ein Flugzeug in mehreren Tausend Metern Höhe zu sehen, dann jedoch beschlossen, dass es sich um einen Vogel mit einem verletzten Flügel handeln musste. Mittlerweile hatte er nicht die geringste Ahnung mehr, was da vom Himmel herunterflatterte und dabei hin und wieder im Sonnenlicht aufblitzte.
Saladin Hazaymeh stand auf und nahm überrascht zur Kenntnis, dass die Rückenschmerzen, die er morgens immer spürte, wie weggeblasen waren. Eilig rollte er seine Matte zusammen und steckte sie in den Rucksack. Irgendetwas würde passieren. Etwas von großer Bedeutung. Er spürte, wie sich sein ganzes Ich mit neuer Energie füllte. Dies konnte nur ein Zeichen von oben sein. Eine Offenbarung von dem Gott, an den er glaubte, seit er denken konnte, und der ihm nun sagen wollte, dass er auf dem richtigen Weg war. Der Gott, dessen Sohn er, wie er an seinem siebzigsten Geburtstag beschlossen hatte, zu Fuß von Jerusalem bis an den See Genezareth folgte.
Gestern hatte er mit dem Ziel, die Nacht genau dort zu verbringen, wo Jesus mit seinen Jüngern und der Jungfrau Maria übernachtet hatte, die heilige Grotte in Anjara besucht, aber da die Wächter ihn entdeckten, musste er unter freiem Himmel schlafen. Doch offensichtlich hatte das alles einen Sinn, dachte Saladin und eilte leichtfüßig über das unebene Gelände zu dem Olivenbaum, in dessen Zweigen das Zeichen Gottes hängen geblieben war.
Als er vor dem Baum stand, erkannte er, dass es sich um einen Umschlag handelte.
Ein Briefumschlag?
Sosehr er sich auch bemühte, eine logische Erklärung für dessen Herkunft zu finden, musste er sich am Ende doch mit dem Himmel als Antwort begnügen. Und nachdem seine innere Stimme mantraartig wiederholte, wie wichtig es sei, dass er sich hierum kümmerte, war das vielleicht auch nicht ganz falsch. Vielleicht war genau das hier und nichts anderes der Grund seiner Wanderung.
Nach einigen Versuchen gelang es ihm, ihn mit einem Stein zu treffen und den Umschlag aufzufangen, bevor er auf dem Boden aufschlug. Er war schmutzig und beschädigt und schien allen Widrigkeiten zum Trotz den Weltuntergang überlebt zu haben. Außerdem war er schwerer als erwartet.
Alle Zweifel waren hinweggefegt.
Gott hatte ihn auserwählt.
Dies war nicht irgendein Briefumschlag.
Er studierte ihn von allen Seiten, fand aber keinen Hinweis, abgesehen von einem klein und krakelig geschriebenen Namen.
Aisha Shahin.
Saladin Hazaymeh setzte sich auf einen Stein und las sich den Namen mühsam laut vor, aber er sagte ihm nichts. Nach einigem Zögern zog er sein Messer aus der Tasche und schlitzte das Kuvert vorsichtig auf. Ohne zu merken, dass er den Atem anhielt, zog er den Brief aus dem Umschlag und faltete ihn auseinander. Er war voller handgeschriebener Zeichen, die zusammen lange Wortreihen in hebräischer Sprache bildeten, so viel begriff er. Aber wie hätte er sie verstehen sollen, wo er doch kaum Arabisch lesen konnte?
War es das, was Gott ihm zu sagen versuchte? Bestrafte er ihn, weil er nie Lesen gelernt hatte? Oder war der Brief gar nicht für ihn bestimmt? War er in Wirklichkeit nur ein unbedeutendes Bindeglied, dessen Aufgabe darin bestand, ihn weiterzugeben? Erfolglos bemühte er sich, seine Enttäuschung zu unterdrücken, während er den Brief wieder zusammenfaltete, zurück in den Umschlag steckte und seine Wanderung nach Ajloun fortsetzte, wo er ihn widerwillig in einen Briefkasten steckte.
Viele wären sicher der Meinung, dass Khaled Shawabkeh sich schändlich und höchst unmoralisch verhielt. Er selbst dagegen hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen, als er den Umschlag ohne Briefmarke, Absender und Adresse einsteckte. Briefe, deren Absender ihren Pflichten nicht nachgekommen waren, betrachtete er als sein Eigentum. So hatte er es in den dreiundvierzig Jahren in der Postsortierung ohne Ausnahme gehalten.
Zu Hause hatte er mehrere Kisten, eine für jedes Jahr, voller verirrter Briefe, und es gab nichts Schöneres für ihn, als zufällig einen herauszufischen und an Gedanken teilzuhaben, die eigentlich für jemand anderen bestimmt waren. Dieser Briefumschlag jedoch war etwas Besonderes. Seine Patina verriet, dass allein die zurückgelegte Reise ein Abenteuer gewesen sein musste. Außerdem war er bereits geöffnet worden, doch der gesamte Inhalt war noch da.
Für ihn und niemanden sonst.
Genau achtundneunzig Minuten später als üblich war Khaled Shawabkeh zu Hause und schloss die Tür von innen ab. Um Zeit zu gewinnen, hatte er den Nachmittagskaffee ausfallen lassen, obwohl Kuchenfreitag war, und den Weg vom Bus zur Haustür im Laufschritt zurückgelegt. Jetzt war er richtig außer Atem, und sein Schweiß gab sich die größte Mühe, durch das viel zu enge Polyesterhemd nach außen zu dringen.
Das Abendessen musste warten, dachte er und schenkte sich ein Glas von dem Wein ein, der hinter den Büchern im Regal verborgen war, ließ sich im Sessel nieder, schaltete die alte Stehlampe ein, zog das Kuvert aus der Tasche und faltete den Brief andächtig auseinander.
»Endlich«, sagte er leise zu sich selbst und streckte die Hand nach dem Weinglas aus, nicht ahnend, dass sich in diesem Moment der Pfropf aus geronnenem Blut, der sich über Jahre in seinem linken Bein gebildet hatte, löste und mit dem Blutstrom ganz nach oben schwamm.
Obwohl seit dem Tod von Marias Onkel mehr als ein Jahr vergangen war, hatte sie noch immer keinen Fuß in sein Haus gesetzt. Ihre beiden Brüder hatten das Testament angefochten und mit allen Mitteln versucht, sie zum Verzicht auf das Erbe zu treiben. Sogar ihr eigener Vater wollte sie davon überzeugen, dass Khaled Shawabkeh all die Jahre allein gelebt und am Ende den Verstand verloren hatte und Frauen für den Besitz und die Verwaltung von Eigentum einfach nicht geschaffen wären.
Maria hatte jedoch nicht nachgegeben und konnte nun endlich den Schlüssel ins Schloss stecken und die Tür öffnen. Dass sie in diesem Zusammenhang den Kontakt zu ihren Brüdern und Eltern verloren hatte, musste sie in Kauf nehmen. Das Haus würde ausgeräumt und verkauft werden, und mit dem Geld konnte sie es sich leisten, bei der Schneiderei zu kündigen, nach Amman zu ziehen und in der Jordanian National Commission for Women für die Rechte der Frau zu kämpfen.
Eigentlich war es unmöglich. Nichts sprach dafür, dass der Brief jemals seinen Empfänger erreichen würde. Die Hindernisse waren so zahlreich, dass sich die zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit, dass er es doch tun würde, nicht mehr in Zahlen ausdrücken ließ.
Trotzdem passierte genau das.
Ein Jahr, vier Monate und sechzehn Tage nachdem der Brief durch den Spalt in der Wand des Gefangenentransports gesteckt und von den Winden in die schwarze Nacht getragen worden war, fand ihn Maria Shawabkeh, der einige Stunden später das Kunststück gelang, ihn wieder mit dem Briefumschlag zusammenzufügen, dem alles fehlte außer einem Namen.
Drei schlaflose Nächte, nachdem sie von der furchtbaren Geschichte erfahren hatte, recherchierte sie im Netz, frankierte den Umschlag, schrieb die vollständige Adresse darauf und gab ihn im nächsten Postamt ab. Ohne die geringste Ahnung von den Konsequenzen.
Aisha Shahin
Selmedalsvägen 40, 7. OG
12937 Hägersten
Schweden
TEIL 1
16.–19. Dezember 2009
Viele werden über meine Taten entsetzt sein. Einige werden sie als Rache für alle begangenen Ungerechtigkeiten betrachten. Andere als ein allen Wahrscheinlichkeiten trotzendes Spiel, das unser System zum Narren hält und zeigt, wie weit man gehen kann. Die meisten jedoch werden sich rührend einig sein, dass es sich um die Taten eines äußerst geistesgestörten Menschen handelt.
Alle werden sich irren …
Kapitel 1
Vor zwei Tagen.
Sofie Leander saß im Warteraum der Ultraschallabteilung im Söderkrankenhaus und blätterte in einem zerlesenen Exemplar der Zeitschrift »Wir Eltern«, in der auf einer Doppelseite nach der anderen schöne, glückliche Paare abgebildet waren. Sie wollte nichts lieber, als zu ihnen zu gehören, aber nach all den wirkungslosen Behandlungen mit Clomifen bezweifelte sie allmählich, dass sie ihre Amenorrhö jemals loswerden würde. Dies war ihre allerletzte Chance. Falls sich herausstellte, dass das Medikament auch diesmal nichts genützt hatte, blieb ihr nichts anderes übrig als aufzugeben.
Ihr Mann hatte das längst getan. Obwohl er versprochen hatte, für sie da zu sein, wenn sie ihn brauchte. Sie schaltete ihr Handy ein und las seine Nachricht noch einmal. Bin verhindert und schaffe es leider nicht. Als ginge es darum, auf dem Heimweg einen Liter Milch zu kaufen. Nicht einmal ein »Viel Glück« hatte er sich abgerungen.
Sie hatte gehofft, der Umzug nach Schweden vor drei Jahren würde das Feuer wieder anheizen. Schließlich hatte er sogar ihren Nachnamen angenommen. Damals hatte sie das als Liebeserklärung aufgefasst. Ein Beweis dafür, dass sie zusammengehörten, was auch immer passierte. Nun war sie sich nicht mehr so sicher, und sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich immer weiter voneinander entfernten. Sie hatte versucht, mit ihm darüber zu reden, aber er mimte den Ahnungslosen und beteuerte ihr hartnäckig seine Liebe. Doch sie merkte es an seinem Blick. Oder vielmehr daran, wie er ihrem auswich.
Er, der ihr einmal das Leben gerettet hatte, war nun plötzlich verhindert und sah kaum noch in ihre Richtung. Am liebsten hätte sie ihn angerufen und zur Rede gestellt, ihn gefragt, ob er sie noch liebte. Oder ob er eine andere kennengelernt hatte. Aber sie traute sich nicht. Außerdem war sie überzeugt, dass er ohnehin nicht antworten würde. Das tat er während der Arbeit fast nie, und vor allem nicht mitten in einem neuen Projekt. Nein, ihre einzige Chance war ein positiver Bescheid von der Ärztin. Wenn sie den bekam, würde bestimmt alles wieder gut werden. Dann könnte sie ihm dieses Kind schenken, und er würde merken, wie sehr er sie in Wirklichkeit liebte.
»Sofie Leander«, hörte sie eine Stimme rufen. Sofie folgte der Hebamme durch den Flur zu einem kleinen Untersuchungszimmer mit heruntergelassenen Rollos, einem großen computerartigen Apparat und einem Krankenbett.
»Sie können Ihren Mantel dort aufhängen und sich hinlegen. Frau Doktor kommt gleich.«
Sofie nickte und zog sich, während die Hebamme den Raum verließ, die Stiefel aus. Als sie auf dem Bett lag, zog sie die Bluse aus dem Bund, knöpfte ihre Hose auf und beschloss, ihren Mann trotzdem anzurufen und zu fragen, was denn so wichtig sei, dass er ihr keine Gesellschaft leisten könne. Sie hatte aber gerade erst nach ihrer Handtasche gegriffen, als die Tür aufging und die Ärztin reinkam.
»Sind Sie Sofie Leander?«
Sofie nickte.
»Gut, dann wollen wir mal sehen … Legen Sie sich zunächst mit dem Rücken zu mir auf die Seite.«
Sofie tat, was sie sagte, und hörte die Ärztin eine Art Plastikverpackung öffnen. Irgendwas an der Situation kam ihr merkwürdig vor.
»Also, ich bin hier, damit meine Eierstöcke untersucht werden.«
»Unbedingt. Wir müssen nur erst das hier regeln.« Die Ärztin drückte auf den einzelnen Wirbeln ihres Rückgrats herum.
Plötzlich spürte sie im Rücken einen Stich.
»Warten Sie mal. Was machen Sie da? Haben Sie mir eine Spritze gegeben?« Sofie drehte sich um und sah, wie sich die Ärztin etwas in die Hosentasche steckte. »Ich verlange, darüber aufgeklärt zu werden, was …«
»Seien Sie unbesorgt. Das ist reine Routine. Sind das Ihre Sachen?« Die Ärztin zeigte auf ihren Mantel und die Stiefel und legte ihr die Sachen, ohne ihre Antwort abzuwarten, zu Füßen. »Wir wollen doch lieber nichts vergessen. Wie würde das denn aussehen?«
Es war bei weitem nicht Sofies erste Eierstockuntersuchung, und dies entsprach keineswegs der üblichen Routine. Sie hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging, aber sie wusste mit Sicherheit, dass sie da nicht mehr mitmachen wollte. Sie wollte weg. Von der Ärztin und diesem Untersuchungsraum. Weg vom ganzen Krankenhaus.
»Ich glaube, ich muss gehen.« Sie versuchte aufzustehen. »Ich möchte gehen, haben Sie gehört?« Doch ihr Körper gehorchte nicht. »Was ist hier los? Was haben Sie gemacht?«
Die Ärztin beugte sich nach vorn und strich ihr über die Wange. »Das werden Sie bald verstehen.«
Sofie wollte protestieren und laut losschreien, aber die Atemmaske, die ihr über das Gesicht gespannt wurde, erstickte jeden Laut, und bevor sie wusste, wie ihr geschah, wurden die Bremsen des Betts gelöst und sie aus dem Zimmer und durch den Flur geschoben.
Hätte sie sich doch nur an irgendetwas festhalten, sich aus dem Bett ziehen und allen begreiflich machen können, was hier vor sich ging. Aber es war nicht möglich. Ihr blieb nichts anderes übrig, als liegen zu bleiben, an die Decke zu starren und eine Leuchtstoffröhre nach der anderen über sich hinweggleiten zu sehen.
Mehr Gesichter. Überall schwangere Frauen und werdende Väter. Hebammen und Ärzte. Alle so nah und doch so weit weg. Türen, die aufgingen. Ein Aufzug und Stimmen anderer Menschen. Fahrstuhltüren, die sich hinter ihr schlossen. Oder öffneten?
Anschließend war sie wieder allein mit der Ärztin, die eine Melodie vor sich hin pfiff, die von den harten Wänden widerhallte. Sonst hörte sie nichts. Außer ihrem Atem, der sie an das Asthma erinnerte, als sie klein war. Wenn sie das Spiel unterbrechen und nach Luft ringen musste, hatte sie sich vollkommen hilflos gefühlt. Jetzt kam sie sich nicht nur hilflos, sondern auch so klein wie damals vor und wäre am liebsten weinend zusammengebrochen. Doch nicht einmal das konnte sie.
Die Neonröhren an der dunklen Betondecke endeten, und sie sah, wie zuerst ihre Beine und dann ihr Oberkörper auf eine Trage hinübergehoben wurden. »Das werden Sie bald verstehen«, hatte die Ärztin gesagt. Doch wie sollte sie? Sie musste die ganze Zeit an den plastischen Chirurgen aus Malmö denken, der seinen Patientinnen Propofol injiziert hatte, damit sie sich nicht gegen die Vergewaltigung wehrten. Aber warum sollte sie jemand vergewaltigen wollen?
Sie wurde rückwärts in einen Krankenwagen geschoben und beschloss, sich auf die Geräusche zu konzentrieren. Die Fahrertür wurde zugeschlagen und der Motor angelassen. Der Wagen fuhr los, bog links in den Ringväg ein und fuhr auf der Hornsgata weiter in Richtung Hornstull, wo er auf die Liljebro und aus der Stadt hinausfuhr. Bis dahin war sie mühelos mitgekommen, aber nach mehreren Runden in einem Kreisverkehr verlor sie die Orientierung.
Als sie etwa zwanzig Minuten später anhielten, hätten sie sich genauso gut wieder vor dem Söderkrankenhaus wie an irgendeinem anderen Ort befinden können. Nachdem sie ein Garagentor aufgehen hörte, rollte der Krankenwagen noch zirka dreißig Meter. Dann wurde der Motor abgewürgt.
Die Türen öffneten sich, ihre Trage wurde aus dem Wagen gezogen und weggeschoben. Über ihr jagte erneut eine Leuchtstoffröhre die andere. Das Tempo stieg, und die Schritte der Ärztin knallten auf einen harten Boden, bis sie schließlich stehen blieb. Schlüssel und ein Piepen, woraufhin ein Elektromotor ansprang.
Sie wurde in einen dunklen Raum gerollt, und hinter ihr schien etwas zu passieren. An der Decke wurde eine große Lampe eingeschaltet, die einen länglichen Tisch beleuchtete. Sie sah weder Fenster, noch konnte sie erkennen, wie groß der Raum war. Nur die Lampe und den Tisch, der von Apparaten umgeben war.
Als sie an den Tisch geschoben wurde, sah sie, dass er mit Plastikfolie abgedeckt und mit Gurten und einem etwa zehn Zentimeter großen Loch etwas unterhalb des Mittelpunkts ausgestattet war. Auf einem Metalltisch daneben lagen verschiedene Metallwerkzeuge auf einem weißen Handtuch aufgereiht.
Erst jetzt ging Sofie Leander auf, worum es ging.
Als sie all die Scheren, Zangen und Skalpelle sah, wusste sie es genau.
Warum sie hierhergebracht worden war.
Und was sie erwartete.
Kapitel 2
Fabian Risk las die Nachricht noch einmal. Dann blickte er vom Handy auf. Die Klassenlehrerin sah ihn fragend an.
»Es tut mir leid, aber wir müssen leider ohne sie auskommen.«
»Ach. Okay«, sagte die Lehrerin, ließ jedoch keinen Zweifel daran, was sie davon hielt.
»Was? Kommt Mama nicht?« Matilda machte ein Gesicht, als hätte sie sich lieber von der Västerbro gestürzt, als sich ohne Sonja einem Elterngespräch auszusetzen. Und Fabian konnte sie verstehen. Die vergangenen Termine hatte er aus verschiedenen Gründen verpasst, und obwohl Matilda inzwischen die dritte Klasse besuchte, konnte er sich nicht einmal an den Namen der Klassenlehrerin erinnern.
»Mama muss leider arbeiten, Matilda. Du weißt doch, wie das vor Ausstellungseröffnungen ist.«
»Sie hat aber gesagt, dass sie kommt.«
»Ich weiß, und ich schwöre dir, sie ist genauso enttäuscht wie du, aber wir kriegen das bestimmt trotzdem super hin.« Er tätschelte ihren Kopf und sah die Klassenlehrerin hilfesuchend an, doch die setzte ein nichtssagendes Lächeln auf, als wären sie zu einer Runde Poker zusammengekommen.
»Hör auf!« Matilda schlug seine Hand weg.
»Ja, also, in Bezug auf Matildas Motivation und ihre Fähigkeit, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, habe ich von allen Kollegen nur Positives zu berichten.« Die Klassenlehrerin blätterte in ihren Unterlagen. »In Schwedisch und Mathe ist sie eine der Besten …« Sie verstummte und wandte sich Fabians Handy zu, das auf dem Tisch vibrierte.
»Verzeihung.« Fabian drehte das Telefon um und sah zu seinem Erstaunen, dass der Anrufer Herman Edelman war. Edelman, der in all den Jahren bei der Reichskripo sein Chef gewesen war, hatte trotz seiner sechzig Jahre nichts von seiner Präsenz und seinem Wahrheitshunger verloren. Fabian musste ehrlich zugeben, dass er ohne Edelman kein guter Ermittler geworden wäre.
Doch heute hatte er sich seit dem Mittagessen nicht in der Abteilung blicken lassen, und als weder Fabian selbst noch jemand anderes aus dem Team bis zum Nachmittagskaffee von ihm gehört hatte, fragten sie sich langsam, ob etwas passiert war.
Nun meldete er sich also. Noch dazu außerhalb der Bürozeit, und das konnte nur eins bedeuten.
Es war definitiv etwas passiert.
Etwas, das keinen Aufschub duldete.
Fabian wollte gerade ans Telefon gehen, als die Klassenlehrerin sich räusperte. »Wir haben nicht den ganzen Abend Zeit. Ich habe heute noch mehr Elterngespräche.«
»Entschuldigen Sie. Wo waren wir stehen geblieben?« Fabian wies den Anrufer ab und legte das Handy weg.
»Matilda. Ihre Tochter.« Die Klassenlehrerin rang sich ein Lächeln ab. »Wie ich schon sagte, sind die Beurteilungen aus dem gesamten Lehrerkollegium durchweg positiv. Aber …« Sie sah Fabian in die Augen. »Wenn es möglich wäre, würde ich gerne unter vier Augen mit Ihnen sprechen.«
»Ach so? Na gut. Das ist kein Problem. Oder, Matilda?«
»Worüber wollt ihr reden?«
»Nur so Kram für Erwachsene.« Fabian drehte sich zur Klassenlehrerin um, die lächelnd nickte. »Du kannst auf dem Flur warten, ich komme gleich.«
Matilda seufzte und verließ mit demonstrativ über den Boden schlurfenden Füßen das Klassenzimmer. Während Fabian ihr hinterherblickte, fragte er sich, was Edelman von ihm wollte.
»Es ist nämlich so.« Die Klassenlehrerin legte die gefalteten Hände auf den Tisch. »Ich bin von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht worden, dass es bei Matilda ernsthafte Hinweise auf …« Wieder wurde sie von Fabians vibrierendem Handy unterbrochen. Ihre Verärgerung war nun nicht mehr zu übersehen.
»Entschuldigen Sie, ich weiß wirklich nicht, was hier los ist.« Er nahm das Handy in die Hand und drehte es um. Diesmal rief seine Kollegin Malin Rehnberg an, die in Kopenhagen auf einem Seminar war. Edelman hatte sich also an sie gewandt, weil er annahm, dass sie leichter an ihn herankam. »Es tut mir leid, mir bleibt nichts anderes übrig …«
»Gut, aber dann sollten wir das hier jetzt beenden.« Die Klassenlehrerin sammelte ihre Unterlagen ein.
»Warten Sie mal. Können wir nicht einfach …«
»In dieser Schule praktizieren wir im Unterricht Nulltoleranz gegenüber Mobiltelefonen, und ich wüsste nicht, warum für Erwachsene andere Regeln gelten sollten.« Sie steckte den Papierstoß in ihre Aktentasche. »Nehmen Sie ruhig den wichtigen Anruf an, und ich widme mich stattdessen denjenigen Eltern, die sich für ihre Kinder interessieren. Einen angenehmen Abend noch.« Sie stand auf.
»Moment mal, das ist ein Missverständnis«, sagte Fabian, während sein Handy verstummte. Mailbox. Was hatte sich dort getan? »Es tut mir leid. Natürlich bin ich ausschließlich wegen Matilda hier.«
Die Frau, deren Namen er vergessen hatte, musterte ihn auf eine Art, die an Verachtung grenzte. »Okay.« Sie öffnete ihre Aktentasche wieder und holte Matildas Hefter hervor. »Normalerweise mischen wir uns in solche Angelegenheiten nicht ein, aber im Fall Ihrer Tochter erscheint es uns außerordentlich wichtig, denn wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird es sich auf ihren Lernerfolg auswirken.«
»Verzeihung, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe. Was wollen Sie unternehmen?«
Die Klassenlehrerin legte eine Zeichnung auf den Tisch. »Hier ist eins ihrer jüngeren Werke. Sie sehen es ja selbst.«
Fabian erkannte sich an dem Ziegenbärtchen, das er vor einigen Wochen abgenommen hatte. Ihm gegenüber stand Sonja mit einem Küchenmesser in der Hand. Beide brüllten mit offenen Mündern und waren knallrot im Gesicht. Er erinnerte sich, dass er die Frage gestellt hatte, ob sie abends unbedingt so viel arbeiten müsste. Sonja war an die Decke gegangen, hatte ihm all die Abende vorgehalten, an denen er in den letzten Jahren spät nach Hause gekommen war, und ihm vorgeworfen, nur an sich zu denken.
Dabei hatten sie mal vereinbart, sich nie vor den Kindern zu streiten. Dass er im Eifer des Gefechts mit Scheidung drohte, machte die Sache nicht besser.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das hier, das ist …«
»Hier ist noch eins«, unterbrach ihn die Klassenlehrerin.
Fabian erkannte die Tapetenwand an Matildas Bett sofort. Ganz unten saßen in Reih und Glied ihre Kuscheltiere. Ein kleiner Teil von ihm war beeindruckt von ihren Zeichenkünsten, während der Rest sich dagegen sträubte, den Inhalt der Sprechblasen aufzunehmen, die den Streit auf der anderen Seite der Wand illustrierten. Diesmal ging es um Sex, und soweit Fabian erkennen konnte, kamen einige Sätze der Wahrheit quälend nah.
Am liebsten wäre er in seinem Stuhl versunken und hätte sich in Luft aufgelöst.
»Das sind natürlich Phantasien und Übertreibungen, das ist mir klar, aber das Thema taucht zurzeit bei allem auf, was Matilda macht. Ich dachte, Sie sollten das wissen. Mir als Mutter wäre das jedenfalls lieber gewesen.«
»Selbstverständlich.« Fabian versuchte zu verbergen, dass das Telefon in seiner Hand schon wieder vibrierte.
Auf dem Weg zum Ausgang der Björngårdsskola wählte Fabian Edelmans Nummer, hörte aber nur ein Besetztzeichen. »Hast du das gesehen, Matilda? Es ist noch mehr Schnee gefallen.« Er ließ seinen Blick über den Schulhof schweifen, der unter einer dicken Schicht Neuschnee schlummerte. »Super, oder? Da könnt ihr ja morgen Schneemänner bauen.«
»Ach, dann ist bestimmt nur noch Matsch übrig.« Matilda ging die Treppe hinunter.
»Warte mal, Matilda.« Fabian lief ihr hinterher. »Du hast doch wohl keine Angst, dass Mama und ich uns trennen?«
»Darüber habt ihr also geredet.«
»Was? Stimmt es denn?«
Ohne ihm zu antworten, rannte Matilda zum Auto, das Fabian auf der anderen Straßenseite abgestellt hatte.
Fabian hielt den Autoschlüssel hoch, um mit einem Tastendruck das Auto aufzuschließen, damit sie einsteigen konnte. Eigentlich wollte er schnell zu ihr, aber er wusste nicht, was er sagen sollte. Sie hatte ja recht. Wenn sie so weitermachten, war das endgültige Scheitern nur noch eine Frage der Zeit. Dabei hatte er nicht nur Sonja, sondern vor allem sich selbst versprochen, dass er niemals in die Fußstapfen seiner Eltern treten würde. Was auch immer passierte. Egal, wie anstrengend es wurde. Es spielte keine Rolle. Nichts sollte ihn jemals dazu bringen, alles hinzuwerfen und nicht mehr zu kämpfen.
Jetzt war er sich nicht mehr so sicher.
Trotz platter Reifen war er so lange auf den nackten Felgen herumgegurkt, dass eine Reparatur vermutlich nicht mehr möglich war. Seufzend blieb er mitten auf dem Schulhof stehen, zog das Handy aus der Tasche und wählte Malin Rehnbergs Nummer.
»Was zum Teufel treibst du gerade, Fabian? Dass ich mehr als sechshundert Kilometer von dir entfernt bin, ist deine einzige Rettung.«
Fabian sah ein, dass er am besten schwieg, bis sie fertig war.
»Ist dir klar, dass Herman mir wie ein Blutegel auf den Leib gerückt ist, nur weil du keine Lust hast, ans Telefon zu gehen? Als ob ich seine Sekretärin wäre. Ich weiß, dass es niemanden juckt, aber ich befinde mich zufällig gerade auf einem richtig interessanten Seminar.«
»Okay, weißt du denn, worum …?«
»Allerdings sind die Betten scheiße, und außerdem fühle ich mich wie eine aufgequollene Sau.«
»Das kann ich verstehen, aber …«
»Und ich scheiße darauf, dass ich erst in zwei Monaten Termin habe, denn wenn diese Kinder nicht bald rauskommen, tu ich etwas Verbotenes. Hallo? Fabian? Bist du noch da?«
»Hat er gesagt, worum es ging?«
»Nein, oder ich weiß nicht genau. Anscheinend war es unheimlich wichtig. Ich habe aber eine Idee.«
»Okay.«
»Versuch, ans Telefon zu gehen, wenn er das nächste Mal anruft.«
Es klickte. Fabian musste ihr recht geben. Er hoffte auch, dass ihre Schwangerschaft bald vorüber war. Fünfzehn Sekunden später erhielt er eine SMS, in der Malin sich für ihren harten Ton entschuldigte und versprach, wieder sie selbst zu sein, sobald sie diese »Schwangerschaftshölle« überstanden hatte.
Fabian setzte sich ans Steuer und betrachtete Matilda im Rückspiegel. »Was hältst du davon, wenn wir bei Ciao Ciao vorbeifahren und Pizza holen?«
Matilda zuckte die Achseln, aber das kleine Lächeln, das gegen ihren Willen über ihr Gesicht huschte, entging ihm trotzdem nicht. Er drehte den Zündschlüssel um und unternahm, während er sich in den Verkehr auf der Maria Prästgårdsgata einfädelte, einen weiteren Versuch, Edelman zu erreichen.
»Hallo, Herman, ich habe gesehen, dass du angerufen hast.«
»Das habe ich dann wohl Malin zu verdanken.«
»Ich saß in einem Elterngespräch und habe erst jetzt …«
»Ja, ja, scheißegal jetzt. Ich rufe an, weil ich heute Abend um acht zur Säpo muss, und es wäre mir am liebsten, wenn du mitkämst.«
»Heute Abend? Tut mir leid, aber ich bin mit den Kindern alleine. Warum ist es denn ausgerechnet heute so wichtig …?«
»Hab ich hier das Sagen oder du?«
»So habe ich es nicht gemeint …«
»Hör mir mal zu. Persson und Päivinen haben soeben eine Spur im Adam-Fischer-Fall entdeckt, und Höglund und Carlén sind vollauf mit den Recherchen zu Diego Arcas beschäftigt. Außer dir und Rehnberg haben alle zu tun. Und wenn ich das richtig sehe, befindet sich Rehnberg in Kopenhagen.«
»Na gut. Kannst du mir denn sagen, was passiert ist?«
»Ich gehe davon aus, dass wir darüber bei dem Treffen informiert werden. Wir sehen uns draußen vor der Tür um fünf vor. Bis dann.«
Fabian zog sich das Headset aus den Ohren und bog in die Nytorgsgata ein. Es war bei weitem nicht das erste Mal, dass sich seine und die Wege der Sicherheitspolizei Säpo kreuzten, aber zu einem Treffen nach Büroschluss war er noch nie gebeten worden. Vermutlich, weil er in der Hackordnung zu weit unten stand. Herman Edelman war ständig dort und betonte bei jeder Gelegenheit, wie wichtig es sei, dass man mit dem Rücken zur Wand saß, wenn man ein Treffen mit den Kollegen dort überleben wollte.
Und nun wollte er Fabian also dabeihaben.
»Nein, Fabian, ausgeschlossen. Tut mir leid, das musst du anders regeln.«
»Wie, anders regeln? Was meinst du damit?« Fabian blickte über die schneebedeckten Dächer, während Sonja noch einen krebserregenden Zug nahm und den Rauch mit einem Seufzen ausatmete. Ein Zeichen, dass sie richtig schlechte Laune hatte.
»Was weiß ich? Du musst eben improvisieren. Ich habe jetzt keine Zeit mehr zu reden.«
»Warte doch mal.« In der Fensterscheibe sah er das Spiegelbild von Matilda, die ihnen von der Küche aus zuhörte. Er griff nach der Fernbedienung, schaltete den Fernseher ein und drehte die Lautstärke auf.
Acht Tage nach dem spurlosen Verschwinden von Adam Fischer hat die Polizei bekanntgegeben, dass es sich um eine Entführung handelt …
»Sonja, das war nicht meine Entscheidung. Es ist nicht so, dass ich die Wahl hätte.«
»Denkst du, ich?«
Bei uns im Studio ist jetzt Kriminalprofessor Gerhard Ringe …
»Soll ich einfach den Pinsel hinschmeißen und Ewa sagen, sorry, das mit der Ausstellung wird nichts?«
»Nein, aber …«
»Na dann.«
»Jetzt beruhige dich doch bitte.«
Was hat die Polizei veranlasst, mit dieser Information an die Öffentlichkeit zu treten, und warum wissen wir immer noch nichts von einer Lösegeldforderung?
»Ich bin ruhig.« Sonja gab sich keine Mühe zu verschleiern, dass sie wieder an der Zigarette zog. »Ich verstehe nur nicht, warum es so ein Problem für dich darstellt, wenn ausnahmsweise ich arbeiten muss.«
»Okay, ich werde versuchen, eine andere Lösung zu finden. Hast du irgendeine Ahnung, wann du nach Hause kommst?«
»Ja. Wenn ich fertig bin. Frag mich bitte nicht, wann das ist, denn ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich diese Bilder stündlich mehr hasse.« Wieder Seufzen und an der Zigarette Ziehen. »Entschuldige … Ich habe das nur alles so satt, dass ich kotzen könnte.«
»Liebling. Das wird schon. Das ist doch vor jeder Ausstellung so, und dann weißt du plötzlich, wie du es machen musst, und das Ganze ist ein Kinderspiel.«
»Mal sehen.«
»Ich finde eine andere Lösung. Mach dir keine Gedanken.«
»Gut.«
»Ich liebe dich.«
»Wir sehen uns.«
Fabian setzte sich zu Matilda in die Küche und nahm sich seine Pizza. »Wie war die Bananenpizza?«
»Ganz okay. Du?«
»Ja?«
»Hat Mama gesagt, dass sie dich auch liebt?«
Fabian sah ihr in die Augen und überlegte, was er antworten sollte. »Nein, hat sie nicht.«
Fabian nickte und biss ein großes Stück von der längst kalten Pizza ab.
Kapitel 3
Es war nicht Fabians erster Besuch bei der Säpo, aber noch nie hatte er so viele Sicherheitssperren passiert und war so weit ins Innere des Hauses vorgedrungen, dass er schließlich die Orientierung verlor. Erst nach einigen Fahrstühlen und fensterlosen Korridoren wurden er und Herman Edelman, der ausnahmsweise auf dem gesamten Weg kein Wort von sich gegeben hatte, in einen größeren Saal mit schwacher Beleuchtung gebracht.
Kurz bevor er sich auf den Weg hatte machen müssen, war Theodor vom Hallenhockey gekommen und hatte sich nach kurzer Verhandlung bereit erklärt, sich um Matilda zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie ins Bett ging. Obwohl es ein gewöhnlicher Mittwoch war, hatte Fabian in Chips, Cola und einen Film im Schlafzimmer eingewilligt. Seine einzige Bedingung war, dass sie ihn nicht bei Sonja verpetzten und Matilda in der Schule kein Bild über diesen Abend malte.
»Sie müssen Herman Edelman und Fabian Risk sein.« Eine Frau trat aus der Dunkelheit hervor und gab ihnen die Hand. »Willkommen. Anders Furhage und die anderen warten schon.«
Die Frau führte sie in den Saal, und als sich Fabians Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bemerkte er einige dunkle Quader, die einen guten Meter über dem Boden zu schweben schienen. Er kannte die abhörsicheren Räume, die das Budget der Säpo angeblich um Millionen überstiegen hatten, aus Erzählungen, hatte sie aber noch nie mit eigenen Augen gesehen. Edelman dagegen zuckte nicht mit der Wimper, er war bestimmt schon hier gewesen. Er zupfte nur an seinem grauen Bart, rückte seine Nickelbrille gerade und ging weiter. So ernst und streng hatte Fabian ihn nicht erlebt, seit seine Frau vor zehn Jahren an Krebs gestorben war.
»Bitte sehr«, sagte die Frau und blieb vor einer Treppe stehen, die zu einem der kojenartigen Quader hinaufführte und vor einer mehrere Dezimeter dicken Tür endete, die vermuten ließ, dass sich die Kuben hermetisch verschließen ließen.
Die Wände des Kubus waren braun, der Boden mit dunkelrotem Teppich bedeckt. An einem ovalen Tisch saßen drei Anzugträger mit jeweils anderer Krawattenfarbe. Auf Anhieb erkannte Fabian den Generaldirektor Anders Furhage, der aufstand, um sie zu begrüßen, während sich hinter ihnen die Tür schloss.
»Wie schön, dass ihr so kurzfristig kommen konntet. Alles, was hier besprochen wird, ist absolut vertraulich, das ist hoffentlich klar. Handys also bitte gleich ausschalten und auf den Tisch legen.«
Fabian und Edelman taten, was ihnen gesagt wurde, und setzten sich.
»Gut, kommen wir direkt zur Sache.« Anders Furhage sah sie an. »Es hat sich eine, sagen wir, Situation ergeben, die sich, wenn es hart auf hart kommt, als nicht existent herausstellen könnte. Eine unbedeutende kleine Bagatelle.«
Fabian warf Edelman einen Blick zu, doch der machte ein genauso fragendes Gesicht wie er selbst.
»Melvin Stenberg, hier neben mir, ist für Personenschutz zuständig. Er kann euch mehr erzählen.« Furhage nickte dem Mann mit der blauen Krawatte zu.
»Heute um 15:24 Uhr, zirka eine Stunde nach Ende der Interpellationsdebatte im Reichstag, verließ Carl-Eric Grimås das Bürogebäude der Abgeordneten durch den westlichen Ausgang, wo ihn ein Fahrer erwartete. Laut unserem Fahrer ist Grimås nie aufgetaucht und seitdem nicht mehr gesehen worden«, sagte die blaue Krawatte, ohne eine Miene zu verziehen.
»Moment mal, wollen Sie damit sagen, der Justizminister persönlich ist verschwunden?«, fragte Edelman.
Stenberg strich seine Krawatte glatt und nickte.
»Wir haben das Gebiet rings um die Parteibüros und Rosenbad durchsucht und sowohl seine Familie als auch die Stabschefin des Ministeriums kontaktiert«, sagte der Mann mit dem grünen Schlips. »Aber momentan sind sie alle gleich ahnungslos.«
Schweigen machte sich breit. Es schien, als bräuchten alle – die drei Krawatten eingeschlossen – Zeit, um die Tatsache zu verdauen, dass ein Minister, und noch dazu ihr höchster Vorgesetzter, spurlos verschwunden war.
»Und das bezeichnest du als Bagatelle?« Edelman schüttelte den Kopf.
»Das habe ich nicht gesagt, Herman.« Furhage lächelte. »Wir wollen uns hier nicht die Worte im Munde herumdrehen, aber wie du weißt, habe ich gesagt, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen können, ob …«
»Er ist doch verschwunden, Herrgott noch mal! Wie viele Politiker müssen denn in diesem Land noch ihr Leben opfern? Ich meine, wird Grimås denn nicht rund um die Uhr geschützt?«
Furhage drehte sich zu dem blauen Schlips um, der sich räusperte. »Also, da stellt sich ja immer die Frage nach den Ressourcen und Prioritäten. Unsere Risikoeinschätzung hat ergeben, dass sich die Gefahrenlage in Grenzen hielt, solange er sich in den Reichstagsgebäuden befand.«
Aber Hauptsache, wir sitzen in einem abhörsicheren Quader, dachte Fabian, während Furhage die grüne Krawatte aufforderte, die Knöpfe an der in den Tisch integrierten Armatur zu betätigen.
An der einen Wand wurde eine Leinwand ausgerollt. »Diese Sequenz stammt aus der Überwachungskamera am betreffenden Ausgang.« Er schaltete den Projektor ein.
In dem Filmausschnitt, der kaum länger als eine Minute dauerte, war zu sehen, wie Carl-Eric Grimås mit einer Aktentasche in der linken Hand auf die doppelten Sicherheitstüren aus Glas zuging, seine Passierkarte durch das Lesegerät zog, erst die eine und dann die andere Tür aufdrückte und im Schneegestöber verschwand.
Fabian kannte seine Kleidung von Fotos aus der Zeitung. Den Wintermantel mit dem dicken schwarzen Pelzkragen und den unverwechselbaren Hut, die sich gemeinsam zum Markenzeichen des Ministers entwickelt hatten. Unten in der linken Ecke stand die Uhrzeit, es war tatsächlich genau 15:24 Uhr.
Der Projektor ging aus, und die Leinwand verschwand lautlos in der Decke.
»Und da draußen stand eins von Ihren Autos und wartete auf ihn?« Fabian fand das Ganze nahezu unbegreiflich.
Der grüne Schlips nickte. »Der Fahrer hatte aufgrund des starken Schneefalls allerdings keine freie Sicht auf den Eingangsbereich.«
»Und wann ist er angekommen?«
»Grimås hat das westliche Reichstagsgebäude um 11:43 Uhr durch den Haupteingang betreten.« Der grüne Schlips wirkte hochzufrieden, weil er die Frage so prompt und präzise beantworten konnte.
»Um 11:38 Uhr verließ er Rosenbad und spazierte in schnellem Tempo die Strömgata entlang, aber anstatt die Riksbro zu überqueren, machte er einen Umweg über die Vasabro und den Kanslikai. Mit Personenschutz«, sagte die blaue Krawatte.
»Und wann begann die Interpellationsdebatte? Um zwölf?«
»Nein, erst um halb eins, aber Grimås ist bekannt für seine Pünktlichkeit.«
»Und der Fahrer, der ihn erwartete? Für welche Uhrzeit war der bestellt?«
»Fünfzehn Uhr.« Der blaue Schlips trank einen Schluck Wasser.
»Aber obwohl er für seine Pünktlichkeit bekannt ist, verließ er das Bürogebäude der Reichstagsabgeordneten erst um 15:24 Uhr.«
Die Krawattenträger wechselten Blicke, Anders Furhage räusperte sich.
»Lasst mich noch mal klarstellen, warum ihr überhaupt hier seid. Es geht nicht darum, dass ihr die Ermittlungen übernehmt. Ihr seid aus einem einzigen Grund hier, und zwar, um euch zu informieren. Mit anderen Worten: Solange wir nicht wissen, ob dem Vorfall überhaupt ein Verbrechen zugrunde liegt, sind wir für die Ermittlungen zuständig.«
»Was sollte denn sonst dahinterstecken, wenn nicht ein Verbrechen?« Edelman zog an seinem grauen Bart.
»Bislang gibt es keine konkreten Hinweise darauf, und wie … Verzeihung, wie heißen Sie noch mal?« Furhage wandte sich an Fabian.
»Fabian Risk.«
»Genau. Wie Risk schon sagte, gibt es da einige offene Fragen. Und wir arbeiten unter Hochdruck daran, sie zu beantworten. Jetzt schon voreilige Schlüsse zu ziehen ist meiner Ansicht nach sinnlos, aber wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.«
»Ach, wirklich? Sie haben die Information seit heute Nachmittag um halb vier unter Verschluss gehalten und uns jetzt erst informiert. Und das nennen Sie auf dem Laufenden halten?«
»Ich würde es so ausdrücken: Im Moment haben wir weder eine Leiche noch eine akute Gefahrenlage. Nichts spricht für einen Terroranschlag oder Ähnliches. Demgegenüber gibt es einige, die sein Auftreten in der letzten Zeit als gestresst und unkonzentriert bezeichnet haben. Was dafür spräche, dass er aus freien Stücken untergetaucht ist und einfach seine Ruhe will.«
Edelman rümpfte die Nase. »Hast du mal darüber nachgedacht, dass eure sogenannten Gefahrenanalysen für den Arsch sind und euch jetzt nichts anderes mehr übrigbleibt, als irgendwie Zeit zu gewinnen, um die Spuren eures Scheiterns zu vertuschen?«
»Herman, ich schlage vor, dass wir ein gewisses Niveau nicht unterschreiten.« Furhage ließ Edelmans Angriff an sich abperlen. »Niemand versucht, irgendwelche Spuren zu verwischen. Sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Im Gegenteil. Wir haben das gleiche Ziel wie ihr. Herausfinden, was passiert ist. Natürlich ist es gut möglich, dass wir bei unserer Risikoanalyse Fehler machen, aber das ändert nichts daran, dass wir für die Ermittlungen zuständig sind, bis sich herausstellt, ob tatsächlich ein Verbrechen begangen wurde. Und ich möchte betonen, dass es nicht darum geht, euch auszuschließen. Wir wollen nur den Vorteil nutzen, im Stillen zu arbeiten. Denn eins wissen wir beide, Herman. Sobald ihr eure Maschinerie in Gang setzt, steht die Sache auf jeder Titelseite, und wir beide werden von morgens bis abends nur noch Pressekonferenzen abhalten.«
»Und wenn ich mich nicht darauf einlasse?«
»Das wirst du. Und um dir unnötige Kopfschmerzen zu ersparen, habe ich die Sache mit Crimson geklärt.«
Fabian beobachtete Edelman, der mit regloser Miene schweigend dasaß. Ihm war soeben der Teppich unter den Füßen weggezogen worden, er lag am Boden. Furhage hatte ohne sein Wissen bereits den Chef der Reichskripo kontaktiert und dessen Einverständnis eingeholt, die Reichskripo aus den Ermittlungen rauszuhalten. Vermutlich saßen sie auf Crimsons Anordnung hier und ließen sich informieren. Das Ganze war nur mit einem Dolchstoß zu vergleichen.
Doch da saß er, während die Sekunden vergingen, und ließ sich nicht im Geringsten anmerken, was er dachte. Stattdessen zog er sein Zigarilloetui aus der Tasche und öffnete es mit der einen Hand, während er mit der anderen sein altes Ransonfeuerzeug hervorkramte. Bevor jemand reagieren konnte, glühte das Zigarillo zornig rot, und er füllte seine Lungen mit Rauch. Weder Furhage noch eine von den Krawatten sagten etwas dazu, und erst nach zwei weiteren langen Zügen drückte Edelman das Zigarillo in seinem Glas aus.
»Alright. Dann sind wir hier fertig, glaube ich. Ich freue mich darauf, ständig auf dem Laufenden gehalten zu werden.«
»Selbstverständlich.« Furhage gab ihm die Hand. »Du stehst ganz oben auf meiner Liste. Das weißt du doch.«
Edelman übersah die ausgestreckte Hand und wandte sich stattdessen an Fabian, der aufstand, sein Handy einsteckte und sich schwor, niemals einen Chefposten anzunehmen.
Auf dem Weg durch das Labyrinth aus Fluren war Edelman genauso schweigsam wie bei ihrer Ankunft. Ob er befürchtete, abgehört zu werden, oder schlicht zu wütend war, um zu sprechen, war nicht zu erkennen, und daher hielt auch Fabian sich zurück, obwohl er jede Menge Fragen hatte.
Erst draußen im Schneesturm auf der Polhemsgata schlug Edelman vor, dass sie sich in Fabians Auto setzten, obwohl sie von einem Taxi erwartet wurden. Sie überquerten die Straße, stiegen ein, und Fabian ließ den Motor an, damit die Heizung lief. Edelman starrte die schneebedeckte Windschutzscheibe an.
»Ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, dass Grimås einer meiner besten Freunde ist.«
Fabian nickte. Lange vor seiner eigenen Zeit bei der Reichskripo war Grimås Edelmans Chef gewesen. Später war er in die Politik gewechselt. Wie erfreulich die Zusammenarbeit der beiden gewesen war, hatte niemandem in der Abteilung entgehen können. Edelman ließ keine Gelegenheit aus, zu erzählen, wie er und Grimås damals Ermittlungen angegangen waren. Doch dass sie immer noch Kontakt hatten und sogar enge Freunde waren, überraschte ihn.
»Hast du eine Ahnung, was passiert sein könnte?«
Edelman schüttelte den Kopf. »Ich rechne mit dem Schlimmsten. Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass wir so viel wie möglich erfahren, bevor die Putzkommandos von der Säpo zu viel erreichen.«
»Du glaubst also, dass sie …?«
»Ich glaube gar nichts, aber Furhage ist der Letzte, dem ich vertraue.«
»Meinst du, wir sollen Ermittlungen anstellen, obwohl Bertil Crimson …?«
»Nicht wir. Du«, unterbrach ihn Edelman. »Lass mich das unmissverständlich ausdrücken. Es gibt in der Abteilung niemanden, der auch nur annähernd das Zeug dazu hat. Und das wissen wir beide.«
»Wie können wir ermitteln, wenn Bertil Crimson ausdrücklich …?«
»Lass uns nicht Ermittlungen dazu sagen. Was mir vorschwebt, ist …« Edelman drehte sich zu Fabian um und sah ihm in die Augen. »Wenn wir die Wahrheit nicht ans Licht bringen, wer dann? Die Säpo?«
Fabian konnte nur zustimmen. Edelman hatte recht.
»Pass nur auf, dass du weit genug unterm Radar bleibst, und bis wir mehr wissen, erstattest du niemandem Bericht außer mir.« Edelman stieg aus und knallte die Tür so fest zu, dass sich der Schnee von den Scheiben löste.
Fabian entfernte den Rest mit Hilfe der Scheibenwischer und fuhr los. Er versuchte, sich auf den Verkehr zu konzentrieren, aber seine Gedanken führten ein Eigenleben, und zu begreifen, was eigentlich passiert war, nahm ihn so in Anspruch, dass er schließlich auf den Parkplatz am Norr Mälarstrand fahren, die Scheibe hinunterlassen und die kalte Nachtluft einatmen musste.
Es war nicht nur unter mysteriösen Umständen der Justizminister verschwunden. Edelman hatte ihn auserwählt, geheime Ermittlungen anzustellen. Je länger er darüber nachdachte, desto klarer wurde es ihm.
Wo er anfangen würde.
Wen er kontaktieren würde.
Kapitel 4
Malin Rehnberg wünschte sich nichts sehnlicher als ein Glas Wein. Ein vollmundiger roter Zinfandel war die Voraussetzung, um dem Tournedo-Steak auf ihrem Teller gerecht zu werden. Zu Hause in Stockholm war es ihr überhaupt nicht schwergefallen, mit Beginn der Schwangerschaft den Alkohol wegzulassen. Die Lust darauf schien ganz von selbst zu verschwinden. Die dänische Hauptstadt dagegen steigerte sie enorm. Oder lag es an Dunja Hougaard – ihrer neuen Kontaktperson von der Kripo Kopenhagen –, die offenbar kein Problem damit hatte, sich alleine eine ganze Flasche einzuverleiben?
Nach wenigen Stunden in dem zweitägigen Seminar, zu dem Ermittler aus Mordkommissionen in ganz Europa gekommen waren, um über die Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten, hatten sie einander gefunden und auf der Stelle als jeweilige Ansprechpartnerin auserwählt. Sie verstanden sich so gut, dass Malin vorschlug, sie sollten zusammen essen gehen.
Und nun saßen sie hier im Restaurant Barock in Nyhavn, und Malin begriff allmählich, warum von allen Kindern auf der Welt die dänischen am spätesten sprechen lernten. Schon nach dem ersten Glas Wein verließ ihre Kontaktperson den sicheren Hafen der englischen Sprache und redete in einem Dänisch weiter, das mit zunehmender Alkoholaufnahme immer schwieriger zu verstehen war. Anfangs hatte sie die andere unterbrochen und nachgefragt, sobald sie ein Wort nicht verstand, war aber bald dazu übergegangen, freundlich zu nicken und sich auf den Zusammenhang zu konzentrieren.
Nun tat sie nicht einmal mehr das. Die Worte schienen zu einem dicken Brei zusammengepresst zu werden, und sie ertappte sich mehrmals dabei, an etwas ganz anderes zu denken. Zum Beispiel daran, wie eifersüchtig sie auf diese Dänin war, die so viel trinken konnte, wie sie wollte, weil sie nicht schwanger war. Ganz zu schweigen von ihrem Neid auf den Körper der anderen, der noch kein bisschen aus der Form gegangen war.
Malin selbst hasste ihren Körper und hätte, ohne mit der Wimper zu zucken, mit fast jedem anderen Menschen tauschen wollen. Fünfundzwanzig Kilo hatte sie zugenommen, und dabei hatte sie noch zwei Monate vor sich.
Zwei verfickte Scheiß-Arschloch-Monate.
Selbst wenn sie sich die größte Mühe gab, fiel ihr keine einzige Stelle an ihrem ganzen Körper ein, die nicht angeschwollen war, weh tat und zumindest gerötet und verschwitzt war. Ihr ganzes Wesen schien sich in ein einziges klebriges Minenfeld aus Krämpfen und Zipperlein verwandelt zu haben, die sich jeden Augenblick zu etwas richtig Schmerzhaftem auswachsen konnten. Allein der Bauch, den sie jeden Morgen und Abend mit einer Creme eingeschmiert hatte, die so teuer war, dass sie Anders den wahren Preis verheimlichte, und der nun trotzdem von so vielen Dehnungsstreifen bedeckt war, dass sie immer an einen Wildunfall denken musste, wenn sie an sich hinunterblickte.
»Bist du sicher, dass du nicht trotzdem ein kleines Glas Wein willst?«
Malin zuckte zusammen. »Entschuldigung? Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe.«
»Bisschen Wein«, versuchte Dunja Hougaard Schwedisch zu sprechen und hielt die Flasche hoch.
»Danke, schon okay. Ich habe mir geschworen, keinen Tropfen zu trinken, solange ich schwanger bin.«
»Aha. Warum?« Dunja wirkte ehrlich interessiert, und Malin überlegte, ob sie auf einem fremden Planeten gelandet war und nicht nur im Nachbarland.
»Also, es ist nicht gut für die Kinder. Alkohol geht über die Plazenta direkt in …«
»Weißt du was? Das ist typisch schwedisch.«
»Was denn?«
»Ihr habt so viele Regeln und Verbote und seid totale Hosenschisser. Ganz ehrlich. Ein kleines Glas Wein schadet doch nicht.«
Malin musste tief Luft holen, um ihren Ärger im Zaum zu halten. »Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch nicht bis Dänemark vorgedrungen, aber die jüngere Forschung zeigt tatsächlich, dass sich das Kind nicht so gut entwickelt und ein größeres Risiko für ADHS hat, wenn die Mutter Alkohol trinkt. Im Übrigen …«
»Nein, das passt einfach nicht zusammen.« Dunja trank einen Schluck und sah Malin in die Augen. »Hier in Dänemark hat man kürzlich eine Studie mit Tausenden von Fünfjährigen durchgeführt, und da konnte man überhaupt keinen Unterschied zwischen den Kindern, deren Mütter zwei Gläser am Tag getrunken, und denen feststellen, deren Mütter ganz auf Alkohol verzichtet haben.«
»Ach, und das wundert dich? Mit diesen Untersuchungen kann man doch belegen, was man will. Der Witz an der Sache ist …«
»Weißt du, was ich glaube?« Dunja hob den Zeigefinger. »Wenn du ein kleines Glas Wein trinkst, besteht nur die Gefahr, dass die Kinder eine glückliche Mutter haben.«
Malin war sich nicht sicher, ob sie den Satz richtig verstanden hatte. »Was heißt hier glücklich? Ich bin doch glücklich.« Sie spürte, wie der Ärger die Oberhand gewann und sie regelrecht übermannte.
»Okay, Malin. Bitte verzeih mir, ich bin ein bisschen betrunken, aber ich muss es einfach sagen.«
»Dann mal los. Ich höre.« Malin merkte, dass sie plötzlich jedes Wort verstand.
Dunja sah Malin in die Augen. »Leider wirkst du nicht sehr glücklich.«
Malin wusste weder, was sie sagen, noch, wie sie reagieren sollte. Sie hätte wütend aufstehen und gehen sollen, nachdem sie ihrer neuen dänischen Freundin ins Gesicht gesagt hatte, dass sie sich diesen alkoholverherrlichenden Scheiß an den Hut stecken konnte. Dann musste sie sich eben in Stockholm eine neue Ansprechpartnerin suchen. Hätte Anders es auch nur ansatzweise gewagt, Kritik an ihr zu äußern, hätte sie ihn bedenkenlos mit der Gartenschere kastriert.
Doch aus irgendeinem Grund war sie überhaupt nicht sauer. Im Gegenteil.
»Okay …« Sie leerte ihr Glas Mineralwasser. »Dann gib mir eben ein bisschen Wein, verdammt noch mal.« Sie hielt ihr das leere Glas hin, und Dunja schenkte es lachend voll, während sie dem Kellner ein Zeichen gab, dass er noch eine Flasche bringen sollte.
Sie hoben ihre Gläser und stießen an. Malin probierte den Wein und spürte, wie sich eine Welle der Wollust in ihrem ganzen Körper ausbreitete.
»Oh mein Gott, tut das gut.« Sie nippte noch einmal. »Aber eins hast du in den falschen Hals bekommen. Und zwar nicht nur du, sondern alle Dänen. Schweden hat nicht mehr Verbote als Dänemark. In Wahrheit ist es genau umgekehrt.« Sie trank noch einen Schluck. »Hier darf man ja zum Beispiel nicht in seinem Sommerhaus wohnen, so lange man will. Kan Jang, ein ganz normales Naturheilmittel, ist verboten, und sonntags sind sogar die Läden geschlossen. Also erzähl mir nichts von Bevormundung.«
»Ist ja gut, ich hab schon verstanden, aber …«
»Und das Beste überhaupt. Wusstest du, dass es dänischen Bauarbeitern gesetzlich vorgeschrieben ist, unter freiem Himmel Lippenstift mit Sonnenschutzfaktor zu tragen?«
»Das ist ein Witz.«
»Nein, das ist die Wahrheit des Tages!«
Sie brachen in Gelächter aus und hoben ihre Gläser. »Prost!«
»Nur damit du es weißt, ich bin unheimlich neidisch auf deine Schwangerschaft.«
»Neidisch? Hab ich das richtig verstanden? Wir können gerne tauschen.«
»Wieso? Ist es nicht phantastisch?«
»Phantastisch? Kannst du mir mal erzählen, was so phantastisch daran sein soll, wie eine fette Ente herumzuwatscheln und am ganzen Körper Schmerzen zu haben? Ich habe nichts dagegen, Kinder zu bekommen. Im Gegenteil. Und dass es Zwillinge sind, sehe ich als großen Vorteil an. Die Kleinkinderjahre sollte man nach Möglichkeit komprimieren, aber die Schwangerschaft … Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hasse ich sie von Tag zu Tag mehr.«
»Das meinst du doch nicht ernst.«
»Du hast ja selbst gesagt, dass ich nicht besonders glücklich aussehe, und woran liegt das wohl?« Malin zeigte mit der einen Hand auf ihren Bauch und griff mit der anderen nach dem Weinglas. »In den ersten Wochen habe ich mit meinem Mann Anders darüber gescherzt, ob er die Schwangerschaft, die Geburt oder das Stillen übernehmen möchte. Jetzt ist es kein Scherz mehr. Wenn er nicht bald übernimmt, wird nichts draus. Also befolge einen guten Rat und setze deinen, wenn ich das so sagen darf, wunderbaren Körper niemals dieser Tortur aus.«
»Vorläufig wird das wohl ohnehin nicht passieren.«
»Warum? Bist du Single?«
»Nein, das Problem ist, dass mein Freund und ich zu wenig poppen.«
»Poppen?« Malin führte ihren rechten Zeigefinger in einen Ring aus Daumen und Zeigefinger der anderen Hand ein.
Dunja nickte. »Wir haben auch schon darüber geredet und uns fest vorgenommen, es mindestens einmal in der Woche zu treiben, aber es hat nichts genützt.«
»Liebst du ihn?«
»Carsten? Natürlich. Im Sommer heiraten wir, und im Herbst ziehen wir nach Silkeborg.«
»Silkeborg? Liegt das nicht in Jütland? Entschuldige, aber was wollt ihr denn da?«
»Carsten übernimmt die Buchhalterfirma seines Vaters.«
»Und du? Du machst doch hier Karriere.«
»Ja, aber … Mit kleinen Kindern will ich sowieso nicht Vollzeit arbeiten.«
»Hör mir mal zu, Dunja.« Malin schenkte beide Gläser voll.
»Vielleicht solltest du ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird.«
»Jetzt rede ich«, sagte Malin. »So was habe ich noch nie zu jemandem gesagt, und wahrscheinlich mache ich es auch nie wieder. Hör mir gut zu. Du wirst keine Kinder bekommen. Jedenfalls nicht mit Carsten oder wie er heißt.«
»Woher willst du das wissen?« Dunja stellte ihr Glas ab.
»Es gehört schon einiges dazu, wenn ein Mann einen Körper wie deinen neben sich im Bett hat und trotzdem nicht öfter ›poppen‹ will, wenn ich das mal so frank und frei sagen darf.«
»Frank?«
»Na ja … Ich glaube nicht, dass dieser Carsten dich liebt, und ich frage mich, ob du ihn überhaupt liebst.«
»Natürlich lieben wir uns. Was gibt dir eigentlich das Recht, hier einfach anzukommen und …?«
»Ich sage nur, was ich sehe.«
»Und was siehst du?«
»Ich sehe eine Frau, die … die … Das erklärt sich doch von selbst. Die ganze Geschichte mit diesem Carsten wirkt vollkommen …« Malin verstummte. Auf einmal wurde ihr bewusst, auf wie dünnem Eis sie sich bewegte. Sie stellte ihr Glas auf den Tisch und hielt sich die Hand vor den Mund. »Oh mein Gott, entschuldige.« Es war zwar nicht das erste Mal, dass sie einfach drauflosplapperte und genau das aussprach, was sie dachte, aber sie hatte es noch nie gegenüber einer Person getan, die sie kaum kannte. »Entschuldige … Es tut mir leid. Ich nehme alles zurück. Es war nicht meine Absicht, wie eine Dampfwalze … Wie blöd von mir. Ich weiß nicht, was mich geritten hat.«
»Vielleicht war es ein bisschen zu viel des Guten?«
»Wahrscheinlich. Außerdem ist mit meinen Hormonen nicht zu spaßen. Die hält man sich besser vom Leib, aber mir sind da ja momentan die Hände gebunden.«
Dunja fing an zu lachen und hob ihr Glas.
Kapitel 5
Zu den Klängen von Black Mirror von Arcade Fire saß Fabian am Norr Mälarstrand im Auto und blickte auf den Riddarfjärd, in dem sich die unzähligen beleuchteten Fenster auf der Anhöhe des Stadtteils Södermalm im Wasser spiegelten. Der Anblick war beeindruckend schön. Ein verführerischer und gleichzeitig trügerischer Dunst lag über dem Wasser. Fast wie bei Hitze.
Un! Deux! Trois! Dis: Miroir Noir!
Dabei war es in Wirklichkeit nur noch knapp vom Gefrierpunkt entfernt.
Er stellte die Musik leiser und suchte ihre Nummer raus. Es klingelte nur zweimal.
»Hallo! Lange her.«
»Stimmt, ist fast zwei Jahre her, dass du aufgehört hast. Tut mir leid, dass ich so spät anrufe«, sagte er, obwohl sie ganz und gar nicht müde klang.
»Keine Sorge, die Nacht ist noch jung, du kennst mich doch.«
»Wer weiß, vielleicht bist du ja zur Ruhe gekommen, hast eine Familie gegründet und stehst jetzt früh auf.«
Fabian hörte sie am anderen Ende lachen, denn dass Niva Ekenhielm eine Familie gründete, war so wahrscheinlich wie eine Besiedlung des Mondes. Sechs Jahre lang waren sie bei der Reichskripo Kollegen gewesen, wo sie als Kriminalassistentin oder Sci-Fi-Bulle ermittelt hatte, wie sie es nannten. Nicht selten blieb Niva noch, wenn alle längst zu Hause waren, und arbeitete die Nacht durch, um erst am nächsten Morgen zu gehen, wenn die Ersten wieder eintrudelten.
Fabian hatte ihr mehrmals Gesellschaft geleistet und mit ihr die Nacht in der Abteilung verbracht. Meistens steckten sie mitten in einem Fall, der ihn nachts wach hielt, aber manchmal nutzte er auch einfach die Gelegenheit, seinen Schreibtisch aufzuräumen.
Sonja reagierte jedes Mal mit heftigen Eifersuchtsattacken, die ihre Beziehung zu vergiften drohten. In gewisser Weise konnte er sie verstehen. Nivas Ausstrahlung und Aussehen waren weit überdurchschnittlich. Und sie hatte einen besonderen Stil. Anfangs dachte er, dass sie mit allen Männern so umging, aber bald merkte er, dass sie mit ihm flirtete. Obwohl er unmissverständlich signalisierte, dass er nicht interessiert war, machte sie weiterhin Andeutungen und gab sich immer weniger Mühe, ihre eigentlichen Absichten zu verschleiern.
Doch diesmal wollte er etwas von ihr.
»Was kann ich für dich tun, Fabian? Du hast dich nicht zufällig getrennt?«
»Nein, so viel Spaß werden wir leider nicht miteinander haben.« Fabian bereute sofort, was er gesagt hatte, und versuchte, die Situation mit einem Lachen zu retten. »Scherz beiseite, ich brauche deine Hilfe bei einer Sache, die aus dem Haus rausgehalten werden soll.«
»Kann das nicht bis morgen warten?«
»Möglichst nicht.«
Sein Blick blieb an der Münchenbryggeri auf der anderen Seite des Riddarfjärd hängen, und er begann, die erleuchteten Fenster zu zählen, während er Niva mit ihren hohen Absätzen auf dem Parkett auf und ab gehen hörte.
»Okay, erzähl.«
Kapitel 6
Karen Neuman fürchtete sich im Dunkeln, seit sie denken konnte. Als Kind hatte sie Angst vor Monstern gehabt, die sich unterm Bett oder hinterm Vorhang versteckten, und konnte daher nur bei Licht schlafen. Ihre Eltern hatten das als vollkommen normal für ihr Alter betrachtet und waren überzeugt gewesen, dass es sich mit der Zeit auswachsen würde. Doch stattdessen wuchs das Problem, und als Teenager litt Karen an so schweren Schlafstörungen, dass sie Schlaftabletten nehmen musste.
Nun fürchtete sie sich nicht mehr vor Monstern unter ihrem Bett, aber die Angst vor der Dunkelheit hatte sie noch immer im Griff, und ohne Schlafmittel wäre sie nicht zurechtgekommen. Dass der Winter erst in den Startlöchern saß und es nun einige Wochen lang von Tag zu Tag noch dunkler werden würde, machte die Sache nicht besser.
Auch dass sie in einem alten Fachwerkhaus wohnten, war nicht besonders hilfreich, obwohl das Haus wunderschön war und eine atemberaubende Aussicht auf den Öresund bot. Zumindest sagten das alle. Karen selbst konnte den Ausblick nie wirklich genießen, denn letztendlich war nicht das Meer, sondern die Dunkelheit ihr nächster Nachbar.
Die Verhaltenstherapie und die Außenbeleuchtung, für die Aksel ein kleines Vermögen ausgegeben hatte, verringerten den Druck auf ihrer Brust zwar ein wenig, konnten ihn aber bei weitem nicht vollständig beseitigen. Immerhin hielt sie es mittlerweile alleine zu Hause aus, wenn Aksel seine Abendshow auf TV2 hatte. Allerdings musste trotz Aksels Beschwerden über die hohe Stromrechnung jede einzelne Lampe im Haus brennen.