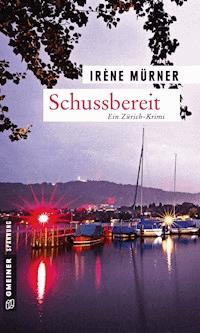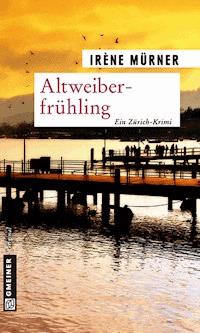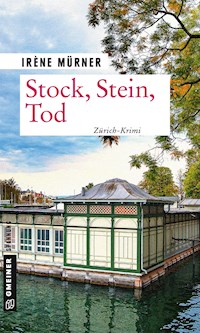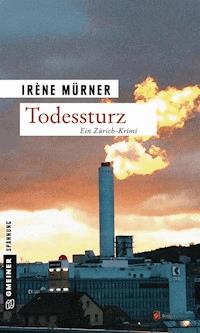Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Andrea Bernardi
- Sprache: Deutsch
Andrea Bernardi, Detektiv der Stadtpolizei Zürich, jagt einen Drogendealer. Unterstützt wird er von der Praktikantin Rea. Eine Spur führt in die Wohnung der attraktiven, geheimnisvollen Rebecca König, die rund um den Globus fliegt und abwechselnd im Central Park joggt, durch Jeddahs Suqs schlendert, in Accra ein SOS-Kinderdorf besucht, über die Golden Gate Bridge fährt oder in Miami am Strand liegt. Ist sie die perfekt getarnte Kokainhändlerin?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IrÈne Mürner
Herzversagen
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013–Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Nikolai Sorokin - Fotolia.com und Lutz Eberle
September
1.
Wunderschön, wie sie da in ihrem transparenten Sommerkleid im klaren Wasser schwebte; das hübsche Gesicht fast durchscheinend und von einer elfenhaften Reinheit; die dunklen Haare ein fließender Vorhang, sich im Takt der ansonsten unsichtbaren Strömung um ihren Kopf bewegend. Morgendunst, unregelmäßig aus dem Wasser aufsteigend, verbreitete etwas unwirklich Märchenhaftes. Der sanfte Wind streichelte den lichten Schilfgürtel am Ufer und verursachte damit ein geheimnisvolles Wispern. Vögel hatten die Flucht ergriffen, verstummt und verjagt. Irgendwo quakte laut ein Frosch, klarstellend, dass es sich hier um sein Revier handelte.
Wäre er ein Künstler, er würde die Szenerie malen wollen.
Beinahe hätte man die Stimmung als magisch bezeichnen können, wären da nicht die uniformierten und zivilen Zerstörer herumgestapft, mit ihrer dumpfen Betriebsamkeit jeglichen künstlerischen Wert zunichte machend.
Hatte er eben noch ›wunderschön‹ gedacht? Durfte man eine Wasserleiche überhaupt so nennen?
»Kann ich jetzt gehen?« Leicht genervt und sichtlich weniger poetisch veranlagt, unterbrach ihn eine Frauenstimme. »Mein Mann wartet mit den Kindern daheim, er muss arbeiten gehen. Übrigens, wir…« Offenbar hatte sie noch etwas hinzufügen wollen, es sich dann aber doch anders überlegt. Ungeduldig schaute sie ihn an.
»Ich nehme an, mein Kollege hat Ihre Aussage, Personalien und die Telefonnummer entgegengenommen?« Sie nickte.
»Dann können Sie gehen. Falls wir noch Fragen haben, melden wir uns bei Ihnen. Ansonsten einen schönen Tag.« Mit einem lässigen Winken entließ er sie und sie verabschiedete sich mit irritiertem Gesichtsausdruck. Vermutlich hielt sie seine Bemerkung zum schönen Tag für unangebracht, immerhin hatte sie heute eine Leiche entdeckt. Aber das würde sie verkraften, da war sich Andrea sicher. In flottem Tempo rannte die Frau bereits von dannen. Irgendwie war sie ihm bekannt vorgekommen, aber er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wo sie sich schon einmal begegnet waren.
»Wir haben noch keine Ahnung, wer die Tote ist. Sie wurde heute Morgen von der Joggerin auf ihrer Runde gefunden. Vermutlich liegt sie noch nicht lange hier.« Der Uniformierte stand beflissen vor ihm und teilte sein notiertes Wissen pflichtbewusst aus dem schwarzen Büchlein mit. Die leicht rosa angehauchten Wangen im Jünglingsgesicht verrieten seinen Eifer. Er musste neu sein. Andrea kannte ihn nicht. Ein Blick auf die jungfräulich unberührte Schulterpatte bestätigte den Eindruck; frisch ab Presse sozusagen. Dies erklärte auch die unverblümte Freude, die aus seinen Augen leuchtete und die er sichtlich ob seiner neu gewonnenen Wichtigkeit verspürte.
Für Andrea war es lange her, seit er die zweijährige Ausbildung der Stadtpolizei Zürich abgeschlossen und die anspruchsvolle Verwandlung vom Schüler vor den Ferien zum Polizisten nach den Ferien erlebt hatte. Dennoch konnte er sich gut an die erste Zeit in Uniform erinnern. Allein die Vorfreude, das Daraufhinfiebern, all die Vorbereitungen, Anproben, bis es dann endlich, endlich so weit gewesen war, der entscheidende Augenblick gekommen: seine Kleidung bereit zum Anziehen. Wie würde sie sich anfühlen? Konnten die Erwartungen, Vorstellungen überhaupt erfüllt werden? Würde man ihn damit anders anschauen? Wie ihm begegnen? Es folgte die Aufregung, ja, schon beinahe an Nervosität grenzende Erregung, das Gefühl des Beobachtetseins, sobald er in der Dienstbekleidung auf die Straße getreten war.
Rasch hatte allerdings das substanzielle Gefühl, eine Polizeiuniform tragen zu dürfen–und damit das Recht in Person zu sein–einer selbstverständlichen Alltäglichkeit Platz gemacht. Dass das ›Tenü blau‹ zu ihm gehörte wie seine dunklen Haare und die kaffeebraunen Augen. Wo anfangs so etwas wie Stolz aufgekommen war, weil er offensichtlich auf der richtigen Seite stand, sich für Sicherheit und Ordnung in seiner Stadt einsetzte, war mit der Zeit nicht mehr viel von diesem Selbstbewusstsein übrig geblieben. Und manchmal war ihm die Uniform im Gegenteil eher wie ein notwendiges Übel erschienen. Er hatte sich sehr schnell an all die schuldbewussten Blicke, die Abwehrhaltungen, die Verteidigungsstrategien gewöhnt, die ihm gegenübertraten; die Dienstbekleidung rief im ersten Moment selten positive Assoziationen hervor, die meisten Menschen waren in Not oder gerieten in Not, sobald sie es mit der Polizei zu tun hatten.
Mittlerweile war es Jahre her, seit Andrea zivil in der Kripo als Detektiv arbeitete. Dennoch konnte er sich in den grünen Heinrich hier bestens einfühlen und so nickte er ihm ermutigend zu. »Hast du zufällig auch schon aufgeschrieben, wer alles auf Platz ist?«
Der junge Uniformierte errötete. »Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. Mach ich aber selbstverständlich sofort.« Eilfertig schaute er den dienstälteren Kollegen an und zückte bereits wieder Kugelschreiber und schwarzes Büchlein.
»Nein, nein, lass nur, ich mache das selber. Aber wenn du mir deine Notizen per Mail zukommen lassen könntest, wär das super. Danke.«
»Ja, ja, natürlich, mach ich.« Etwas verloren blieb der Kleine stehen und wusste nicht so recht, was nun von ihm erwartet wurde. Andrea erlöste ihn mit den Worten: »Eure Arbeit hier ist erledigt. Die Sofortmaßnahmen habt ihr toll abgedeckt. Nochmals danke. Hier meine Karte, ich erwarte dann deine Nachricht. Mach’s gut.«
Wieder errötete der junge Mann, diesmal in freudigem Stolz über das unerwartete Lob. »Danke. Und dann viel Erfolg bei deinem Fall. Sobald ich in der Wache bin, sende ich dir meine Angaben. Tschüs.«
Andrea schaute sich den Tatort nochmals genau an und ließ seinen Blick über die nähere Umgebung schweifen. Sie hatten einen verregneten Juli und August gehabt, dafür schien der September wettmachen zu wollen, was der Sommer versäumt hatte. Während die einen unter der ungewohnten Hitze stöhnten, genossen andere das unerwartete Geschenk. Auch der heutige Tag versprach,–genau wie gestern–, ein verspäteter Hochsommergruß zu werden. Er hatte bisher nicht mitbekommen, wie schön die hundefreie Fußgängerallmend geworden war. Ob sie gut frequentiert war? Auf ihn wirkte sie eher wie ein Biotop und nicht unbedingt, als würden sich Familien und Sportler darin vergnügen. Aber anscheinend nützten zumindest Läufer das Naherholungsgebiet, diverse Sportbewusste waren in der Zwischenzeit schnaufend an ihnen vorbeigerannt und hatten immer wieder ihre neugierigen Blicke geworfen. Erkennbar war längst nichts mehr, die Seepolizei hatte ihr weißes Zelt abschirmend aufgestellt. Unterdessen war auch die Ärztin fertig, den Leichnam würde sie zur Abklärung der Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin bringen lassen und sobald eindeutig feststand, was das unvermutete Ableben der jungen Frau zu verantworten hatte, würde die Leiche freigegeben werden.
Dies war für Andrea bereits der zweite ungewöhnliche Todesfall dieser Art innerhalb weniger Monate. Bei beiden Opfern handelte es sich um junge Frauen, und Andrea kam nicht umhin, die auffälligen Gemeinsamkeiten der beiden Aufträge zu bemerken. Im ersten Fall war man noch von einer sexuell motivierten Tat ausgegangen, da die Tote, nur mit einem Bikini bekleidet, auf der Mole des Yachthafens gefunden worden war. Es hatte sich aber herausgestellt, dass sie keinerlei Zeichen eines Missbrauches aufwies, sondern ohne Fremdeinwirkung verstorben war, an Herzversagen. Sie hatte an einem Herzfehler gelitten, der bis dahin unerkannt geblieben war. In ihrem Blut waren Kokainrückstände gefunden worden, und so ging die Rechtsmedizin davon aus, dass eine Überdosis der Droge das Herzversagen verursacht hatte. Einen Rest Kokain hatte die Verstorbene noch in ihrer Tasche gehabt, und wie die Probe ergeben hatte, handelte es sich um außergewöhnlich reinen Stoff. Andrea hatte aus dem Umfeld der Toten erfahren, dass sie nach ihrem Wissen nie vorher mit Drogen experimentiert hatte. Ihre Familie hatte schockiert reagiert, und sogar ihre Freunde waren überrascht, als sie hörten, woran das Opfer gestorben war. Das Abenteuer am Zürichsee hatte für die junge Frau tödlich geendet.
Gut möglich, dass es sich bei der zweiten Toten um ähnliche Umstände handelte. Auf den ersten Blick konnte eine Todesursache jedenfalls nicht festgestellt, ein Gewaltverbrechen aber vermutlich ausgeschlossen werden. Andrea hütete sich allerdings davor, vorschnelle Schlüsse ziehen zu wollen.
Zwar würde er nicht von einer eigentlichen Drogenszene im Kreis 2 sprechen. Aber das leicht verschlafene und vorwiegend von Familien bewohnte Wollishofen eignete sich genauso hervorragend als Tarnung für einen Dealer wie die geschäftige Enge mit dem belebten Bahnhof, den großen Versicherungsgesellschaften und gut besuchten Parkanlagen. Es schien, als würde sich tatsächlich jemand diese augenscheinlichen Vorteile zunutze machen. Ob Andrea mit seinen Überlegungen recht hatte, würde er in Kürze erfahren, der Bericht aus der Rechtsmedizin sollte auf jeden Fall Licht ins Dunkel bringen.
2.
Sie war die Nacht durchgeflogen und frühmorgens in Zürich gelandet. Daheim hatte sie nur rasch das Gepäck abgeladen, war dann schnurstracks hierhergekommen, um den Frühstückskaffee zu genießen. Sie blickte aus dem Fenster und beobachtete die vorbeihastenden Menschen. Wer konnte schon mitten unter der Woche dem Heer der Arbeitenden zuschauen, im Wissen, dass ein langer, freier Tag vor ihm lag? Ja, der Job war perfekt. Allerdings nur, wenn zu Hause alles stimmte. Wenn man über ein soziales Netz verfügte, über Freunde und Familie. Wieder einmal erschien das Bild jenes sonnigen Schulvormittags in ihrem Kopf. Der Morgen, der ihr ganzes Leben verändert hatte.
»Entschuldigung, ist der Stuhl noch frei? Kann ich ihn mitnehmen?« Der Blick der jungen Frau war hoffnungsvoll.
»Ja, bitte.« Rebecca schaute ihr nach und verspürte einen kleinen, neidvollen Stich, als sie sah, wie sie sich zu zwei Freundinnen setzte. Dann schüttelte sie das Gefühl ab, nein, der Morgen war herrlich und sie würde ihn sich durch nichts verderben lassen. Mal sehen, was sie in den letzten Tagen verpasst hatte und was in der Zeitung stand. Wie immer, wurde über den Krieg in Afghanistan berichtet. Was für ein unerfreuliches Kapitel! Diverse Politiker zerbrachen sich den Kopf über das Schulsystem im Kanton Zürich, warum nur jeder Kanton für sich selber wursteln musste? Rebecca fand es beispielhaft, wie in der Schweiz Platz für Minderheiten war, und Föderalismus in allen Ehren, aber alles hatte seine Grenzen.
Im Opernhaus war’s zum Eklat gekommen, weil der Ballettdirektor die Vorstellung abgesagt hatte. Außerdem wurden mögliche neue Bundesratskandidaten vorgestellt. Sie überflog den ersten Bund und blieb schließlich an einer Reportage über Kuba hängen.
So, sie faltete die gelesene Zeitung zusammen. Nun war sie bereit für einen genussreichen Spätsommertag. Die geschuldete Geldmenge für den Kaffee rundete sie auf und legte die Münzen neben die ausgetrunkene Tasse. Beim Hinausgehen warf sie einen letzten Blick auf die drei Frauen am Nebentisch, die sich schnatternd unterhielten.
Obschon weit über Mitte September, würde es ein heißer Tag werden. Sie freute sich, hatte sie doch Lust auf die Mole, das Wasser. Rebecca liebte Zürich. Wenn sie ein paar Tage im Ausland verbracht hatte, fiel es ihr mit jedem Zurückkommen von Neuem auf. Natürlich spielten da rein ästhetische Äußerlichkeiten mit. Dennoch lag diese Liebe nicht in erster Linie an den gepflegten Häusern, ein bisschen Patina konnte durchaus interessant wirken; den sauberen Straßen, die jede Geschichte der Vornacht zerstörten, bevor sie erzählt werden konnte; den teuren Autos, deren glänzende Oberfläche mehr von Luxus, denn von hart erarbeitetem Leben zeugten; nicht einmal an den großzügigen, getrimmten und gestutzten Grünflächen und selbst die Postkartenidylle der Quaibrücke war es nicht. Obwohl kein Kunstschaffender eine perfektere Aussicht hätte erstellen können. Mit der grandiosen Kulisse aus Groß- und Fraumünster, Brücken, schaukelnden Booten, der sanft oder manchmal auch zügig fließenden Limmat einerseits und andererseits dem See mit den Kursschiffen und dem Alpenpanorama im Hintergrund; an einem sichtigen Tag grenzte es beinahe an Kitsch, was einem hier präsentiert wurde. Dass Rebecca Zürich so besonders gefiel, lag auch nicht an den Bewohnern, obwohl es in der heimlichen Hauptstadt des Landes überdurchschnittlich viele attraktive Menschen gab. Geld machte schön. Nein, am meisten schätzte Rebecca, dass Zürich eine Stadt für Fußgänger war und dass sie sich hier sicher fühlte. Sie konnte sich zu jeder Uhrzeit frei bewegen, das war wahre Lebensqualität. Hinzu kam, dass es in seiner Übersichtlichkeit trotzdem die Größe und Anonymität ausstrahlte, die versprach, nicht jeden Tag den gleichen Gesichtern begegnen zu müssen. Nur manchmal empfand sie diese Überschaubarkeit als Enge, waren es der Verbote und Vorschriften zu viele und der Großzügigkeit zu wenig. Dann sehnte sie sich nach Raum, Platz, Unkompliziertheit und etwas weniger Korrektheit. Einer offenen Weite, die durch nichts unterbrochen, in der der Blick nicht aufgehalten wurde, wo sich freie Gelassenheit in ihr ausbreiten konnte und sie atmen ließ. Dann musste sie wieder weg.
Rebecca ging über den Fußgängerstreifen und ertappte sich dabei, wie sie zufrieden lächelte. Ja, heute war ein guter Tag.
Für die Mole war sie noch früh. Nur wenig Sonnenhungrige hatten sich vor ihr auf den Steinen niedergelassen und sie konnte sich ihren Platz aussuchen. Leise plätscherten die Wellen an die aufgeworfene Mauer. Sie entledigte sich des Kleides–darunter trug sie bereits ihren Bikini–und stieg ins Wasser. Wie erfrischend kühl. Mit kräftigen Crawlzügen schwamm sie in sicherer Distanz zum Ufer gleichmäßig voran. Wunderbar, das Wasser zu spüren. Dieses Gleiten in einem anderen Element, es fühlte sich so befreiend und gleichzeitig stark an.
Nach einer halben Stunde kletterte sie befriedigt aus dem erquickenden Nass. Die Gänsehaut verlor sich rasch in den wärmenden Sonnenstrahlen und die perlenden Wassertropfen verschwanden schneller, als ihr lieb war.
Gedankenverloren schaute sie auf den Springbrunnen linkerhand. Genau hier war sie schon als Mädchen oft mit ihrem Vater gesessen. Allerdings nur, wenn ihre Mutter unterwegs war, ihr schien der Platz völlig ungeeignet für Kinder. Womit sie nicht unbedingt unrecht hatte. Der Auslauf, auf den Kinder angewiesen waren, fehlte gänzlich und dafür war die Gefahr, ins tiefe Wasser zu stürzen, ständig präsent. Aber wie hatte sie die Boote des Yachthafens bewundert und niemals an den Worten ihres Vaters gezweifelt, der ihr versicherte, dass der majestätische Steinlöwe in seiner beschützenden Position am Ende der Mole immer auf sie achten würde. Noch heute strahlte die Figur eine ihr eigene Sicherheit aus und sie war mit ein Grund, weshalb es Rebecca stets hier herzog und sie sich daheim fühlte.
Rücklings legte sie sich auf ihr großes Badetuch. Über ihr nichts als endloser, blauer Himmel, einzig geteilt durch zwei schnurgerade Kondensstreifen. Ein spielzeugkleines Flugzeug bewegte sich gen Osten. Wohin wohl? Wien? Warschau? Moskau? Delhi? Peking? Tokio? Sydney? Eine kleine, für sich abgeschlossene Welt da oben im Nichts. Völlig losgelöst, frei der Erde und doch im Kleinen ein funktionierender Kosmos. Es war schön, ab und zu einfach davonfliegen zu können, den Alltag mit allen Pflichten und Unannehmlichkeiten hinter sich zu lassen. In eine Welt, die einen nicht kannte, die unbeschrieben und unbelastet betreten werden konnte. Völlig anonym, unbeschwert und leicht wie ein Blütenblatt. Allmählich verwischten die Kondensstreifen. Verschmiert, wie zwei unsauber von der Tafel gewischte Kreidestriche, mittlerweile schon beinahe nicht mehr als Flugzeugspur erkennbar.
3.
Andrea hatte richtig vermutet, die junge Frau war indirekt durch die Drogen getötet worden. Aus dem Bericht der IRM-Ärztin ging klar hervor, dass sie tatsächlich an einem Herzstillstand, verursacht durch eine Überdosis an Kokain, gestorben war. Genau wie die erste Tote, hatte auch sie an einem unerkannten Herzfehler gelitten, der ihr den Drogenkonsum nicht verziehen hatte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war der ›Schneestreuer‹ also wieder unterwegs und hatte sein zweites Opfer gefordert.
Inzwischen stand auch die Identität der Toten fest. Unweit des Tatortes war ein Portemonnaie in einem Gebüsch gefunden worden, und aufgrund der Ausweise war sie eindeutig identifizierbar. Es handelte sich um eine 24-jährige Schweizerin, Nathalie Baumann. Laut Einwohnerkontrolle der Stadt Zürich teilte sie sich ihre Wohnung mit einer anderen Frau. Die beiden lebten in einer Wohngemeinschaft im angesagten Stadtteil Seefeld. Andrea hatte nie nachvollziehen können, warum gerade das rechte Zürichsee-Ufer so hipp war. In seinen Augen standen die Häuser viel zu eng, und es musste Wohnungen geben, die kaum je ein Sonnenstrahl erreichte. Nicht, dass ihn das persönlich interessierte, zählte er sich ohnehin zu den Nachtschattengewächsen.
Bevor er nun die Wohnungsgenossin über den Verlust ihrer Wohnpartnerin unterrichten musste, waren die Eltern Nathalies an der Reihe. Er war auf dem Weg zu Baumanns. Ein belastender Gang, an den er sich nie würde gewöhnen können. Mit wechselhaftem Erfolg versuchte er, sich von dem abzulenken, was ihm bevorstand. Der 6-er mit der Aufschrift ›Zoo‹, dem er im Dienstgolf hinterher den Zürichberg hochkroch, kam ihm deswegen gerade recht. In diesem Jahr war er noch kein einziges Mal im Tiergarten gewesen, was bestimmt daran lag, dass Nicole nicht daheim war. Für sie war der Park immer dann zum Einsatz gekommen, wenn ihre Reiselust unbezähmbar und die nächsten Ferien noch weit entfernt waren. Dieses unkontrollierte Reißen, das sie meistens während der Wintermonate überfiel, gerade dann, wenn die erstickende Nebeldecke, die hässliche Kälte, das aufdringlich tote Grau und die miese Stimmung all überall vorherrschten. Die brennende Sehnsucht nach Wärme, Fremdländischem und einem Schuss Romantik suchte sie regelmäßig heim. ›Masoala‹ zerging ihr dann wie ein Stück Caramel auf der Zunge, ließ sie an Bäder unter Wasserfällen, an Pirschfahrten mit dem 4 x 4, an knisternde Lagerfeuer und unendliche Sternenhimmel denken. Der Name versprach ihr pure Exotik und hielt reine Verzauberung. Allein der Geruch nach feuchtem Moder, lebendigen, warmen Tierkörpern, bunten, fremdartigen Blumen und undurchdringlichem Pflanzengewirr versetzte sie in längst verloren geglaubte Erinnerungen und ließ sie in noch nie erlebten Abenteuern schwelgen. Wie oft hatte er ihren Schwärmereien gelauscht. An Fantasie mangelte es seiner Freundin wahrlich nicht und häufig ließ sie ihn an ihrem Traum vom Beamen teilnehmen: einmal mit dem Finger schnippen und sie wären auf dem majestätischen Tafelberg, im geschäftigen Tokio, an einem menschenleeren Strand in Thailand, in der unendlichen Weite des australischen Outbacks, im afrikanisch-lebendigen Ouagadougou, auf einem schneeweißen Salzsee in Bolivien oder in der verlassenen Tundra Sibiriens. Da sie aber vom Beamen nach wie vor weit entfernt waren, musste jeweils die Masoala-Halle als passabler Ersatz herhalten. Das Dämmerlicht des verhangenen Himmels, welches durch das lichtdurchlässige Dach der Halle drang, gaukelte ihnen einen echten Regenwald vor, und gingen sie zur fortgeschrittenen Nachmittagsstunde auf ihre Runde, so schien der Dschungel schläfrig, waren wenig aktive Tiere und noch weniger Besucher zu sehen. Als hätten sie alles für sich alleine. Die seltenen Mitwanderer schienen das gleiche Glück zu empfinden, die geheimnisvolle Stimmung aufzusaugen und sie um keinen Preis durch irgendwelche lauten Geräusche oder unpassenden Bewegungen zerstören zu wollen. Selbst Andrea musste gestehen, dass ein gewisser Zauber in der Luft lag, wenn sie beinahe nur zu flüstern wagten, an Orchideen vorbeischlichen, unter riesigen Blattdächern schlenderten, mucksmäuschenstill den schlafenden Flughund beobachteten, eine Madagaskarente entdeckten, Chamäleon mit Gecko verglichen und schließlich bei den Schildkröten ruhten. Apropos Schildkröten, sein ganz persönlicher Favorit im Zoo war die Forschungshütte, das Daheim der Urtiere. In ihrer überblickbaren Kleinheit wurde das Schildkrötenhaus nämlich beinahe stiefmütterlich besucht. Eine Oase der Ruhe. Eine Ruhe, die das Gemächliche und die Friedlichkeit der Riesen widerspiegelte und so eine Atmosphäre der Beschaulichkeit schaffte. Ob dieses Leben in Zeitlupe nur mit Hilfe eines sicheren Panzers gelingen konnte? Scheinbar unbeteiligt gingen die Schildkröten ihres Weges, und es war, als sagte der weise Blick aus ihren alten Augen: ›Was eilst du von einem Ding zum nächsten, was hast du immer tausend Ideen im Kopf, was nimmst du dir täglich alles zur Erledigung vor. Sieh her, es geht ohne Listen und ungesunde Hetzerei. Auch bei uns wird es Abend, und wir sind ganz bestimmt nicht unzufriedener oder kränker als du.‹ Wie recht sie hatten. Er beneidete sie um ihre Gelassenheit.
Endlich waren sie an der Tramendhaltestelle angekommen und Andrea kam wieder zügiger voran.
Es war Vormittag, kurz vor halb zehn, und die Menschen pilgerten bereits in Scharen in den Zoo. Die vielen Kinder würden bestimmt bei den Affen reinschauen. Nicole kannte alle Gorillas mit Namen und liebte es, ihnen zuzuschauen. Wie sich der kleine Habibu zum Beispiel hin und her schwang. Da ein Blatt abzupfte, dort an einem Ast riss und schon war er wieder am Boden um sich gleich darauf erneut am Gitter hoch zu hangeln. Alles spielerisch vergnügt und ohne das kleinste Zeichen einer Kraftanstrengung. Fresssäckchen Haiba mochte es, Selleriestangen durch die Deckenstäbe zu klauben und mit ihrer Beute im Hintergrund zu verschwinden. Die Mütter Mamitu und Nache? Egal, was sie machten, ob essen, lausen, klettern, ein Auge und ein Ohr gehörten immer ihrem Nachwuchs. Während Binga und Bonsenga die aufmüpfigen Halbstarken markierten und ihre Grenzen ausloteten, ließ sich einer durch nichts aus der Ruhe bringen. Da saß er jeweils, gewichtig und fast schon gelangweilt. Hätte man es nicht besser gewusst, man hätte glauben können, das ganze Gewimmel und Gewusel rund um ihn herum ginge ihn nichts an. Was für eine Machtdemonstration, so manch ein Staatsmann oder Politiker könnte sich eine dicke Scheibe davon abschneiden. N’Gola brauchte keine einstudierten Gesten, keine aufgeregte Mimik und schon gar keine lauten Worte, ein Blick genügte und es war klar, wer hier das Sagen hatte. Für Nicole waren die Primaten ein Spiegel der Menschen, in den sie immer wieder gerne blickte, und Andrea ließ sich von ihr mitziehen.
Da stand das weiße Haus, in dem Baumanns in ihrer Eigentumswohnung lebten. Er trat vor die eingefasste Glastüre, in der linken Hand hielt er einen durchsichtigen Effektensack, die rechte zögerte noch, bevor sie gleich den Klingelknopf betätigen musste. Er wusste haargenau, was nun kommen würde. Erst würde ahnungslose Überraschung die Gesichter der Eltern dominieren, sie würden sich fragen, wer er war und was er von ihnen wollte. Dann würde ein Elternteil das Mobiltelefon oder das Portemonnaie im Plastiksack als Nathalies persönliches Hab und Gut erkennen und in seinen Händen als seltsam fehl am Platze empfinden. Die Rädchen im Kopf würden sich in Bewegung setzen. Stellte er sich erst mit Namen und Arbeitsplatz vor, kam zur unwissenden Verwunderung die Angst in die Augen, Angst vor etwas Schrecklichem. Man erwartete niemals etwas Gutes, wenn ein Stadtpolizist vor der Türe stand, mit den Dingen der eigenen Tochter in einer Tüte. Während die einen sofort wussten, was geschehen war, sträubten sich andere noch dagegen, selbst wenn er ihnen alle Fakten auf den Tisch gelegt hatte. Es war schlimm, dieses Wechselbad der Gefühle in den Gesichtern der unvorbereiteten Hinterbliebenen lesen zu müssen. Oft wechselte die Mimik zu wütendem Unglauben, ja gar zu Zorn, Verblüffung, Befremden, Verwirrung, sobald er sie über den Tod ihrer Angehörigen unterrichtete, bis hin zu unendlichem Schmerz und Fassungslosigkeit, wenn sie zu begreifen begannen, dass er die Wahrheit sagte und sie tatsächlich mit einem unvorstellbaren Verlust umgehen mussten. Je nach Kultur wurde geschrien, geweint, gefragt, versteinerte man. Den meisten war gemein, dass sie von ihm Gründe hören, wissen wollten, wie und warum das Unglaubliche hatte geschehen müssen. Andrea versuchte, so gut es ging, befriedigende Antworten zu finden, aber zu diesem Zeitpunkt war es noch zu früh und er konnte Verwandten niemals genug mitteilen.
So verschieden die Menschen auf die unverhoffte Nachricht reagierten, Andrea wusste, dass es oft besser war, wenig zu sagen und die Menschen begleitend in ihrem Leid erst einmal ankommen zu lassen.
Er drückte auf die Klingel.
4.
Da saß sie auf dem Klo. Nackt. Hier drinnen war es angenehm kühl, aber draußen erschlug es sie fast. 38° Celsius am Tag, 28° selbst in der Nacht. Sie waren gestern gegen Abend gelandet. An die strengen Kontrollen hatte sie sich längst gewöhnt. Kein Tropfen Alkohol–auch keine gefüllten Pralinen, jedes Trinkglas war vorsorglich mit Wasser ausgespült worden, und jede Flasche lag, deckellos, kopfüber im Abfall–keine Illustrierten mit offenherzig gekleideten Frauen, von Drogen jeglicher anderer Art ganz zu schweigen. Die Koffer waren ausnahmslos geöffnet worden und sie hatte sich von einer Zöllnerin abtasten lassen müssen. Ihre Abbaya–schwarz und blickdicht–hatte sie im Hotel gekriegt. Im Grunde trug sie sie nicht ungern. In Saudi-Arabien brauchte sie sich jedenfalls nie Gedanken über ihre Garderobe zu machen. Sie wusste den Umhang zu tragen, hatte ihre Schrittgröße dem knöchellangen Gewand so weit angepasst, dass sie beinahe die gleiche Anmut an den Tag legte wie die Einheimischen.
Trotz der fortgeschrittenen Stunde war sie noch in der Stadt gewesen. Vorschriftsgemäß gekleidet sogar mit Gesichtsschleier. Das Reden und Atmen war ihr unangenehm gewesen, der Schweiß in Bächen am Körper hinuntergeronnen; ausgenommen in jenen Läden, die mit einer Klimaanlage ausgestattet waren. Dennoch mochte sie diese Besuche in Jeddahs Suqs. Die Händler waren erstaunlich freigebig und sie durfte ihre Ware überall probieren. Das orientalisch Fremde hatte seinen Reiz. Zuweilen empfand sie es sogar als bequem, überall hinchauffiert zu werden, und Rebecca konnte verstehen, dass es für Frauen, die nichts anderes kannten, unverständlich war, was die Attraktivität am westlich freien Leben ihrer Geschlechtsgenossinnen ausmachen sollte. Was, bitte, war so herrlich daran, zu arbeiten, sich selber um alles zu kümmern, sich durchsetzen zu müssen und dauernd zu beweisen, dass man Dinge genauso gut konnte wie ein Mann? Sie sahen den Sinn dieses anstrengenden Lebens nicht ein, dementsprechend schwierig war, es so jemandem zu erklären, dass autark sein, sich unabhängig fühlen zu können, all die Mühsal tausendfach wettmachte. Genauso wie es Frauen hier verboten war, Auto zu fahren, durften sie auch ihre Konsumation im Restaurant nur in einem von Männerblicken abgeschirmten Teil einnehmen. Dass Rebecca als Frau alleine überhaupt bedient wurde, grenzte vermutlich beinahe an ein Wunder. Ihrer hellen Augen und der ungewohnten Gesten und fremdartigen Verhaltensweisen wegen wurde sie jedoch als Ausländerin erkannt und deshalb wohl mit etwas gnädigerer Großzügigkeit behandelt. Als sie aus dem Restaurant auf die Straße getreten war, hatte sie als Erstes auf eine Gruppe kniender Männer geblickt; zu den Pflichten des starken Geschlechtes gehörte das pünktliche Verrichten der Gebete. Das Bild der gebückten Männerwelt hatte etwas eindrücklich Faszinierendes und gleichzeitig beklemmend Zwanghaftes in seiner ausschließenden Herdenhaftigkeit. Es war gut gewesen, zurück im Hotel zu sein, im Wissen, ihre Einkäufe erfolgreich getätigt zu haben. Und im ›Sheraton‹ gab man sich wie immer jede erdenkliche Mühe, um ihr den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.
Der heutige Tag würde sehr heiß und wolkenlos werden wie jeder Tag hier. Rebecca zog sich an und informierte den Concierge, dass sie einen Wagen inklusive Chauffeur brauchte. Die Fahrt ans Meer im klimatisierten Fahrzeug war wenig abwechslungsreich, ging aber angenehm flüssig vonstatten. Das eigentümliche Weiß des Himmels vermischte sich mit dem hellen Beige des Sandes zu einem undurchsichtig staubigen Gelb, das eine eindeutige Erkennung des Horizontes unmöglich machte. Die reizlos öde Wüstenlandschaft wurde einzig unterbrochen durch filigrane Ölbohrtürme und protzige Villen, allesamt eingemauert. Die eckigen Häuser erinnerten Rebecca an Geschenkpakete, und sie hätte gerne den einen oder anderen Inhalt zu Gesicht bekommen.
Bald räkelte sie sich keine fünf Meter vom Roten Meer entfernt auf einem Liegestuhl im Sand unter Palmen. Selbstverständlich der Privatstrand des Hotels, nur für nicht arabische Gäste. Die beiden Welten vertrugen sich schlecht, gerade wenn es um freizügiges Sonnenbaden ging. Sie stieg ins Wasser. Schnorcheln war hier fantastisch. Sich eins fühlen mit den bunten Fischschwärmen, indem sie sich im gleichen Rhythmus über den Korallen bewegte wie die kleinen Tiere. Sie meinte, Anemonen- und Pfauenkaiserfische zu erkennen, und freute sich über eine Pyjamaschnecke.
Baden, lesen und dösen. Faul schaute sie nach oben in die sich im leichten Wind wiegenden Palmwedel; die spitzen Blätter zerschnitten, scharfen Messern gleich, das intensive Blau des Himmels. Ihr sanftes Rascheln wirkte einschläfernd. Sie überlegte sich kurz, ob sie einige Längen im fast widerlich warmen, von Meerwasser gespeisten Schwimmbecken ziehen sollte, entschied sich aber dagegen.
So ließ es sich leben. Der Rückflug war noch weit weg. Sie schloss die Augen.
5.
Er liebte diese ruhigen Morgenminuten, bevor die Kollegen kamen. Meistens kam er als Erster, nahm sich seinen Kaffee aus der Maschine, startete den Computer und las währenddessen die Headlines der mitgebrachten Zeitung. Bis die anderen kamen, hatte er seine Mails durchkämmt und den ersten Kaffee intus. Der Tag würde wenig Überraschendes bringen. Er war seit einigen Wochen an einer Gruppe Jugendlicher dran, die die Kassen der Solarien aufbrachen. Die Überwachungskameras halfen wenig, da die Täter Helme trugen. Trotzdem würde er sich die Aufnahmen nochmals vornehmen, irgendetwas musste doch darauf erkenn- und verwertbar sein. Priorität aber hatte nach wie vor sein ›Schneestreuer‹.
Mit halbem Ohr hörte er, wie Gian und Markus die Treppen hochstiegen und sich über das Wetter unterhielten. Alles wie immer. Langsam tröpfelte auch der Rest der Truppe ein.
»Andrea, dein Klient ist hier!« Markus war mühelos zu hören, obwohl sich sein Büro einen Stock tiefer befand.
»Komme.« Andrea sagte es mehr zu sich selbst. Vermutlich würde er gleich der Person, die Nathalie zuletzt lebend gesehen hatte, gegenüberstehen. Er hatte diesen Keller, der sich angeblich mit Nathalie im ›Pelikan‹ unterhalten hatte, vorgeladen.
Das Ehepaar Baumann war völlig fassungslos gewesen, ihre Tochter, tot. Ein erfolgreiches Mädchen, hübsch, intelligent, blühend, nie hatte sie ihnen Probleme gemacht. Alle Möglichkeiten noch gehabt. Vor allem für Frau Baumann war eine Welt zusammengebrochen. Andrea konnte den Schmerz einer Mutter nur erahnen und hoffte inständig, dass er seiner Mutter nie würde so wehtun müssen. Die bedingungslose Liebe, diese einzigartige Naturgewalt, machte es den Frauen unendlich schwer, ihre Kinder überleben zu müssen. Der Vater litt anders, war zornig auf seine Tochter, suchte den Grund, einen möglichen Schuldigen. Aus Erfahrung wusste Andrea, dass es zumindest anfangs half, wütend zu sein, bei der Wut alleine würde es aber kaum bleiben. Er wünschte den beiden, dass sie sich in ihrem Schmerz gegenseitig Stütze sein konnten.
Üblicherweise übernahm es die Familie eines Opfers, andere Nahestehende zu unterrichten. In diesem Fall aber hatte Andrea auch die Wohngemeinschafts-Freundin darüber informiert, dass ihre Mitbewohnerin nie mehr würde nach Hause kommen. Nach ihrer ersten traurigen Sprachlosigkeit konnte sie ihm insofern weiterhelfen, dass sie wusste, wo und mit wem sich die Tote angeblich am Abend vor ihrem Tod verabredet hatte. Der genannte Klub war einschlägig als Drogenumschlagplatz bekannt, und Andrea war überrascht, dass es sich tatsächlich um den gleichen handelte, in welchem bereits das erste Opfer vermutlich an den Stoff gekommen war.
Leider hatte ihm auch die Kollegin, mit welcher Nathalie im ›Pelikan‹ gewesen war, nicht weiterhelfen können. Sie hatte ihm glaubhaft versichert, dass sie keinen Schimmer davon habe, woher Nathalie die Betäubungsmittel hätte bekommen können. Die zwei Frauen arbeiteten zusammen und gingen gelegentlich gemeinsam aus, aber über die gegenseitigen Lebensgewohnheiten wussten sie herzlich wenig. Dennoch war anzunehmen, dass Nathalie tatsächlich im ›Pelikan‹ an das Kokain gekommen war. Die beiden waren direkt nach der Arbeit in die Bar gegangen und die Kollegin war davon überzeugt, dass Nathalie ihr mitgeteilt hätte, wenn sie bereits Kokain dabei gehabt hätte. Nathalie war zu Lebzeiten eine sehr mitteilsame und neugierige Person gewesen, was auch ihr Bruder erwähnt hatte, mit welchem Andrea telefonisch Kontakt gehabt hatte. Daher hatte das Umfeld der Toten nicht weiter erstaunt über den Umstand reagiert, dass Nathalie Suchtmittel ausprobiert hatte, sehr wohl aber darüber, dass sie niemandem davon erzählt hatte. Das passte so gar nicht zu ihr. Vermutlich war sie erst kurz vor ihrem Tod an das Kokain geraten und hatte so überhaupt keine Zeit mehr gehabt, jemanden über ihren neuerworbenen Besitz zu informieren. Auch in diesem Punkt stimmte der Fall mit Andreas erster Toten überein. Genauso wie Nathalie war auch jene Frau vorher nie mit Drogen in Verbindung gebracht worden. Bisher deutete alles darauf hin, dass die beiden rein zufällig an den Stoff gekommen waren.
Mit Sicherheit hatte der Dealer noch andere Kunden, die aber bisher nicht aufgefallen waren, da sie kein Interesse an der Publikmachung ihres Verbrauchs der verbotenen Substanz hatten. Gefährlich war in diesem speziellen Fall, dass das Kokain einen ungewöhnlich hohen Reinheitsgehalt aufwies. Und gerade für Konsumenten, die nie vorher Drogen versucht hatten oder sonst an gestreckte Ware gewöhnt waren, konnte die Einnahme tödlich enden. Die jungen Frauen hatten insofern Pech gehabt, dass sie ihre Krankheit eine so unverdünnte Art von Koks nicht überleben ließ.
»Guten Tag, Herr Keller. Bernardi mein Name, bitte folgen Sie mir.« Andrea drückte die weiche Hand eines attraktiven Businessmannes. Dunkle, kurze Haare, blaue Augen, stattliche Größe. Er ging dem gut gekleideten Enddreißiger voraus ins Einvernahmezimmer, dessen karge Einrichtung nicht zu Fantasiegeschichten einlud; ein Pult mit dem Computer, ein Telefon, der Schreibblock und ein Bleistift, zwei Plastikstühle, ein Abfalleimer und an der Wand ein Kalender. »Bitte nehmen Sie Platz. Zuerst möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Aussage verweigern können. Alles, was Sie hier erzählen, kann als Beweismittel verwendet werden, und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, einen Anwalt zu kontaktieren. Haben Sie das verstanden?«
»Ja, ich spreche deutsch, wenn Sie das meinen.«
»Haben Sie eine Ahnung, warum Sie hier sind?«
»Nein. Und um ehrlich zu sein, finde ich es eine ziemliche Frechheit, mich um diese Zeit hierher zu bestellen. Können Sie sich nicht vorstellen, dass ich arbeiten muss? Und was soll das mit dem Anwalt? Worum geht es hier eigentlich?« Keller hatte sich bereits ziemlich in Rage geredet. Zwar wollte er den arroganten Geschäftsmann vortäuschen, der er vermutlich unter anderen Umständen auch war, aber Andrea spürte genau, wie nervös er war. Seine Taktik, Angriff als beste Verteidigung, würde hier nicht aufgehen.
»Doch, kann ich mir durchaus, da geht es Ihnen nämlich wie mir. Leider haben wir es mit dem ungewöhnlichen Todesfall Ihrer Freundin Nathalie Baumann zu tun, und ich nehme an, dem geben auch Sie Priorität?« Andrea wartete ab. Er wollte sehen, wie Keller auf die Freundin, die er ihm angedichtet hatte, reagieren würde. Bereits viel kleinlauter, antwortete dieser denn auch: »Sie ist nicht meine Freundin.«
»Wie kommt es dann, dass man Sie in der Todesnacht zusammen aus dem ›Pelikan‹ kommen sah?« Keller lockerte den Knoten seiner Krawatte, die ersten Schweißtropfen standen ihm auf der Stirne. »Wir haben uns gut unterhalten und sind einfach zufällig zur gleichen Zeit herausgegangen, um nach Hause zu gehen.«
»Wann genau war das?«
»Keine Ahnung, vielleicht kurz nach 24 Uhr.«
»Zu wem nach Hause gingen Sie?« Andrea stellte seine Fragen rasch, er wollte Keller keine Zeit zum Nachdenken geben.
»Jeder zu sich natürlich!« Wieder schien die Entrüstung gespielt zu sein.
»Ach ja? Dann schildern Sie mir doch bitte ganz genau, was sich zwischen 21.30 Uhr und 4.00 Uhr in der Nacht vom 19. auf den 20. September zugetragen hat.«
»Muss ich das?«
»Nein, Sie müssen nicht. Sie dürfen die Aussage verweigern. Ob Sie sich damit allerdings einen Gefallen tun, ist sehr zweifelhaft.« Andrea schaute ihn aus ausdruckslosen Augen an. Nach kurzem Überlegen und Abwägen kam Keller zu dem Schluss, dass es vermutlich besser war, mit offeneren Karten zu spielen. Er zog sein Jackett aus und fuhr eine Stufe zerknirschter fort: »Also gut, das war so: Ich hatte mich mit zwei Arbeitskollegen verabredet und wir waren zusammen essen. Der eine ging bald nach Hause, mit dem anderen wollte ich noch auf einen Drink ins ›Pelikan‹. Und wie es sich so ergab, stand da plötzlich diese Frau neben mir. Sie war ebenfalls mit einer Kollegin da, und während sich Dirk mit der anderen unterhielt, kam ich mit Nathalie ins Gespräch.«
»Wollen Sie mir sagen, Sie hätten sich noch nie vorher gesehen?«
»Ja, ich kannte sie nicht.«
»Und Ihr Freund Dirk?«
»Soweit ich weiß, kannte er auch keine der beiden vorher.«
»Und wie ging’s dann weiter?«
»Nun, Dirk musste nach Hause, er hat Frau und Kinder. Als ich einmal von der Toilette zurückkam, war Nathalies Kollegin ebenfalls verschwunden. Wir tranken noch einen Schlummertrunk und gingen danach, wie gesagt, nach Hause.«
»Sie haben sich vor der Türe verabschiedet?«
»Ja.«
»Man hat Sie gemeinsam in Ihr Auto steigen sehen.«
»Ach, du Scheiße. Also gut, ich fand sie geil und wollte sie mit nach Hause nehmen. Aber sie wollte nicht.«
»Was heißt das? Wie ging’s dann weiter?«
»Nun, ich brachte sie zuerst zu sich nach Hause und fuhr dann ebenfalls heim.«
»Herr Keller. Und jetzt mal die Wahrheit. Jemand hat ausgesagt, dass er Ihr Auto auf der Allmend parkiert gesehen habe.«
»Kann man denn in dieser verdammten Stadt überhaupt nichts tun, ohne dabei beobachtet zu werden? Fuck! Okay. Nathalie hatte diese verrückte Idee. Sie schlug vor, noch ein bisschen spazieren zu gehen, es sei so eine laue Nacht.«