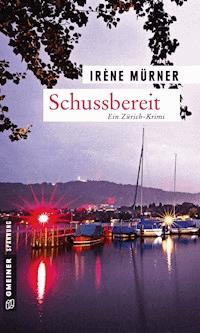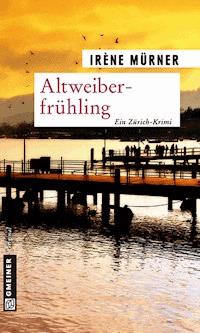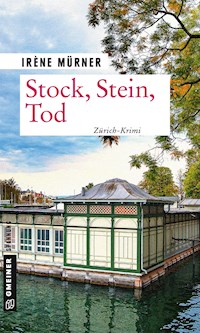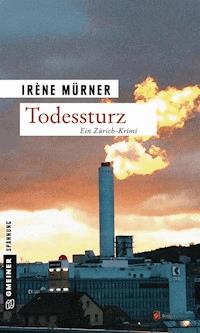Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Andrea Bernardi
- Sprache: Deutsch
Andrea Bernardi, Detektiv bei der Stadtpolizei Zürich, wird zum Selbstmordversuch eines jungen Mädchens gerufen. Was hat die 16-jährige Lara zu dieser Verzweiflungstat getrieben? Ihre Eltern sind wohlhabend, sie hat einen kleinen Bruder und besucht das Gymnasium. Doch der Schein trügt. Der Vater will die Familie verlassen, der Bruder leidet an einer mysteriösen Krankheit und die Mutter versucht mit aller Macht, die Kontrolle zu behalten. Welches schreckliche Familiendrama verbirgt sich hinter der tadellosen Fassade?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irène Mürner
Lügen am Zürichberg
Andrea Bernardis sechster Fall
Zum Buch
Mutterliebe Andrea Bernardi, Detektiv bei der Stadtpolizei Zürich, wird zum Selbstmordversuch eines jungen Mädchens gerufen, das von einem Hochhaus springen will. Die Polizei kann sie in letzter Minute davon abhalten. Was aber hat das Mädchen zu dieser Verzweiflungstat bewogen? Lara kommt aus einem vermeintlich perfekten Daheim. Ihre Eltern sind sehr wohlhabend, sie lebt in einem Haus am Zürichberg, hat einen kleinen Bruder und besucht das Gymnasium. Aber offensichtlich trügt der Schein. Bernardi erkennt rasch, dass es sich bei diesem Drama nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Der Vater will die Familie verlassen und in die USA auswandern, der Bruder leidet an einer mysteriösen Krankheit und die Mutter versucht mit aller Macht, die Kontrolle zu behalten. Welches furchtbare Geheimnis verbirgt sich hinter der tadellosen Fassade? Andrea muss tief in menschliche Abgründe blicken, wobei das Unfassbare plötzlich ein Gesicht kriegt.
Irène Mürner, geboren und aufgewachsen in St. Gallen, ist begeisterte Weltenbummlerin, ehemalige Lehrerin, Flugbegleiterin und Stadtzürcher Polizistin. Als Kolumnistin hat sie unter anderem die Freuden und Leiden der Polizistenseele durchleuchtet. Nach knapp eineinhalb Jahrzehnten Zürich und fünf Jahren Nairobi lebt sie jetzt im Berner Oberland am Thunersee. Mürner ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Stock, Stein, Tod (2019)
Todessturz (2017)
Schussbereit (2016)
Altweiberfrühling (2014)
Herzversagen (2013)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Roland zh
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolderbahn_IMG_4181.JPG
ISBN 978-3-8392-6284-9
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog Freitag
Sie schlug die Augen auf. Es war dunkel, aber da war ein Geräusch. Yanik? Nein. Die Vögel. Sie flatterten und kreischten. Warum so früh? Noch war der Sonnenaufgang weit entfernt. Etwas musste sie aufgeweckt und erschreckt haben. Angestrengt horchte sie in die Finsternis. Hellwach jetzt. Ja, da war noch etwas anderes. Ein leises, aber stetiges Surren. Ganz nah. Was war das? Die verdammten Vögel veranstalteten einen solchen Krach, dass es unmöglich war, etwas Genaues zu hören. In letzter Zeit hatte sie öfters daran gedacht, die Wellensittiche in die Freiheit zu entlassen. Beim Füttern könnte sie ganz einfach die Käfigtüre »vergessen« zu schließen, worauf die Tiere durch ein offenes Fenster davonschössen. In die Freiheit. Und den sicheren Tod. Für die kleinen Australier waren die Temperaturen hier viel zu tief. Und wenn die Kälte sie nicht tötete, dann die einheimischen Vögel oder der Hunger. Warum hatte sie es nicht getan? Mit offenen Augen starrte sie ins Nichts und versuchte durch das Gekreisch, dieses andere Geräusch zu lokalisieren. Kam es von der Haustür? Ja! Schlagartig beschleunigte ihr Puls. Was ging hier vor sich? An ihrer Haustür? Sie spürte ihren Herzschlag bis in den Hals. So stark, dass es sich anfühlte, als käme er aus der Bettdecke. Panik ließ sie bewegungslos daliegen. Holz ächzte und stöhnte. Völlig fixiert, lauschte sie dem mysteriösen Knarren. Gott, was war hier los? Einbrecher? Räuber? Sie wollte um Hilfe schreien, brachte aber keinen Ton heraus.
Da, ein jähes, leichtes Schnappen, das Schloss musste aufgesprungen sein und machte den Weg frei für eine hereinrollende Lawine. Schwere Stiefel polterten übers Parkett. Schritte, plötzlich scheinbar überall in ihren eigenen vier Wänden. Noch immer konnte sie keinen Finger rühren, lag wie gelähmt. Die Flut kam näher, gleich würde sie sie erreicht haben. Die Schlafzimmertür ging auf. Ein Lichtstrahl traf sie mitten ins Gesicht. Bevor sie geblendet die Augen schloss, sah sie eine dunkle Gestalt. Jemand riss ihr die Decke weg. Sie versuchte zu blinzeln und blickte direkt in den Lauf einer Waffe.
Eine Woche zuvor Samstag
1.
Irgendwie taten ihm die Verwandten leid. Es war nicht schön, mit ansehen zu müssen, wie die Mutter und Ehefrau wie ein schwerer Sack in den Sarg gehievt wurde. Schon der Untersuch durch den Mediziner war für Ungewohnte ein heftiger Anblick. Ein Stück Fleisch, das gedreht, gedrückt, gemessen wurde. Ein Toter war so anders als ein Kranker. Der Körper schlaff und völlig spannungslos, ein Kloß, bestehend aus Fett, Gewebe und Knochen. Und dann war da auch noch er, der Polizist, der herumtrampelte und kontrollierte, ob alle nötigen Papiere vorhanden waren und alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen war. Er konnte sich nur halbwegs vorstellen, was für ein Schock das Eindringen der Offiziellen in diese kleine Sterbestube für die Anwesenden sein musste. Sie hatten die Patientin in aller Ruhe begleitet, hoffentlich gebührend Abschied nehmen können und dann, kaum hatte sie die Augen für immer geschlossen, war es aus mit dem Frieden. Rechtsmedizin, Polizei, Staatsanwaltschaft, Leichenbestatter, sie alle machten ihren Job mehr oder weniger feinfühlig. Er hoffte, die Angestellten der Dignitas hatten ihre Klientel nicht nur auf das Sterben, sondern auch auf die nachfolgende Situation vorbereitet. Immerhin blieben ihnen die Uniformen erspart, er war als einziger Polizist anwesend und in Zivil. Auf eine Untersuchung und die Kontrolle der Arbeit der Sterbehilfeorganisation konnte aber nicht verzichtet werden. Eine suizidwillige Person musste die tödliche Substanz selbstständig, vor mindestens zwei Zeugen und ohne Fremdeinwirkung einnehmen.
Generell wählten mehr Frauen als Männer diesen assistierten Selbstmord und über vierzig Prozent litten an Krebs, so war es offenbar auch bei dieser Frau gewesen. Zum Glück waren die Sterbebegleiter Profis und hatten alle Formulare für ihn bereitgelegt. Das war nicht sein erster AgT, außergewöhnlicher Todesfall, in der von der Sterbehilfe gemieteten Wohnung und er wusste genau, was zu tun war. So war seine Arbeit schnell erledigt und er schaute zu, dass er so rasch wie möglich wieder verschwinden konnte.
Als er die aufgewühlte Situation mit den nötigen Papieren verließ, um zurück auf den Posten zu kommen und den Rest des Nachtdienstes hinter sich zu bringen, hatte es zu regnen begonnen. Der Asphalt glänzte nass und widerspiegelte die Lichter der Autos auf der Straße.
Im Detektivbüro herrschte trügerische Ruhe. Hans, der Nachtdienstpostenchef, war an Leuten bereits ausgeschossen, offenbar war der Teufel los auf der Gasse. Kaum hatte Andrea seinen Journaleintrag fertig geschrieben und wollte mit dem C-Rapport beginnen, wurde auch er gerufen.
»Spinnen mal wieder alle.« Zur Bekräftigung seiner Worte wedelte Hans mit der Hand vor der Stirn. »Ende Monat, jeder hat seinen Lohn in der Tasche, dazu haben wir Vollmond und auch noch Wochenende. Heirassa, kannst dich auf eine gelungene Nacht einstellen.« Er zog ein missmutiges Gesicht und fuhr dann weiter: »Ein junges Mädchen will an der Gasometerstraße vom Dach springen. Das Spezial ist bereits vor Ort, ebenso Limmat 5. Aber es wird wohl an dir hängenbleiben.«
»Okay. Bin schon unterwegs.« Andrea meldete sich am Computer ab, packte den Ausdruck, den ihm der Chef freundlicherweise vorbereitet hatte, und trat erneut in die aufgeladene Dunkelheit.
Mittlerweile regnete es Bindfäden. Scheiße. Ein Schirm wäre ganz praktisch gewesen. Obwohl er so schnell wie möglich zum Auto rannte, war er klitschnass, bevor er von innen die Wagentür zuschlagen konnte. Er spürte, wie ihm das Wasser aus den Haaren Hals und Rücken hinunterrann, während er den Motor und die Scheibenwischer einstellte. Quietschend zogen sie ihre Halbkreise über das Glas, kamen aber kaum nach, so dass er eine Stufe höher stellte, und sie jetzt nervös hin- und herhasteten. Trotz des garstigen Wetters waren die Leute gruppenweise unterwegs. Es musste tatsächlich viel Energie in der Luft liegen, dass man auf einen gemütlichen Abend daheim verzichtete und sich stattdessen dermaßen verschiffen ließ. Hieß es nicht für gewöhnlich, Regen sei der beste Polizist? Offensichtlich nicht heute. An die Gasometerstraße war’s nicht weit, aber Verkehr und Ausgänger verhinderten, dass er rasch vorwärtskam. Als er endlich am Ziel eintraf, waren bereits zwei Streifenwagen sowie die Feuerwehr vor Ort. Mehrere Polizisten stiefelten mit ihren dunkelblauen Cowboyhüten herum. Bei aller Lächerlichkeit hielten sie wenigstens den Kopf trocken. Andrea schüttelte diverse Hände und bekam die nötigen Informationen. Marc Gerber, Grenadier und Mitglied der stadtpolizeilichen Verhandlungsgruppe, hatte die Erstsprecherfunktion übernommen. Er schien seine Sache ganz gut zu machen. Jedenfalls konnten sie das Mädchen von der Straße aus nicht mehr sehen und die erste unmittelbare Gefahr war somit gebannt. Für die Feuerwehr stellte das allerdings insofern ein Problem dar, dass sie nun nicht mehr wussten, wo sie ihr Sprungkissen aufstellen sollten. Der Generator benötigte mindestens dreißig Sekunden, bis er es aufgeblasen hatte, so ganz spontan war das Luftkissen nicht platzierbar. Nun konnten sie nur hoffen, dass der Kollege auf dem Dach reüssierte und das Mädchen zum Herunterkommen überreden konnte.
*
Sie betrachtete ihren schlafenden Sohn. In der Nachttischlampe drehten kleine farbige Fische ihre immer wiederkehrenden Runden um die Glühbirne. Das gedämpfte Licht warf unruhige Schatten auf das Gesicht des Dreijährigen. Die Kinderbettstäbe tanzten über Bettdecke und Kind. Wie friedlich er dalag. Kein Mensch käme auf die Idee, er könnte krank sein. Die runden Wangen und der kleine Mund waren völlig entspannt. Unter seiner kleinen Patschhand lag der braune Stoffbär. Leise verklangen die letzten Töne der Spieldose. »Weißt du, wie viel Sternlein stehen …« Sie summte die Melodie zu Ende.
Stille breitete sich aus und sie hörte nur noch Yaniks Atmen. Sie hatte alles unter Kontrolle. Die Nacht würde ruhig verlaufen.
Sie hatten einen schönen Tag im Zoo gehabt. Sie ging oft in den Tiergarten, konnte ihn von zu Hause aus bequem zu Fuß erreichen und da Yanik, obwohl schon drei, sich noch immer unsicher bewegte, war sie ohnehin gezwungen, den Kinderwagen stets dabeizuhaben. Im Zoo fühlte sie sich unter all den anderen Besuchern ungestört und unbeobachtet. Sie konnten stundenlang den interessant angelegten Wegen folgen, zwischendurch auch eine Weile auf einem der Spielplätze haltmachen oder Vier- und Zweibeiner studieren, solange sie wollte, und das praktisch, ohne dass sie je ein bekanntes Gesicht entdeckte. Die Kinder bekamen frische Luft und Bewegung und vielleicht schnappten sie nebenbei noch etwas Wissen auf. Lara war heute mit ihrem Vater unterwegs. So hatte sie ihren Jüngsten ganz für sich und konnte ihm all ihre Aufmerksamkeit schenken, was sonst schwierig war. Zwei Kindern in so verschiedenen Lebensphasen gerecht zu werden, war bisweilen fast unmöglich.
Es war kalt und hatte immer wieder geregnet, der Besuch im Zoo war daher einmal mehr eine gute Entscheidung gewesen. Sie hatten lange im Exotarium verweilt. Yanik liebte das Südamerika-Haus. Vor allem die bunten Fische. Filigrane Putzergarnelen, Pinzettenfische oder Schwimmwühle. Seepferdchen. Piranhas. Der Aal war ihm unheimlich, das konnte sie schnell erkennen. Vielleicht, weil er so groß war? Oder eher, weil er in einem sehr dunklen Aquarium schwamm und nichts von der Leichtigkeit eines Clownfischs hatte? Und ja, natürlich mochte er auch die Pinguine. Mit dem Lift waren sie in den 1. Stock gefahren, wo Schlangen, Echsen und Spinnen daheim waren, und ganz zum Schluss hatten sie die Froschausstellung im Obergeschoss besucht. Die kleinen giftigen, aber äußerst bunten und schönen Kreaturen faszinierten sie. Yanik mochte vor allem den neuen Ausstellungskasten mit Geräuschkulisse, die den Dreijährigen zu beruhigen schien. Sie hatte ihn da geparkt und er lauschte dem Ruf der Erdkröten, der an Wildgänse erinnerte, oder der Kreuzkröte, der sie selbst an Zikaden denken ließ. Sollte er sich beim Bellen des Moorfroschs, dem Zirpen des Laubfroschs, dem Knarren der Knoblauchkröte, dem Heulen der Gelbbauchunke oder Pfeifen der Geburtshelferkröte neben irgendeinem sumpfigen See an einem lauschigen Sommerabend wähnen. Sie hatte derweil interessiert und fasziniert über die Gefährlichkeit der Amphibien gelesen. Das Gift eines einzigen Goldenen Pfeilgiftfrosches konnte 20.000 Mäuse töten. Das musste man sich einmal vorstellen. 20.000 Mäuse! Froschsekrete wirkten offenbar aber auch positiv, eigneten sich zur Senkung des Bluthochdrucks oder als Blutverdünner. Außerdem waren sie antibakteriell und hatten eine schmerzstillende Wirkung.
Für Medizinisches konnte sie sich immer wieder begeistern.
Yanik war allerdings bald ungeduldig geworden, und sie hatte den Wagen weiterschieben müssen, noch bevor sie alle relevanten Informationen hatte lesen können. Ein Halt bei den Springtamarinen hatte ihren Sohn wieder für eine Weile beschäftigt. Die kleinen schwarzen Äffchen waren neugierig auf den Sims im Käfiginnern direkt vor sie hin geklettert. Nervös und zittrig hatten sie ihnen ängstliche Blicke zugeworfen. Eines hatte schließlich auch noch seinen mit einem gefährlich aussehenden Gebiss ausgestatteten Mund aufgerissen und gellend hohe, spitze Schreie ausgestoßen. Die allerdings durch die dicke Scheibe praktisch unhörbar blieben, was sie aber nicht minder unheimlich machte. Jedenfalls hatte Yanik mit vor Schreck geweiteten Augen zurückgestarrt, und es war offensichtlich, dass er sich vor den kleinen Kobolden mit den langen Krallen gruselte.
Die exotischen Pflanzen erinnerten an den Regenwald, und unwillkürlich hatte sie an ihren eigenen Aufenthalt in Südamerika denken müssen. Vor vielen Jahren war sie in Bolivien und Peru gewesen. Monate mit Höhen und Tiefen. Sie war in der Ausbildung zur Lehrerin gewesen und hatte in ihrem Zwischenjahr ihr Sozialpraktikum in einem Kinderheim in La Paz absolviert. Nachmittags hatte sie jeweils zusätzlich für ein paar Stunden das Colegio besucht, um Spanisch zu lernen. Es war eine entscheidende und in gewissem Sinn auch wegweisende Zeit für ihr Leben gewesen. Damals hatte sie Philippe kennengelernt.
*
»Dammi, die sollen mal vorwärtsmachen. Langsam wird’s ungemütlich hier.« Stump schlug seine Arme um den Körper. Andrea betrachtete den nörgelnden Kollegen. Tja, kein Wunder, dass er fror, ohne Jacke und nur mit dem Rollkragenpullover bekleidet. Allerdings war auch ihm kalt, die Temperatur war empfindlich gesunken. Bereits mischten sich erste Schneeflocken unter die Regentropfen. Hörte dieser verdammte Winter denn niemals auf?
»Entweder soll sie jetzt springen oder endlich runterkommen.«
»Wie lange steht ihr schon hier?«
»Mindestens eine Stunde.«
»Wenn sie sich wenigstens eine andere Gegend für ihren Abschied ausgesucht hätte.« Damit hatte Tanja, Stumps Kollegin aus der Regionalwache Industrie, recht. Sie befanden sich mitten im Ausgehbezirk und es war unmöglich, unbeobachtet zu agieren. »Ich geh dann mal rein.« Mit diesen Worten bewegte sie sich in Richtung Haus. Kaum war sie außer Hörweite, erklang in Andreas Rücken eine neue, ihm aber wohlbekannte Stimme: »Mann, die ist ja fett geworden. Schwingt mindestens eine Vierzimmerwohnung. Die war doch mal heiß.« Gysin schüttelte angewidert den Kopf und wandte sich dann an Andrea: »Na, Bernardi, alles klar, du Superstar?«
Gysin, dieses Arschloch. Andrea hatte mit dem großgewachsenen Uniformierten die Polizeischule besucht und leiden hatten sie sich da schon nicht können. Was Tanja betraf, hatte Gysin allerdings nicht unrecht. Auch Andrea hatte mit Enttäuschung den gewaltigen Hintern diagnostiziert, den die Kollegin gegenwärtig mit sich trug. Freilich war sie nicht die Einzige, die im Verlaufe der Jahre bei der Polizei auseinandergegangen war. Viele Kollegen legten an Gewicht zu und füllten mit den Jahren immer größer werdende Dienstbekleidungen aus. Schuld daran war vermutlich der ungesunde Lebenswandel. Der regelmäßige Nachtdienst verursachte einen energiezehrenden Schlafmangel, den man mit einem Zuviel an Naschereien wieder wettzumachen versuchte. Ihm ging es ja ganz ähnlich, wenn er müde war, kämpfte er ständig gegen diese Lust aufs Essen.
»Gysin, gibt’s dich auch noch.«
»Ja. Und im Gegensatz zu dir stecke ich noch immer in der Uniform. Du bist ja schon seit Jahren Deckel… bravo.« Der Sarkasmus in seiner Stimme war nicht zu überhören. Dennoch trat Andrea nicht darauf ein, sondern fragte stellvertretend: »Alles im Griff hier?«
»Was denn sonst.« Als wollte er den Polizisten Lügen strafen, torkelte in diesem Moment ein Betrunkener laut grölend um die Ecke. In einem Sprachgemisch und mit stark englisch gefärbtem Akzent wandte er sich an die Uniformierten: »I need some help. Die haben mich aus dem Club geworfen, aber ich will da wieder rein!«
»Fuck, der schon wieder. Den haben wir doch schon vor einer halben Stunde aus einem Club holen müssen und weggeschickt. Macht heute nichts als Probleme.« Gysin ging dem Dunkelhäutigen ein paar Schritte entgegen und sagte: »Ja, die Geschichte kennen wir schon. Ich denke, Sie sollten jetzt nach Hause gehen.«
»No! I wanna go back, ich will tanzen!« Der Afrikaner versuchte, einige Moves auszuführen, was ihm allerdings nicht gelang, stattdessen landete er auf dem Boden. »Shit. Man.« Langsam kam er auf die Knie und streckte dem Polizisten hilfesuchend seine Hand hin. Gysin ignorierte sie geübt und wiederholte seine Aufforderung: »Geh heim. Für dich ist hier Schluss.« Inzwischen war der Mann auch ohne fremde Hilfe auf die Beine zurückgekommen, ließ sich aber nicht so rasch abwimmeln. »No. Kommt überhaupt nicht infrage.« Mit diesen Worten versuchte er, die Tür des Streifenwagens zu öffnen. Was er damit bezweckte, war nicht ganz klar. Erhoffte er sich eine Taxifahrt? Die Absicht allein genügte, um Gysin etwas bestimmter auftreten zu lassen. »Hör zu, wenn du jetzt nicht verschwindest, müssen wir dich einpacken. Verstanden?« Der Schwarze schaute ihn verständnislos an und sagte: »I just wanna dance. Darf man hier denn nicht einmal mehr das?«
»Nein. Du nicht.« Gysin packte ihn am Jackenkragen, drehte ihn von sich weg und gab ihm einen Schubs.
»Hey, fuck you! That’s just because I’m black! Rassistisches Nazischwein!« Erstaunlich, dass er die letzten Ausdrücke auf Deutsch kannte, weniger überraschend hingegen, dass er die Rassismuskarte zog. Der Mann begann zu brüllen und spannte seine Muskeln, im Wissen, dass sich die Passanten in der Umgebung sofort mit ihm solidarisieren würden. Aus den Augenwinkeln sah Andrea, wie die Vorbeigehenden stehen blieben und zu ihnen herüberstarrten. Er meinte Bemerkungen wie: »Ist ja klar, die Bullen haben sich wieder einen Dunkelhäutigen ausgesucht.« – »Rechtsradikales Pack.« – »Typisch Schmier« und Ähnliches herauszuhören. Bereits zückten die Ersten ihre Handys und begannen zu filmen und zu fotografieren. Gysin, mit seinem Klienten sehr unglücklich exponiert, ließ sich nicht provozieren. Als Streifenpolizist im Kreis 5 war er solche Anfeindungen gewöhnt. Ungerührt meinte er nur: »Da sind sie ja wieder, die Schmeißfliegen, die von der Scheiße angezogen werden.« Andrea versuchte, sich schützend vor ihn zu stellen, und bestellte über Funk vorsorglich Verstärkung. Er wusste nur zu gut, dass die Stimmung oft innert Kürze kippen konnte und rasch Flaschen oder Steine geflogen kamen. Bevor sich ganze Menschentrauben bildeten, ging er mit zwei Kollegen vom Spezial zu den Passanten rüber und forderte sie zum Verlassen des Schauplatzes auf: »Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.«
»Ja, natürlich wollt ihr keine Zeugen, wenn ihr Schwarze ungerecht behandelt.«
»Bitte.«
»Nein, wir sind freie Bürger und wir dürfen uns aufhalten, wo wir wollen.«
»Das ist so nicht ganz richtig. Wenn wir Ihnen sagen, Sie sollen weggehen, dann müssen Sie das.«
»Aber ich bin ein unbescholtener Bürger und ich kenne meine Rechte.«
»Offenbar nicht.« Wie ihm diese naseweisen Hosenscheißer auf den Sack gingen. Von Tuten und Blasen hatten sie keine Ahnung, aber die Klappe aufreißen und der Polizei sagen, wie sie zu arbeiten hatte, das konnten sie.
»Hören Sie, Sie gehen jetzt weiter, und wir haben alle unseren Frieden.«
»Kommt doch überhaupt nicht infrage.«
»Dann muss ich Sie verzeigen wegen Nichtbefolgen einer polizeilichen Anweisung.«
»Was? Das ist ja wohl die Höhe. Die Bullen haben wieder das Gefühl, sie seien allmächtig. Ich lass mir von dir doch nicht vorschreiben, wann ich wohin zu gehen habe.«
»Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig.« Andrea zückte sein schwarzes Büchlein und das reichte immerhin, um den aufsässigen Kerl loszuwerden. Natürlich nicht, ohne dass er weiterhin auf die Scheißschmier geflucht hätte.
Andrea ging zurück und sah, wie inzwischen Unterstützung eingetroffen war. Zwei Wagen von der Soko mit je vier Mann standen bereit. Gut. Offenbar wollte man den betrunkenen Schwarzen zur Ausnüchterung mitnehmen und wartete nur noch auf den Kastenwagen. Er war arretiert worden und stand schimpfend und schreiend an einer Hauswand. Mit seinem Lärm hatte er bereits neue filmende Gaffer angelockt.
Nun wusste er wieder, warum ihm die Arbeit auf der Straße verleidet war, er hatte auf der Zunge, zu rufen: »Haut ab, macht jetzt die Fliege und lasst uns einfach unsere Arbeit tun«, aber er konnte sich beherrschen und hörte stattdessen, wie Gysin cool sagte: »Was ist, noch nie einen Rassisten gesehen? Geil, die Macht, die wir haben. Wenn dir dein Job zu langweilig ist, komm doch auch zu uns. Und ansonsten darf man verschwinden. Gehen Sie.« Wenigstens einige der Glotzer zogen sich beschämt zurück. Die meisten allerdings blieben stehen und ein besonders Mutiger rief: »Na, hör mal, wie redest du denn mit mir? Ich werde mich über dich beschweren. Das muss ich mir nicht bieten lassen! Und was hat der Herr überhaupt getan? Warum steht er in Handschellen?« Er kam näher und wollte sich zum Arretierten gesellen. Gysin ging dazwischen. »Ich hab gesagt, Sie sollen verschwinden. Und wenn ich Ihre Visage noch länger hier sehen muss, verzeige ich Sie wegen Hinderung einer Amtshandlung.«
»Wie kommst du dazu! Ich behindere gar niemanden. Du verhältst dich nicht richtig!«
»Wenn ich sage, Sie sollen hier weggehen, dann ist das kein Wunsch oder eine Bitte, sondern ein Befehl. Verstanden?«
»Das kommt doch überhaupt nicht infrage. Ich werde die Presse informieren. Wie heißt du noch mal?« Er beugte sich vor, um einen Blick auf Gysins Namensschild zu erhaschen.
Der machte es ihm einfach und sagte: »Gysin. Aber bitte mit Y.«
In diesem Moment raste der Kastenwagen mit quietschenden Reifen, Blaulicht und heulender Sirene um die Ecke.
»Na endlich, wurde aber auch Zeit.« Gysin packte den Gefesselten mit festem Griff am Ellbogen, der Schwarze stieß einen letzten Schrei des Aufbegehrens aus, bevor er unsanft in den Kawa gestoßen wurde. »Wir sehen uns.« Gysin winkte Andrea lässig zum Abschied, stieg zu seinem Kollegen ins Auto und folgte dem blauen VW in die Regionalwache City.
»Ja.« Leider. Auf diese Gegenwart konnte Andrea verzichten. Obwohl man Gysin durchaus einen gewissen Unterhaltungswert zugestehen konnte. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ruhig zu bleiben und polizeiliche Überlegenheit nicht auszunützen, obwohl man tagtäglich bis aufs Blut provoziert wurde, war schon höhere Schule.
Noch immer stand der gaffende Pöbel filmbereit da und hoffte auf eine Sensation.
»Kann mal jemand dem Gerber auf dem Dach sagen, er soll sich beeilen?«
Als hätte er auf diesen Satz gewartet, trat ein Uniformierter aus dem Hauseingang und winkte Andrea zu sich. Erleichtert trat er zu ihm und folgte ihm in den dunklen Hausflur. Es ging einen Moment, bis er das Mädchen verloren in einer Ecke stehen sah. Zusammen mit Tanja, der Polizistin. Marc Gerber entdeckte Andrea und kam auf ihn zu.
»Hi, Bernardi.«
»Hallo, Gerbi.«
Er drückte die kräftige Hand des Kollegen.
»Lara ist 16. Ich denke, das mit dem Selbstmord war nicht ganz ernst gemeint. Sie hat ein bisschen was getrunken. Ihr Vater will ihre Mutter verlassen, und mit der versteht sie sich nicht. Die Aktion auf dem Dach war wohl ein Hilferuf. In ihrer Not wusste sie keinen anderen Ausweg. Sie hat eingewilligt, mit dem Notfallpsychiater zu reden und anschließend für eine Weile in die Klinik zu gehen.«
»Okay. Gut gemacht.«
»Danke.«
Gemeinsam gingen sie zum Mädchen, das ihnen stumm entgegenblickte. Gerber stellte ihr Andrea vor. »Lara, das ist Herr Bernardi, er übernimmt deinen Fall. Er ist in Ordnung. Du kannst ihm vertrauen. Und vergiss nicht, was wir besprochen haben. Es geht immer weiter. Alles nur halb so schlimm. Mach’s gut.« Er drückte ihre Hand und blickte ihr ein letztes Mal aufmunternd in die Augen. Sie nickte nicht einmal. Gerber verabschiedete sich von Andrea, indem er ihm ebenfalls die Hand drückte und gleichzeitig auf die Schulter schlug. »Damit übergebe ich dir den Fall.« Andrea nickte zustimmend und wandte sich anschließend an das eingeschüchterte Mädchen. Er stellte sich noch einmal kurz vor und erklärte ihr das weitere Vorgehen. Sie werde jetzt in einem bereitstehenden Kastenwagen in die Regionalwache City gefahren und könne dort mit einem Psychiater reden. Die ersten Worte, die sie sagte, kamen leise, fast zögernd: »Müssen Sie meine Eltern informieren?« Nach einem Blick in sein Gesicht fuhr sie weiter: »Bitte rufen Sie meinen Vater an. Ich möchte nicht, dass meine Mutter etwas hiervon erfährt.« Sie schaute ihn flehend an. Er musterte sie aufmerksam, dann nickte er. »Klar. Wenn du das willst.« Es reichte, wenn erst einmal ein Elternteil Bescheid wusste. Sie wirkte eine Spur erleichtert.
»Meine Mutter ist schwierig. Und jemand muss sich um meinen Bruder kümmern.«
Mütter waren immer schwierig, das hatten die so an sich. »Also, dann wollen wir mal.« An niemand Bestimmtes gewandt, fragte er: »Hat das Haus auch einen Hinterausgang?« Jemand nickte und deutete noch weiter den Korridor entlang. »Gut. Gehen wir da raus.« Er schob das Mädchen vor sich her.
2.
Philippe war ihr schon in der ersten Pause in der Sprachschule in La Paz aufgefallen. Schien der einzige richtige Mann zu sein, zwischen all den Milchbubis, die sich sonst auf dem Gelände tummelten. Ja, Philippe hatte ihr imponiert, er war sechs Jahre älter als sie und damals schon sehr zielstrebig und ehrgeizig gewesen. Daheim verdiente er sich nebst dem Jusstudium einen ganz schönen Batzen in einer internationalen Firma mit Sitzen in Südamerika. Er hatte bereits das Cambrigde Advanced English Certificate in der Tasche und benutzte nun die Semesterferien, um sein Spanisch aufzubessern. Für drei Monate hatte er sich eine eigene kleine Wohnung mitten in der Stadt gemietet. Etwas, worum sie ihn glühend beneidete, kein Vergleich zu ihrer jämmerlichen Unterkunft im Kinderheim. Er hatte sich zu alt gefühlt, um bei einer einheimischen Familie als zusätzliches »Kind« ein und aus zu gehen. Dieses kleine Einzimmerapartment war zwar spartanisch eingerichtet gewesen, schlecht isoliert und wurde auch nie wirklich warm, dennoch war es ihr wie das Paradies erschienen, und sie war auf diese Insel geflüchtet, sooft es ihr möglich gewesen war. Auch sie hatte Philippe beeindruckt, vornehmlich wohl mit ihrem guten Aussehen. Jedenfalls waren sie rasch ein Paar geworden und nach dem Abschluss der Sprachschule und ihrer Arbeit im Kinderheim hatten sie sich dazu entschlossen, gemeinsam zu reisen. Genau genommen hatte sie sich Philippe ganz einfach angehängt. Er hatte vier Wochen, bevor es für ihn nach Brasilien weiterging, wo er zusätzlich Brasilianisch lernen wollte. Von Brasilien hatte man sich wirtschaftlich damals schon einiges versprochen, was sich ja in der Zwischenzeit bewahrheitet hatte. Und so hatten sie sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Peru und Bolivien im Eilzugstempo reingezogen. Waren von La Paz nach Oruro gefahren und von da mit der Bahn nach Uyuni. Der Salzsee war eindrücklich gewesen, stundenlang waren sie durch eine weiße Wüste von der Größe der Schweiz gefahren, und sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben eine Fata Morgana gesehen. Weiter ging’s mit dem Bus nach Potosì, wo sie die Minen im Cerro Rico besuchten. Philippe hatte sich darüber amüsiert, wie furchtbar ineffizient Edelmetall abgebaut wurde, in einem Berg, der längst völlig ausgehöhlt schien. Während ihr vor allem die Armut und der Aberglaube auffielen, konnte er sich über die Langsamkeit und fehlende Wirtschaftlichkeit aufregen. In Potosì mussten sie dem Schutzgott Kokablätter bringen, damit er ihnen wohlgesonnen war und den Arbeitern reiche Erzadern zeigte. Sie waren auch nach Sucre, der Hauptstadt Boliviens, gefahren. Der Ort hatte ihr gefallen, schneeweiß und gut erhalten. Aber sie konnten nicht lange bleiben, Philippe drängte weiter, und so flogen sie erneut nach La Paz, von wo sie nach Huatajata am Titicacasee reisten. Hier hatten sie die Farben beeindruckt. Die Luft war so rein und kalt und klar gewesen. Der Himmel strahlte in einem Dunkelblau, das ihr unwirklich erschien. Mit einem Schnellboot fuhren sie nach Copacabana. Dann ging es wieder mit dem Bus weiter bis nach Puno in Peru, wo sie die schwimmenden Inseln der Uros besuchten. Oh Gott. Diese Menschen hausten auf Schilfinseln mitten auf dem See und das sommers wie winters. Sie konnte und wollte sich nicht ausmalen, wie das Leben hier sein musste. Es war nicht die Kälte allein, die Welt war auch so schrecklich klein und wenig abwechslungsreich. Was musste man anspruchslos sein, wenn man auf diese Weise leben konnte. Etwas besser ging es den Menschen auf Taquile. Eine Insel, die sie an Griechenland denken ließ. Hier strickten die Männer und die Frauen durften nur flüstern. Auch nicht gerade das, was sie sich unter einem Paradies vorstellte. Von Juliaca fuhren sie in einer über zwölfstündigen Zugfahrt nach Cusco. Hier hatten sie dann endlich etwas Zeit gehabt, sich diverse Inka Ruinen angeschaut und waren natürlich auch nach Machu Picchu gelangt. Magisch war ihr das allerdings nicht erschienen, dafür hatte es viel zu viele andere Touristen und Ramschverkäufer auf dem Gelände gehabt. Cusco war schließlich auch das Ende ihrer Reise gewesen, aber nicht ihrer gemeinsamen Zeit. Während Philippe sich auf Brasilia freute, war sie allein nach Hause geflogen und hatte nach den Sommerferien wieder dankbar und brav selbst die Schulbank gedrückt. Dankbar dafür, in einem sicheren Land zu leben, sich nur um ihre Zensuren sorgen zu brauchen, Kleider in Hülle und Fülle zur Verfügung zu haben und vor allem, weder frieren noch Hunger haben zu müssen. Vielleicht hatten sie die Monate in Südamerika in erster Linie gelehrt, auf die Zähne zu beißen. Sie hatte gemerkt, dass sie nicht gleich starb, nur weil sie fror, Hunger hatte oder nicht auf eine saubere Toilette konnte. An die Kurzfristigkeiten, das Chaos und das Ineffiziente allerdings hatte sie sich nicht gewöhnen wollen. Sie hatte festgestellt, wie wichtig ihr Sicherheit, Sauberkeit, Kontrolle und Verlässlichkeit waren.
Als Philippe wieder in der Schweiz war, hatten sie quasi da weitergemacht, wo sie in Peru aufgehört hatten. Sie waren ein attraktives Paar. Gleich nach ihrer Ausbildung heirateten sie jung, und die erste Zeit war sehr schön gewesen. Was hatte sie es genossen mit ihrem begehrenswerten Ehemann. Er hatte sie verwöhnt und auf Händen getragen. Von Rucksacktourismus hatte er genug gehabt, seine Abenteuerferienlust war mit diesen Monaten in und durch Südamerika gestillt gewesen. Von jetzt an ließ er es sich gutgehen. Man logierte nur noch in den besten Hotels. Ob es nun in Dubai das Burj Al Arab oder auf Mauritius das Dinarobin war. Natürlich hatten sie auf den Malediven im Four Seasons gewohnt. Waren in Thailands Khao Lak im Sarojin ein und aus gegangen und auf Bali im Amanusa. Seychellen, Fiji, es gab kaum eine der paradiesischen Inselgruppen, weder in der Südsee noch im Indischen Ozean, die sie nicht besucht hatten. Philippe arbeitete viel, und alles, was er sich von einem Urlaub wünschte, war entspannen, sich um nichts kümmern zu müssen, Wärme und eine schöne Umgebung. Da kam ihm die asiatische Mentalität sehr entgegen. Die Bediensteten hatten stets ein Lächeln im Gesicht, verhielten sich unaufdringlich und unsichtbar, solange man nichts brauchte, aber sobald ein Wunsch erfüllt werden musste, tauchten sie wie aus dem Nichts auf. Alles war mit viel Liebe zum Detail angerichtet, sorgfältig und aufmerksam. Philippe schlief während dieser Tage sehr viel. Manchmal versuchte er, ein Buch zu lesen, was nach ein paar Seiten aber nur zum nächsten Schlummer führte. Nicht, dass er in den Ferien inaktiv gewesen wäre. Natürlich ging er tauchen und ins Fitness, aber das interessierte sie nicht. Sie fanden keine gemeinsamen Aktivitäten. Sobald er sich irgendwo hinlegte, sei es die Liege am Strand, am Pool oder sein Bett, nickte er sogleich ein und war oft kaum wieder wach zu kriegen. In der ersten Zeit hatte sie den Luxus genossen und sie war sich wichtig vorgekommen. Sie konnten sich alles leisten, wovon sie immer geträumt hatte. Aber mit der Zeit langweilte sie sich nur noch. Da lag sie auf diesen mit weichen Kissen belegten Holzliegen und bohrte ihre nackten Zehen links und rechts davon krampfhaft in den feinkörnigen Sand. Während ihre krebsrote Haut versuchte, unter einer schmierigen Schicht Sonnencreme zu atmen, blickte sie in das von Regen und Sonne ausgebleichte rosa Stoffdach, das der aufgespannte Sonnenschirm über ihr bildete. Nicht einmal das Herumbefehlen der Bediensteten machte mehr Spaß. Man gewöhnte sich an alles. Selbst an den schönsten Hochglanzferienprospekt. Sie fühlte sich eingeklemmt, ja, gefangen. Im Traum vom tiefblauen Meer, gefüllt mit süßen Mußestunden, feudalen kulinarischen Genüssen und vermeintlicher romantischer Zweisamkeit. Was hatte sie sich als Mädchen ausgemalt, wie schön es wäre, mit ihrem Traumprinzen am Strand in den roten Abendhimmel zu spazieren. Morgens in der prickelnden Meeresbrise gemeinsam zu joggen, später die wärmenden Sonnenstrahlen und das Dolcefarniente der Verwöhnten zu genießen. Ihr fast nackter Körper sollte sich im smaragdgrünen Pool auf der Luftmatratze aalen und ihren Begleiter anturnen. Abends wollte sie sich in einer vom Duft des Gebratenen geschwängerten Luft am mit fantasievollen Kreationen ausgestatteten Buffet laben. Und nachts unter einem samtenen, von Millionen glitzernder Sterne übersäten Himmelszelt den einen oder anderen Verehrer abblitzen lassen, um dann in brennender Leidenschaft Sex mit ihrem Ehemann zu haben und danach selig in seinen Armen den Schlaf der Erfüllten zu schlafen. Nichts davon war je eingetreten. Eine Schnarchwanze hatte sie geheiratet, einen Mann, der sie tödlich langweilte.
Aber wenigstens hatte er ihr Kinder geschenkt.
Plötzlich wurde sie wütend. Philippe war im Begriff, alles zu zerstören. Alles kaputt zu machen, was sie erarbeitet hatte. Erst wollte er sich von ihr trennen und nun ging er auch noch ins Ausland. Obwohl sie so tüchtig war und immer alles im Griff gehabt hatte. Hatte sie etwa nicht versucht, stets zu seiner Zufriedenheit zu handeln? War das jetzt der Dank für ihre Bemühungen?
Als Lara gehört hatte, dass Philippe nach Los Angeles ziehen würde, hatte sie natürlich mitgehen wollen. Aber das kam überhaupt nicht infrage. Und vermutlich lag es auch nur daran, dass im Kopf ihrer Tochter sofort Bilder dieser Beach-Apartments, in welchen Sam und Addison aus »Private Practice« wohnten, herumspukten. Zugegeben, die waren natürlich traumhaft, lagen mit ihren riesigen Terrassen direkt am Meer. Und offenbar hatten bei Philippe tatsächlich Unterlagen von Häusern in Long Beach und Malibu herumgelegen. Wen konnte es also wundern, dass der Teenager sich blenden ließ und von Baywatch Rettungsschwimmern, Schauspielern und anderen Illusionen zu träumen begann. Nein, Lara machte sie keinen Vorwurf. Aber dass Philippe ihr diese Fantastereien nicht austrieb, konnte sie nicht verstehen. Obwohl es sie eigentlich nicht zu wundern brauchte. Hatte er sich nicht immer davor gedrückt, sich bei seinen Kindern unbeliebt zu machen?
Ach was, im Grunde war sie doch besser dran ohne ihn. Sie brauchte keinen Mann. Sie hatte ohnehin keine Zeit für einen Partner und sie würde dafür sorgen, dass Philippe ihr genug zahlte, dass sie weiterhin ein sicheres und schönes Dasein führen konnten. War das Leben ohne Mann im Prinzip nicht sowieso viel einfacher? All die Energie und die Zeit, die er verschlang und die nun den Kindern zugutekämen.
Umsichtig zog sie die Decke über Yanik zurecht und stopfte sie an den Seiten fest, damit sich das Kind im Schlaf nicht gleich wieder freistrampelte. Der Stoffbär war unter seiner Hand hervorgerutscht. Sie legte ihn auf den weiß-blau gestreiften Deckenbezug. Bevor sie das Licht löschte und auf leichten Schritten lautlos das Zimmer verließ, warf sie einen letzten Blick auf das Köpfchen mit dem glatten blonden Haar. Die Tür ließ sie einen Spalt breit offen, sollte ihr Sohn weinen oder nach ihr rufen, musste sie ihn hören.
*