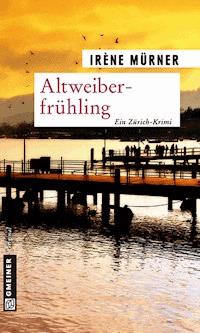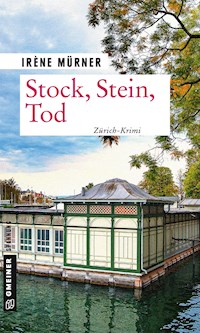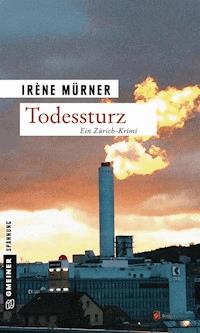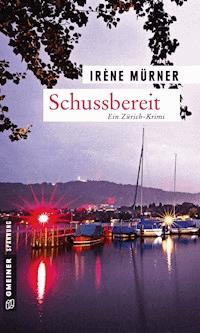
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Andrea Bernardi
- Sprache: Deutsch
Im Gymnasium Sihlberg in Zürich wird auf der Mädchentoilette eine alarmierende Botschaft gefunden. Eine Schülerin scheint so verzweifelt zu sein, dass sie an den verhassten Mitschülern und Lehrern Rache nehmen will. Sie hat den Amoklauf bis ins Detail geplant und ist fest entschlossen, möglichst viele ihrer Peiniger mit in den Tod zu nehmen. Polizeiermittler Andrea Bernardi bleibt nur eine Woche, die Katastrophe zu verhindern. Der Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Wird es ihm gelingen, rechtzeitig herauszufinden, wer hinter der tödlichen Drohung steckt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Irène Mürner
Schussbereit
Andrea Bernardis dritter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2016
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © portishead5 – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4912-3
Montag
1.
Sie waren da. Es hatte geklappt. Augenblicklich begann ihr Puls zu rasen. Das Herz schlug so schnell und heftig, dass das Pochen von außerhalb zu kommen schien. Der Mund fühlte sich trocken an, und ihr wurde übel. Oh Gott. Schüler hasteten vorbei. Rennende Füße. Schreien. Lachen. Begrüßungen. Türenschlagen. Sie stand einfach da. Wie gelähmt. Jemand rempelte sie von hinten an. »Ui, sorry.« Um sich aufzufangen, machte sie einen Schritt nach vorne. Weitergehen. Los. Die Befehle wirkten. Mechanisch stieg sie die Treppe hoch. Da war das Klassenzimmer. Sie betrat es, setzte sich an ihren Platz. Immer noch wie in Trance. Als wäre das eine andere Person, die hier funktionierte, als würde sie sich selber zuschauen. Ihre Hände waren nass von kaltem Schweiß. Angst. Einige der Mitschüler waren schon da. Niemand nahm sie wahr, machte auch nur die kleinste Bemerkung. Man ließ sie in Ruhe. Und sie war froh um diese Unsichtbarkeit. Langsam packte sie ihre Sachen aus. Legte sie ordentlich vor sich auf das Pult. Jedes an seinen Platz. Automatisch. In der rechten Ecke oben das Etui mit den Stiften. Direkt vor ihr der Notizblock, rechts davon ein gespitzter Bleistift. Links die Schulbücher. Das Zimmer füllte sich. Es wurde so laut, dass man die Schulklingel leicht überhörte. Plötzlich klatschte jemand in die Hände. »Meine Damen und Herren, bitte setzen Sie sich.« Sie hatte gar nicht bemerkt, dass der Lehrer im Raum anwesend war. Er musste noch einmal in die Hände klatschen. »Bitte, meine Damen und Herren.« Sie atmete tief durch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Allmählich begann sie, sich zu beruhigen. Sie war sicher. Es war alles wie gewöhnlich. Das Rauschen in den Ohren ließ nach. Puls und Herzschlag normalisierten sich. Die Stunde begann und nahm ihren Lauf. So normal, wie es eben möglich war in der ersten Lektion nach fünf Wochen Sommerferien.
Um 8.35 Uhr schrillte die Glocke. Wie auf Kommando begann das Stuhlrücken, Bücherzuschlagen, Reden, Lachen, Füßescharren. Niemand hörte den Lehrer, wie er noch vergeblich versuchte, die nächste Hausaufgabe bekannt zu geben. Resigniert schloss er seinen Mund, schrieb eine Seitenzahl mit weißer Kreide an die Wandtafel und deutete mit dem rechten Zeigefinger darauf. Damit hatte er etwas von einem unfreiwilligen Pantomimen. Sie packte ihre Sachen und verließ im Pulk einer Schülergruppe das Zimmer. Die lebhafte Präsenz der anderen verschluckte sie. In ihrem Lärmpegel ging sie so vollständig unter, als würde sie selbst keine Geräusche verursachen. Die homogene Masse bewegte sich den Korridor entlang. Wich einer entgegenkommenden Gruppe aus, zog sich in die Länge, kam an der Treppe wieder zusammen, wurde schließlich im Nadelöhr der Zimmertür zählbar klein und löste sich im Inneren des Raumes wieder in Individuen auf. Latein. Frau Habegger stand mit dem Rücken zur Wand und lächelte den Hereinströmenden tapfer zu. Kaum jemand lächelte oder grüßte zurück. Taschen wurden auf Tische gepfeffert, man schubste sich, packte wieder aus, fläzte sich auf seinen Sitz. Dieses Schulzimmer ging auf die andere Seite raus, nach Westen. Bevor sie sich setzte, fiel ihr Blick auf das beruhigende Grün der Ulme vor dem Fenster.
Irgendwann wurde es Mittag. Sie verzog sich an einen schattigen Platz im Park. Die Mädchen ihrer Klasse waren verschwunden. Sie würden sich in der nahe gelegen Migros etwas besorgen und dann gemeinsam verzehren. Sie war froh, allein zu sein. Mit einem flüchtig mitleidigen Blick bedachte sie die verlorenen Erstklässler, die mit fragenden Gesichtsausdrücken verunsichert herumirrten. Sie setzte sich auf den Rasen unter der Ulme, wo sie sich ungestört wähnte, und griff in den Rucksack. Dabei streifte ihre suchende Hand den Taugenichts, und sie zog das gelbe Reclambüchlein heraus. Als Nächstes fand sie die kleine, mit Wasser gefüllte Petflasche und danach die Lunchbox. Das Brot war trocken. Bedächtig zermalmte sie es und nahm zusätzlich einen Bissen Apfel in den Mund. Sie liebte diese Kombination, wenn das Brot begann, süßlich zu schmecken. Zwischendurch ein Schluck Wasser. Wieder ein Bissen Brot, dann der Apfel. Kauen. Schlucken. Beißen. Hatte sie wirklich jemanden gesehen heute Morgen? Oder hatte sie sich geirrt? Sie ließ ihren Blick über das Schulgelände schweifen. Alles schien wie immer zu sein. Essende, plaudernde Schülergruppen, hastende Lehrer. Niemand, der nicht hierhergehörte. Sollte sie sich alles nur eingebildet haben? Sie begann zu zweifeln. Hatten ihr ihre Augen und ihre Fantasie einen Streich gespielt? War das möglich?
Um Gewissheit zu erhalten, blieb ihr nichts anderes übrig, als auf der Toilette nachzuschauen.
Noch hatte sie etwas Zeit, bevor die Nachmittagslektionen begannen. Es war heiß draußen, und selbst im gut isolierten Schulhaus war es warm geworden. Wieder klopfte ihr Herz heftig, als sie auf der Toilette kontrollierte, was sie heute Morgen angenommen hatte. Also doch. Jemand hatte sich an der Zeichnung zu schaffen gemacht. Sie war verblasst, aber immer noch gut sichtbar. Das Schwarz des wasserfesten Filzstifts hatte sich zu tief in die weißen Fliesen eingefressen, als dass es einfach so weggeputzt hätte werden können. Alles war gut. Alles war so, wie sie es wollte. Dennoch kribbelte es in ihrem Magen unkontrolliert, und er zog sich unangenehm zusammen. Die Nervosität breitete sich in ihrem Körper aus und drohte, sie zu überwältigen.
Sie betrat das Schulzimmer. Jemand hatte vorsorglich die Sonnenstoren heruntergelassen. Sie dämpften das Licht im Raum. Es war trotzdem heiß.
Sie setzte sich auf ihren Stuhl, und die Nachmittagsstunden begannen, schlichen dahin. Lektion reihte sich an Lektion. Endlich 17.20 Uhr. Die Schulglocke schrillte heute zum letzten Mal. Es war vorbei. Sie hatte den ersten Schultag überstanden. Überlebt. Sie konnte nach Hause fahren.
In der Wohnung war es still. Und zu heiß. Wieder hatte ihr Vater vergessen, die Rollläden zu schließen. Die Sonne hatte den ganzen Vormittag bis in den Nachmittag hinein die Räume aufgeheizt. Nun hockte sie in Teppichen, Polstermöbeln, Stoffkissen und ließ sich nicht mehr vertreiben. Selbst wenn sie jetzt die Fenster öffnete, käme nur noch mehr Hitze von draußen rein. In diese 60er-Jahre-Blockwohnung mit Klinkerböden, Buchenparkett und braun gesprenkelten Spannteppichen. Außer ihnen wohnten im ganzen Haus nur alte Leute, die seit jeher hier lebten und nichts vertrugen. Immer musste sie ruhig und still sein. Sie schlichen durch die Zimmer und sprachen mit gedämpfter Stimme. Und wehe, wenn sie einmal die Musik ein paar Dezibel höher drehte. Sofort wurde reklamiert, rügend an den Boden oder an die Decke geklopft. Längst hatte sie sich Kopfhörer besorgt, um die Musik in ihrem Kopf dröhnen lassen zu können, so laut sie es wünschte.
Von draußen drang das rhythmische »Tschigetschigetschige« der Rasensprenger herein. Der Kühlschrank war, abgesehen von einer angebrochenen Tetrapackung Milch, einer krummen Käsescheibe und einem Stück ranzig gelber Butter, leer. Die letzte Schnitte Brot musste ihr Vater mitgenommen haben. Sie hatte ohnehin keinen Hunger. Beim Verlassen des Raums schien sie das überlaute Ticken der billigen Plastikuhr von der Wand herab zu verhöhnen. In ihrem Zimmer war es stockfinster. Sie brauchte einen Moment, bis sich die Augen von der sonnigen Helligkeit unvorbereitet an die Dunkelheit gewöhnten. Ihre Höhle. Sie trat hinein und drückte auf den Knopf der Stereoanlage. Dazu brauchte sie nichts zu sehen, hier fand sie sich mit verbundenen Augen zurecht. Das rote Stand-by-Lämpchen erlosch, stattdessen blinkte die Digitalanzeige auf und verbreitete ein eigentümlich unnatürlich grünes Licht. Sie stülpte sich die Kopfhörer über, warf sich aufs Bett und wartete. Dazu starrte sie ins Leere. Langsam begann das Lied. Sie war ganz alleine mit der Musik. Es gab nur noch die Dunkelheit, Reamonn und sie.
War richtig, was sie akribisch vorbereitet hatte? Worauf sie nun seit Monaten hinlebte? Würde der Plan aufgehen? Das Lied steigerte sich. Jetzt kam die Stimme. Sie kannte den Text auswendig. Die Worte über Freiheit, Ewigkeit, Zerrissenheit und Heimkommen.1
Sie passten ganz genau zu ihr und ihrem Leben.
Was für ein beschissenes Jahr sie gehabt hatte.
Sie war immer brav und angepasst gewesen. Und man hatte sie dementsprechend in Ruhe gelassen. Sie leben gelassen, wie ein lästiges Insekt, das zwar da war und das man jederzeit zertreten konnte, sollte es einen Mucks machen, das man aber duldete, solange es sich unsichtbar hielt.
Wieder lauschte sie eine Weile den Worten im Lied.
Es war richtig, was sie vorhatte. Sie wusste, was richtig und was falsch war. Keine Angst mehr. Keine Schmerzen. Und seit sie sich entschieden hatte, war es tatsächlich, als könnte sie heimgehen. Im Prinzip hatte sie sich schon lange nicht mehr mit dem Warum befasst. Seit Wochen ging es nur um Organisatorisches. Haarklein hatte sie alles geplant und wusste bis ins Detail, wie sie vorzugehen hatte.
Das Alleinsein hatte ihr nie viel ausgemacht. Sie kannte nichts anderes. Seit sie sich erinnern konnte, waren ihr Vater und ihr Großvater in der Backstube gewesen und ihre Mutter mit der Großmutter im Laden. Solange sie klein gewesen war, hatten die Eltern sie in der Bäckerei gehabt. Ihr einen kleinen Tisch in den hinteren Teil des Ladens gestellt, und da hatte sie gebastelt, gezeichnet, ihre Hausaufgaben erledigt. Und als sie größer geworden war, hatte sie ihren Schlüssel gehabt und sich alleine in der Wohnung aufgehalten. Das war in Ordnung gewesen. Und damit hätte sie auch hier klarkommen können. Selbstverständlich hätte sie gerne eine Freundin gehabt, aber solange man ihr ihren Frieden ließ, konnte sie auch ohne leben. Diejenigen, die behaupteten, Kinder gewöhnten sich überall schnell ein, logen. Es war extrem schwierig, in ein bestehendes Klassengefüge zu kommen, wo die Gruppenbildung abgeschlossen war und Freund- und Feindschaften bereits in Stein gemeißelt schienen. Sie passte zu keiner Peergroup. Weder war sie hipp und urban wie die »Szenis« noch wusste sie, wo sich die angesagten Plätze befanden und man sich mit den »richtigen« Leuten traf. Schon gar nicht anschließen konnte sie sich den »Bönzlis«, die alle so auffällig schön waren, ihre Garderobe zu jeder Saison und Gelegenheit passend hervorzauberten und außerordentlich reiche Eltern haben mussten. Aber sie passte nicht einmal zu den »Normalos«, die konservative Werte vertraten und ebenfalls aus gutem Hause stammten. Alle blieben sie gerne unter sich, trafen sich in ihren Klubs oder feierten ihre Home-Partys in den elterlichen Villen. Man hatte sie niemals dazugebeten. Nichtsdestotrotz war es so weit gut gegangen. Sie hatte sich eingewöhnt, kam in der Schule problemlos mit, und das Heimweh ließ sich unter Kontrolle halten. Bis die Klassen fürs dritte Jahr neu zusammengesetzt wurden. Sie hatte Typus B gewählt, Latein mit einer Fremdsprache. Sprachen hatten ihr immer gelegen, und sie lernte leicht.
Aber sie war vom Regen in die Traufe geraten.
Automatisch übersetzte sie Bruchstücke aus Raemonns Text: richtig, falsch, Angst. Niederlage. Krieg.
Sie hatten den Krieg gewollt. Dann sollten sie ihn haben. Sie hatte keine Angst mehr vor dem Kampf, im Gegenteil, sie griff danach, die Zeit der Vernichtung war gekommen.
Eigentlich war sie gar nie eine Konkurrenz gewesen. Zu den Barbies der neuen Klasse hatte sie nicht gepasst. Nicht zur Jeunesse dorée, der vergoldeten Jugend. Dafür hatte sie den falschen Namen, die falschen Eltern, die falsche Herkunft. Die Schwäne hatten ihr das Gefühl gegeben, für immer das hässliche Entlein zu bleiben. Dabei war sie eigentlich gar nicht hässlich. Sie hatte ein hübsches Gesicht und glänzendes Haar. Aber der Glamourfaktor fehlte ihr. Vielleicht hätte man sie aufgenommen, wenn sie sich etwas besser in Szene zu setzen gewusst hätte. Über ihre unscheinbare Kleidung und gewöhnliche Herkunft hinweggesehen. Aber sie war schüchtern und hatte auch körperlich den entwickelten Mitschülerinnen nichts entgegenzusetzen. Es war, als hätten die langen Winter im Prättigau nicht nur den pflanzlichen, sondern auch ihren ganz persönlichen Frühling hinausgezögert. Kam hinzu, dass sie fast ein Jahr jünger als die meisten ihrer Klasse war, da man sie früher eingeschult hatte. Sie konnte sich drehen und wenden vor dem Spiegel, wie sie wollte, kurviger wurde sie dadurch nicht. Das sah sie selber. Vorne konnte man ja noch was reinstopfen, aber das hatte sie aufgegeben, nachdem man sie gedemütigt hatte. Und auch die tröstenden Worte ihrer Mutter halfen nichts. Wie konnte sie sagen, sie solle es genießen, solange sie noch ihre mädchenhafte Figur habe, ihr Busen würde bald wachsen? Was wusste ihre Mutter denn schon! Von den Jungs, für die sie gar nicht vorhanden war. Von den Weibsbildern in ihrer Klasse, die bereits Schamhaare und mindestens kleine Brustknospen vorweisen konnten. Sie war immer dünn gewesen, aber jetzt wurde sie mager. Ja klar litt sie an einer Essstörung. Aber welches Mädchen nicht? Es gab drei Kategorien. Erstens diejenigen, die fraßen und kotzten. Zweitens diejenigen, die diszipliniert Buch führten über ihre Kalorienaufnahme und fanatisch Sport trieben, um zu viel eingenommene Energie wieder zu verbrennen, und drittens die, die überhaupt nicht schauten und fett waren. Sie mochte Sport grundsätzlich, war eine ausgezeichnete Läuferin und liebte das Schwimmen. Außerdem hatte sie nie an übermäßigem Appetit gelitten.
Das zweite Lied auf der CD: Supergirl2. Wie passend. Supergirl. Ha, genau. Sie lachte bitter auf. Für einen Moment hatte sie es selber geglaubt. Hatte sich eingebildet, sie sei Supergirl und könne fliegen. Was für ein unverzeihlicher Hochmut. Selbstverständlich konnte auch sie die Naturgesetze nicht überlisten. Und der Absturz war brutal gewesen. Alles hatte nach den Sommerferien im letzten Jahr so hoffnungsvoll begonnen. Sie war eine Woche mit ihrer Patentante in Italien gewesen. Venedig hatten sie besucht und einige faule Tage am Lido genossen. Knackig braun war sie heimgekommen und irgendwie selbstbewusster. Mittlerweile konnte sie sogar etwas Busen vorweisen, und die heißblütigen Italiener hatten ihr das Gefühl gegeben, ein attraktives Mädchen zu sein. Das hatte sie wahrscheinlich in ihrem naiven Glauben bestärkt, dass sich Yves tatsächlich für sie interessieren könnte. Sie hatten beide das Wahlpflichtfach Chor belegt, und er hatte einen Blick auf sie geworfen. Das war nicht verborgen geblieben. Natürlich nicht. Nichts entging den eifersüchtig aufmerksamen Augen ihrer Mitschülerinnen. Und ihr Elend hatte damit seinen Anfang genommen.
Dabei wussten sie ja nichts. Hatten keine Ahnung und nie etwas gewusst. Aber wie auch immer, auf jeden Fall hatte sie die Rudbeckien verärgert und ihren ganzen Zorn auf sich geladen. Tagtäglich. Stunde für Stunde. Minute für Minute. Fiese kleine Bemerkungen, vernichtende Blicke, herabwürdigende Gesten, hinterrückes Getuschel. Ihr Leben war eine einzige Tortur geworden. Jede Lektion glich einer Folterstunde, und jede Pause war ein Spießrutenlauf. Zudem hatte man sich nicht damit begnügt, sie in der Klasse fertigzumachen, nein, nichts Geringeres als das World Wide Web wurde genutzt. Man verleumdete sie, schrieb Unwahrheiten auf Facebook, setzte sie dem Gespött der ganzen Welt aus. Und das alles nur, weil ein Junge der Schule sich für sie interessierte. Ihr Pech, dass es ausgerechnet der Prinz war, auf den die Queen herself ein Auge geworfen hatte. Dass es noch schlimmer werden könnte, hatte sie sich nicht vorstellen können. Aber sie hatte sich geirrt.
Man hatte sie seit jeher von allem ausgeschlossen und nie eingeladen. Nicht zu irgendeiner privaten Feier, nicht zu irgendjemandem nach Hause. Bis zu jener Geburtstagsparty.
Aber daran wollte sie jetzt nicht denken. Sie konzen- trierte sich lieber auf das dritte Lied: Swim3. Die Sätze sprachen ihr aus der Seele. O ja, es war verdammt hart und schwierig, das Richtige zu tun, wenn man etwas ganz anderes in ihre Gesichter schmettern wollte. Sie fühlte sich verstanden und unterstützt. Wollte tun, was zu tun war, nicht davonlaufen. Was sang er? Sie solle schwimmen? Oft, sehr oft hatte sie versucht, sich ein- zureden, dass alles gut werden würde. Und schwamm. Aber sie war lange genug geschwommen. Wollte nicht mehr. Konnte nicht mehr. Sie wollte fliegen. Instinktiv übersetzte sie die nächsten Worte: Kämpfe nicht gegen die Gezeiten, schwimme einfach mit, aber zuerst, zuerst setzt du deine Füße auf den Boden. Ich kann dir nicht jedes Mal aufhelfen, wenn du fällst, ich bin nicht deine Mutter oder dein Vater.
Sie hatte weder einen Vater noch eine Mutter, die sie hätten an der Hand nehmen und ihr helfen können. Das hatte sie nie gehabt. Aber schlimmer war, dass sie ihre Mutter im Stich gelassen hatte. Das konnte sie sich niemals verzeihen. Sie war gemein und ekelhaft zu ihr gewesen. Und dafür gab es keine Entschuldigung. Ihren Frust und ihre Ohnmacht hatte sie an ihr ausgelebt. Bei ihr abgeladen. Es war Selbstmord gewesen, sie wusste es. Und sie war schuld daran, sie hatte ihre Mutter in den Suizid getrieben.
Depression war eine Krankheit. Das wusste sie. Und auch, dass ihre Mutter nichts dafürkonnte. Aber dieses Wissen hatte ihr nicht geholfen. Hatte sie weder geduldiger noch fürsorglicher gemacht. Ihrer Mutter machte sie keinen Vorwurf, aber sich selbst und ihrem Vater. Sie hatten versagt. Sie hatte zwar versucht, Verantwortung zu übernehmen, aber es war ihr nicht gut genug gelungen.
Daheim im Dorf war alles noch leichter gewesen. Hatte es am anderen Lebensstil gelegen? War es ihrer Mutter besser gegangen, weil sie Arbeit hatte? Mehr Bewegung, mehr Sonnenschein, mehr Kontakte? Fröhlich war sie auch in Klosters selten gewesen, aber immerhin nicht dermaßen deprimiert wie in der Stadt. Ihr Zustand hatte sich in Zürich rapide verschlechtert. Ohne die Aufgabe in der Bäckerei verlor ihr Leben jede Struktur. Niemand hatte ihr geholfen oder sich für sie interessiert. Oft war sie tagelang im abgedunkelten Zimmer im Bett geblieben.
Auch ihr Vater hatte die nötige Empathie nicht aufbringen können und war weder genug liebe- noch verständnisvoll gewesen. Heillos überfordert mit seinen pubertierenden Schülern und selber einem Zusammenbruch nahe, fehlte ihm die Kraft, sich daheim zusätzlich um eine kranke Frau zu kümmern. An ihr wäre es gewesen, ihrer Mutter zu helfen. Niemals würde sie rückgängig machen können, was an jenem verhängnisvollen Abend geschehen war. Sie hatte sich von ihrer Mutter abgewandt und so benommen, dass diese überhaupt keinen Sinn mehr in ihrem Leben sah. Damals war sie selbst todunglücklich gewesen und so wahnsinnig wütend geworden, als sie ihre Mutter einmal mehr ungepflegt in der dunklen Wohnung sitzen sah. Warum konnte sie sich nicht zusammenreißen? Warum war sie nicht wie all die anderen Mütter? Warum konnte sie ihr nicht helfen? Sie war das Kind, sie brauchte Hilfe. Aus einem Gefühl der Machtlosigkeit und der Niederlage heraus hatte sie zornig gerufen: »Wofür bist du eigentlich gut?«
Ihre Mutter hatte müde geantwortet: »Du hast recht, ich bin für nichts gut. Ich mache nur Arbeit und verursache Kosten.«
Es hatte ihr sofort leidgetan. Aber sie konnte nicht mehr zurück. Die Worte waren gesagt. Sie war in ihr Zimmer gestürmt, hatte die Tür zugeschlagen und ihre Mutter alleine gelassen.
Eine Woche später war das eingetreten, wovor sie sich immer gefürchtet hatte. Ihre Mutter war tot gewesen.
Reamonn sang, und die Worte sprangen in ihren Kopf: Kämpfe nicht gegen die Gezeiten, schwimm einfach mit. Aber zuerst setzt du deine Füße auf den Boden. Ich kann dir nicht jedes Mal aufhelfen, wenn du hinfällst. Ich bin nicht deine Mutter oder dein Vater. Nein, nein, ich kann nicht weiter … Recht hatte er. Er war weder ihre Mutter noch ihr Vater und er konnte ihr nicht aufhelfen. Niemand konnte es. Nur sie selbst.
Sie riss sich den Kopfhörer von den Ohren und lauschte angespannt in die Wohnung. War ihr Vater bereits nach Hause gekommen? Sie musste hier raus. Weg, bevor er heimkam.
1 Reamonn: 7th son
2 Reamonn: Supergirl
3 Reamonn: Swim
2.
Endlich konnte er nach Hause gehen. Es war heiß, und der Schweiß lief ihm in Bächen am Körper herunter, als er langsam, vergeblich nach Schatten Ausschau haltend, die Schulhausstraße hinaufging. Seine Gedanken kreisten. Gewöhnlich verfolgte ihn die Arbeit nicht. Mit der hinter sich schließenden Bürotür ließ er auch seine Fälle zurück. Lag es daran, dass er normalerweise an einen Tatort gerufen wurde, bei dem das Verbrechen bereits geschehen war? Wo es nicht an ihm war, die Katastrophe zu verhindern? Das hier war schwierig, und die Vorstellung, was da womöglich auf ihn zukam, schrecklich.
Für einmal fuhr er mit dem Lift in den ersten Stock, sogar zwei Treppen waren zu viel. Die Hitze war unerträglich. Hoffnungsvoll rief er: »Hallo?« in die Wohnung, und die gedämpfte Antwort kam umgehend zurück: »Hallo. Hier draußen.« Er folgte der Stimme und ging durch die Küche auf den Balkon. Rebecca lag auf dem Liegestuhl unter dem Sonnenschirm. In der Hand hielt sie ein Glas, in welchem die Eiswürfel dezent klingelten. Die milchige Flüssigkeit verriet ihm, dass es sich um einen klassischen Pastis handelte. Offensichtlich hatte sie sich nicht vom Hype um den Aperol Spritz anstecken lassen. In diesem Sommer nippte der Zürcher mit kindlicher Freude an diesem künstlich orangen Produkt, im nächsten Jahr würde einem wieder etwas anderes aus jeder Hand in der Bar oder Beach-Lounge entgegenleuchten. Er küsste seine Freundin auf den Mund. Mmh, der Anisgeschmack schmeckte gut auf seinen Lippen und nach mehr.
»Wie war dein Tag?«
»Geht so. Und deiner?«
»Herrlich. Ich war am Morgen paddeln.« Das Bild gefiel ihm. Da sich der Zürichsee nicht zum Wellenreiten eignete, Rebecca als halbe Australierin aber auf einem Brett daheim war, hatte sie diesen Sommer mit dem Stand-up Paddeling, kurz SUP genannt, begonnen. Andreas schöne Vorstellung, wie sich Rebeccas lange, schlanke Silhouette im Bikini auf dem Brett stehend gegen den Himmel abhob, wenn sie elegant einer Göttin gleich dem Horizont entgegenruderte, wurde jäh durch ihre Worte unterbrochen: »Der See ist warm geworden und schon beinahe keine Erfrischung mehr.« Sie hatte wohl gemerkt, dass er mit den Gedanken woanders war, und fragte lächelnd: »Willst du meinen?« Großzügig hielt sie ihm ihr Glas hin. »Ich mach mir einen neuen.« Mit diesen Worten verschwand sie in die Küche. Dankbar nahm er an, setzte sich auf einen Stuhl und trank einen ersten Schluck von der scharfen Flüssigkeit. Selbst im Schatten war ihm viel zu heiß. Während sich Rebecca Eiswürfel aus dem Kühlfach holte und erneut Pastis in einen Tumbler einschenkte, stellte sie fest: »Natürlich war’s nicht so schön wie gestern. Aber auch auf der Mole lässt sich der Sommer genießen.« Ach ja, gestern. Sie hatten sich einen Weidling bei der Seepolizei ausgeliehen und waren den ganzen Tag auf dem Wasser geblieben. Die Ruhe war paradiesisch gewesen. Das Geschrei aus den Badeanstalten am Ufer, die aus allen Nähten platzten und wo mindestens so schlimme Zustände wie rund ums Mittelmeer während der Sommerferien herrschten, klang nur gedämpft bis zu ihnen. Und mit ein paar leichten Ruderschlägen entfernten sie sich gerade so weit, um den Luxus des Alleinseins nicht zu vergessen. Genüsslich waren sie im Bug des Bootes gelegen, derweil die Wellen sanft und leise an die Holzwände schmatzten. Ab und zu hornte ein Kursschiff in der Ferne, oder ein weißer Segler glitt fast lautlos vorbei. Sogar die Maschinen der Motorjachten schnurrten wie verwöhnte Katzen. Man ließ sich treiben, dümpelte schaukelnd dahin. Ein träger Sommersonntag. Sie hatten gelesen, gedöst, geschwatzt. War ihnen zu warm geworden, suchten sie mit einem Kopfsprung Abkühlung im See. Mit einem einfachen Picknick rundeten sie abends den perfekten Tag ab. Die Weißweinflasche war den ganzen Tag an einer Schnur am Boot befestigt im Wasser gelegen und mitgeschwommen. Das Baguette zwar ein bisschen trocken und der Käse etwas weich, aber mit dem Wein hatte sich dennoch ein Hauch Frankreich schmecken lassen. Erst weit nach Sonnenuntergang hatten sie sich dazu aufraffen können, ans Ufer und nach Hause zurückzukehren.
Ungleich Rebecca, die heute nochmals freigehabt hatte, war sein Wecker um 6.00 Uhr losgegangen, und er hatte den Tag bei der Arbeit verbracht. Erneut riss ihn Rebecca aus seinen Gedanken. »Man merkt, dass die Schule wieder begonnen hat. Untertags sind bedeutend weniger Kinder auf der Straße anzutreffen.« Schule. Hm, eigentlich wollte er nicht mehr daran denken. Er hatte heute viele Stunden in der Schule zugebracht. Jetzt war Feierabend, und irgendwann musste man abschalten können. Es gelang ihm nicht. Was ging nur im Kopf eines Teenagers vor, bis er so weit kam? Was musste da alles schiefgelaufen sein?
Inzwischen war Rebecca wieder auf den Balkon getreten und prostete ihm mit den Worten »Auf den Sommer« zu.
»Auf einen Sommer mit dir.« Die Gläser trafen sich und ebenso ihre Lippen.
»Hab ich einen Hunger! Was meinst du, wollen wir nachher gleich los?«
Er nahm einen kräftigen Schluck und antwortete: »Ich hüpf noch schnell unter die Dusche.« Das Glas nahm er mit, als er ins Badezimmer ging. Es war eine Wohltat, endlich aus diesen schweißfeuchten Kleidern zu kommen. Das kalte Wasser traf ihn brutal. Aber es tat gut, wie es über Haare und Gesicht lief. Das hatte er gebraucht. Erfrischt stieg er aus der Kabine, trocknete sich ab und lief nackt ins Schlafzimmer. Ein anerkennender Pfiff von draußen verriet ihm, dass ihn Rebecca beobachtet hatte. Er lachte. »Lust?«
»Behalten wir uns das für den Nachtisch auf?«
»Wann immer du willst.« Er strich sich eine nasse Haarlocke aus der Stirn. Seit er wusste, dass Rebecca auf Männer mit langem Haar stand, ließ er seine ungebremst wachsen. Während er ein frisches Paar Jeans und ein T-Shirt aus dem Schrank suchte, summte er vergnügt vor sich hin. Das Leben war trotz allem schön.
Hand in Hand schlenderten sie durch Rieter- und Belvoirpark in Richtung See. Der Herbst war noch weit entfernt, nach dem nassen Juli leuchteten Blätter und Rasen in sattem Dunkelgrün. Bis Mitte August war das Wetter wechselhaft und kühl gewesen. Die Freibäder hatten bereits die schlechte Saison beklagt, niemand hatte mehr so recht mit einer Hitzewelle gerechnet. Aber pünktlich zum Schulanfang legte der Sommer so richtig los. War es nicht im letzten Jahr ähnlich gewesen? Da war es sogar September geworden, bis sich die im Hochsommer aufgesparte Hitze entlud. Am Wochenende hatte das Theaterspektakel auf der Landiwiese begonnen, und der Anlass war ihr Ziel. Das letzte Stück des Weges legten sie gemeinsam mit all den anderen Fußgängern und Velofahrern entlang des Mythenquais zurück, die dieselbe Idee gehabt hatten. Man wollte den lauen Abend genießen, und Hunderte Menschen wurden angezogen wie Motten vom Licht.
Sie passierten die obligaten Unterschriftensammler. Worum’s diesmal wohl wieder ging? Freie Schulwahl für alle? Gerechtere Löhne? Mehr bezahlbare Wohnungen? Er zwängte sich so rasch wie möglich an den Lauernden vorbei, aber Rebecca krallten sie sich natürlich sofort, und einer der jungen Idealisten laberte sie ernsthaft voll mit irgendwelchen Weltverbesserungsvorschlägen.
Als sie um 19.00 Uhr schließlich das Gelände betraten, hatten sich bereits vor allen Essständen lange Schlangen gebildet. Sie trennten sich vorübergehend, da Rebecca sich einen afrikanischen und er lieber einen asiatischen Teller organisieren wollte. Von überall her roch es exotisch. Kinder rannten an Tischen vorbei und fielen zwischen Bänke. Trommler gaben der Geräuschkulisse einen dumpfen Boden. Frauen und Männer begrüßten sich lachend. Kurz vor 20.00 Uhr kamen die kulturinteressierten Besucher, und Kolonnen bildeten sich jetzt auch vor den Eingängen der Theaterzelte. Gerade als Andrea den letzten Bissen des würzigen Satay-Spießes mit einem Schluck Bier hinunterspülte, tippte ihm jemand von hinten auf die Schulter. Er sah Rebeccas freundliches Lachen, und bevor er sich umdrehen konnte, hörte er eine weibliche Stimme: »Dacht ich mir doch, dass ihr das seid. Guten Abend.«
»Hallo, Kathrin!«
»Hoi miteinander!« Die zwei Kirchner Jungs strahlten sie an, und dann trat auch noch der Mann zu Frau und Kindern. »Tja, nun ist’s vorbei mit der Zweisamkeit … Hallo, Rebecca, Andrea.« Bei Küsschen und Händeschütteln erfuhren sie, dass die Familie bereits im Ship O’Fools gewesen war. Wo man mitten auf der Wiese für wenig Geld in einem Piratenschiff verrückte Maschinen aus Besteck, Spielzeug und Musikinstrumenten bewundern konnte. Bevor sie sich nun auf den Heimweg machen wollten, immerhin wurden die Knaben morgen wieder in Schule beziehungsweise Kindergarten erwartet, mussten sie noch in die Erinnerungsstube im Haus am See, wo pro Tag nämlich ein Stofftier adoptiert werden durfte.
»Wollt ihr schon mal vorgehen?« Kai wandte sich an Kathrin, seine Frau. »Ich habe mit Andrea noch etwas zu besprechen.« Sie nickte und verabschiedete sich, um die Söhne, die ihr bereits vorausgerannt waren, wieder einzuholen.
»Seid ihr schon weitergekommen?«
»Leider nicht sehr.« Andrea hatte keine wirklich guten Nachrichten für den Nachbarn. Kai, der Gymnasiallehrer, war in der letzten Sommerferienwoche im Schulhaus gewesen, um sich auf den kommenden Unterricht vorzubereiten. Aufgeregt war der Hauswart mitten in seine Planung geplatzt und hatte ihn auf eine Skizze in der oberen Damentoilette aufmerksam machen wollen. Er sollte sich ansehen, was sie Seltsames beim Entfernen der Hygienebox entdeckt hatten.
Die Orchidee war relativ groß und schwarz. Daneben, etwas kleiner, ein Busch Rudbeckien und auf der anderen Seite eine Malvenart. Besorgniserregend war das Sturmgewehr, dessen Kugeln alle Stängel durchschossen hatten. Die Blumen waren erbarmungslos geköpft worden, sodass die Pflanzen geknickt starben. Da hatte sich jemand viel Mühe mit einer Zeichnung gegeben. Dick und fett stand zudem darüber: »26.08.2011«.
Das war kein Fall für Padägogen, sondern für die Polizei. Umgehend hatte Kai Andrea, den Detektiv der Stadtpolizei Zürich, alarmiert. Ein School-Shooting? Hm, dafür gab es eigens eine Fachstelle. Die Gewaltprävention. Nach einer gründlichen Gefahrenanalyse empfahl das Dreiergremium, bestehend aus einem Polizisten, einem Kriminal- und einem Schulpsychologen, die Drohung ernst zu nehmen. Andrea hatte den nächsten Schritt unternommen und die Interventionseinheit informiert. Die Stadtpolizei Zürich verfügte seit 1973 über eine eigene Anti-Terror-Einheit. Sie war nur ein Jahr nach dem verheerenden terroristischen Angriff auf die Olympischen Sommerspiele im Jahr 1972 in München gegründet worden. Damals war die Unfähigkeit der Polizei offenbar geworden, auf eine solche Art der Schwerstkriminalität adäquat reagieren zu können. Die Interventionseinheit, die bis im April 2006 als Milizsystem funktioniert hatte, war schließlich in die Abteilung Spezial mit einem Sollbestand von über 80 Mitarbeitern umgewandelt worden. Hier arbeiteten die Grenadiere in fünf Einsatzgruppen mit je zwölf Mitgliedern rund um die Uhr im Schichtdienst. Gerufen wurden sie, wenn es irgendwo besonders gefährlich zu sein schien oder sich Einsätze als heikler herausstellten: Sobald Waffen im Spiel waren, die Täter als skrupellos galten, Geiselnahmen vorlagen oder völkerrechtlich zu schützende Personen begleitet werden mussten. Zudem deckten sie die Überfallgruppe ab und leisteten Unterstützung für die Grundversorgung. Eine Amoktat in der Schule war sozusagen ihr Klassiker schlechthin. Aktion Orchidee war geboren worden und rollte in logischer Konsequenz unter Andreas Kommando.
Er brachte Kai auf den neuesten Stand. In puncto Täterschaft waren sie unbefriedigend wenig weitergekommen, und über Taktisches konnte und wollte er dem Nachbarn nichts Genaueres mitteilen. Sorgenvoll verabschiedete sich der Lehrer daraufhin und begab sich auf die Suche nach seiner Familie.
Längst waren die Lichterketten auf der Landiwiese angegangen und gaben der ganzen Umgebung eine fast magische Atmosphäre. Andrea versuchte, sich erneut davon einnehmen zu lassen, und trieb mit Rebecca im Strom der Menschen an die Esoterik-und-Ethnomeile. Hier ließen sich kleine Mädchen farbige Garne ins Haar flechten und bunte Bändchen um den Arm. Mutigere hielten Wahrsagerinnen ihre Hände zum Lesen hin oder hörten sich an, wie man Geister vertreiben konnte. Rebecca suchte sich spontan eine der Seherinnen aus, zahlte einen bescheidenen Betrag und wurde sofort bedient. Nicht unbedingt Andreas Welt. Er blickte über die Köpfe der Sitzenden hinweg und entdeckte ein Stück weiter ein paar bekannte Gesichter.
»Na, euch geht’s ja verdammt gut!«
»Wem sagst du das. Wir werden jeden Abend rund und runder.« Der Fahnder seufzte schmunzelnd und strich sich dabei über den Bauch. Ein Anlass wie das Theaterspektakel zog nicht nur unbedarfte Bürger an, sondern mit dieser unbeschwerten und leichten Opfer-Zielgruppe auch professionelle Taschendiebe und andere Kleinkriminelle. Die zivilen Polizisten verbanden das Angenehme mit dem Nützlichen, gönnten sich ein Essen unter freiem Himmel und konnten dabei gleichzeitig mutmaßliche Täter im Auge behalten.
Nach den üblichen Spötteleien wurde Andrea ernst. Das Auftauchen der Kollegen brachte ihn auf eine neue Idee, und dieser Eingebung folgend, fragte er: »Wie wär’s mit einem zusätzlichen Observanten-Einsatz?« Warum nicht weitere Unterstützung anfordern? Es konnte auf keinen Fall schaden, wenn noch einige zusätzliche Augenpaare Schüler nach verdächtigem Verhalten beobachteten.
»Lass hören.« Auch Manfred, der Fahnder, wurde ernst. Andrea informierte die Männer über seinen laufenden Fall, und sie ließen sich sofort überzeugen. Ohne großes Wenn und Aber beschloss man, sich morgen im Detektivposten in der Enge zu treffen und alles Weitere zu besprechen.
Natürlich war den Kollegen nicht verborgen geblieben, mit wem Andrea hier war, und kaum war das Geschäftliche besprochen, konnte man sich eine weitere Fopperei nicht verkneifen. Mit einem Nicken in Rebeccas Richtung fragte Manfred: »Und, wie schmeckt sie denn, deine Cremeschnitte …?«
»So gut, wie sie aussieht.«
Zur Bewunderung kam wohl ein Schuss Neid. Immerhin entsprach Rebecca mit ihren über 1,80 Meter, der schlanken Figur, den klassisch feinen Gesichtszügen und dem makellosen Alabasterteint der Rothaarigen einem Idealbild und kam einem Topmodel sehr nahe.
Als sich Rebecca strahlend und um ihr Glück bestätigt zu den Männern gesellte, rissen sie sich zusammen, ließen die Sticheleien, und man verabschiedete sich. Eine Weile noch schauten Rebecca und Andrea einem geschickten Jongleur zu, hörten den Applaus, den ein zahlreiches Publikum einem Zauberer zollte, fragten sich, ob die Vorstellung des Feuerkünstlers noch drin liege, entschieden sich dagegen und machten sich stattdessen definitiv auf den Heimweg. Die Nacht war samten. Vereinzelte Sterne funkelten zwischen den Blattdächern der alten Parkbäume, und wäre da nicht dieser unverdauliche Fall gewesen, hätte Andrea wunschlos glücklich sein können. Wenigstens hatte er allmählich das Gefühl, alles in seiner Macht Stehende getan zu haben. Eine schlechte Vorahnung ließ sich dennoch nicht ganz vertreiben. Wenn sie wenigstens einen Anhaltspunkt hätten, um wen es sich beim Täter handeln könnte.
3.
Nachdem sie die Wohnung fluchtartig verlassen hatte, war sie eine Weile planlos durch die kochende Stadt gestreunt und schließlich auf dem Saffa-Inseli gelandet. Hier musste sie nicht befürchten, von jemandem erkannt zu werden. Den Tussen ihrer Klasse war der See oder eine öffentliche Badeanstalt natürlich viel zu gewöhnlich. Man traf sich in den elterlichen Villen mit eigenem Swimmingpool. Was ihr recht war. Je weniger sie in diese blasierten Gesichter sehen musste, umso besser. Aus dem Schatten eines Baumes blickte sie auf unzählige Sonnenanbeter. Braune, rote, gescheckte Leiber. Manchmal war es gut, inmitten von Menschen zu sein. Je mehr Volk, desto unsichtbarer wurde sie.
Wie schön es hier war. Der See so blau, die Wiese grün, weiß die Segler. Ihr Blick blieb an einer jungen Familie hängen. Die Frau sonnte sich oben ohne, der Mann spielte mit einem schätzungsweise zwei Jahre alten Knaben. Das Kind lachte.
Vielleicht war doch alles ein Fehler?
Manchmal hatte sie diese lichten Momente. Aber nur ganz kurz, dann kroch sie sofort wieder in ihren dunklen Tunnel zurück. Und daraus gab es nur einen Ausweg.