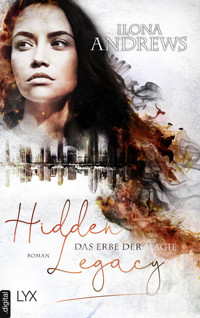
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nevada-Baylor-Serie
- Sprache: Deutsch
Wenn Vertrauen zur Feuerprobe wird
In einer Welt, in der Magie alles bedeutet - Reichtum, Macht und Ansehen.
Eine Welt, in der Familiendynastien das Schicksal der Menschen bestimmen, Kriege führen und Politik beeinflussen.
Seit dem Tod ihres Vaters ist Nevada Baylor die Hauptverdienerin in ihrer Familie. Als Privatdetektivin übernimmt sie jeden Fall, um alle über Wasser zu halten - sie lässt sich sogar auf einen Auftrag ein, der sie in Lebensgefahr bringt. Nevada soll einen mächtigen Feuermagier dingfest machen, als ihr Weg den von Connor "Mad" Rogan kreuzt. Rogan ist tödlich, sexy, eiskalt und auf der Suche nach demselben Verdächtigen wie Nevada. Um am Leben zu bleiben, muss sie mit ihm zusammenarbeiten - hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch zu fliehen und der Leidenschaft, die zwischen ihnen beiden brennt. Denn Rogan geht ihr unter die Haut ... aber Liebe ist in dieser Welt so gefährlich wie der Tod!
"Ilona Andrews' Name auf dem Buch ist die bombensichere Garantie auf ein überragendes Leseerlebnis!" Romantic Times
Der Auftakt zur Hidden-Legacy-Reihe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungEinführungVorwort123456789101112131415EpilogDanksagungDie AutorenDie Romane von Ilona Andrews bei LYXImpressumILONA ANDREWS
Hidden Legacy
Das Erbe der Magie
Roman
Ins Deutsche übertragen von Marcel Aubron-Bülles
Zu diesem Buch
Wenn Vertrauen zur Feuerprobe wird
Eine Welt, in der Magie alles bedeutet: Reichtum, Macht und Ansehen. Eine Welt, in der Familiendynastien das Schicksal der Menschen bestimmen, Kriege führen und Politik beeinflussen.
Seit dem Tod ihres Vaters ist Nevada Baylor die Hauptverdienerin in ihrer Familie. Als Privatdetektivin übernimmt sie jeden Fall, um alle über Wasser zu halten. So hat sie keine andere Wahl, als sich auf einen Auftrag einzulassen, der sie in Lebensgefahr bringt. Nevada soll einen mächtigen Feuermagier dingfest machen, als sich ihr Weg mit dem von Connor »Mad« Rogan kreuzt. Rogan ist eiskalt, tödlich, sexy und auf der Suche nach demselben Verdächtigen wie Nevada. Um am Leben zu bleiben, muss sie mit ihm zusammenarbeiten, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch zu fliehen und der Leidenschaft, die zwischen ihnen beiden brennt. Denn Rogan geht ihr unter die Haut … aber Liebe ist in dieser Welt so gefährlich wie der Tod!
Für unsere großartigen Töchter, die die ganze Mühe wert sind, und für den Rest unserer Familie, die uns in den Wahnsinn treibt.
Einführung
Im Jahr1863, in einer Welt, die der unseren sehr ähnlich ist, entdeckten europäische Wissenschaftler das Osiris-Serum, ein Gebräu, das schlummernde magische Begabungen erweckt. Dabei kamen Fähigkeiten mit den unterschiedlichsten Auswirkungen zum Vorschein: Einige Menschen lernten, Tieren zu befehlen, die nächsten konnten Wasser aus großer Entfernung erspüren, und wieder andere stellten mit Überraschung fest, dass sie ihre Feinde mit Blitzen vernichten konnten, die aus ihren Händen schleuderten. Das Serum verbreitete sich auf der gesamten Welt. Es wurde Soldaten in der Hoffnung verabreicht, dass militärische Streitkräfte schneller und effizienter den Tod in feindliche Reihen tragen konnten. Aristokraten kauften es, weil sie ihre schwindende Macht zurückerlangen wollten. Die Reichen holten es sich, um noch reicher zu werden.
Schließlich aber begriff die Welt, welche Konsequenzen es nach sich zog, gottgleiche Fähigkeiten in einfachen Leuten zu erwecken. Das Serum wurde weggeschlossen – doch es war zu spät. Die magischen Begabungen wurden von Eltern an ihre Kinder weitergegeben und veränderten den Lauf der menschlichen Geschichte. Die Zukunft ganzer Nationen fand in nur wenigen Jahrzehnten eine neue Ausrichtung. Wer einst heiratete, um gesellschaftlichen Rang, Geld oder Macht zu erlangen, der schloss nun die Ehe um der Magie willen, denn starke Magie ermöglichte einem alles.
Jetzt, anderthalb Jahrhunderte später, haben sich Familien, in denen das Erbe der Magie stark und mächtig ist, in Dynastien gewandelt. Diese Familien – sie nennen sich selbst »Häuser« – besitzen Unternehmen, haben in den Städten ihre eigenen Areale und beeinflussen die Politik. Sie unterhalten Privatarmeen, mit denen sie sich untereinander bekämpfen, und ihre Auseinandersetzungen enden stets tödlich. Dies ist eine Welt, in der man mächtiger, reicher und berühmter ist, je mehr Magie man besitzt. Einige magische Begabungen sind zerstörerisch, andere sind wesentlich raffinierter. Eines aber ist gewiss: Einen jeden magisch Begabten sollte man sehr ernst nehmen.
Vorwort
»Ich kann es dich nicht tun lassen. Auf keinen Fall. Kelly, der Mann ist wahnsinnig.«
Kelly Waller griff nach der Hand ihres Ehemanns, um sich zu beruhigen, woraufhin er seine Rechte vom Lenkrad löste und zärtlich ihre Finger drückte. Seltsam, wie intim eine solche Geste sein kann, dachte sie. Diese Berührung, die ihre Kraft aus den zwanzig Jahren ihrer Liebe zog, war der Fels in der albtraumhaften Brandung, zu denen sich die letzten achtundvierzig Stunden entwickelt hatten. Ohne diese Berührung hätte sie jetzt laut geschrien.
»Er wird mir nicht wehtun. Wir sind eine Familie.«
»Du hast mir selbst gesagt, dass er seine Familie hasst.«
»Ich muss es versuchen«, sagte sie. »Oder sie werden unseren Jungen töten.«
Tom starrte mit glasigem Blick durch die Windschutzscheibe und steuerte den Wagen die Zufahrt entlang. Alte texanische Eichen breiteten ihr ausladendes Blätterdach über dem Rasen aus, auf dem vereinzelt gelber Löwenzahn und rosafarbener Hahnenfuß wuchs. Connor ließ das Anwesen wirklich verwahrlosen. Ihr Vater hätte das Unkraut vernichten lassen …
Ihr wurde flau im Magen. Der eine Teil von ihr wäre am liebsten in die Vergangenheit gereist und hätte das ungeschehen gemacht, was in den letzten beiden Tagen geschehen war. Der andere Teil von ihr wollte einfach nur den Wagen wenden. Es ist zu spät, ermahnte sie sich. Zu spät für Reue und Bedauern. Sie musste sich der Realität stellen, wie furchterregend sie auch sein mochte. Sie musste sich wie eine Mutter verhalten.
Die Zufahrt endete vor einer hohen Stuckfassade. Sie kramte in ihren Erinnerungen. Sechzehn Jahre waren eine lange Zeit, aber sie war sich sicher, dass diese Fassade damals noch nicht existiert hatte.
Ein schmiedeeisernes Tor versperrte den bogenförmigen Eingang. Das war es also. Es führte kein Weg zurück. Wenn Connor ihren Tod beschloss, dann würde ihre Magie – oder zumindest das wenige, was davon noch übrig war – ihn nicht aufhalten können.
Connor war die Krönung dreier Generationen sorgfältig geplanter Ehen, die nicht nur die guten Verbindungen der Familie, sondern auch ihre Magie stärken sollten. Eigentlich hätte er sich als würdiger Nachfolger des Hauses Rogan erweisen und dessen Schicksal bestimmen sollen. Doch ähnlich wie sie hatte er sich nicht zu dem entwickelt, was sich ihre Eltern vorgestellt hatten.
Tom stellte den Wagen ab. »Du musst das nicht tun.«
»Doch, muss ich.« Grauen ergriff Besitz von Kelly, legte sich drückend auf ihre Seele, und eine bodenlose Angst befiel sie. Ihre Hände begannen zu zittern. Sie schluckte schwer und versuchte sich zu räuspern. »Das ist die einzige Möglichkeit.«
»Lass mich wenigstens mitkommen.«
»Nein. Er kennt mich. Er könnte dich als Bedrohung verstehen.« Sie schluckte erneut, aber der Kloß in ihrem Hals weigerte sich zu verschwinden. Sie wusste nie, ob Connor die Gedanken anderer Leute lesen konnte, aber er war sich ihrer Gefühle auf jeden Fall bewusst. Sie hatte auch nicht den geringsten Zweifel, dass sie in diesem Augenblick beobachtet und vermutlich auch belauscht wurden. »Tom, ich glaube nicht, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird. Falls doch, und ich komme hier nicht mehr raus, dann will ich, dass du verschwindest. Ich will, dass du nach Hause fährst, zu den Kindern. Im Schrank über dem kleinen Tisch in der Küche steht ein blauer Ordner. Auf dem zweiten Regalbrett. Du findest dort unsere Lebensversicherungen und mein Testament …«
Tom ließ den Wagen an. »Schluss damit. Wir fahren sofort nach Hause. Wir kümmern uns selbst drum.«
Sie riss die Autotür auf, sprang heraus und rannte zum Tor, was ihre High Heels über den Boden klacken ließ.
»Kelly!«, rief er ihr hinterher. »Tu es nicht!«
Sie zwang sich, das Eisentor zu berühren. »Ich bin es, Kelly. Connor, lass mich bitte rein.«
Das Eisentor öffnete sich langsam. Kelly hob den Kopf und trat hindurch. Hinter ihr schloss sich das Tor wieder. Sie ging unter dem Bogen hindurch und den Steinpfad entlang, der sich durch den malerischen Hain mit seinen Eichen, Judasbäumen und dem Lorbeer schlängelte. Der Pfad bog schließlich zur Seite ab, und sie blieb wie angewurzelt stehen.
Das riesige Monstrum, der Kolonialbau mit seiner weißen Fassade und der vornehmen Kolonnade, war nicht mehr. An seiner Stelle erhob sich eine zweistöckige Villa im mediterranen Stil, cremefarben getüncht und mit einem dunkelroten Dach. Hatte sie sich in der Adresse geirrt?
»Wo ist das Haus?«, flüsterte sie.
»Ich habe es abgerissen.«
Kelly drehte sich zur Seite. Connor stand direkt neben ihr. Sie erinnerte sich an einen schlanken Jungen mit auffallend hellblauen Augen. Sechzehn Jahre später war er größer als sie. Seine Haare hatten damals einen kastanienbraunen Ton, aber jetzt waren sie dunkelbraun, fast schon schwarz. Das früher so knochige Gesicht hatte sich sehr verändert; sein kantiges Kinn und die harten, männlichen Züge ließen ihn faszinierend gut aussehen. Mit diesem Gesicht hätte er über die Welt herrschen können.
Kelly blickte Connor in die Augen und wünschte sich augenblicklich, sie hätte es nicht getan. Das Leben hatte diese faszinierenden blauen Augen kalt werden lassen. In ihren Tiefen regte sich unvergleichliche Macht. Sie konnte sie spüren. Es war eine wilde, ungezähmte Energie, die direkt unterhalb der Oberfläche brodelte. Sie zuckte hin und her, bäumte sich auf – eine entsetzliche, furchterregende Kraft, die Gewalt und Zerstörung verhieß und nur durch einen eisernen Willen im Zaum gehalten wurde. Ein eisiger Schauer lief Kelly das ganze Rückgrat hinab.
Sie musste etwas sagen. Irgendwas.
»Um Gottes willen, Connor, das Haus war zehn Millionen Dollar wert.«
Er zuckte mit den Achseln. »Ich habe es als eine Befreiung empfunden. Möchtest du eine Tasse Kaffee?«
»Ja, sehr gern.«
Er führte sie durch den Eingang in die Lobby, eine Holztreppe mit verschnörkeltem Eisengeländer hinauf und schließlich hinaus auf einen überdachten Balkon. Sie folgte ihm leicht verwirrt und nahm ihre Umgebung nur als konturlose Linien wahr, bis sie sich in einen Plüschsessel setzte. Jenseits des Balkongeländers erstreckte sich der Obstgarten. Bäume säumten Teichufer und einen malerischen Bach. Am Horizont zeichnete sich eine bläuliche Hügellandschaft ab wie die Wellen eines fernen Meeres.
Es duftete nach Kaffee. Connor stand mit dem Rücken zu ihr und wartete darauf, dass ihre Tassen von der Kaffeemaschine gefüllt würde.
Finde einen gemeinsamen Nenner. Erinnere ihn daran, wer du bist. »Wo ist die Schaukel?«, fragte sie. Als Kinder hatten sie dort am liebsten ihre Zeit verbracht. Dort hatten sie sich getroffen, als er sie um Rat bitten musste: Er war zwölf und sie die coole ältere Cousine Kelly gewesen, die sich mit ihren zwanzig Jahren in allen Teenager-Belangen bestens ausgekannt hatte.
»Sie ist immer noch da. Die Eichen haben sich breitgemacht. Man kann sie vom Balkon aus nicht mehr sehen.« Connor drehte sich um, stellte die Tasse vor ihr ab und nahm Platz.
»Es gab mal eine Zeit, da hättest du die Tassen schweben lassen«, sagte sie.
»Ich spiele keine Spielchen mehr. Zumindest nicht mehr die Spiele, an die du dich erinnern kannst. Warum bist du hier?«
Die Kaffeetasse verbrannte ihr die Finger. Sie stellte sie ab. Sie hatte nicht einmal gemerkt, dass sie sie überhaupt in die Hand genommen hatte. »Hast du in letzter Zeit die Nachrichten gesehen?«
»Ja.«
»Dann hast du von der Brandstiftung bei der First National gehört.«
»Ja.«
»Ein Wachmann ist verbrannt. Seine Frau und ihre beiden Kinder haben ihn auf der Arbeit besucht. Sie sind alle drei im Krankenhaus. Der Wachmann war Polizeibeamter außer Dienst. Die Aufnahmen der Videoüberwachung haben zwei Brandstifter identifizieren können: Adam Pierce und Gavin Waller.«
Er wartete.
»Gavin Waller ist mein Sohn«, sagte sie. Ihre Stimme klang hohl, als sie den Namen aussprach. »Mein Sohn ist ein Mörder.«
»Ich weiß.«
»Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe Gavin von ganzem Herzen. Wenn ich mich zwischen meinem und seinem Leben entscheiden müsste, würde ich mich sofort für ihn opfern. Gavin ist nicht böse. Er ist nur ein sechzehnjähriges Kind, das versucht hat, sich selbst zu finden. Aber stattdessen hat er Adam Pierce entdeckt. Weißt du, Kinder verklären Pierce. Er ist ihr Antiheld – der Mann, der sich von seiner Familie abgewandt und eine Motorradgang gegründet hat. Der böse Junge, der zum charismatischen Rebellen wird.«
Sie klang verbittert und wütend, konnte es aber nicht verhindern.
»Er hat Gavin dazu benutzt, diese Gräueltat zu begehen, und jetzt ist ein Polizist tot. Die Frau des Toten und die beiden Kinder haben schwere Brandverletzungen erlitten. Dafür werden sie Gavin töten, Connor. Selbst wenn mein Sohn mit erhobenen Händen da rauskommt, werden ihn die Cops erschießen. Er ist ein Polizistenmörder.«
Connor trank seinen Kaffee. Seine Miene blieb völlig unbewegt. Aus seinem Gesicht konnte sie nichts ablesen.
»Du schuldest mir nichts. Wir haben zwanzig Jahre nicht miteinander gesprochen, nicht, seitdem mich die Familie enterbt hat.«
Sie schluckte erneut schwer. Sie hatte sich damals ihren Anweisungen widersetzt und sich geweigert, einen Fremden mit den richtigen Genen zu heiraten. Sie hatte ihnen gesagt, sie wollte in ihrem Leben selbst die Entscheidungen treffen. Ihrem Wunsch war entsprochen worden, und man hatte sie wie eine heiße Kartoffel fallen lassen … nein, bloß nicht darüber nachdenken! Denke an Gavin.
»Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe«, sagte sie, »würde ich dich damit nicht belästigen. Aber Tom hat keinerlei Verbindungen. Wir haben weder Macht noch Geld und schon gar nicht große Magie. Niemand interessiert sich dafür, was mit uns geschieht. Alles, was ich noch besitze, sind unsere Kindheitserinnerungen. Ich war immer für dich da, wenn du in Schwierigkeiten geraten bist. Bitte hilf mir.«
»Was soll ich deiner Meinung nach tun? Hoffst du etwa, seine Verhaftung umgehen zu können?«
In seiner Stimme schwang ein Unterton zynischster Missbilligung mit. »Nein. Ich will, dass mein Sohn verhaftet wird. Ich will, dass er vor Gericht kommt. Ich will, dass die Verhandlung im Fernsehen gezeigt wird, denn wenn Gavin erst mal zehn Minuten im Zeugenstand verbracht hat, wird ihn jeder als das erkennen, was er ist: ein verwirrtes, dummes Kind. Sein Bruder und seine Schwester verdienen es zu erfahren, dass er kein Monster ist. Ich kenne meinen Sohn. Ich weiß, dass das, was er getan hat, ihn zerreißt. Ich will nicht, dass er stirbt, dass er wie ein Tier abgeschossen wird, ohne jemals die Chance zu haben, den Familien der Menschen, die er getötet hat, zu sagen, wie sehr es ihm leidtut.«
Tränen liefen ihr die Wangen hinab. Es war ihr egal. »Bitte, Connor. Ich flehe dich um das Leben meines Sohnes an.«
Connor trank seinen Kaffee. »Ich heiße Mad Rogan, der Irre. Sie nennen mich auch den Schlächter und die Geißel, aber Mad ist der bei weitem am häufigsten benutzte Spitzname.«
»Ich weiß, dass du -«
»Nein, das weißt du nicht. Du hast mich vor dem Krieg gekannt, als ich noch ein Kind war. Sag mir, was bin ich jetzt?«
Sein Blick lastete schwer auf ihr.
Ihre Lippen zitterten, und sie sagte das Erste, was ihr in den Kopf kam. »Du bist ein Massenmörder.«
Ein eiskaltes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Keine Freude, keine Wärme, nur ein gnadenloses Raubtier, das seine Fangzähne bleckte. »Seit der Brandstiftung sind achtundvierzig Stunden vergangen, und du bist jetzt erst hier. Du musst wirklich verzweifelt sein. Bist du zuerst zu allen anderen gegangen? Bin ich deine letzte Adresse?«
»Ja«, sagte sie.
Seine hellblauen Augen blitzten kurz auf, wie unter Strom. Sie sah ihm in die Augen, und für den Bruchteil einer Sekunde erkannte sie die wahre Macht, die in ihm verborgen lag. So musste es sich anfühlen, wenn man einer Lawine entgegenstarrte, bevor sie einen begrub. In diesem Augenblick wusste sie, dass alle Geschichten über ihn stimmten. Er war ein Mörder, und er war ein Irrer.
»Mir ist es egal, selbst wenn du der Teufel höchstpersönlich wärst«, flüsterte sie. »Bitte bring mir Gavin zurück.«
»Okay«, sagte er.
Fünf Minuten später taumelte sie die Zufahrt entlang. Tränen strömten ihre Wangen hinab. Sie hatte versucht, sich wieder unter Kontrolle zu bekommen, konnte es aber nicht. Immerhin hatte sie das erreicht, was sie sich zum Ziel gesetzt hatte. Es war eine ungeheure Erleichterung.
»Kelly, Schatz!« Tom fing sie auf.
»Er wird es machen«, flüsterte sie, zutiefst erschüttert. »Er hat mir versprochen, er wird Gavin suchen.«
1
Alle Männer sind Lügner. Und alle Frauen auch. Diese Tatsache wurde mir im Alter von zwei Jahren bewusst, als mir meine Großmutter sagte, dass die Spritze, die mir der Arzt gleich verabreichen würde, nicht wehtäte, solange ich nur ein braves Mädchen wäre. Es war das erste Mal, dass mein noch junges Gehirn das verstörende Gefühl meines magischen Talentes empfand: Lügen zu erkennen und diese mit den Handlungen anderer Menschen in Verbindung zu bringen.
Menschen lügen aus vielen Gründen – um sich zu retten, um sich Ärger zu ersparen, um die Gefühle anderer Menschen nicht zu verletzen. Manipulatoren lügen, um das zu bekommen, was sie wollen. Narzissten lügen, um anderen gegenüber und vor allem sich selbst gegenüber großartig zu erscheinen. Alkoholiker, die sich auf dem Weg der Genesung befinden, lügen, um den ohnehin schon ruinierten Ruf nicht noch weiter zu verschlimmern. Und die, die uns am meisten lieben, belügen uns am häufigsten. Denn das Leben ist eine Achterbahnfahrt, und sie wollen uns vor den schlimmsten Talfahrten bewahren.
John Rutger log, weil er ein Drecksack war.
Nichts an seinem Aussehen schrie: »Hallo, ich bin ein verachtenswertes menschliches Wesen.« Als er den Hotelaufzug verließ, schien er ein durchaus angenehmer Kerl zu sein. Er war groß gewachsen, schlank und trug braunes, leicht welliges Haar, das an den Schläfen genügend grauen Strähnen aufwies, um ihn vornehm wirken zu lassen. Er besaß das Gesicht, das man von einem erfolgreichen, sportlichen Mann in seinen Vierzigern erwartete: männlich, sauber rasiert, selbstbewusst. Er war der typisch gutaussehende, ordentlich angezogene Vater, der seinen Jungen bei einem Spiel der Junior Football League lautstark unterstützte. Er war der vertrauenswürdige Börsenmakler, der seine Klienten niemals in unsichere Gewässer steuerte. Intelligent, erfolgreich, ein Fels in der Brandung. Und die wunderschöne Rothaarige, die mit ihm Händchen hielt, war nicht seine Frau.
Johns Frau hieß Liz, und vor zwei Tagen hatte sie mich angeheuert, um herauszufinden, ob er sie betrog. Sie hatte ihn schon mal dabei erwischt, vor zehn Monaten, und damals hatte sie ihm gesagt, dass sie sich das nicht noch einmal gefallen ließe.
John und die Rothaarige schlenderten durch die Lobby.
Ich saß im Loungebereich, halb verborgen hinter einer buschigen Pflanze, und tat so, als ob ich auf mein Handy starrte, während ich mit der kleinen Digitalkamera, die ich in meiner schwarzen Häkeltasche bei mir trug, die Turteltauben unauffällig filmte. Ich hatte mir die Tasche genau deswegen ausgesucht, weil sie so dekorativ löchrig war.
Rutger und sein Date blieben nur ein paar Schritte entfernt von mir stehen. Ich sorgte mit wachsender Begeisterung dafür, dass Vögel höhnisch grinsende grüne Schweine von meinem Bildschirm vertrieben. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen, nur eine junge Blondine, die neben irgendeinem Gebüsch mit ihrem Handy spielte.
»Ich liebe dich«, sagte die Rothaarige.
Die Wahrheit. Verblendete Närrin.
Die Schweine lachten mich aus. Ich war richtig scheiße bei diesem Spiel.
»Ich liebe dich auch«, sagte er zu ihr und sah ihr tief in die Augen.
Eine vertraute Verärgerung baute sich in mir auf, als ob eine unsichtbare Fliege meinen Kopf umschwirrte. Meine Magie klickte. John log. Was für eine Überraschung.
Mir tat Liz wirklich leid. Sie waren nun seit neun Jahren verheiratet und hatten zwei Kinder, einen acht Jahre alten Jungen und ein vier Jahre altes Mädchen. Sie hatte mir ihre Fotos gezeigt, als sie mir den Auftrag erteilte. Jetzt ähnelte ihre Ehe der Titanic kurz vor dem Eisberg, und ich sah ihn direkt vor mir auftauchen.
»Meinst du das wirklich?«, fragte die Rothaarige und himmelte ihn an.
»Ja. Das weißt du doch.«
Erneut meldete sich meine Magie. Lüge.
Die meisten Leute empfanden eine Lüge als anstrengend. Die Wahrheit zu verdrehen und sich eine nachvollziehbare, alternative Realität auszudenken setzte ein gutes Gedächtnis und hohe geistige Beweglichkeit voraus. Wenn John Rutger log, dann log er einem mitten ins Gesicht, direkt in die Augen blickend. Und er schien wirklich überzeugend zu sein.
»Ich wünschte mir, wir könnten zusammen sein«, sagte die Rothaarige. »Ich bin es leid, dass wir uns verstecken müssen.«
»Ich weiß. Nur ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich arbeite daran. Mach dir keine Gedanken.«
Meine Cousins waren seine Abstammung durchgegangen. John war mit keiner der wichtigen magischen Familien verbunden, deren große Unternehmen Houston besaßen. Er hatte kein Vorstrafenregister, aber da war etwas an ihm, an seiner Haltung, das mich nervös machte. Meine Instinkte sagten mir, dass er gefährlich war, und ich vertraute meinen Instinkten.
Wir hatten auch eine Bonitätsprüfung durchführen lassen. John konnte sich eine Scheidung nicht leisten. Seine Bilanz als Börsenmakler war in Ordnung, aber eine steile Karriere hatte er nicht hingelegt. Tatsächlich war er bis über beide Ohren verschuldet. Das Vermögen, das er besaß, war in Aktien angelegt, und die aufzuteilen würde ihn sehr teuer zu stehen kommen. Das wusste er auch, und so gab er sich Mühe, seine Spuren zu verwischen. Er und die Rothaarige waren in zwei verschiedenen Autos angekommen, und das mit zwanzig Minuten Unterschied. Wahrscheinlich würde er sie zuerst gehen lassen, und wenn man von seinem angespannten Rücken ausging, war diese öffentliche Zurschaustellung ihrer Liebe mitten in der Lobby nicht Teil seines Plans.
Die Rothaarige öffnete ihre Lippen, und John beugte sich zu ihr hinab, um sie pflichtbewusst zu küssen.
Liz würde uns tausend Dollar bezahlen, wenn ich ihr die notwendigen Beweise lieferte. Mehr konnte sie nicht auftreiben, ohne dass John es bemerkte. Viel war es nicht, aber wir befanden uns gerade nicht in der Situation, einen Auftrag ablehnen zu können, und was diesen anging, so war kein großer Aufwand nötig. Sobald die Turteltäubchen das Hotel verließen, würde ich das Gebäude durch den Seitenausgang verlassen, Liz Bescheid geben und unser Geld einstreichen.
Die Türflügel zum Hotel schwangen auf, und Liz Rutger betrat die Lobby.
Mein ganzer Körper geriet in Alarmbereitschaft. Warum? Warum hören die Leute nie auf mich? Wir hatten ausdrücklich vereinbart, dass sie sich auf keinen Fall in meine Arbeit einmischen würde. Da war noch nie was Gutes bei rausgekommen.
Liz sah, wie sie sich küssten, und erbleichte. John ließ seine Geliebte los. Entsetzen zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Die Rothaarige starrte ebenso entsetzt Liz an.
»Es ist nicht so, wie es aussieht«, sagte John.
Aber es war genau das, wonach es aussah.
»Hallo!«, sagte Liz erschreckend laut. Ihre Stimme drohte sich zu überschlagen. »Wer sind Sie? Ich bin nämlich seine Frau!«
Die Rothaarige drehte sich auf dem Absatz um und floh in das Innere des Hotels.
Liz wandte sich an ihren Ehemann. »Du.«
»Lass uns woanders hingehen.«
»Ach, jetzt willst du den Schein wahren? Jetzt?«
»Elizabeth.« Aus seinem Mund klang ihr Name wie ein Befehl. Oh, oh.
»Du hast alles kaputt gemacht.«
»Hör zu …«
Sie öffnete den Mund. Es dauerte einen Augenblick, bis sie die Worte aussprach, als ob sie sich dazu zwingen musste. »Ich will die Scheidung.«
Seit meinem siebzehnten Lebensjahr arbeitete ich bereits im Familienbetrieb, und so konnte ich den Augenblick, in dem das Adrenalin in Johns Adern schoss, genau erkennen. Einige Kerle laufen rot an und fangen an zu schreien. Einige erstarrten – das waren die Angstbeißer. Setze sie zu stark unter Druck, und sie flippen aus. John Rutgers Miene wurde schlagartig ausdruckslos. Auf seinem Gesicht war keine Emotion mehr zu erkennen. Seine Augen weiteten sich, und dahinter beurteilte ein gnadenloser, berechnender Verstand die Lage mit absoluter Präzision.
»Okay«, sagte John ruhig. »Lass uns darüber reden. Es geht um mehr als uns beide. Es geht auch um die Kinder. Komm, ich bringe dich nach Hause.« Er griff nach ihrem Arm.
»Fass mich nicht an«, zischte sie.
»Liz«, sagte er. Seine Stimme klang vollkommen vernünftig, er musterte sie konzentriert, raubtierhaft, wie ein Scharfschütze, der endlich sein Ziel vor Augen hat. »Das ist kein Gesprächsthema für eine Hotellobby. Mach uns doch keine Szene. Das kriegen wir besser hin. Ich fahre.«
Ich durfte Liz auf keinen Fall in seinen Wagen einsteigen lassen. Sein Blick sagte mir, dass, wenn ich es ihm erlaubte, Liz unter seine Kontrolle zu bringen, ich sie nie wiedersehen würde.
Ich reagierte sofort und stellte mich zwischen sie.
»Nevada?« Liz blinzelte und war aus dem Gleichgewicht gebracht.
»Geh jetzt«, sagte ich zu ihr.
»Wer ist das?« Johns Augen richteten sich auf mich.
So ist’s brav, schau mich an, nicht sie. Ich bin die größere Bedrohung. Ich schob Liz nach hinten und sorgte dafür, dass ich mich immer zwischen den beiden befand.
»Liz, geh zu deinem Wagen. Fahr nicht nach Hause. Geh zu einem Verwandten. Sofort.«
Die Muskeln an Johns Kinn verspannten sich, als er die Zähne zusammenbiss.
»Was?« Liz starrte mich an.
»Du hast sie angeheuert, um mir hinterherzuspionieren.« John lockerte die Schultern und drehte den Kopf von links nach rechts wie ein Preisboxer, der sich auf seinen Kampf vorbereitete. »Du hast sie in unser Privatleben geholt.«
»Sofort!«, blaffte ich sie an.
Liz wandte sich ab und rannte hinaus.
Ich hob die Hände in die Luft und wich langsam zum Ausgang zurück, immer darauf achtend, dass mich die Überwachungskamera der Lobby im Blick behielt. Hinter mir zischte die Tür, als Liz schnellen Schrittes das Gebäude verließ.
»Es ist vorbei, Mr Rutger. Ich bin keine Bedrohung.«
»Du neugierige Schlampe. Du und diese Harpyie, ihr steckt unter einer Decke.«
Der Portier tippte hektisch auf die Tasten des Telefons am Empfangstresen.
Wenn ich allein gewesen wäre, dann hätte ich mich einfach umgedreht und wäre weggelaufen. Es gibt Leute, die weichen nicht von der Stelle, egal, was passiert. In meiner Branche wird man von solchen Idealen schnellstens kuriert, vor allem, wenn man im Krankenhaus landet und eine Rechnung präsentiert bekommt, die man nicht bezahlen kann, weil man ja nicht arbeitet. Wenn sich mir also die Chance bot, dann nahm ich die Beine in die Hand. Aber ich musste Liz genügend Zeit verschaffen, damit sie ihr Auto erreichen konnte.
John hob die Arme, die Ellbogen waren gebeugt, Handinnenflächen nach oben und die Finger gespreizt. Er sah aus, als ob er zwei unsichtbare Softbälle in den Händen hielt. Die Magierhaltung. Ach, scheiße.
»Mr Rutger, tun Sie das nicht. Ehebruch ist nicht illegal. Sie haben bisher kein Verbrechen begangen. Bitte tun Sie das nicht.«
Er bedachte mich mit einem eiskalten, erbarmungslosen Blick.
»Sie können sich jetzt noch dagegen entscheiden.«
»Du hast gedacht, du könntest mich demütigen. Du hast gedacht, du könntest mich lächerlich machen.« Seine Miene verfinsterte sich, als geisterhaft magische Schatten über seine Haut glitten. Kleine rote Funken entzündeten sich oberhalb seiner Handinnenflächen und stiegen auf. Helle karmesinrote Blitze tänzelten über seine Haut bis zu seinen Fingerspitzen.
Wo zur Hölle steckten die Hotelwachleute? Im Gegensatz zu ihnen durfte ich ihn nicht zuerst angreifen – das wäre Körperverletzung, und wir konnten es uns nicht leisten, verklagt zu werden.
»Lass mich dir zeigen, was mit den Leuten passiert, die mich zu demütigen versuchen.«
Ich hechtete zur Seite.
Donner krachte.
Die Glastüren des Hotels zersplitterten. Die Druckwelle hob mich vom Boden hoch. Ich sah, wie der Stuhl aus dem Loungebereich auf mich zuraste, und warf meine Hände hoch, während ich mich in der Luft zusammenrollte. Die Mauer krachte gegen meine rechte Schulter. Der Stuhl traf meine Seite und mein Gesicht. Autsch.
Ich schlug direkt neben den Scherben eines Topfes auf, in dem sich vor wenigen Sekunden noch eine Blume befunden hatte, und kam mit Ach und Krach wieder auf die Beine.
Erneut waren die roten Funken zu sehen. Er machte sich für Runde zwei bereit.
Es heißt immer, dass eine knapp sechzig Kilogramm schwere Frau gegen einen durchtrainierten, neunzig Kilo schweren Kerl keine Chance hat. Das ist eine Lüge. Man muss sich nur dafür entscheiden, ihm wirklich wehzutun, und es dann einfach machen.
Ich schnappte mir eine schwere Scherbe und schleuderte sie John entgegen. Sie landete mit einem dumpfen Aufprall mitten auf seiner Brust und kostete ihn das Gleichgewicht. Ich stürmte auf ihn zu und riss auf dem Weg einen Taser aus meiner Tasche. Er schlug nach mir. Es war ein schneller, harter Schlag, und er landete in meiner Magengrube. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich warf mich ein letztes Mal nach vorn und rammte ihm den Taser gegen den Hals.
Der elektrische Impuls raste durch seinen Körper. Seine Augen wurden riesig.
Bitte lass ihn zu Boden gehen. Bitte.
Sein Mund klappte auf. John erstarrte und fiel um wie ein gefällter Baum.
Ich kniete mich auf seinen Hals, zog Kabelbinder aus meiner Tasche, brachte irgendwie seine Hände zusammen und fesselte ihn.
John knurrte.
Ich setzte mich neben ihn auf den Boden. Das Gesicht tat mir weh.
Aus einer Seitentür stürzten zwei Männer herbei und rannten auf uns zu. Auf ihren Jacken stand SECURITY. Toll. Jetzt tauchen sie auf. Dank sei dem Herrn für zu späte Hilfe.
In der Ferne heulten Polizeisirenen auf.
Sergeant Munoz, ein untersetzter Mann, der doppelt so alt war wie ich, starrte auf das Überwachungsvideo. Er hatte es sich schon zweimal angesehen.
»Ich konnte nicht zulassen, dass er in ihren Wagen einsteigt«, sagte ich von meinem Sitzplatz aus. Die Schulter tat mir weh, aber die Handschellen verhinderten, dass ich besänftigend über die schmerzende Stelle reiben konnte. In der Nähe von Polizisten war ich immer ziemlich aufgeregt. Ich wollte herumzappeln, aber das hätte mich nur nervös wirken lassen.
»Sie hatten recht«, sagte Munoz und tippte auf den Bildschirm. Er hatte an der Stelle angehalten, wo John Rutger nach dem Arm seiner Frau griff. »Diese Bewegung sagt einfach alles. Der Mann wird auf frischer Tat ertappt, sagt aber nicht: ›Tut mir leid, ich habe Mist gebaut.‹ Er bittet sie nicht um Vergebung und wird auch nicht wütend. Er ist eiskalt und versucht, seine Frau sofort wegzubringen.«
»Ich habe ihn nicht provoziert. Ich habe ihn nicht einmal angefasst, bis er versucht hat, mich umzubringen.«
»Das sehe ich.« Er wandte sich mir zu. »Sie haben offensichtlich einen C2-Taser. Sie wissen also auch, dass der Sicherheitsabstand bei etwa viereinhalb Metern liegt?«
»Ich wollte kein Risiko eingehen. Auf mich wirkte seine Magie elektrisch, und ich befürchtete, dass er den Stromimpuls blockieren könnte.«
Munoz schüttelte den Kopf. »Nein, er war enerkinetisch. Einfach rohe magische Energie. Ist auch bestens ausgebildet, dank der Armee der Vereinigten Staaten. Der Kerl ist ein Veteran.«
»Aha.« Das erklärte, warum Rutger so gefühlskalt reagiert hatte. Er wusste bereits, wie er mit einem Adrenalinschub umzugehen hatte. Auch die Tatsache, dass er enerkinetisch war, ergab einen Sinn. Pyrokineten konnten mit Feuer hantieren, Aquakineten mit Wasser und Enerkineten bedienten sich roher magischer Energie. Niemand war sich sicher, welcher Art dieser Energie war, aber sie kam relativ häufig vor. Wie um alles in der Welt konnte Bern das bei seinen Nachforschungen übersehen haben? Wenn ich nach Hause kam, würde ich mit meinem Cousin einiges zu besprechen haben.
Ein Uniformierter warf kurz einen Blick herein und reichte meine Lizenz an Munoz weiter. »Sie scheint sauber zu sein.«
Munoz öffnete meine Handschellen, nahm sie mir ab und reichte mir meine Tasche und meine Kamera. Dann folgten mein Smartphone und meine Brieftasche. »Wir haben Ihre Aussage, und wir haben uns Ihre Speicherkarte ausgeliehen. Sie bekommen sie später wieder. Gehen Sie nach Hause und legen Sie sich ein Eispack auf den Hals.«
Ich grinste ihn an. »Sagen Sie mir jetzt, dass ich die Stadt nicht verlassen darf, Sergeant?«
Munoz bedachte mich mit einem »Schon wieder so eine Klugscheißerin«-Blick. »Nein. Sie haben sich für einen Tausender einem Magier mit militärischer Ausbildung in den Weg gestellt. Wenn Sie das Geld so nötig haben, könnten Sie sich vermutlich nicht mal das Benzin leisten, um die Stadt zu verlassen.«
Drei Minuten später stieg ich in meinen fünf Jahre alten Mazda-Kleinbus. In meinen Papieren wurde die Farbe des Mazda als »Gold« bezeichnet. Alle anderen beschrieben ihn als »na ja, champagnerfarben« oder »irgendwie beige«. In Verbindung mit der Tatsache, dass es sich offensichtlich um eine Familienschleuder handelte, machte ihn das zum perfekten Überwachungsfahrzeug. Auf ihn achtete niemand. Einmal war ich einem Kerl auf einem nahezu leeren Highway zwei Stunden lang gefolgt, und als ihm die Versicherungsfirma später die Aufnahmen zeigte und damit bewiesen war, dass es seinem Knie absolut blendend ging, weil er in seinem El Camino problemlos schalten konnte, war er doch ziemlich überrascht gewesen.
Ich drehte den Spiegel zur Seite. Ein riesiger roter Striemen, der sich später zu einem leuchtend lilafarbenen Bluterguss entwickeln würde, verlief von meinem Hals über meine rechte Schulter. Es sah so aus, als ob sich jemand eine Handvoll Heidelbeeren genommen und sie mir einfach quer über den Körper gerieben hätte. Ein ebenso strahlend roter Fleck war auf der linken Seite an meinem Kinn zu sehen. Ich seufzte, stellte den Rückspiegel wieder ein und fuhr nach Hause.
Das war ja mal ein leichter Job gewesen. Wenigstens musste ich nicht ins Krankenhaus. Ich verzog das Gesicht. Der Striemen war der Ansicht, dass er meine Grimasse nicht mochte. Au.
Die Detektei Baylor hatte ursprünglich als Familienunternehmen begonnen. Wir waren zwar immer noch ein Familienunternehmen, praktisch betrachtet gehörte unser Unternehmen allerdings jemand anderem. Doch sie ließen uns die Geschäfte führen, wie wir es für richtig hielten. Und wir hielten uns an drei Regeln. Regel Nr. 1: Wir bleiben bei jedem Fall. Wenn uns ein Klient anheuert, dann sind wir dem Klienten verpflichtet. Regel Nr. 2: Wir brechen nicht das Gesetz. Das war eine gute Regel. So kamen wir nicht in den Knast und nicht vor Gericht. Und Regel Nr. 3, die wichtigste von allen: Am Ende eines jeden Tages mussten wir in der Lage sein, unserem Spiegelbild ins Auge blicken zu können. Den heutigen Tag legte ich unter Regel Nr. 3 ab. Vielleicht war ich ja auch verrückt, und John Rutger hätte seine Frau nach Hause gebracht, wäre vor ihr auf die Knie gefallen und hätte sie um Vergebung angefleht. Doch letzten Endes hatte ich nichts zu bedauern, und ich musste mir keinen Kopf machen, ob ich das Richtige getan hatte oder ob Liz’ beide Kinder jemals ihre Mutter wiedersehen würden.
Ihr Vater war eine ganz andere Geschichte, aber er stellte auch nicht mehr mein Problem dar. Er hatte sich das alles selbst eingebrockt.
Ich schlängelte mich in Richtung Nordwesten durch den Feierabendverkehr auf der I-290 und bog dann nach Süden ab. Einige Minuten später erreichte ich den Parkplatz vor unserem Lagerhaus. Berns abgenudelter schwarzer Civic stand auch dort, direkt neben Moms blauem Honda Element. Oh, wie schön. Alle waren zuhause.
Ich stellte den Wagen ab, ging zur Tür und gab den Zahlencode am Türschloss ein. Ein leises Klicken sagte mir, dass die Tür offen war, und ich ging hinein. Drinnen blieb ich eine Sekunde stehen, um das beruhigende Schnappen des Schlosszylinders hinter mir zu hören.
Wenn man das Lagerhaus von dieser Seite aus betrat, sah es einfach nur wie ein Büro aus. Wir hatten einige Mauern eingezogen, ein paar Glaswände, und strapazierfähigen beigefarbenen Teppich ausgelegt. Dadurch hatten wir auf der linken Seite drei Büroräume geschaffen, und auf der rechten befanden sich ein Pausenraum und das große Besprechungszimmer. Die abgehängte Decke vervollständigte die Illusion.
Ich betrat mein Büro, stellte die Tasche und die Kamera auf den Schreibtisch und nahm auf meinem Stuhl Platz. Ich sollte wirklich einen Bericht schreiben, aber fühlte mich überhaupt nicht danach. Das würde ich später erledigen.
Das Büro war schalldicht. Um mich herum herrschte vollständige Ruhe. Die vertraute leichte Note des Grapefruitkernöls in der Duftlampe stieg in meine Nase. Die Öle waren mein ganz eigener kleiner Luxus. Ich atmete den Duft ein, und ich war zuhause.
Ich hatte überlebt. Wenn ich mit dem Kopf gegen eine Mauer geprallt wäre, als mich Rutger durch die Gegend geschleudert hatte, dann hätte ich heute sterben können. In diesem Augenblick hätte ich tot sein können, anstelle hier in meinem Büro zu sitzen, nur wenige Meter entfernt von zuhause. Meine Mom stünde jetzt im Leichenschauhaus, um mich zu identifizieren. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Übelkeit regte sich in mir, und die Kehle schnürte sich mir zu. Ich beugte mich vor und konzentrierte mich auf meine Atmung. Tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Ich musste mich einfach durchbeißen.
Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen.
Langsam wich die Anspannung.
Einatmen, ausatmen.
Okay.
Ich stand auf, verließ mein Büro, durchquerte den Pausenraum, öffnete die Tür an seiner Rückseite und betrat das Lagerhaus. Ein beeindruckend breiter Flur verlief zu meiner Linken und Rechten. Der versiegelte Betonboden schimmerte matt. In gut neun Metern Höhe über mir erstreckte sich die Decke. Nachdem wir das Haus hatten verkaufen und in das Lagerhaus ziehen müssen, überlegten Mom und Dad, ob wir sein Inneres nicht wie ein richtiges Haus aussehen lassen konnten. Stattdessen hatten wir eine große Mauer eingezogen, um diesen Teil des Lagerhauses – unseren Wohnraum – von Omas Reparaturwerkstatt abzutrennen, so dass wir nicht die gesamten 2000 Quadratmeter Lagerhausfläche heizen oder klimatisieren mussten. Die restlichen Wände waren ganz organisch gewachsen, was auch nur eine beschönigende Umschreibung war für »Wir haben sie eingezogen, wenn’s nötig war, und mit dem Zeug, das wir dahatten«.
Wenn Mom mich erblickte, dann würde ich ihr nicht ohne eine gründliche medizinische Untersuchung davonkommen. Das Einzige, was ich im Augenblick tun wollte, war duschen und etwas essen. Um diese Tageszeit war sie normalerweise bei Oma, um ihr bei der Arbeit zu helfen. Wenn ich wirklich leise war, konnte ich mich einfach in mein Zimmer schleichen. Ich tapste den Flur entlang. Gewieft denken, gewieft handeln … Sei unsichtbar … Hoffentlich würde nichts passieren, was ihre Aufmerksamkeit erregte.
»Ich bringe dich um!«, brüllte eine vertraute Stimme zu meiner Rechten.
Verdammt. Arabella, wer sonst. Meine jüngste Schwester schien in Topform zu sein, wenn man von der Tonhöhe ausging.
»Oh, toll, wie erwachsen!« Und die Antwort stammte von Catalina, der Siebzehnjährigen. Zwei Jahre älter als Arabella und acht Jahre jünger als ich.
Ich musste das sofort beenden, bevor Mom herüberkam, um sich das mal anzuschauen. Ich rannte den Flur entlang zum Medienzimmer.
»Wenigstens bin ich keine dumme Schlampe, die keine Freunde hat!«
»Und ich bin wenigstens nicht fett!«
»Wenigstens bin ich nicht hässlich!«
Keine von beiden war fett, hässlich oder promiskuitiv. Aber beide waren unglaubliche Zicken, und wenn ich diesen kleinen Streit nicht schnellstens beilegen konnte, würde Mom in wenigen Sekunden auftauchen.
»Ich hasse dich!«
Ich betrat das Medienzimmer. Catalina, dünn und dunkelhaarig, stand zur Rechten und hatte ihre Arme vor der Brust verschränkt. Zur Linken hielt Bern die blonde Arabella sorgsam zurück, indem er sie an der Hüfte festhielt – und sie in die Luft gehoben hatte. Arabella war wirklich stark, aber Bern hatte die gesamte Schulzeit im Ringerteam gekämpft und ging außerdem zweimal die Woche zum Judo. Er war jetzt neunzehn und noch nicht ausgewachsen; trotzdem war er bereits 1,83 Meter und wog etwa neunzig Kilo, die zum großen Teil aus durchtrainierten, geschmeidigen Muskeln bestanden. Eine 45 Kilogramm leichte Arabella hochzuheben stellte kein Problem dar.
»Lass mich los!«, fauchte Arabella.
»Denk darüber nach, was du tust«, sagte Bern mit tiefer, geduldiger Stimme. »Wir haben uns doch geeinigt – keine Gewalt.«
»Was ist es denn diesmal?«, fragte ich.
Catalina deutete mit ihrem Zeigefinger auf Arabella. »Sie hat meine Flüssigfoundation offen gelassen. Jetzt ist sie eingetrocknet!«
Hätte ich mir ja denken können. Sie stritten sich nie um wirklich wichtige Dinge. Sie bestahlen sich nie gegenseitig, sie versuchten nie, die Beziehung der jeweils anderen zu sabotieren, und wenn jemand eine von ihnen nur schräg von der Seite ansah, würde die jeweils andere der Schwester sofort zu Hilfe kommen. Aber Gott bewahre, wenn die falsche Haarbürste benutzt und nicht ordentlich sauber gemacht wurde. Dann brach der dritte Weltkrieg aus.
»Das stimmt nicht …« Arabella erstarrte. »Nevada, was ist mit deinem Gesicht passiert?«
Alle hielten inne. Dann begannen sie alle gleichzeitig richtig laut zu reden.
»Still! Beruhigt euch, das ist nur Make-up. Ich muss lediglich unter die Dusche. Außerdem hört auf zu streiten. Wenn ihr das nicht macht, dann taucht Mom auf, und ich will nicht, dass sie -«
»Dass sie was?« Meine Mutter betrat leicht hinkend den Raum. Ihr Bein bereitete ihr wieder Schwierigkeiten. Sie war mittelgroß und früher schlank und durchtrainiert gewesen, aber die Verletzung hatte sie ans Haus gekettet. Jetzt hatte sie sanftere Rundungen, auch im Gesicht. Dunkle Augen wie ich, nur waren ihre Haare kastanienbraun.
Oma Frida folgte ihr auf dem Fuße. Sie hatte in etwa meine Größe, war dünn und hatte platingraue Locken, die mit Schmierfett durchzogen waren. Der vertraute, tröstende Geruch nach Motorenöl, Gummi und Schießpulver waberte in den Raum. Oma Frida schaute mich an, und ihre blauen Augen wurden richtig groß. Oh, nein.
»Penelope, warum ist meine Kleine verletzt?«
Ein Angriff ist die beste Verteidigung. »Ich bin nicht mehr klein. Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt.« Ich war Omas erste Enkelin. Selbst wenn ich fünfzig Jahre alt wäre und eigene Enkel hätte, würde sie mich immer noch als ihre »Kleine« bezeichnen.
»Wie ist das passiert?«, fragte Mom.
Verdammt. »Eine magische Druckwelle, eine Wand, ein Stuhl.«
»Druckwelle?«, fragte Bern.
»Der Rutger-Fall.«
»Ich dachte, er wäre ein Blindgänger.«
Ich schüttelte den Kopf. »Enerkinetische Magie. Er war Veteran.«
Berns Miene verdüsterte sich. Er runzelte die Stirn und verließ das Zimmer.
»Arabella, hol den Erste-Hilfe-Kasten«, sagte Mom. »Nevada, leg dich hin. Du könntest eine Gehirnerschütterung haben.«
Arabella rannte los.
»So schlimm ist es überhaupt nicht! Ich habe keine Gehirnerschütterung.«
Meine Mutter wandte sich mir zu und starrte mich an. Den Blick kannte ich. Sie war jetzt Sergeant Baylor. Es gab kein Entkommen.
»Haben sich die Sanitäter am Tatort um dich gekümmert?«
»Ja.«
»Was haben sie gesagt?«
Es hatte keinen Zweck, sie anzulügen. »Sie sagten, ich sollte zur Sicherheit ins Krankenhaus gehen.«
Meine Mutter starrte mich unverwandt an. »Bist du ins Krankenhaus gegangen?«
»Nein.«
»Leg dich hin.«
Ich seufzte und ergab mich in mein Schicksal.
Am nächsten Morgen saß ich im Medienzimmer und aß die Crêpes und die Würstchen, die Mom mir gemacht hatte. Mein Hals tat mir immer noch weh. Meine rechte Seite fühlte sich wesentlich schlimmer an.
Mom saß am anderen Ende der Couchgarnitur, trank einen Schluck Kaffee und machte sich dann an Arabellas Haare. Offensichtlich gehörte es in der Highschool zum letzten Schrei, aufwändig geflochtene Zöpfe zu tragen, und irgendwie hatte Arabella Mom beschwatzt, ihr zu helfen.
Auf der linken Bildschirmhälfte redete eine Nachrichtensprecherin mit unvorstellbar perfekter Frisur über die Brandstiftung in der First National, während auf der rechten Bildschirmhälfte das Inferno gezeigt wurde, in das sich das Gebäude verwandelt hatte. Die orangefarbenen Flammen züngelten aus allen Fenstern.
»Das ist furchtbar«, sagte Mom.
»Ist jemand gestorben?«, fragte ich.
»Ein Wachmann. Seine Frau und ihre beiden Kinder haben ihm sein Essen vorbeigebracht und erlitten schwere Verbrennungen, haben aber überlebt. Anscheinend war Adam Pierce in die Sache verwickelt.«
Alle in Houston kannten Adam Pierce. Magisch Begabte wurden in fünf Stufen eingeteilt: gering, mäßig, durchschnittlich, begabt und hochbegabt. Pierce war mit einem äußerst seltenen pyrokinetischen Talent geboren worden, was ihm die Edelstahl-Einstufung eingebracht hatte. Ein Pyrokinet wurde als mäßig begabt angesehen, wenn er einen Kubikfuß Eis in weniger als einer Minute schmelzen konnte. In derselben Zeit konnte Adam Pierce ein Feuer herbeibeschwören, das einen Kubikfuß Edelstahl verflüssigte. Das machte Pierce zu einem Hochbegabten, dem höchsten Rang aller magisch Begabten. Alle wollten ihn -- die Armee, das Ministerium für innere Sicherheit, die Privatwirtschaft.
Die in Houston ansässige und wohlhabende Familie Pierce besaß Firebug, Inc., den Marktführer für alles, was Industrieschmieden benötigten. Adam, gutaussehend und magisch atemberaubend, war der ganze Stolz des Hauses Pierce. Er war in liebevollstem Luxus aufgewachsen, hatte all die richtigen Schulen besucht, die richtige Kleidung getragen, und sein zukünftiger Weg war mit goldenem Glitter bestreut gewesen. Er war nicht nur ein aufgehender Stern, sondern auch der meistbegehrte Junggeselle. Dann, im fortgeschrittenen Alter von zweiundzwanzig Jahren, hatte er ihnen allen den Stinkefinger gezeigt, sich als Radikalen bezeichnet und eine Motorradgang gegründet.
Seitdem war Pierce immer wieder mal in den Nachrichten aufgetaucht, normalerweise immer im selben Atemzug mit Polizisten, Verbrechen und Anti-Establishment-Deklarationen. Die Medien liebten ihn, denn sein Name garantierte hohe Einschaltquoten.
Wie aufs Stichwort tauchte auf der rechten Bildschirmhälfte ein Foto von Pierce auf. Er trug seine typische schwarze Jeans und eine schwarze Lederjacke, die den Blick auf seine muskulöse, nackte Brust freigab. Ein keltisches Knotenmuster war auf seine linke Brust tätowiert, und ein knurrender, gehörnter Panther verzierte die rechte Seite seines Waschbrettbauchs. Lange braune Haare fielen ihm in sein schönes Gesicht, betonten die großartigsten Wangen der Welt und ein perfekt geformtes Kinn, dem ein Dreitagebart den letzten Schliff verpasste. Machte man ihn ein wenig zurecht, dann würde er fast engelsgleich wirken. So aber war er bloß ein gefallener Poser-Engel, dessen Flügel kunstvoll angesengt waren, um den optimalen Schnappschuss zu garantieren.
Ich hatte in meinem Leben genügend Biker kennengelernt. Nicht die Wochenendmotorradfahrer, die in Wirklichkeit Ärzte und Anwälte waren, sondern die echten, deren Heimat die Straße war. Sie waren hart im Nehmen, nicht sonderlich gepflegt, und sie hatten allesamt einen stählernen Blick. Pierce wirkte eher wie ein Hauptdarsteller in einem Actionfilm, der den harten Typen mimt. Er hatte allerdings das große Glück, sich selbst einen Hintergrund aus lodernden Flammen basteln zu können.
»Heiß!«, rief Arabella.
»Schluss jetzt«, sagte Mom zu ihr.
Oma Frida kam ins Zimmer. »Hallo, mein Hübscher!«
»Mutter«, knurrte Mom.
»Was denn? Ich kann’s doch nicht ändern. Er hat den Teufel im Blick.«
Pierce hatte tatsächlich den Teufel im Blick. Dunkel und unergründlich, von der Farbe frisch gemahlenen Kaffees, lauerten in diesen Augen Unberechenbarkeit und Wahnsinn. Er war durchaus eine Augenweide, aber alle Fotos von ihm wirkten inszeniert. Er schien immer zu wissen, wo die nächste Kamera wartete. Und wenn ich ihn jemals persönlich kennenlernen sollte, würde ich vor ihm weglaufen, als ob mein Rücken in Flammen stünde. Sollte ich in diesem Augenblick zögern, würde nämlich genau das passieren.
»Er hat einen Mann getötet«, sagte Mom.
»Er wurde reingelegt«, sagte Oma Frida.
»Du weißt doch nicht mal, was passiert ist«, sagte Mom.
Oma zuckte mit den Achseln. »Reingelegt. Ein so schöner Mann kann kein Mörder sein.«
Mutter starrte sie an.
»Penelope, ich bin zweiundsiebzig. Lass mir meine Fantasien.«
»Für Oma!« Arabellas Faust schoss nach oben.
»Wenn du auch weiterhin Omas willigen Handlanger abgeben willst, dann soll sie dir doch die Haare machen«, sagte Mom.
»Wir kehren nach der Pause mit ersten Erkenntnissen über die Brandstiftung zurück«, verkündete die Nachrichtensprecherin. »Außerdem das Neueste zum rattenverseuchten Park in der Innenstadt.«
Ein Bild des Bridge Park tauchte auf dem Bildschirm auf, und natürlich war die lebensgroße Bronzestatue eines Cowboys auf seinem galoppierenden Pferd Zentrum der Aufmerksamkeit.
»Sollte die Verwaltung von Harris County zu drastischen Maßnahmen greifen? Mehr nach der Pause.«
Bern kam ins Zimmer. »He, Nevada, kann ich dich mal kurz sprechen?«
Ich stand auf und folgte ihm nach draußen. Ohne ein Wort zu wechseln, gingen wir den Flur entlang in die Küche. Es war der nächstgelegene Ort, an dem uns Mom und Oma nicht belauschen konnten.
»Was ist los?«
Bern fuhr sich mit der Hand durch seine kurzen hellbraunen Haare und hielt mir eine Mappe hin. Ich öffnete und überflog sie. John Rutgers Abstammung, Kurzbiografie und Hintergrundüberprüfung. Eine Zeile war in Gelb hervorgehoben worden: Ehrenhafte Entlassung, Verschlusssache.
Ich hob meinen Zeigefinger. »Aha!«
»Aha«, bestätigte Bern.
In der Regel heuerten Arbeitgeber ehemalige Soldaten gerne an. Sie waren pünktlich, diszipliniert, höflich und in der Lage, schnelle Entscheidungen zu treffen, wenn es nötig war. Aber Kampfmagier ließen die Personalabteilung praktisch jeden Unternehmens die Beine in die Hand nehmen. Niemand wollte einen Kerl im Büro haben, der über die Fähigkeit verfügte, eine ganze Armee ausgehungerter Blutegel herbeizubeschwören. Um dieses Problem zu umgehen, hatte das Verteidigungsministerium damit begonnen, die Unterlagen von Personal mit Kampferfahrung zur Verschlusssache zu erklären. Ein versiegelter Eintrag bedeutete natürlich nicht immer einen Kampfmagier, aber ich wäre auf jeden Fall vorgewarnt gewesen. Ich hätte die Situation mit Rutger aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet.
»Ich hab’s vermasselt.« Bern lehnte sich an eine der Arbeitsflächen. Seine grauen Augen konnten sein schlechtes Gewissen nicht verbergen. »Ich hatte eine Prüfung in neuerer Geschichte. Ist nicht gerade meine Stärke, und ich brauchte mindestens eine Zwei, um mein Stipendium zu behalten, also musste ich richtig pauken. Ich habe es Leon machen lassen. Er hat sich um Abstammung und Hintergrundüberprüfung gekümmert, aber vergessen, sich in die Datenbank des Verteidigungsministeriums einzuloggen.«
»Ist schon in Ordnung«, sagte ich zu ihm. Leon war fünfzehn. Ihn länger als dreißig Sekunden ruhig sitzen zu lassen war schwieriger, als einen Sack Flöhe zu hüten.
Bern rieb sich über den Nasenrücken. »Nein. Es ist nicht in Ordnung. Du hast mich gebeten, es zu erledigen. Ich hätte es tun sollen. Du bist verletzt worden. Es wird nicht noch mal passieren.«
»Mach dir nichts draus«, beruhigte ich ihn. »Ich habe auch schon Sachen übersehen. Das passiert halt. Achte einfach nur darauf, von jetzt an immer auf der Webseite des Verteidigungsministeriums nachzuschauen. Hast du denn deine Zwei bekommen?«
Er nickte. »Tatsächlich ist das eine ziemlich interessante Sache. Kennst du die Geschichte von Mrs O’Learys Kuh?«
Geschichte hatte mir immer richtig Spaß gemacht. Ich hatte sogar überlegt, es als Nebenfach zu studieren, aber irgendwie war das wirkliche Leben dazwischengekommen. »Hat sie nicht in einer Scheune eine Laterne umgetreten, irgendwann in den 1860ern, und den Großen Brand von Chicago verursacht?«
»Im Oktober 1871«, sagte Bern. »Mein Professor glaubt nicht, dass die Kuh schuld war. Er glaubt, dass es ein Magier war.«
»1871? Da hatte man das Osiris-Serum doch gerade erst entdeckt.«
»Es ist eine richtig interessante Theorie.« Bern zuckte mit den Achseln. »Du solltest mal bei Gelegenheit mit ihm sprechen. Er ist ein ziemlich cooler Typ.«
Ich lächelte. Ich hatte vier Jahre gebraucht – einschließlich der Sommer –, um mich zu einem Abschluss in Strafrecht zu quälen, weil ich immer hatte arbeiten müssen. Bern hatte ein Stipendium bekommen, weil er schlauer war als wir alle zusammen genommen, und er brachte jetzt gute Leistungen. Er mochte sogar Seminare in seinen Nebenfächern.
»Da ist noch etwas«, sagte Bern. »Montgomery will mit uns sprechen.«
Mir rutschte das Herz in die Hose. Wir gehörten Haus Montgomery. Als unsere Ersparnisse und das Geld aus dem Verkauf unseres Hauses nicht mehr ausgereicht hatten, um Dads Arztrechnungen zu bezahlen, hatten wir unsere Firma an Montgomery verkauft. Eigentlich hatten wir sie mit einer Hypothek belastet. Unsere Frist für die Rückzahlung betrug dreißig Jahre, und wir schafften die monatliche Mindestzahlung immer nur mit Müh und Not. Die Konditionen unserer Hypothek machten uns praktisch zu einem Tochterunternehmen von Montgomery International Investigations. Bisher hatte Montgomery kein allzu großes Interesse an uns gezeigt. Wir waren zu klein, um ihnen wirklich von Nutzen zu sein, und sie hatten keinen Grund, sich unseretwegen Sorgen zu machen, solange unsere Schecks immer gedeckt waren. Und das war bisher immer der Fall. Dafür sorgte ich jeden Tag.
»Sie sagten, so schnell wie möglich«, sagte Bern.
»Hörte es sich nach einem routinemäßigen Anruf an?«
»Nein.«
Verdammt. »Sag Mom oder Oma nichts davon.«
Er nickte. »Sie würden sich nur Sorgen machen.«
»Genau. Ich rufe dich an, sobald ich weiß, worum es geht. Hoffentlich haben wir nur vergessen, ein Formular einzureichen, oder so was in der Art.«
Ich war schon fast durch die Tür, als er mir hinterherrief: »Nevada? John Rutgers Frau hat uns das Geld geschickt. Tausend Dollar, wie vereinbart.«
»Gut«, sagte ich und zog von dannen. Ich musste mir die Haare kämmen, mich vorzeigbar machen, um dann mit Höchstgeschwindigkeit quer durch die Stadt zum gläsernen Hochhaus zu rasen.
Mal ehrlich, wie schlimm konnte es schon sein?
2
Das asymmetrische Hochhaus von Montgomery International Investigations – MII –, das sich über den benachbarten Bürogebäuden erhob, wirkte wie eine Haifischflosse aus blauem Glas. Es war vierundzwanzig Stockwerke hoch, und seine kobaltblau getönten Fenster funkelten im Sonnenlicht. Seine Aufgabe war es, den Besucher zu beeindrucken und mit Ehrfurcht vor Haus Montgomerys Großartigkeit zu erfüllen. Ich versuchte ein wenig Ehrfurcht zu zeigen, konnte aber nur mit Unbehagen dienen.
Ich betrat das Hochhaus durch den Haupteingang und ging zu einem der glänzenden Aufzüge, nachdem ich einen Metalldetektor passiert hatte. Die Nachricht von Montgomery besagte sechzehnter Stock, also betrat ich den Aufzug, nachdem sich die Türflügel zischend geöffnet hatten, drückte den Knopf mit der 16 und wartete, während der Fahrstuhl leise murmelnd nach oben huschte.
Was zum Teufel konnten sie nur von uns wollen?
Als sich die Aufzugtür vor mir öffnete, gab sie den Blick auf einen großen Raum frei, in dessen Mitte ein Empfangstresen aus polierten Edelstahlrohren stand. Mindestens sieben Meter lagen zwischen dem dunkelblauen Hochglanzfußboden und der weißen Decke. Ich verließ den Aufzug, bevor er wieder seine Tür schließen konnte. Die Wände erstrahlten in reinstem Weiß, aber die vor mir liegende riesige, kobaltblaue Glasfront hinter der Rezeptionistin wirkte wie ein Filter auf das Tageslicht, so dass es den Eindruck erweckte, wir befänden uns unter Wasser. Alles fühlte sich hochmodern, makellos und nur einen Hauch herzlos an. Selbst die blütenweißen Orchideen auf dem Empfangstresen vermochten dem Raum keinerlei Wärme zu schenken. MII hätte einfach ihre Räumlichkeiten mit Geld tapezieren lassen sollen, und fertig.
Die Rezeptionistin sah zu mir auf. Sie hatte ein makelloses blassbraunes Gesicht, große blaue Augen und kunstvoll konturierte zartrosa Lippen. Die tomatenroten Haare hatte sie zu einer fehlerlosen Banane hochgesteckt. Ich konnte ihre langen Wimpern deutlich erkennen, und es gab daran nicht mal den Hauch eines Mascaraklümpchens. Sie trug ein weißes Kleid, das der Fantasie nicht viel Raum ließ.
Als die Rezeptionistin mein misshandeltes Gesicht erblickte, blinzelte sie kurz. »Kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Ich habe einen Termin mit Augustin Montgomery. Mein Name ist Nevada Baylor.« Ich lächelte.
Die Rezeptionistin stand auf. »Folgen Sie mir.«
Ich folgte ihr. Barfuß war sie vermutlich etwa so groß wie ich, aber die Stöckelschuhe brachten ihr fünfzehn zusätzliche Zentimeter ein. Ihre Absätze trommelten an der gekrümmten Wand entlang.
»Wie lange brauchen Sie?«, fragte ich.
»Wie bitte?«
»Wie lange brauchen Sie morgens, um sich für die Arbeit fertig zu machen?«
»Zweieinhalb Stunden«, sagte sie.
»Bezahlen Sie Ihnen die Überstunden?«
Sie blieb vor einer Milchglasfront stehen. Eisblumen bildeten sich auf ihrer Oberfläche, bewegten sich und vergingen in hypnotisierenden Mustern. Vereinzelt blitzte ein dünner Faden reinen Goldes auf und zerschmolz. Wow.
Ein Teil der Glasfront glitt zur Seite. Die Rezeptionistin sah mich an. Ich ging durch die entstandene Lücke hinein in ein riesiges Büro. Wir mussten uns in einer Ecke der Flosse befinden, denn die Wand zur Linken und die direkt vor mir bestanden aus blauem Glas. Ein hochmoderner weißer Schreibtisch schien nahtlos aus dem Boden emporzuwachsen. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann im Anzug. Er hielt den Kopf gesenkt, da er etwas auf einem kleinen Tablet las. Ich konnte nur dichtes dunkelblondes Haar erkennen, dessen Schnitt sicherlich ein kleines Vermögen gekostet hatte.
Ich näherte mich ihm und blieb neben einem weißen Stuhl direkt vor dem Schreibtisch stehen. Ein guter Anzug in dem Farbton zwischen Grau und richtigem Schwarz, den die Leute manchmal als »Gunmetal« bezeichnen, ein metallisches Blaugrau.
Der Mann sah zu mir auf. Manchmal verbargen Menschen mit einem Talent zur Täuschung ihre körperlichen Makel mit Hilfe ihrer Magie. Wenn man von Augustin Montgomerys Gesicht ausging, musste er ein Hochbegabter sein. Er hatte perfekte Gesichtszüge, so wie sie nur bei griechischen Statuen vorkamen, mit klaren, männlichen Linien, ohne jedoch unzivilisiert zu wirken. Er war sauber rasiert, hatte eine spitze Nase, einen entschlossen wirkenden Mund und besaß diese Art Schönheit, die man anstarren musste. Seine Haut schien fast schon zu glühen, und seine grünen Augen verrieten einen hellwachen Geist, der einen durch nahezu unsichtbare Brillengläser fixierte. Wahrscheinlich brauchte er jedes Mal, wenn er das Gebäude verließ, nur deswegen Leibwächter, um all die Bildhauer zurückzuweisen, die ihn in Marmor verewigen wollten.
Die Brille aber war die wahre Meisterleistung. Ohne sie hätte man ihn für einen Gott auf seiner Wolke halten können, doch das hauchdünne Gestell vermittelte den Eindruck, er würde doch noch mit einem Fuß auf derselben Welt wie wir Normalsterblichen stehen.
»Mr Montgomery«, sagte ich. »Mein Name ist Nevada Baylor. Sie wollten mich sprechen?«
Montgomery ignorierte beherzt die Blutergüsse in meinem Gesicht. »Bitte nehmen Sie doch Platz.« Er deutete auf den Stuhl.
Ich nahm Platz.
»Ich habe eine Aufgabe für Sie.«
Wir gehörten ihnen jetzt schon fünf Jahre lang, und sie hatten uns noch nie eine Aufgabe gegeben. Bitte lass es irgendwas Einfaches sein …
»Wir möchten, dass Sie diesen Mann festnehmen.« Er schob mir ein Foto über den Schreibtisch zu. Ich beugte mich vor.
Die wahnsinnigen Augen Adam Pierces starrten mich an.
»Ist das ein Witz?«
»Nein.«
Ich starrte Montgomery an.
»In Anbetracht der jüngsten Ereignisse macht sich die Familie Pierce Sorgen um Adams Wohlergehen. Sie möchten, dass wir ihn festnehmen. Unverletzt. Da Sie unser Tochterunternehmen sind, halten wir Sie für diese Aufgabe als bestens geeignet. Ihr Anteil am Honorar wird fünfzigtausend Dollar betragen.«
Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. »Wir sind ein kleines Familienunternehmen. Schauen Sie sich unseren Eintrag doch an. Wir sind keine Kopfgeldjäger. Wir kümmern uns um armselige Versicherungsbetrüger und Ehebrüche.«
»Nun, es ist an der Zeit, ihr Repertoire zu vergrößern. Die Erfolgsquote bei ihren Fällen beträgt neunzig Prozent. Wir haben vollstes Vertrauen in Sie.«
Wir hatten eine Erfolgsquote von neunzig Prozent, weil ich keine Fälle annahm, von denen ich wusste, dass wir damit nicht umgehen konnten. »Er ist ein übermäßig begabter Pyrokinet. Dafür haben wir nicht genügend Leute.«
Montgomery runzelte kurz die Stirn, als ob ihm das nicht gefiel. »Meinen Unterlagen zufolge haben Sie eine Vollzeit- und fünf Teilzeitstellen. Rufen Sie Ihre Leute zusammen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe.«
»Haben Sie sich die Mühe gemacht, die Geburtsdaten der Teilzeitstellen zu kontrollieren? Ich werden Ihnen die Mühe ersparen: Drei von ihnen sind jünger als sechzehn, und einer ist gerade erst neunzehn geworden. Das sind meine Schwestern und Cousins. Sie verlangen von mir, mit Kindern auf die Jagd nach Adam Pierce zu gehen.«
Montgomerys Finger huschten kurz über seine Tastatur. »Hier steht, dass Ihre Mutter eine hochdekorierte Veteranin ist.«
»Meine Mutter wurde 1995 bei einem Einsatz in Bosnien schwer verletzt. Man hat sie gefangen genommen und zusammen mit zwei anderen Soldaten zwei Monate lang in ein Loch gesteckt. Man hielt sie für tot, und sie wurde nur rein zufällig gerettet. Diese Tortur hat an ihrem linken Bein für bleibende Schäden gesorgt. Ihre Maximalgeschwindigkeit beträgt acht Kilometer die Stunde.
Montgomery lehnte sich zurück.
»Ihr magisches Talent liegt in ihrer Augen-Hand-Koordination«, fuhr ich fort. »Sie kann Leuten aus sehr großer Entfernung in den Kopf schießen, was uns aber überhaupt nichts bringt, weil sie Pierce lebend wollen. Und meine eigene Magie …«
Montgomery musterte mich neugierig. »Ihre Magie?«
Mist. In ihren Unterlagen stand, dass ich ein Blindgänger war. »… ist nicht vorhanden. Das ist ein Selbstmordkommando. Sie haben tausendmal mehr Leute und noch viel mehr Möglichkeiten. Warum tun Sie uns das an? Glauben Sie überhaupt, dass wir eine Chance haben?«
»Ja.«
Meine Magie klickte. Er hatte gerade gelogen. Diese Erkenntnis war wie ein Schlag in die Magengrube.
»So ist das also? Sie wissen genau, dass Pierce festzunehmen nicht nur schwierig, sondern auch teuer sein wird. Sie werden einige Ihrer Leute verlieren, erstklassig ausgebildetes Personal, in das Sie Zeit und Geld investiert haben, und am Ende wird Sie die Geschichte mehr kosten, als die Familie Ihnen zahlen wird. Aber wahrscheinlich können Sie Haus Pierce keine Bitte abschlagen. Also geben Sie uns diesen Auftrag, und wenn der katastrophal scheitert, können Sie ihnen unsere Zahlen zeigen. Sie können den Pierces beweisen, dass Sie Ihre besten sechs Leute mit einer neunzigprozentigen Erfolgsquote auf die Sache angesetzt haben. Sie haben getan, was Sie konnten. Sie gehen davon aus, dass wir scheitern und wahrscheinlich sterben werden. Alles nur, um Ihren Gewinn und Ihr Gesicht zu wahren.
»Es gibt keinen Grund, sich aufzuspielen.«
»Ich mache es nicht.« Ich konnte es nicht. Das war unmöglich.
Montgomery ließ seine Finger erneut über die Tastatur klappern und drehte dann den Bildschirm zu mir. Ein Dokument war aufgerufen worden, auf dem ein Abschnitt gelb hervorgehoben war.
»Das ist Ihr Vertrag. In diesem gelb unterlegten Abschnitt steht, dass einen Auftrag MIIs abzulehnen einem Vertragsbruch gleichkommt und Ihre Hypothek per sofort und vollständig zurückgezahlt werden muss.«
Ich biss die Zähne zusammen.
»Können Sie den ausstehenden Geldbetrag vollständig zurückzahlen?«
Ich wünschte mir, über den Tisch zu langen und ihn erwürgen zu können.
»Miss Baylor.« Er sprach langsam, als ob ich schwerhörig sei. »Können Sie den ausstehenden Geldbetrag zurückzahlen?«
Ich entspannte meine Kiefermuskulatur wieder. »Nein.«
Montgomery breitete die Arme aus. »Lassen Sie mich dies in aller Deutlichkeit sagen: Sie nehmen die Aufgabe an, oder wir nehmen Ihnen Ihre Firma.«
»Sie lassen mir keine Wahl.«
»Natürlich haben Sie eine Wahl. Sie können die Aufgabe annehmen oder Ihre Geschäftsräume frei machen.«
Wir würden alles verlieren. Das Lagerhaus gehörte der Firma. Die Autos gehörten der Firma. Wir wären obdachlos. »Wir haben unsere Ratenzahlungen immer pünktlich geleistet. Wir haben Ihnen nie irgendwelche Probleme bereitet.« Ich zog mein Portemonnaie aus meiner Tasche, holte das Foto meiner Familie hervor und legte es auf den Schreibtisch. Wir hatten es vor ein paar Monaten gemacht, und wir hatten uns nur mit Mühe in ein Bild quetschen können. »Ich bin alles, was sie haben. Unser Vater ist tot, meine Mutter arbeitsunfähig. Wenn mir etwas zustößt, dann kommt niemand mehr für ihren Unterhalt auf.«
Er warf einen Blick auf das Foto. Die Andeutung einer Emotion huschte über sein Gesicht, dann sah er mich wieder ausdruckslos an. »Ich brauche eine Antwort, Miss Baylor.«
Vielleicht brauchte ich mich ja gar nicht in die Sache reinzuhängen. Das ging mir zwar gegen den Strich, aber ich würde alles tun, um unser Überleben zu sichern. »Was, wenn die Cops ihn zuerst fangen?«
»Dann verlieren Sie Ihr Geschäft. Sie müssen ihn zu uns bringen, lebend und bevor die Behörden ihn in die Hände bekommen können.«
Verdammt. »Was passiert, wenn ich sterbe?«





























