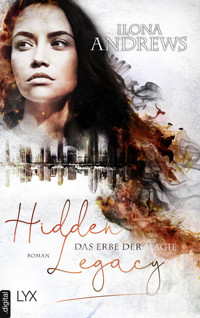11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kate-Daniels-Reihe
- Sprache: Deutsch
Alle sieben Jahre wird die Stadt Atlanta von einer magischen Flut heimgesucht, die das Gleichgewicht der Mächte gefährlich ins Wanken bringt. Als die Söldnerin Kate Daniels von Curran, dem Herrn der Gestaltwandler, den Auftrag erhält, gestohlene Landkarten aufzuspüren, wird ihr bald klar, dass diesmal weitaus mehr auf dem Spiel steht: Zwei uralte Gottheiten wollen das Aufflammen magischer Energie nutzen, um die Herrschaft der Welt an sich zu reißen. Und wenn Kate sie nicht aufhalten kann, droht die Vernichtung Atlantas ... Fortsetzung der erfolgreichen Urban-Fantasy-Serie mit ihrer charismatischen Heldin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Impressum
Ilona Andrews
DIE DUNKLE FLUT
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Jochen Schwarzer
Gewidmet dem Andenken an David Gemmell
Kapitel 1
Das Telefon klingelte mitten in der Nacht. Die Woge der Magie war auf dem Höchststand, daher hätte das Telefon gar nicht funktionieren dürfen, aber es klingelte dennoch, immer und immer wieder, empört, dass es nicht beachtet wurde, bis ich schließlich abnahm.
»Nnnja?«
»Raus aus den Federn, Kate!« Die sonore, kultiviert klingende Stimme am anderen Ende deutete auf einen schlanken, eleganten, gut aussehenden Mann hin – all das, was Jim nicht war. Zumindest nicht in seiner Menschengestalt.
Ich öffnete die Augen gerade so weit, dass ich einen kurzen Blick auf die mechanische Uhr am anderen Ende des Zimmers werfen konnte. »Es ist zwei Uhr früh. Manche Leute schlafen um diese Uhrzeit.«
»Ich habe einen Job für uns«, sagte Jim
Mit einem Schlag saß ich hellwach im Bett. Ein Job – das war gut, ich brauchte dringend Geld. »Die Hälfte.«
»Ein Drittel.«
»Die Hälfte.«
»Fünfunddreißig Prozent.« Jims Stimme bekam einen harten Klang.
»Die Hälfte.«
Am anderen Ende herrschte Schweigen. Mein ehemaliger Gildenpartner dachte nach. »Also gut. Vierzig Prozent.«
Ich legte auf. Im Schlafzimmer war es still. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, und durch das Gitter vor dem Fenster fiel Mondschein herein. Das Mondlicht wirkte als Katalysator und ließ, wo der Silberanteil der Legierung mit dem magischen Wehr reagierte, eine bläuliche Patina über die Gitterstäbe glimmen. Hinter dem Gitter schlief die Stadt, Atlanta, dunkel und trügerisch friedlich, wie ein Ungetüm aus einer Legende. Wenn die Woge der Magie erst vorüber war, würde dieses Ungeheuer wieder erwachen – als aufleuchtendes Lichtermeer, von dem ab und an Schüsse herüberhallten.
Gegen Kugeln war mein Wehr nicht gefeit, aber den Wahnsinn der Magie hielt es aus meinem Schlafzimmer fern, was für den Anfang ja auch schon ganz okay war.
Das Telefon meldete sich erneut. Ich ließ es zweimal klingeln, dann nahm ich ab.
»Also gut«, knurrte Jim. »Halbe-halbe.«
»Wo bist du?«
»Auf dem Parkplatz unter deinem Fenster.«
Er rief also von einem Münzfernsprecher an, der ebenfalls nicht hätte funktionieren dürfen. Ich schnappte mir meine Klamotten, die für derlei Gelegenheiten neben dem Bett bereitlagen. »Worum geht’s denn?«
»Um irgend so einen Feuerteufel.«
Eine Dreiviertelstunde später tappte ich durch eine Tiefgarage. Da die Magie das elektrische Licht ausgeknipst hatte, konnte ich die Hand vor Augen nicht sehen.
In den stockdunklen Tiefen der Garage leuchtete ein Feuerball auf. Lodernd und tosend schoss er auf mich zu. Ich sprang hinter einen Betonpfeiler, den Griff meines Wurfmessers in der schweißnassen Hand. Hitze umhüllte mich. Für einen Moment verschlug es mir den Atem, und dann raste das Feuer an mir vorbei und zerstob an der nächsten Mauer in tausend Funken.
Aus den Tiefen der Garage erklang schadenfrohes, meckerndes Gelächter. Ich spähte hinter dem Pfeiler hervor. In der Dunkelheit war nichts zu erkennen. Wo blieb die Technik, wenn man sie mal brauchte?
Hinter der nächsten Pfeilerreihe hob Jim eine Hand und ahmte mit Daumen und Zeigefinger pantomimisch einen schnatternden Schnabel nach. Er wollte, dass ich diesen Wahnsinnigen, der bereits vier Menschen in qualmende Fleischklumpen verwandelt hatte, in ein Gespräch verwickelte. Okay. Nichts leichter als das.
»Also gut, Jeremy!«, rief ich in die Dunkelheit. »Du gibst mir jetzt den Salamander! Und ich schlag dir dafür nicht den Kopf ab!«
Jim hielt sich eine Hand vors Gesicht und bebte. Es sah aus, als lachte er, aber sicher konnte ich mir da nicht sein, denn im Gegensatz zu ihm verfügte ich über kein sehr gutes Nachtsichtvermögen.
Jeremys meckerndes Gelächter steigerte sich ins Hysterische. »Halt die Schnauze, dumme Fotze!«
Jim löste sich von dem Pfeiler und verschwand, Jeremys Stimme folgend, in der Finsternis. Bei schwachem Licht sah er besser als ich, doch in vollkommener Dunkelheit ließ auch seine Sicht ihn im Stich. Dann musste er sich auf sein Gehör verlassen, und das bedeutete, dass ich Jeremy am Reden halten musste. Und während sich Jim an Jeremys Stimme heranpirschte, pirschte sich Jeremy an mich heran.
Kein Grund zur Panik, schließlich war er ja bloß ein mordgieriger Pyromane, der mit einem Salamander in einer verzauberten Glaskugel bewaffnet und darauf aus war, das, was von Atlanta noch stand, auch noch niederzubrennen.
»Also bitte, Jeremy. Dein Wortschatz lässt wirklich zu wünschen übrig. Es gibt so viele schöne Schimpfnamen, mit denen du mich belegen könntest, und das Beste, was dir einfällt, ist ›dumme Fotze‹? Gib mir lieber den Salamander, eh du dir noch wehtust.«
»Du kannst mich mal, du … Nutte!«
Links flammte ein Funke auf. Er schwebte in der Dunkelheit und beleuchtete das schuppige Maul des Salamanders und Jeremys Hände, die die Glaskugel umklammert hielten. Das Zauberglas tat sich auf und entließ den Funken. Als die darin geballte Energie auf Luft traf, wuchs der Funke zu einem Feuerball.
Ich warf mich wieder hinter den Pfeiler, und das Feuer brandete an den Beton. Beiderseits schossen Flammen vorüber. Beißender Schwefelgestank.
»Der ging ja meilenweit vorbei! Das war ja genau so ein Blindgänger, wie du selbst einer bist, Jeremy!«
»Friss Scheiße und stirb!«
Jim musste mittlerweile ganz nah an ihm dran sein. Ich trat hinter dem Pfeiler hervor. »Komm doch her, Schwachkopf! Kriegst du denn gar nichts auf die Reihe?«
Ich sah Flammen, hechtete zur Seite und rollte mich auf dem Boden ab. Über mir heulte das Feuer wie ein wütendes Tier. Der Messergriff verbrannte mir die Finger. Die Luft in meiner Lunge glühte, und mir tränten die Augen. Ich drückte mein Gesicht an den staubigen Beton und hoffte, dass es nicht noch heißer würde, und dann war es mit einem Mal vorbei.
Jetzt reichte es mir. Ich sprang auf und stürzte in Jeremys Richtung. Der Salamander in der Kugel leuchtete auf. Ich sah Jeremys Grinsen über der Glaskugel. Es verschwand schlagartig, als sich Jims dunkle Hände um Jeremys Hals schlossen. Der sank, schlaff wie eine Lumpenpuppe, in sich zusammen, und die Kugel kullerte aus seinen geschwächten Händen …
Ich hechtete danach und fing sie eine Handbreit über dem Betonboden auf. Dann fand ich mich Auge in Auge mit dem Salamander wieder. Rubinrote Augen betrachteten mich mit mäßigem Interesse, schwarze Lippen teilten sich, und eine lange, fadenschlanke Zunge glitt aus dem Maul und leckte über das gläserne Spiegelbild meiner Nase. Ja, du bist mir auch sehr sympathisch.
Vorsichtig erhob ich mich, erst auf die Knie, dann auf die Füße. Nun drang die Aura des Salamanders auf mich ein, bemüht, gefällig zu sein, wie ein verschmustes Kätzchen, das einem den Buckel entgegenreckte, damit man es streichelte. Visionen von Flammenmeeren und Hitzewogen kamen mir in den Sinn. Lass uns irgendwas abfackeln … Schnell drängte ich diesen Einfluss aus meinem Hirn.
Jim ließ Jeremy los, und der Feuerteufel sank wie ein nasser Sack zu Boden. Das Weiße seiner Augen starrte aus seinem ausdruckslosen Gesicht an die Decke, vom Tod kalt erwischt. Dem musste man nicht mehr den Puls fühlen. Mist. Damit war die Fangprämie zum Teufel.
»Du hast doch gesagt, lieber lebend als tot«, murmelte ich. Lebend wäre Jeremy viel mehr wert gewesen. Wir würden zwar dennoch das Kopfgeld kassieren, aber Jim hatte soeben ein Drittel der Summe in den Wind geschossen.
»Stimmt.« Jim drehte die Leiche auf die Seite, sodass wir den Rücken sahen. Zwischen Jeremys Schulterblättern ragte ein dünner Metallbolzen hervor, der am Ende mit drei schwarzen Federn versehen war. Ehe mein Hirn klären konnte, was das bedeuten mochte, hatte ich mich schon zu Boden geworfen, den Salamander mit sicherem Griff in den Händen. Jim gelang es irgendwie, sogar noch schneller in Deckung zu gehen.
Wir starrten in die Dunkelheit. Stille.
Jemand hatte unsere Zielperson mit einer Armbrust erschossen. Dieser Jemand hätte genauso gut auch uns beide umnieten können. Wir hatten mindestens vier Sekunden lang bei der Leiche gestanden. Das war mehr als genug Zeit, um zwei weitere Bolzen abzuschießen. Ich berührte Jim und legte mir dann einen Finger an die Nase. Er schüttelte den Kopf. Bei dem Schwefelgestank, der hier in der Luft hing, war sein Geruchssinn überfordert. Ich lag reglos da und atmete flach. Jetzt galt es, die Ohren zu spitzen.
Eine Minute verging, eine Minute, die sich ewig hinzuziehen schien und in der alles still blieb. Dann erhob sich Jim ganz langsam, ging in die Hocke und wies mit einer Kopfbewegung nach links. Ich hatte vage das Gefühl, dass sich der Ausgang eher rechts befand, traute aber in dieser Dunkelheit, in der uns womöglich immer noch der unbekannte Armbrustschütze auflauerte, eher Jims Sinnen als meinen.
Jim warf sich den toten Jeremy über die Schulter, und dann brachen wir auf, geduckt und schnell, er voran und ich, die kaum etwas sah, hinterher. Betonpfeiler rauschten vorüber – einer, zwei, drei, vier. Dann kehrte mit einem Schlag die Technik zurück, und ehe ich meinen eben erhobenen Fuß wieder absetzen konnte, wich die Magie aus der Welt. Die Leuchtstoffröhren an der Decke sprangen an und tauchten die Tiefgarage in schummriges Kunstlicht. Drei Meter vor uns klaffte das dunkle Rechteck des Ausgangs. Jim hechtete hinein. Ich sprang nach links, hinter den nächsten Pfeiler. Der Salamander in der Glaskugel hatte aufgehört zu leuchten und schlief ein. Er sah nun aus wie ein harmloser schwarzer Lurch. Meine tolle Fernwaffe machte einfach so schlapp.
Ich setzte die Kugel auf dem Boden ab und zog Slayer aus der Scheide. Diese Salamander wurden sowieso völlig überschätzt.
»Er ist weg«, sagte Jim und wies hinter mich.
Ich sah mich um. Am anderen Ende war die Betonmauer an einer Stelle eingestürzt und gab den Blick auf einen schmalen Durchgang frei, der wahrscheinlich zur Straße hinaufführte. Jim hatte recht. Wenn der Armbrustschütze uns hätte umlegen wollen, hätte er dazu wahrhaftig genug Zeit gehabt.
»Dann hat er also unsere Zielperson aus dem Hinterhalt erschossen und ist anschließend abgehauen?«
»Sieht ganz so aus.«
»Das versteh ich nicht.«
Jim schüttelte den Kopf. »Wenn du dabei bist, passieren doch immer seltsame Sachen.«
»Den Job hast du aufgetan, nicht ich.«
Über der Ausgangstür sprühten Funken, und ein grünes EXIT-Schild sprang an.
Jim starrte es einen Moment lang an, und auf seinem Gesicht erschien ein katzenhafter Ausdruck, eine Mischung aus Empörung und Fatalismus, dann schüttelte er erneut den Kopf.
»Ich kriege aber den Bolzen, den er im Rücken hat«, sagte ich.
»Gern.«
Jims Pieper meldete sich. Er sah nach, und eine mir allzu bekannte, maskenhaft-ausdruckslose Miene überschattete sein Gesicht.
»Oh, nein, bitte nicht! Ich kann ihn nicht alleine tragen!«
»Das Rudel ruft.« Er lief hinaus.
»Jim!«
Ich verkniff es mir, ihm irgendetwas hinterherzuschleudern. Es geschah mir ja eigentlich ganz recht, wenn ich mit einem Mitglied des Rudelrats so einen Auftrag übernahm. Denn es war ja nicht so, dass Jim kein guter Freund war. Aber für einen Gestaltwandler ging das Rudel nun mal immer vor. Auf einer Skala von eins bis zehn stand das Rudel auf elf und alles andere auf eins.
Ich sah zu dem mausetoten Jeremy hinüber, der wie ein Sack Kartoffeln auf dem Boden lag. Er wog schätzungsweise um die siebzig Kilo. Ich konnte unmöglich gleichzeitig ihn und den Salamander forttragen. Und ebenso unmöglich konnte ich den Salamander dort unbeaufsichtigt zurücklassen. Die Magie konnte jederzeit wiederkehren und den kleinen Lurch erneut zum Glühen bringen. Außerdem war der Heckenschütze womöglich noch ganz in der Nähe. Ich musste da weg, und zwar schnell.
Jeremy und der Salamander – beide waren jeweils vier Riesen wert. Ich arbeitete nicht mehr oft für die Gilde, und derart fette Jobs kamen mir nur selten unter. Auch nachdem ich das Kopfgeld fifty-fifty mit Jim geteilt hatte, konnte ich davon zwei Monate meine Hypothekenraten bezahlen. Bei der Vorstellung, viertausend Dollar dort auf dem Boden liegen zu lassen, packte mich ein geradezu körperlicher Widerwille.
Ich sah Jeremy an. Ich sah den Salamander an. Immer diese Entscheidungen.
Der Kopfgeldbuchhalter der Söldnergilde, ein kleiner, schlanker, dunkelhaariger Mann, starrte Jeremys Kopf auf dem Tresen an. »Wo ist denn der Rest von dem?«
»Ich hatte da ein kleines logistisches Problem.«
Er lächelte breit. »Jim hat dich im Stich gelassen, stimmt’s? Das macht dann also nur einen Fangschein?«
»Nein, zwei.« Jim hatte sich mir gegenüber ja vielleicht mies verhalten, aber ich würde ihn nicht um seinen Anteil bescheißen. Er würde seinen Fangschein bekommen, der ihn dazu berechtigte, seine Hälfte des Kopfgelds einzustreichen.
»Na, wenn du meinst.« Er knallte mir einen Stapel Formulare auf den Tresen. »Bitte ausfüllen.«
Dieser mindestens zwei Zentimeter dicke Papierstapel versprach, mich locker eine Stunde lang zu beschäftigen. Die Gilde selbst hatte recht laxe Regeln – da es sich dabei um einen Zusammenschluss von Söldnern handelte, achtete sie fast nur darauf, dass die Kohle stimmte –, doch so ein Todesfall musste der Polizei gemeldet werden, und das brachte eine Menge Formalitäten mit sich.
Ich bedachte das oberste Formular mit einem bösen Blick. »Das R-20 muss ich aber nicht ausfüllen.«
»Stimmt, du arbeitest ja jetzt für den Orden.« Der Buchhalter nahm die obersten acht Seiten wieder fort. »So, bitte schön, eine kleine Erleichterung für unsere VIP.«
»Juhu!« Ich griff mir den Papierstapel.
»Ach, übrigens, Kate, ich wollte dich was fragen.«
Und ich wollte die Formulare ausfüllen und heim ins Bett. »Schieß los.«
Er griff unter den Tresen. Die Söldnergilde residierte in einem ehemaligen Sheraton-Hotel am Rande von Atlanta-Buckhead, und dieser Tresen hatte damals zu einer Hotelbar gehört. Der Buchhalter holte eine dunkelbraune Flasche hervor und stellte sie mit einem Glas vor mich hin.
»Äh, danke, aber ich steh nicht so auf geheimnisvolle Liebestränke.«
Er lachte. »Das ist Hennessy. Cognac. Sehr guter Stoff. Ich wollte dir nur etwas zu trinken anbieten.«
»Danke, aber ich trinke nicht.« Nicht mehr jedenfalls. Bei mir daheim hatte ich für den äußersten Notfall immer noch eine Flasche Boone’s Farm Sangria im Schrank, aber Hochprozentiges kam überhaupt nicht infrage. »Was wolltest du mich fragen?«
»Wie ist es denn so, für den Orden zu arbeiten?«
»Willst du wechseln?«
»Nö, ich bin hier ganz zufrieden. Aber ich habe einen Neffen. Und der will Ritter werden.«
»Wie alt?«
»Sechzehn.«
Bestens. Der Orden hatte sie gern so jung. In dem Alter ließen sie sich noch leicht einer Gehirnwäsche unterziehen. Ich nahm mir einen Stuhl. »Ein Glas Wasser würde ich schon trinken.«
Er brachte mir das Wasser, und ich trank einen Schluck. »Der Orden macht im Grunde das Gleiche wie wir: Sie entsorgen magisches Gefahrengut jeder Art. Mal angenommen, man hat nach einer Magiewoge eine Harpyie bei sich im Baum sitzen. Dann ruft man als Erstes die Polizei.«
»Wenn man dumm ist«, sagte der Buchhalter und grinste.
Ich zuckte die Achseln. »Die Polizei wird einem sagen, dass sie gerade voll ausgelastet ist – mit einem Riesenwurm, der drauf und dran ist, ein ganzes Gerichtsgebäude zu verschlingen. Sie wird einem sagen, dass man sich von der Harpyie fernhalten soll und dass sie kommen, sobald sie können. Das übliche Blabla. Dann ruft man bei der Gilde an. Warum sollte man so lange warten, wenn ein paar Söldner für dreihundert Dollar kurzen Prozess mit der Harpyie machen und anschließend dem kleinen Sohnemann auch noch eine hübsche Schwanzfeder für seine Mütze schenken. Nicht wahr?«
»Stimmt.«
»Aber wenn man nun nicht einfach so dreihundert Dollar übrig hat … Oder wenn es sich um einen Kode zwölf handelt – eine Sache, die zu haarig ist, als dass die Gilde sich darum kümmern könnte … Und da hockt immer noch diese Harpyie im Baum, und man will, dass sie verschwindet. Dann ruft man beim Orden an, denn man hat gehört, dass die nicht so viel Geld dafür verlangen. Sie bitten dich, in ihre Niederlassung zu kommen, und da sprichst du dann mit einem netten Ritter, der deine Einkommenssituation durchcheckt und dir anschließend die gute Nachricht überbringt: Da sie ermittelt haben, dass du dir mehr nicht leisten kannst, werden sie dir dafür nur fünfzig Dollar berechnen. Dein Glückstag.«
Der Buchhalter sah mich argwöhnisch an. »Und wo ist der Haken?«
»Der Haken ist der: Sie geben dir einen Wisch, den du unterschreiben sollst. Dein Hilfegesuch an den Orden. Und darin steht in Großbuchstaben, dass du den Orden dazu ermächtigst, jedwede Gefahr für die Menschheit zu beseitigen, die sich im Zusammenhang mit diesem Fall ergeben könnte.«
Der Orden der mildtätigen Hilfe hatte seinen Namen gut gewählt. Er bot tatsächlich mildtätige Hilfe, meist per Kugel oder Klinge. Das Dumme war bloß, dass man dort manchmal mehr Hilfe bekam, als einem lieb war.
»Nun sagen wir mal, du unterschreibst das Hilfegesuch. Dann kommen die Ritter zu dir raus und beobachten die Harpyie. Als Nächstes fällt dir auf, dass jedes Mal, wenn du das verdammte Ding entdeckst, deine alte, senile Tante verschwunden ist. Du behältst die alte Dame also im Auge, und es kommt, wie es kommen musste: Als die Magie wiederkehrt, verwandelt sie sich prompt in eine Harpyie. Da sagst du den Rittern natürlich, dass du die ganze Sache abblasen willst – denn du liebst deine alte Tante, und sie tut ja auch keinem was, wenn sie da im Baum hockt. Die Ritter aber erzählen dir, dass fünf Prozent aller Harpyien eine tödliche Krankheit an den Klauen tragen und dass sie daher eine Gefahr für die Menschheit darstellen. Du wirst wütend, du brüllst rum, du rufst die Bullen, aber die Bullen sagen dir, das sei alles vollkommen legal und sie könnten nichts dagegen unternehmen. Du versprichst ihnen, dass du deine Tante in Zukunft wegschließen wirst. Du versuchst sie zu bestechen. Du zeigst auf deine Kinder und erzählst, wie sehr sie die alte Dame lieben. Du weinst. Du flehst. Aber es nützt alles nichts.« Ich trank mein Glas aus. »Und so ist das, wenn man für den Orden arbeitet.«
Der Buchhalter schenkte sich einen Cognac ein und trank das Glas auf einen Zug aus. »Ist das wirklich so geschehen?«
»Ja.«
»Und sie haben die alte Dame getötet?«
»Ja.«
»Großer Gott.«
»Wenn dein Neffe der Meinung ist, er wäre zu so etwas in der Lage, dann sollte er sich bei der Akademie bewerben. Er ist jetzt im richtigen Alter. Das Ganze ist körperlich sehr anstrengend, und man muss büffeln wie ein Blöder, aber wenn er wirklich Bock drauf hat, wird er es schon schaffen.«
»Woher weißt du das?«
Ich nahm den Stapel Formulare vom Tresen. »Als ich ein kleines Mädchen war, hat mein Vormund mich dort angemeldet. Er war ein Wahrsager des Ordens.«
»Echt? Und wie lange hast du es da ausgehalten?«
»Zwei Jahre. Und ich war eine gute Schülerin, in allem, bloß nicht, was die Konditionierungen anging. Ich habe ein Autoritätsproblem.« Ich verabschiedete mich mit einem Winken und wechselte mit meinem Papierkram an einen der Tische im Foyer.
In Wahrheit war ich keine gute Schülerin gewesen. Sondern eine sehr gute. Ich hatte die Prüfungen mit Auszeichnung bestanden und war zum Knappen der Stufe Elektrum ernannt worden. Aber ich hatte es gehasst. Der Orden verlangte bedingungslose Hingabe, doch ich verfolgte bereits ein anderes Ziel. Ich wollte den mächtigsten Mann der Welt töten, und wenn man solche Ambitionen hegt, bleibt für andere Dinge nicht mehr viel übrig. Ich brach die Ausbildung ab und begann für die Söldnergilde zu arbeiten. Greg brach es das Herz.
Greg war ein fabelhafter Vormund gewesen und hatte alles darangesetzt, mich zu beschützen. Und für Greg war der Orden etwas, das Sicherheit bot. Wenn der Mann, auf den ich es abgesehen hatte, von meiner Existenz erfahren hätte, hätte er mich umgebracht, und weder Greg noch ich hätten die Macht besessen, etwas dagegen zu unternehmen. Zumindest noch nicht. Wenn ich mich aber dem Orden angeschlossen hätte, hätten mich all die Ritter vor dieser Gefahr beschützt. Doch das war es nicht wert, und daher hatte ich dem Orden Lebwohl gesagt und nie mehr zurückgeblickt.
Doch dann war Greg ermordet worden. Um seinen Mörder zu finden, war ich zum Orden gegangen und hatte mich in die Ermittlungen eingeschaltet. Und ich hatte den Mörder gefunden und zur Strecke gebracht. Im Zuge dieser scheußlichen Affäre war meine Akademie-Akte wieder aufgetaucht und der Orden auf den Trichter gekommen, dass sie mich wiederhaben wollten. Sie dachten sich einen Job für mich aus – Verbindungsperson zwischen Söldnergilde und Orden – und boten mir eine ganze Menge an: Gregs Büro, seine Akten, die Befugnis, mich um kleinere Fälle zu kümmern, ein festes Gehalt. Ich sagte zu. Ein Grund war mein schlechtes Gewissen: Nachdem ich die Ausbildung an der Akademie abgebrochen hatte, war ich Greg aus dem Weg gegangen. Ein anderer war der gesunde Menschenverstand: Ich hatte sowohl für das Haus meines Vaters in der Nähe von Savannah als auch für Gregs Wohnung hier in Atlanta Hypothekendarlehen abzuzahlen. Eins der beiden aufzugeben hätte sich angefühlt, als hätte man mir ein Stück aus meinem Körper herausgerissen. Die Jobs für die Gilde waren lukrativ, aber ich war nur für ein kleines Revier nahe Savannah zuständig, und dort ergab sich nur alle paar Monate mal so ein Auftrag. Die Verlockung regelmäßiger Einkünfte erwies sich einfach als zu stark.
Meine Zugehörigkeit zum Orden sollte keine Dauereinrichtung werden. Doch bis jetzt lief alles rund. Ich war mit keiner meiner beiden Zahlungsverpflichtungen im Rückstand, und sobald ich diese Formulare ausgefüllt hatte, konnte ich wieder ein, zwei Monate lang meine Rechnungen bezahlen.
Nachdem ich zehnmal meine Söldnerausweisnummer auf allen möglichen Papieren vermerkt hatte, kam ich in den Genuss eines Fragebogens, bei dem ich nur »Ja« oder »Nein« anzukreuzen brauchte. Ja, ich hatte in Notwehr gehandelt. Nein, ich fand nicht, dass es bei der Überwältigung des Verdächtigen zu übertriebener Gewaltanwendung gekommen war. Ja, ich hatte den Eindruck gehabt, dass der Verdächtige eine Gefahr für mich und andere darstellte. Als ich dann bei dem Abschnitt anlangte, bei dem ich die Vorgänge mit eigenen Worten schildern sollte, hätte ich Streichhölzer gebraucht, um meine Augen offen zu halten. Bei der Frage »Welche Absichten verfolgte der Verdächtige Ihrer Meinung nach?« schrieb ich: »Er wollte die Stadt niederbrennen. Er war nämlich vollkommen übergeschnappt.«
Als ich endlich die schweren Stahltüren der Söldnergilde hinter mir ließ, zeigte sich am Himmel die erste Morgenröte. Wenigstens hatte ich den Armbrustbolzen aus Jeremys Rücken. Und dank des Vorschusses war ich nun dreihundert Dollar reicher. Das restliche Geld bekam ich erst, wenn die Polizei grünes Licht gab. An der nächsten Straßenecke hatte ich den Vorschuss im Geiste schon auf etliche offene Rechnungen aufgeteilt. Ich besaß das Geld noch – wenn ich die Hand in die Tasche schob, spürte ich das weiche Papier der gebrauchten Scheine, vier Fünfziger und fünf Zwanziger –, und dennoch war es längst schon wieder futsch.
Eines der größten Rätsel des Universums.
Zwei Stunden später betrat ich hundemüde die Niederlassung des Ordens in Atlanta. Ich hatte einen großen Becher Kaffee dabei und den geheimnisvollen Bolzen, in einer braunen Papiertüte verstaut, unter den Ellbogen geklemmt. Die Dienststelle empfing mich mit ihrer ganzen Farbenpracht – ein langer Flur mit grauem Teppichboden, grauen Wänden und grauen Deckenleuchten.
In dem Moment, als ich das Gebäude betrat, kehrte die Magie zurück. Die gesamte Elektrik versagte den Dienst, stattdessen leuchteten bläulich die Röhren der Feenlampen auf.
Das war jetzt die dritte Magiewoge innerhalb von vierundzwanzig Stunden. Auf die Magie war in den vergangenen Tagen überhaupt kein Verlass mehr gewesen. Sie kam und ging, als wüsste sie nicht, was sie wollte.
In dem leeren Korridor hallte leise das Tippen einer alten Schreibmaschine wider. Es kam aus dem kleinen Sekretariat vor dem Büro des Protektors. »Guten Morgen, Maxine.«
»Guten Morgen, Kate«, antwortete Maxines Stimme in meinem Kopf. »Eine anstrengende Nacht?«
»Könnte man so sagen.«
Ich schloss die Tür zu meinem Büro auf. Die hiesige Niederlassung des Ordens gab sich große Mühe, einen unscheinbaren Eindruck zu machen, aber mein Büro war selbst nach diesen Maßstäben winzig. Es bot gerade mal genug Platz für einen Schreibtisch, zwei Stühle, eine Reihe von Aktenschränken und einige Bücherregale. Die Wände waren in einem weiteren hinreißenden Grauton gestrichen.
Ich blieb in der Tür stehen. Ich hatte dieses Büro von Greg übernommen. Seit seinem Tod waren nun schon fast vier Monate vergangen. Ich hätte längst darüber hinweg sein sollen, doch manchmal, so auch an diesem Morgen, fiel es mir schwer, das Büro zu betreten. Meine Erinnerung beharrte darauf, dass Greg dort sein würde, wenn ich hineinging, er würde mit einem Buch in der Hand dort stehen und mir auf seine übliche Art aus seinen dunklen Augen vorwurfsvoll, aber nie unfreundlich entgegenblicken. Er war stets bereit, mir aus jedem Schlamassel herauszuhelfen, den ich mir eingebrockt hatte. Doch nun war das alles vorbei. Greg war tot. Erst meine Mutter, dann mein Vater, dann Greg. Alle, die mir nahestanden, waren eines gewaltsamen Todes gestorben. Wenn ich noch länger darüber nachdachte, würde ich anfangen zu heulen wie ein Werwolf bei Vollmond.
Ich schloss die Augen und versuchte die Erinnerungen an Greg in seinem Büro zu verdrängen. Fehler. Nun stand mir Greg umso eindringlicher vor Augen.
Ich machte kehrt und ging den Korridor hinab zur Waffenkammer. Schön, war ich also ein Feigling. Na und?
Andrea saß auf einer Bank und reinigte eine Handfeuerwaffe. Sie war eine kleine, aber kräftige Frau, deren Gesicht die Leute unwillkürlich dazu brachte, ihr in der Schlange vor der Supermarktkasse ihre Lebensgeschichten anzuvertrauen. Sie kannte sich bestens mit der Satzung des Ordens aus und konnte noch so entlegene Statuten auswendig herbeten. Ihre Funkgeräte verloren nie die Verbindung, ihre Magie-Scanner funktionierten stets einwandfrei, und wenn man ihr ein defektes Gerät brachte, bekam man es anderntags voll funktionsfähig und picobello geputzt zurück.
Andrea hob den blonden Schopf und salutierte neckisch. Ich zuckte die Achseln und spürte dabei das beruhigende Gewicht meines Schwerts Slayer, das in seiner Scheide auf meinem Rücken ruhte. Dann erwiderte ich den Gruß mit einer Handbewegung. Ich hing sehr an diesem Stück Metall. Nach dem kleinen Abenteuer, das mir diesen Job hier eingetragen hatte, trennte ich mich nur noch äußerst ungern von Slayer. Nur wenige Minuten ohne mein Schwert, schon war ich ein Nervenbündel.
Andrea bemerkte, dass ich sie immer noch ansah. »Brauchst du irgendwas?«
»Ich müsste einen Armbrustbolzen identifizieren lassen.«
Sie winkte mich herbei. »Gib her.«
Ich gab ihr den Bolzen. Andrea packte ihn aus und pfiff anerkennend.
»Nicht schlecht.«
Blutrot und am Ende mit drei schwarzen Federn besetzt, war der Bolzen knapp sechzig Zentimeter lang. Kurz vor der Fiederung war der Schaft mit einer Markierung versehen: drei mal drei kurze schwarze Striche.
»Das ist ein Karbonschaft. Extrem bruchfest, sehr dauerhaft und teuer. Sieht so ähnlich aus wie ein 2216, gebaut für die Jagd auf mittelgroßes Wild: Hirsche, Bären …«
»… Menschen.« Ich lehnte mich an die Wand und trank einen Schluck Kaffee.
»Ja.« Andrea nickte. »Hohes Durchschlagsvermögen, sehr zielsicher, dennoch sehr schnell. Eine tödliche Waffe. Schau dir die Spitze an: klein, drei Klingen, Gewicht etwa hundert Grains. Erinnert mich sehr an die Wasp-Boss-Baureihe. Manche Leute stehen ja auf mechanische Broadheads, aber bei einer guten Armbrust kommt die Beschleunigung so plötzlich, dass sich die Klingen im Flug öffnen, und das war’s dann mit der Zielgenauigkeit. Wenn ich mir einen Broadhead aussuchen sollte, würde ich so einen nehmen.« Sie drehte den Armbrustbolzen hin und her und ließ das durchs Fenster scheinende Licht über die Spitze spielen. »Von Hand geschärft. Wo hast du den her?«
Ich erzählte es ihr.
Sie runzelte die Stirn. »Dass du den Bogen nicht gehört hast, deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich ein Recurve war. Ein Kompositbogen gibt beim Schuss ein schwirrendes Geräusch von sich. Darf ich mal?« Sie wies auf eine Pappzielscheibe in Menschengestalt, die an der mit mehreren Korkschichten versehenen Stirnwand des Raums angebracht war.
»Klar.«
Sie zog sich Handschuhe an, um die Magie-Rückstände möglichst wenig zu beeinflussen. Dann nahm sie eine kleine Armbrust von der Bank, lud sie, hob sie und schoss – zu schnell, als dass sie hätte zielen können. Der Bolzen pfiff durch die Luft und traf den Mann mitten in die Stirn. Volltreffer. Beeindruckend.
Die Feenlampen flackerten und erloschen. An der Wand flammte gelblich elektrisches Licht auf. Die Woge der Magie war vorüber, und die technischen Gerätschaften funktionierten wieder. Andrea und ich sahen uns an. Niemand konnte die Dauer dieser Gezeiten vorhersagen – die Magie kam und ging, wie es ihr gefiel. Doch normalerweise hielten die Wogen mindestens eine Stunde lang an. Wie lange hatte die hier gedauert? Fünfzehn Minuten?
»Kommt mir das nur so vor, oder geht es schneller hin und her als üblich?«
»Scheint mir auch so.« Andrea blickte ein wenig besorgt. Sie zog den Bolzen aus der Zielscheibe. »Soll ich ihn auf Magie scannen?«
»Wenn es keine allzu großen Umstände macht.« Die Magie hatte die lästige Angewohnheit, sich alsbald zu verflüchtigen. Je schneller man solche Beweismittel scannte, desto besser.
»Gibt’s Probleme?« Sie beugte sich zu mir herüber. »Ich war zwei Monate lang offline. Da kriegt man ja nichts mehr mit. Ich hab schon Spinnweben im Hirn.« Sie zog mit einem Finger ihr rechtes unteres Augenlid herunter. »Da, schau’s dir an.«
Ich lachte. Andrea arbeitete bei einer Sektion im Westen und hatte es dort mit einem Rudel Loups zu tun bekommen, das Rinderfarmen überfiel. Loups – die wahnsinnigen, kannibalischen Gestaltwandler, die den inneren Kampf um ihre Menschlichkeit verloren hatten – zogen mordend und vergewaltigend durch die Lande, bis jemand die Welt von dieser Plage erlöste.
Doch leider waren Loups auch hochgradig ansteckend. Andreas Ritterpartnerin hatte es erwischt: Sie wurde zum Loup und bekam schließlich von Andrea zwei Dutzend Kugeln ins Hirn geballert. Es gab eine Grenze, ab der auch die sonst phänomenalen Selbstheilungskräfte der Gestaltwandler nichts mehr auszurichten vermochten, und Andrea war ein Meisterschütze. Man versetzte sie nach Atlanta, und obwohl sich in ihrem Blut keinerlei Spuren des Lycos-Virus fanden und also keine Gefahr bestand, dass ihr Fell und Klauen wuchsen, hielt Ted sie lieber im Hintergrund.
Andrea ging zum Magie-Scanner, legte den Bolzen auf die Keramikunterlage, ließ den Glaswürfel herab und betätigte den Schalter. Der Scanner begann zu summen.
»Andrea?«
»Ja?«
»Die Technik ist wieder da«, sagte ich und kam mir ein wenig dumm dabei vor.
Sie verzog das Gesicht. »Mist. Dann hat das wahrscheinlich keinen Zweck. Aber wer weiß. Manchmal kann man ja sogar dann noch irgendwelche Magie-Rückstände feststellen.«
Wir sahen zu dem Glaswürfel hinüber. Wir wussten beide, dass es zwecklos war. Während einer Technikphase musste man schon etwas scannen, das mit Magie geradezu gesättigt war, um einen guten M-Scan zu bekommen. Ein Körperteil beispielsweise. Der M-Scanner analysierte die Magie-Rückstände, die jemand an einem Objekt hinterlassen hatte, und gab sie auf einem Ausdruck in verschiedenen Farben an: blau bei Menschen, grün bei Gestaltwandlern, violett bei Vampiren. Farbtöne und Leuchtkraft deuteten auf die einzelnen Formen der Magie hin, und so einen M-Scan korrekt zu interpretieren war eine Wissenschaft für sich. Die Magie-Spuren auf einem Armbrustbolzen, der wahrscheinlich nur ganz kurz festgehalten worden war, konnten allenfalls minimal sein. Ich kannte hier in der Stadt nur einen einzigen Mann, der über einen so guten M-Scanner verfügte, dass er auch während einer Technikphase derlei winzige Magie-Rückstände aufspüren konnte. Er hieß Saiman. Das Dumme war bloß, wenn ich zu ihm ging, würde mich das ein kleines Vermögen kosten.
Der Drucker sprang an. Andrea zog den Ausdruck heraus und hielt ihn mir hin. Ihr Gesicht war noch eine Spur blasser geworden. Über das ganze Blatt zog sich ein silberblauer Streifen. Menschliche Magie. Das war für sich genommen noch nicht bemerkenswert. Jeder, der seine Macht von einem Gott oder einem Glauben bezog, stellte sich so dar: der Papst, Shaolin-Mönche, selbst Greg, ein Wahrsager des Ordens, hatte diese silberblaue Spur hervorgerufen. Seltsam war nur, dass wir, solange die Technikphase anhielt, eigentlich gar keinen M-Scan hätten bekommen dürfen.
»Was bedeutet das? Sind die Magie-Rückstände an diesem Ding so unglaublich stark?«
Andrea schüttelte den Kopf. »Die Wogen der Magie haben sich in letzter Zeit ausgesprochen sprunghaft verhalten.«
Wir sahen einander an. Wir wussten beide, worauf dieses hektische Hin und Her hindeutete: auf einen Flair. Und einen Flair brauchte ich ungefähr so dringend wie ein Loch im Kopf.
»Da ist eine Bittstellerin, um die du dich kümmern solltest«, sagte Maxines Stimme in meinem Kopf.
Ich nahm den M-Scan und ging in mein Büro.
Kapitel 2
Ich ließ mich an meinem Schreibtisch nieder. Ein Flair war im Anzug. Wenn die normalen Gezeiten Wogen der Magie waren, dann war ein Flair ein Tsunami der Magie. Es begann mit einer Reihe schwacher Magie-Schwankungen, die schnell anstiegen und wieder abebbten. Während dieser kurzen Wellen verschwand die Magie nie ganz, sie kam vielmehr immer stärker und stärker zurück, bis sie uns schließlich mit einer Riesenwoge überschwemmte.
Einer Theorie zufolge koexistierten die Magie und die Technik früher in einem Gleichgewicht. Es war wie beim Pendel einer alten Standuhr, das kaum merklich hin- und herschwang. Dann aber begann das Zeitalter des Menschen, und Menschen sind nun einmal aus Fortschritt gemacht. Sie überentwickelten die Magie und schoben das Pendel damit immer weiter auf die eine Seite hinaus, bis es hin- und herzuschwingen begann und die Wogen der Technik auslöste. Dann jedoch übersättigte die Technik die Welt, auch dies dank der ewig übereifrigen Menschen, und nun schwang das Pendel zur anderen Seite aus, zur Seite der Magie. Die Wende von der Magie zur Technik hatte zu Beginn der Eisenzeit stattgefunden. Die gegenwärtige Wende hatte, offiziellen Angaben nach, vor etwa dreißig Jahren ihren Anfang genommen. Alles hatte mit einem Flair begonnen, und mit jedem folgenden Flair waren weitere Teile der Welt der Magie erlegen.
Während eines Flairs konnten die absurdesten Dinge geschehen. Die Flut der Magie hielt nur zwei oder drei Tage lang an, aber diese Tage waren die Hölle. Einen Moment lang wünschte ich, ich wäre immer noch nur eine einfache Söldnerin. Dann hätte ich nach Hause gehen und abwarten können, bis der ganze Wahnsinn vorüber war.
Eine Frau erschien in meiner Tür – die angekündigte Bittstellerin. Sie war schlank und elegant und sah nicht einfach nur gut, sondern geradezu hinreißend aus: Mandelaugen, makelloser Teint, voller Mund und schimmerndes schwarzes Haar, das sich in einer glatten Welle über ihre Schultern ergoss. Sie trug ein schwarzes, eng anliegendes Kleid, und beim Anblick ihrer Schuhe taten mir die Waden weh.
Und sie kam mir bekannt vor. Aber ich kam nicht drauf, wo ich ihr schon einmal begegnet war.
»Kate Daniels?«
Das bin ich. »Ja?«
»Mein Name ist Myong Williams.«
Wir schüttelten einander unbehaglich die Hand. »Bitte, nehmen Sie Platz.«
Sie ließ sich auf dem Stuhl vor meinem Schreibtisch nieder und schlug mit einem textilen Wispern die schlanken Schenkel übereinander.
»Was verschafft mir die Ehre?«
Sie zögerte und änderte unwillkürlich die Stellung ihrer Beine, um sie besser zur Geltung zu bringen. »Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.«
»Was für eine Art von Gefallen?«
»Einen persönlichen.«
Sie verstummte. Wir waren irgendwie an einem toten Punkt angelangt.
Da endlich fiel bei mir der Groschen. »Jetzt weiß ich wieder, woher ich Sie kenne. Sie sind Currans …« – Geliebte, Konkubine, Betthäschen – »… Freundin.« Oh Gott, was wollte die Konkubine des Herrn der Bestien denn von mir?
»Wir sind nicht mehr zusammen«, sagte Myong.
Ihr Problem hatte nichts mit Curran zu tun. Gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Je mehr Abstand zwischen dem Herrn der Bestien und mir lag, desto besser war es für alle Beteiligten. Wir hatten während des Red-Point-Falls miteinander zu tun gehabt und einander dabei fast umgebracht.
Myong rutschte ein wenig auf ihrem Stuhl hin und her, richtete mit einer beiläufigen Fingerbewegung den Saum ihres Kleids und runzelte ihre perfekt gezupften Augenbrauen. »Maximillian und Sie …«
Als sie diesen Namen aussprach, löste das bei mir ein gewisses Unbehagen aus. Ich hatte geglaubt, über ihn hinweg zu sein. Wir hatten einander im Zuge der Ermittlungen nach Gregs Tod kennengelernt. Er war ein gut aussehender und kluger Mann, der sehr an mir interessiert war. Ich wollte … tja, keine Ahnung, was ich wollte. Nähe. Sex. Jemanden, der für mich da war. Doch es hatte kein gutes Ende genommen. Ja, wahrscheinlich hasste er mich sogar. »Max und ich sind auch nicht mehr zusammen.«
Myong nickte. »Ich weiß. Wir sind verlobt.«
Das verstand ich nicht auf Anhieb. »Verlobt? Wer?«
»Maximillian Crest und ich. Wir sind verlobt, und wir wollen heiraten.«
»Verstehe ich das richtig? Sie und mein – « Exfreund wäre nicht das richtige Wort gewesen, da wir streng genommen nie ein Paar gewesen waren. Ehemals angehender Freund wäre schlicht albern. »Max und Sie sind zusammen?«
»Ja.«
Unangenehm – gelinde gesagt. Ich verspürte keine Eifersucht, aber ich fühlte mich unbehaglich dabei, mit ihr zu sprechen, auch wenn ich nicht hätte sagen können, wieso genau. Ich rang mir ein Lächeln ab und lehnte mich zurück. »Gratuliere. Und was wollen Sie von mir?«
Myong blickte verdrießlich. »Der Brauch verlangt, dass Curran um Erlaubnis gebeten wird.«
»Sie meinen, er muss gestatten, dass Sie Crest heiraten? Obwohl Curran und Sie gar nicht mehr zusammen sind?«
»Ja. Ich bin ein Mitglied des Rudels.«
Das erklärte einiges. Curran herrschte mit eiserner Faust über das Rudel der Gestaltwandler. Sämtliche Gestaltwandler des Südostens hatten sich ihm als ihrem Herrn unterworfen. Es sei denn, diese Gestaltwandler waren Loups, dann kamen sie normalerweise gar nicht mehr dazu, sich ihm zu unterwerfen, ehe der Herr der Bestien sie in Stücke riss. Ich sah sie mir an und hob die Augenbrauen. »Fuchs?«
Sie seufzte. »Das glauben alle. Nein, ich verwandle mich in einen Nerz.«
Ich versuchte mir einen Wernerz vorzustellen, aber es gelang mir nicht. Crest aber fand bestimmt Gefallen daran. »Sie haben mir immer noch nicht gesagt, weshalb Sie hier sind.«
»Ich habe Curran um Erlaubnis gebeten«, sagte sie.
»Und er hat Nein gesagt?«
»Nein. Er hat gar nichts gesagt. Und das ist nun schon zwei Monate her.« Myong beugte sich mit gefalteten Händen vor. »Mein Alpha weigert sich, Curran die Frage noch einmal vorzulegen. Und nun hatte ich gehofft, Sie könnten meinen Herrn für mich darum bitten.«
»Ich?«
»Sie haben einen gewissen Einfluss auf ihn. Sie haben ihm das Leben gerettet.«
Sie wollen, dass ich Ihren Ex, den gemeingefährlichen Gestaltwandler, der mir eine Heidenangst einjagt, für Sie bitte, dass Sie meinen »ehemals angehenden« Freund heiraten dürfen? Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. »Ich glaube, da überschätzen Sie meinen Einfluss auf ihn ein bisschen.«
»Bitte.« Myong biss sich auf die Unterlippe. Mit der linken Hand umklammerte sie die rechte und drehte sie dabei so, dass eine kurze, schartige Narbe am Handgelenk zum Vorschein kam. Sie war Linkshänderin. Sie hatte sich die Pulsader aufgeschnitten, wahrscheinlich mit einer Silberklinge – eine dramatische, aber auch vollkommen vergebliche Geste. Damit ein Gestaltwandler verblutete, brauchte es schon ein bisschen mehr als einen kleinen Schnitt. Sie sah mich an und bemerkte offenbar nicht, was ihre Hände gerade taten. »Max hat gesagt, Sie würden das verstehen.«
Oh Mann. Aber selber zu mir zu kommen – das kam für ihn nicht infrage, wie?
Ich sah sie an. Sie wirkte vollkommen aus dem Gleichgewicht. Genau diesen Blick hatte ich schon einmal auf ihrem Gesicht gesehen, drei Monate zuvor. Das war, nachdem der Upir von Red Point in der Festung des Rudels angerufen hatte. Curran und ich hatten endlich herausgefunden, wer er war, und ihm gefiel die ganze Situation überhaupt nicht. Er hielt einer Frau einen Telefonhörer an den Mund, damit Curran alles mit anhören konnte, und riss sie dann in Stücke, bis sie tot war. Die Frau war eine von Currans Exfreundinnen gewesen. Ich war bei diesem Anruf dabei, und als ich anschließend zu meinem Zimmer zurückging und versuchte, die Tränen zurückzuhalten, sah ich Myong durch eine offen stehende Tür, wie sie die Arme um sich schlang, den nämlichen Ausdruck vollkommener Hilflosigkeit auf dem Gesicht wie ich.
Bei dieser Erinnerung durchströmte mich ein Gefühl – das Gefühl, zu dumm zu sein, um zu erkennen, was direkt vor meiner Nase vor sich ging, das Gefühl, ganz allein zu sein, schreckliche Angst zu haben, gejagt zu werden und dabei einen idiotischen Fehler nach dem anderen zu begehen, während rings um mich her Menschen starben. Es schnürte mir die Kehle zu. Mein Puls raste, und ich schluckte und musste mich daran erinnern, dass es vorüber war, dass ich es überlebt hatte. Damals, als mir das Wasser bis zum Halse stand, als ich zu versinken drohte, hatte mir Crest einen Strohhalm hingehalten, und beinahe hätte ich Crest mit mir in die Tiefe gerissen. Er hatte es verdient, glücklich zu sein. Und zwar ohne mich.
»Ich werde ihn fragen«, sagte ich.
Sie atmete auf. »Danke.«
»Aber ich weiß nicht, ob ich Curran überzeugen kann. Euer Herr und ich neigen dazu, einander zur Weißglut zu treiben.« Und jedes Mal, wenn wir aufeinandertrafen, war dabei etwas von mir zu Bruch gegangen. Meine Rippen, mein Dach, mein Hammer …
Den letzten Satz hatte sie überhört. »Wir kriegen das schon hin. Vielen, vielen Dank. Wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar.«
»Besuch im Anmarsch«, warnte mich Maxines Stimme in meinem Kopf.
Eine schlaksige Gestalt erschien an der Tür meines Büros. Der Mann war knapp eins achtzig groß und trug eine hellblaue Jeans und ein helles T-Shirt. Sein braunes Haar war kurz geschoren. Er hatte ein frisches, ebenmäßiges Gesicht und samtbraune Augen mit unglaublich langen Wimpern. Wäre der maskuline, kantige Kiefer nicht gewesen, hätte man ihn geradezu als »hübsch« bezeichnen können. Der Vorteil daran war: Wenn er sich jemals durch einen Raum voller junger Frauen hätte kämpfen müssen, hätte er nur ein paarmal mit den Wimpern zu klimpern brauchen, und sie alle wären auf der Stelle ohnmächtig zu Boden gesunken.
Doch seine Schönheit und seine attraktiv umschatteten Augen waren irreführend. Derek war mordsgefährlich. Er hatte in seinem achtzehnjährigen Leben mehr Leid gesehen als andere Leute in einem halben Jahrhundert, und das hatte ihn stahlhart werden lassen. Ich hatte ihn seit der Red-Point-Sache nicht mehr gesehen. Damals war es mir mit meiner großen Klappe gelungen, dass man ihn mit einem Bluteid verpflichtete, mich zu schützen. Curran hatte ihn später von diesem Eid entbunden, doch ein mit Blut besiegeltes Gelübde löste sich nicht so einfach in Luft auf. Es wirkte nach. Das war das erste und letzte Mal gewesen, dass ich die Rangordnung des Rudels auf die leichte Schulter genommen hatte.
»Kate, hallo«, sagte Derek mit sanfter Stimme. »Myong? Was machst du denn hier?«
Myong sprang vom Stuhl auf und schreckte vor ihm zurück. Sie duckte sich, wie um einem Schlag auszuweichen, und blickte starr zu Boden.
Na prima, damit war ja wohl klar, wer von den beiden im Rudel der Ranghöhere war.
»Sie müssen ihm nicht antworten«, sagte ich. »Was man einem Vertreter des Ordens mitteilt, wird vertraulich behandelt. Allenfalls ein Gericht kann die Herausgabe dieser Informationen verlangen.«
Sie stand einfach nur geduckt da, den Blick zu Boden gewandt. Es war kein schöner Anblick.
»Sie können jetzt gehen«, sagte ich.
Sie floh aus dem Büro. Kurz darauf hörte ich, wie die Tür zum Treppenhaus hinter ihr ins Schloss fiel. Hoffentlich brach sie sich mit ihren Stöckelschuhen auf der Treppe nicht die Beine. Bis ihre Knochen wieder verheilt waren, konnte es durchaus zwei Wochen dauern.
»Darf ich reinkommen?«, fragte Derek.
Ich wies auf meine beiden Besucherstühle. »Weshalb hat Myong solche Angst vor dir?«
Er setzte sich und zuckte die Achseln. »Da kann ich nur Vermutungen anstellen.«
»Dann tu’s.«
»Ich arbeite jetzt direkt für Curran. Sie hat wahrscheinlich Angst, dass ich sie verpfeife, denn ich glaube, ich weiß, weshalb sie hier war.«
»Und? Wirst du?«
Er zuckte erneut die Achseln. »Das ist ihre Privatsache. Solange sie nicht anfängt, dem Rudel zu schaden, interessiert mich das alles nicht im Geringsten. Und es war ja auch sowieso nicht ihre Idee hierherzukommen. Sie ist nämlich eigentlich sehr passiv.«
»Ach ja?«
Er nickte. »Dieser Scheißkerl hat sie dazu angestiftet. Ich wusste ja immer, was das für eine miese Type ist.«
»Soso.« Herzlichen Dank für diesen Kommentar zu meinem »ehemals angehenden« Freund. Wo wäre ich bloß ohne den moralischen Kompass, den mir dieser junge Werwolf bereitwillig anbot?
Derek ließ nicht locker: »Wieso ist er denn nicht selbst gekommen? Sollte er nicht hier sitzen und sagen: ›Hey, mit uns beiden hat es nicht geklappt, aber ich brauche jetzt mal deine Hilfe?‹ Nein, der Typ ist derart selbstgefällig, der schickt lieber seine Verlobte los, damit sie seine Exfreundin anbettelt, die letzten Hindernisse für die Hochzeit aus dem Weg zu räumen. Wie schäbig ist das denn?«
Ziemlich schäbig. »Es reicht. Ich will nichts mehr hören.«
Derek setzte sich ein wenig aufrechter hin. Seine Augen hatten sich vorübergehend verdunkelt. Das war nicht normal.
Ich zog Slayer aus der Scheide und fuhr mit der Fingerspitze an der Klinge entlang. Das beinahe weiße Metall nagte ganz leicht an meiner Haut. Es war eindeutig ein Flair im Anzug. Gestaltwandlern fiel es während eines Flairs schwer, ihre Gefühle im Zaum zu halten. Na toll. Dann sah Curran diese Hochzeitschose ja vermutlich gerade ganz cool.
»Gut siehst du aus«, sagte ich zu Derek.
»Danke.«
»Aber du kommst mich nie besuchen. Hast du Schwierigkeiten?«
»Nein. Ist dieser Raum sicher?«
»Du befindest dich in einem Gebäude des Ordens. Noch sicherer geht es nicht.«
Er griff hinter sich und schloss die Tür. »Ich überbringe dir ein Hilfegesuch des Rudels.«
Ich will nicht mit Curran zusammenarbeiten, ich will nicht mit Curran zusammenarbeiten, ich will nicht mit Curran zusammenarbeiten. »Entschuldige, ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Hast du tatsächlich gesagt, dass das Rudel mich um Hilfe bittet?«
»Ja.« Seine Augen funkelten ein wenig. »Wir sind bestohlen worden.«
»Von wem?«
»Da sind wir uns nicht so ganz sicher«, sagte Derek vorsichtig. »Aber du hast jedenfalls einen Armbrustbolzen von ihm auf dem Tisch.«
Ich beugte mich vor. »Erzähl.«
»Sagen wir einfach nur, dass eins unserer Teams heute Morgen von einem Mann überfallen wurde, der genau solche Bolzen verwendet. Er hat etwas gestohlen, das dem Rudel gehört, und wir wollen es wiederhaben.«
»Aha. Und wieso sollte ausgerechnet ich euch dabei helfen können?« Bis dahin war ich davon ausgegangen, dass das Rudel seine Probleme selbst regelte. Ja, meistens gaben sie nicht mal zu, überhaupt ein Problem zu haben.
»Weil du über Kontakte verfügst, über die wir nicht verfügen.« Derek gestattete sich den Anflug eines Lächelns. »Und weil, wenn wir anfangen würden, auf der Suche nach dieser Person die Stadt auf den Kopf zu stellen, gewisse Kreise sich fragen würden, was wohl dahintersteckt, und dann könnten möglicherweise die recht peinlichen Begleitumstände dieses Diebstahls ans Tageslicht kommen. Wir waschen unsere schmutzige Wäsche nun mal nicht gern in der Öffentlichkeit. Und der Orden hat uns stets geholfen, ohne dass allzu viel davon nach draußen gedrungen ist.«
Na toll. Meine Gegenwehr war im Keim erstickt. Greg hatte als einziges Ordensmitglied das Vertrauen des Rudels errungen. Da er nun nicht mehr lebte und ich mir den Status eines Freundes des Rudels erworben hatte, war dieses Vertrauen auf mich übergegangen. Der Orden wollte das Rudel im Blick behalten, so viel wusste ich. Und irgendetwas sagte mir, dass die Ritter des Ordens dieses Hilfegesuch als großartige Gelegenheit auffassen würden, genau das zu tun.
»Was hat der Armbrustschütze denn geklaut?«
Derek zögerte.
»Derek, ich werde keinen Unbekannten verfolgen, um etwas wiederzubeschaffen, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Was hat er geklaut?«
»Er hat ein Vermessungsteam überfallen und die Landkarten geraubt.«
Fast hätte ich gepfiffen – bloß dass dann mein russischer Vater aus dem Grabe auferstanden wäre, um mir eine Ohrfeige zu verpassen, denn drinnen im Haus gehörte sich das nicht. Die Landkarten des Rudels waren von legendärer Qualität, sehr genau und auf dem neusten Stand. All die neu entstandenen Gegenden und magischen Zonen waren darin verzeichnet, jede Seitenstraße und interessante Einzelheit genau vermerkt. Mir fielen auf Anhieb mindestens ein halbes Dutzend Leute ein, die für eine Fotokopie dieser Landkarten ein Vermögen hingeblättert hätten.
»Der traut sich ja was«, sagte ich. »Personenbeschreibung?«
»Sehr schnell.«
»Das ist alles? Mehr hast du nicht für mich?«
»Ein ausgezeichneter Schütze.«
Ich seufzte. »Auf wen hat er denn geschossen?«
»Auf Jim.«
Ach du Scheiße. »Wie geht es ihm?«
»Er wurde in nicht mal zwei Sekunden viermal getroffen. Und er ist nicht allzu froh darüber. Er hat noch leichte Beschwerden. Aber er wird keine bleibenden Schäden zurückbehalten.«
Ich zählte eins und eins zusammen. »Nachdem unsere Zielperson ausgeschaltet war, kriegte Jim einen Anruf von dem Vermessungsteam. Der Armbrustschütze ist Jim gefolgt, hat ihn überfallen, das Vermessungsteam ausgeschaltet und die Landkarten geklaut.«
Derek guckte, als hätte er gerade auf eine Zitronenscheibe gebissen.
Toller Trick – meinem ehemaligen Partner zu folgen. »Aus wie vielen Leuten besteht so ein Vermessungstrupp? Ich frage nur aus Neugier.«
»Aus vier.«
Mit Jim also fünf. »Und ihr habt ihn entkommen lassen?«
»Er ist einfach so verschwunden.«
»Mit dem Geruchssinn der Gestaltwandler ist es wohl auch nicht mehr allzu weit her.«
»Nein, Kate, du verstehst nicht, was ich damit sagen will. Er ist verschwunden. Den einen Augenblick war er noch da, und im nächsten war er weg.«
Ich konnte es mir nicht verkneifen. »Wie ein Ninja. Als hätte er sich in Luft aufgelöst.«
»Ja.«
»Du möchtest also, dass ich einen übernatürlich schnellen Armbrustschützen finde, der sich in Luft auflösen kann, ihm eure Landkarten wieder abnehme, und das alles möglichst so, dass niemand erfährt, was ich da mache und warum ich es mache?«
»Genau.«
Ich seufzte. »Dann hole ich mal die Formulare.«
Kapitel 3
Wenn man nicht weiß, wie man weiter vorgehen soll, geht man am besten noch einmal zum Anfang zurück. Ich hatte weder einen Namen noch eine Personenbeschreibung noch einen Ort, an dem ich mit der Suche nach dem geheimnisvollen Armbrustschützen hätte beginnen können, und daher ging ich davon aus, dass die Tiefgarage, in der wir von Jeremy um ein Haar gegrillt worden wären, der beste Anhaltspunkt war, den ich besaß. Da sich die Magie wohl auch weiterhin so launenhaft verhalten würde und ich keine Lust hatte, mit einem Wagen irgendwo liegen zu bleiben, beschloss ich, mir aus den Stallungen des Ordens, die sich gleich um die Ecke befanden, ein Pferd zu besorgen.
Es zeigte sich jedoch, dass ich nicht die Einzige war, die so dachte. Die Stallungen waren so gut wie leer, und meine bevorzugten Reittiere waren alle schon vergeben. Ich entschied mich schließlich für eine fuchsfarbene Maultierstute. Sie hieß Ninny und war von eher kleiner Statur, und als sie, ohne mit der Wimper zu zucken, dem Innenstadtverkehr trotzte, erkannte ich, was für eine kluge Sache die Maultierzucht doch war.
Der kürzeste Weg zur Tiefgarage führte an der Interstate 85 entlang quer durch die Innenstadt. In glücklicheren Zeiten musste der Blick von dieser Straße aus atemberaubend gewesen sein. Nun lagen sowohl Downtown als auch Midtown in Trümmern, nach und nach von den Wogen der Magie zermalmt. Die verdrehten Stahlgerippe einst mächtiger Wolkenkratzer ragten wie fossile Gebeine aus dem Schutt. Hier und dort standen noch einzelne Gebäude, waren aber bis auf wenige Etagen abgefressen. Zwischen Betonbrocken funkelten die Splitter unzähliger Fensterscheiben.
Nicht fähig oder nicht willens, die Trümmer fortzuräumen, wuchs die Stadt rings um sie weiter. Am Rande der zwölfspurigen Interstate waren kleine Buden und Stände aus dem Boden geschossen, die alles Mögliche feilboten – von falschen Monstereiern bis hin zu hochmodernen Kleincomputern und Präzisionswaffen. Die Computer versagten meist auch während der Magiepausen den Dienst, die Monster aber schlüpften manchmal wider Erwarten doch.
Pferde, Maultiere, Kamele und die absonderlichsten Gefährte mühten sich auf der verstopften Straße voranzukommen, und alle verschmolzen zu einer riesigen, vielfarbigen Karawane, und ich ritt, in Tiergerüche gehüllt, mittendrin und erstickte fast an den Auspuffgasen der Automobile, während Scharen von Straßenhändlern mich angingen und sich große Mühe gaben, einander heiser zu schreien.
»Das beste Mittel gegen Gicht …«
»… Wasserfilter! Sparen Sie bis zu tausend Dollar im Jahr! …«
»… getrocknetes Rindfleisch!«
Rindfleisch. Aber klar doch.
Zwanzig Minuten später ließen wir dieses ganze Getöse hinter uns, ritten eine hölzerne Rampe hinab und dann hinein in ein Straßengewirr, das im Volksmund Warren genannt wurde – »das Labyrinth«.
An den Lakewood-Park und den Southview-Friedhof grenzend, erstreckte sich Warren bis zum McDonough Boulevard. Einige Jahrzehnte zuvor hatte man die Gegend ins South Urban Renewal-Projekt aufgenommen und dort etliche schöne Wohnanlagen sowie zwei- und dreigeschossige Bürogebäude errichtet.
In den Jahren seit der Wende, als das erste Mal eine Woge der Magie über die Welt hinweggebrandet war, hatte Warren streckenweise schwer gelitten. Die Magie hatte aus bislang unbekannten Gründen einen recht wählerischen Geschmack. Manche Gebäude fraß sie mit Stumpf und Stiel, andere hingegen rührte sie gar nicht erst an. Wenn man nun durch diese Gegend ging, kam man sich vor wie in einem Kriegsgebiet nach einem Bombardement: Neben Häusern, die dem Erdboden gleichgemacht waren, standen andere unversehrt.
Das Parkhaus, in dem Jeremy ums Leben gekommen war, stand Mauer an Mauer zwischen einer Bank und einem nicht mehr genutzten Kirchengebäude. Es bestand aus drei Hoch- und drei Tiefgeschossen, war über und über mit Ruß bedeckt, hatte kein Dach mehr und ähnelte insgesamt ein wenig einem abgebrannten Streichholz. Ich stieg ab und machte Ninny an einer Metallstange fest, die aus einer Mauer ragte. Kein auch nur halbwegs vernünftiger Mensch würde versuchen, ein Maultier zu stehlen, das ein Brandzeichen des Ordens trug. Der Orden pflegte sein Eigentum auf magische Weise zu markieren, und in gewissen Kreisen war kaum etwas unbeliebter als ein paar von gerechtem Zorn erfüllte Ritter, die plötzlich auf der Matte standen.
In dem Parkhaus lag ein kalkiger Geruch in der Luft, das vertraute Aroma des von den Mühlen der Magie zu Staub gemahlenen Betons. Ich nahm die Treppe ins unterste Geschoss. Die spiralförmigen Parkebenen waren stellenweise eingestürzt, und das durch die Lücken hereinfallende Licht erhellte die unterirdischen Geschosse nur notdürftig. Schwefelgestank brannte mir in der Nase.
Ich fand den großen schwarzen Fleck an der Wand und ging von dort aus zurück, bis ich zu Jeremys kopflosem Leichnam kam. Die Bullen mussten an diesem Morgen überlastet sein, sonst hätten sie ihn längst ins Leichenschauhaus geschafft.
Ich ging ein wenig umher, bis ich die Spalte in der Mauer entdeckte, die wir schon in der Nacht gesehen hatten. Ich spähte hinein. Es war dort eng und dunkel und roch nach feuchter Erde. Höchstwahrscheinlich war dies der Fluchtweg des Armbrustschützen gewesen.
Ich zog mein Schwert und zwängte mich in den Gang.