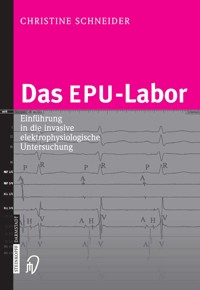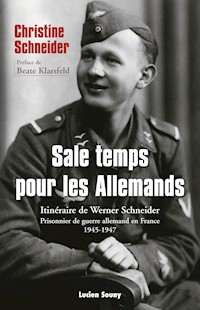Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Da leben keine Europäer!", sagen die Einheimischen, als die Familie Schneider in die Slums von Manila zieht. Und doch werden Abfalldeponien und Wellblechhütten für viele Jahre ihr Zuhause. Hier begegnen sie dem Kronzeugen Bic, der todgeweihten Mariebell, dem Vergewaltiger Arol, der Milliardärin Dona, dem Widerstandskämpfer Noel ... Der fesselnde Erlebnisbericht erzählt von unzähligen spannenden Begegnungen mit Menschen, von Freundschaft und Verrat, von Schusswechseln auf offener Straße, von Gebeten, Träumen und Ängsten, von sinnlosem Sterben und sinnvollem Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian und Christine Schneider
Himmel und Straßenstaub
Unser Leben als Familie in den Slums von Manila
2. Auflage 2011
© 2011 Brunnen Verlag Gießen
www.brunnen-verlag.de
Lektorat: Willi Näf und Eva-Maria Busch
Umschlagfoto: privat
Umschlaggestaltung: Daniel Böhm
Satz: DTP Brunnen
Druck: CPI – Ebner und Spiegel, Ulm
E-Book-Erstellung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN 978-3-7655-7030-8
FÜR ROSE PECIO-SALVE,die mit ihrer Familie freiwillig im Slum lebt und für all unsere engagierten Freunde in den Philippinen steht.
UND FÜR ERNST „ASCHI“ BUCHER-LÄNG,der mit seiner Familie in einem abgelegenen Tal der Alpen lebt und für all unsere Freunde steht, denen die Armen dieser Welt nicht gleichgültig sind.
Stimmen zum Buch
Stimmen zum Buch
Die Geschichte von Christine und Christian Schneider ist aufregend und aufrüttelnd. Sie ist ein wuchtiger Appell, die Höllen auf diesem Planeten nicht zu ignorieren. Sie erinnert daran, dass der christliche Glaube kein Fahrstuhl in den Himmel ist. Sondern der Motor, etwas zu bewegen. Hier und jetzt. Für Gott und Menschen.
Shane Claiborne, Autor
Ich kann sie beim Lesen riechen – die üblen Gerüche der Slums von Manila. Nichts wird ausgelassen oder beschönigt. Über allem aber leuchtet Hoffnung auf. Sie gibt uns den Mut, nie aufzugeben. Weder uns selbst noch einen anderen.
Ruedi Josuran, Coach und Moderator
Schneiders schildern große Verbrecher und kleine Halunken, Mörder, Stricher und Junkies als ihre – jawohl! – liebenswürdigen Nachbarn. Im Wortsinn: Der Liebe Gottes würdig.
Andreas Malessa, Autor, Hörfunk- und Fernsehjournalist
Christine und Christian Schneider haben zehn Jahre lang in den Slums von Manila gelebt. Jeden Tag haben sie mit den Ärmsten die Armut geteilt, um ihnen die Würde zurückzugeben – und neue Hoffnung.
Lise Favre, ehem. Schweizer Botschafterin auf den Philippinen
Ich finde das Buch hervorragend. Spannend. Sehr gut lesbar. Anrührend. Überhaupt nicht frömmelnd. Wegweisend für Christen im 21. Jahrhundert.
Dominik Klenk, Journalist und Prior derökumenischen Kommunität Offensive junger Christen
Zu diesem Buch
Zu diesem Buch
Es war ein heißer Tag im Sommer 1988, als ich mit wenig Ahnung und klopfendem Herzen in das philippinische Bagong Silang einzog. Jenes Slum-Umsiedlungsgebiet von Manila wurde zu meinem ersten Zuhause auf meiner Reise mit den Armen. Vier Jahre lang wohnte ich als Single in den Slums, neun Jahre zusammen mit meiner Familie. Hautnah begegnete ich dort Elend und Not, Schönheit und Lebensfreude. Vor allem jedoch traf ich Menschen, deren Gastfreundschaft, Überlebenswille und Glaube mich verändert haben. Von diesen Begegnungen erzähle ich.
Vor gut sieben Jahren sind wir als Familie in die Schweiz zurückgekehrt. Wir leben wieder in der Wohlstandsgesellschaft mit ihrem Zwang zu Konsum und Produktivität. Und mit dem fürchterlichen Stress, den man hat, wenn man bequem, luxuriös und abgesichert leben will.
Das Buch ist mein Versuch, wertvolle Erinnerungen festzuhalten, bevor sie endgültig in der Geschäftigkeit unseres westlichen Alltags verblassen. Beim Stöbern in Briefen und Tagebucheinträgen fiel mir auf, dass vieles davon nur Momentaufnahmen sind: Wie die Geschichten jener Menschen weitergingen, weiß ich oft nicht.
Auch wenn wir als Familie wieder in der Schweiz leben – ein Teil von uns ist in den Slums geblieben. Die Perspektive der „urban poor“ werden wir wohl nie mehr verlieren, und das ist gut so. Regelmäßige Besuche in Manila lindern mein „Heimweh“. Dann treffe ich die Menschen aus jener Zeit und Erinnerungen werden wach. Viele solche Wiedersehen sind ermutigend, andere stimmen mich traurig. In den meisten Fällen habe ich den richtigen Namen verwendet, nur in einigen Ausnahmefällen habe ich ihn zum Schutz der Betroffenen geändert.
Christian Schneider
Willkommen in Bagong Silang
Willkommen in Bagong Silang
9. Juni 1988. Schier endlos reihen sich die merkwürdigsten Behausungen auf dem leicht hügeligen, von der Tropensonne ausgemergelten Land aneinander. Über Tausenden von Wellblechdächern flimmert heiße Sommerluft. Die besseren Behausungen bestehen aus rohen Zementbacksteinen oder dünnen Sperrholzplatten. Sie werden umso behelfsmäßiger, je weiter wir uns von der Hauptstraße entfernen.
Rob Ewing, ein schlanker, blonder Australier, aus dessen hellblauen Augen der entschlossene Blick eines Siedlers leuchtet, führt mich immer tiefer in die Armensiedlung hinein. Wir ziehen vorbei an abgewrackten Hütten. Einige zeigen sich uns wie bunte Collagen aus alten Reissäcken, Plastikplanen und Pappkartons. Wie ein Flüchtlingslager in Kriegsgebieten, denke ich, und ein beklemmendes Gefühl packt mich. Als Weißer bin ich für die Menschen hier zuerst einmal reich. Ein Fremdkörper. Und trotzdem bin ich nun mit meinem Begleiter unterwegs zur Unterkunft einer Familie, in der ich für die nächsten Monate leben soll.
Bagong Silang liegt gut eine Autostunde außerhalb des Stadtzentrums von Manila. 140 000 Menschen leben hier, schätzt Rob, aber kaum einer freiwillig; die Menschen wurden hierher deportiert, weil die illegalen Stadt-Slums, in denen sie vorher hausten, neuen Quartieren weichen müssen.
„Bagong Silang bedeutet neues Leben“, erklärt mir Rob. „Aber viele werden hier krank, und täglich sterben Menschen durch verschmutztes Wasser oder an Hunger.“ Rob Ewing lebt mit seiner Frau Lorraine und ihrer kleinen Tochter bereits seit drei Jahren in diesem Gebiet. Um die australische Familie im Dienste der SERVANTS hat sich eine kleine Gemeinde von 60 bis 80 Gläubigen gebildet, die „Living Spring Christian Fellowship“ (wörtlich: die „Gemeinschaft der Christen zur lebendigen Quelle“). Entstanden sind zudem ein kleiner Kindergarten und eine Suppen- und Reisküche, wo ausgemergelte Mütter einmal am Tag ihre unterernährten Kinder hinbringen. Diese kleine Hilfe erscheint mir in Anbetracht des Massenelends wie ein schlechter Witz.
Auch den Menschen von Bagong Silang hat man Starthilfe versprochen. Ein paar Quadratmeter karges Land und eine Toilettenschüssel aus Keramik sind dann aber auch schon alles, was die Regierungsbevollmächtigten den Vertriebenen ins neue Leben mitgeben.
Gleichmäßig verteilt ragen fünf Meter hohe Wassertürme über das ausgedörrte Land. Die Tanks sind leer und rosten vor sich hin. Um nicht zu verdursten, versorgen sich die Bewohner aus selbst geschaufelten Löchern. Das Wasser darin ist verschmutzt durch unzählige Kotgruben, wo die Menschen in nächster Umgebung sich ihrer Notdurft entledigen.
Bei den Armen geht man langsam. Und man geht im Spreizschritt – die Pfade zwischen den Häusern sind schmal, und in der Mitte verläuft ein Regenwasserkanal, dessen Abdeckplatten von den unfreiwilligen Siedlern gern als Baumaterial zweckentfremdet werden.
Wir erreichen das Haus von Nanay (Mutter) und Tatay (Vater) Rinion. Sofort entsteht ein kleiner Menschenauflauf. Ein paar kleine Kinder nehmen ohne zu fragen meine Hände und drücken sie. Neugierig und liebevoll zwicken sie mit kleinen, schmutzigen Fingerchen in meine Arme. Eine wuchtige Frau, gut über fünfzig, baut sich vor mir auf. Kreischend und rudernd scheucht sie die Kinder weg. Dann schaut sie mir in die Augen. Ich fasse ihre Hand, neige meinen Kopf und führe ihren Handrücken an meine Stirn. So bitte ich um ihren Segen; eine schöne alte Geste, die hierzulande Nähe und Respekt zu älteren Menschen ausdrückt.
„Das ist also Chris aus der Schweiz“, sagt sie in gebrochenem Englisch. „Keine Sorge, Rob, wir werden gut auf ihn aufpassen.“ Ich zweifle keine Sekunde daran. „Chris, du bist jetzt mein Sohn … und dass du es gleich weißt, ich bin deine Mutter.“ Sie lacht mit rauer Stimme und wirft diskret ihren abgebrannten Zigarettenstummel weg. „Mutter“ bedeutet in diesem Fall wohl so viel wie Boss.
Bevor ich irgendetwas sagen kann, zieht sie mich in den kühlen Schatten ihrer „Sala“, der Wohnstube. Mit schätzungsweise fünfundzwanzig Quadratmetern entspricht der Raum dem quadratischen Grundriss des Hauses. Er ist Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, alles in einem. Der Boden besteht aus gestampfter Erde, die Wände aus unverputztem Zementbackstein. Über der viel zu niedrigen Holzlattendecke liegt ein Obergemach aus dünnem Sperrholz, gedeckt mit Wellblech. Offene Aussparungen mit vorgehängten Reissäcken dienen als eine Art Fenster. Dies wird also einige Monate lang mein Zuhause sein.
Mir fällt auf, dass es in der Hütte weder Hausaltar mit Kerzen und Essensopfern noch Heiligenfiguren gibt. Das deutet darauf hin, dass sich die Eltern vom traditionellen, synkretistisch geprägten Katholizismus abgewandt haben. Mutter Nanay Rinion stellt herrlich kaltes Wasser auf den wackligen Holztisch – die Familie besitzt einen Kühlschrank. Und einen alten Fernseher. Diese beiden Kostbarkeiten stammen aus dem Ersparten von Noel, dem ältesten Sohn der sechs Rinion-Kinder. Sechs lange Jahre arbeitete Noel auf Baustellen in der Wüste von Saudi Arabien. Von seinem Ersparten ist nichts mehr übrig geblieben, abgesehen von dem Fernseher und eben diesem Kühlschrank, der nun ununterbrochen Eis produziert, außer wenn der Strom ausfällt. Das kommt sehr oft vor, manchmal tage- oder wochenlang. „Blackouts“ nennen sie diese Überraschungen. Doch wenn es Strom gibt, verpackt Tatay Rinion das Eis in Plastik und verkauft es für ein paar Centavos pro Stück an die Nachbarn. Ein willkommener Nebenerwerb, wie es scheint.
Noel spricht das beste Englisch in der Familie und soll mein Sprachhelfer werden. Zusammen mit seiner Frau Josslin und ihrem sechs Monate alten Baby wohnen und schlafen sie auf dem einzigen mit Vorhang geschützten bettartigen Holzgestell in der Sala. Pura, die noch ledige, erwachsene Tochter, und die zwei Teenagersöhne Beda und Jon-Jon rollen zum Schlafen ihre „Banig“-Bastmatte aus, wo immer sie Platz finden. Die anderen beiden Kinder sind bereits ausgezogen und haben eigene Familien, dafür leben jetzt an ihrer Stelle zwei Hunde und fünf Tauben unter demselben Dach. Letztere sind das Hobby von Jon-Jon, dem Jüngsten. An der Außenwand des Hauses steht ein altes Sofa, geschützt von einem Vordach aus Plastikplanen. Hier schlafen die Eltern.
Nanay Rinion unterhält sich eifrig mit Rob. Die Sprache der Filipinos gefällt mir. Aber wie ich selber eines Tages diese fremden und komplizierten Laute beherrschen soll, kann ich mir herzlich wenig vorstellen. Dabei soll genau dies das Hauptziel meines ersten Jahres sein: im Zusammenleben mit diesen Menschen ihre Sprache und Lebensweise zu erlernen.
Vermutlich verhandeln Rob und Nanay über die Ausgaben der Rinion-Familie. Meinetwegen. Ihre aktuelle Wohnsituation soll so weit verbessert werden, dass sie für mich erträglich wird. Rob hat ihnen Geld gegeben, damit sie das WC mit einer verschließbaren Tür versehen können. Das WC ist ein Keramiksiphon, über dem man sein Geschäft in Kauerstellung erledigt. Die unter der Hütte gelegene Sickergrube scheint mit einer Betonplatte dicht gemacht. Ein gefüllter Wassereimer mit leerer Konservendose vervollständigt das Ganze zum Duschraum. Ein Grand Hotel ist es nicht gerade, aber ich werde es wohl schaffen.
Während wir unter dem Blechdach mit etwas Sperrholz einen kleinen Schlafplatz einrichten, der mich vor fremden Blicken schützen soll, trifft Robs Frau Lorraine ein. Sie ist schlank und rothaarig, durch ihre Körpergröße und ihr helles, sommersprossiges Gesicht unterscheidet sie sich erheblich von den Filipinofrauen. „Hast du Interesse, auf ein paar Krankenbesuche mitzukommen?“, lacht sie mich einladend an. Sie weiß um meine Ausbildung als Pflegefachmann.
Kurze Zeit später halte ich ein runzliges Häufchen mit großen dunklen Augen in meinen Händen. Es ist das schwer unterernährte Neugeborene eines Teenagers, für das jetzt die junge Großmutter sorgen muss. Die kleine Maribell hat eine Missbildung an Mund und Rachen, die offensichtlich eine ausreichende Nahrungsaufnahme verhindert. Ohne professionelle Hilfe hat das Kind keine Chance.
„Es muss sofort ins Spital“, höre ich mich sagen, realisiere aber im gleichen Augenblick, wie dumm der Ratschlag ist. Als ob die Familie das Geld für einen langen Krankenhausaufenthalt hätte! In den staatlichen Spitälern müssen die Angehörigen Pflege und Verpflegung selbst bezahlen, ebenso den Transport und die Medikamente, die hier genauso teuer sind wie im reichen Westen. Lorraine weist mich darauf hin, dass die Großmutter regelmäßig Milchpulver aus dem Ernährungsprogramm der SERVANTS bezieht.
Was können wir also tun? Wir legen unsere Hände und Arme auf die traurigen Menschen mit ihrem schönen Lächeln und beten – gegen die Hoffnungslosigkeit und für die Genesung.
Wir treten ins Freie und strecken unsere Glieder; viele der Hütten sind zu niedrig für uns Europäer. „Magst du nach einem weiteren kranken Mädchen sehen, gleich nebenan?“, fragt Lorraine. Vom einen kranken Mädchen zum andern ist es nicht sehr weit in Bagong Silang.
„Die Mutter wird bald wieder zurück sein“, erklären uns ein paar Kinder, die uns ihre Köpfe aus einer Maueröffnung des Hauses entgegenstrecken. „Sie ist zu einem teuren Doktor gegangen mit unserer Schwester, sie hat wieder einen ihrer Anfälle gehabt.“
Maribell 1988: Wird sie überleben? Siehe hier→
„Bald zurück“, so viel habe ich jetzt schon begriffen, kann alles heißen. Warten scheint hier zum Leben zu gehören. Die Menschen besitzen fast nichts außer Zeit, davon aber im Überfluss. Wir lassen uns auf improvisierten Sitzen aus Gummireifen und Bambushockern nieder. Wenn nicht die penetranten Angriffe der Moskitos wären, könnte ich die frische Abendbrise genießen. Es ist bereits später Nachmittag. Nahe am Äquator bricht die Nacht plötzlich herein, nach einer kurzen, aber farbenprächtigen Dämmerung. Für die meisten ist dies die angenehmste Zeit am Tag. Jung und Alt kommen aus ihren Hütten ins Freie und schwatzen und spielen und streiten und lachen.
Auf einmal nähert sich uns eine kleine Gruppe von Menschen. Allen voran springt uns eine junge Frau entgegen, in ihrem Gesicht nackte Verzweiflung. Auf ihren Armen trägt sie ihre Tochter; das sechsjährige Mädchen ist unterwegs an einem epileptischen Anfall erstickt. Kinder in jedem Alter und auch Erwachsene drängen sich nun um die kleine Leiche. Viele berühren das noch weiche Körperchen ein letztes Mal. Es wird laut gebetet und geweint. Wir weinen und beten mit.
Benommen schreiten wir auf dem Rückweg dahin, jeder für sich in Gedanken versunken. Ich ahne, dass sich an diesem Ort niemand wirklich um die genaue Todesursache des Mädchens kümmern wird. Plärrende Verstärker von alten, überdrehten Radios und TV-Anlagen und Stimmengewirr unzähliger Menschen beherrschen die Nachtstimmung im Elendsviertel. Plötzlich sagt Rob trocken: „Willkommen in Bagong Silang.“ Er weiß, was mich beschäftigt, und gibt Antwort auf nicht gestellte Fragen. „Merkwürdig ist, dass Leiden und Sterben dieser Kleinen manchmal dazu führen, dass Menschen sich in ihrer Verzweiflung an Gott wenden und dort Trost und vielleicht sogar Kraft für eine Neuorientierung finden.“
Später am Abend sitze ich unter meinem Moskitonetz und schwitze. Unter meiner Schlafecke herrscht ein Riesenlärm. An die vierzig Kinder und Jugendliche der Nachbarschaft drängen sich um den Fernseher der Rinions. Durch die offene Türe und die beiden Fensterlöcher zwängen sich Köpfe und kommentieren mit Gebrüll das aktuelle Meisterschaftsspiel im Basketball. Für sie war dies ein normaler Tag.
Trotz Müdigkeit und ungewöhnlichem Schlaflager spüre ich eine Gewissheit, dort angekommen zu sein, wohin ein anderer mich geführt hat, ohne dass ich danach gesucht hätte. Wie absurd – und wie wohltuend. Einer alten Gewohnheit folgend, lese ich noch einige Sätze aus der Bibel, bevor ich mich schlafen lege. Sie tun mir gut. Meine Ruhe kommt mir absurd vor. Es ist ja nicht einmal der Tod, der mich beschäftigt; mit sterbenden Erwachsenen war ich als Krankenpfleger und Sterbebegleiter oft konfrontiert. Was mir nachgeht, ist die Sinnlosigkeit dieses Todes dieses Mädchens, während andere Teile derselben Welt im Überfluss ersaufen. Das ist absurd, und nicht die Ruhe in mir.
Ich hoffe, dass ich die Ruhe zu bewahren vermag, solange ich hier bleiben werde. Ich richte mich auf meinem engen Lager halbwegs bequem ein. Zumindest daran wird’s nicht liegen. Mit wenig Platz und wenig Intimsphäre auszukommen, das habe ich schon als Kind gelernt …
Kindheit in Basel
Kindheit in Basel
Als Junge teilte ich mir mit meinen zwei älteren Brüdern ein kleines Zimmer. Wir wohnten als achtköpfige Familie in einer Vierzimmer-Sozialwohnung am Stadtrand von Basel. Der Spielraum im Freien war dafür fast unbegrenzt. Da gab es die Kiesgrube, wenige Fußminuten entfernt auf französischem Boden, die zu betreten verboten war, daneben weite, unbebaute Felder mit wilden Hecken und verwachsenen Schützengräben aus den Weltkriegen. Für uns war das Gelände ein echter Abenteuerspielplatz. Hier rauchten wir unsere ersten Zigaretten, übten wir uns an Pfeil und Bogen, Steinschleudern und recht gewalttätigen Prügeleien mit andern Kindern, die uns das Revier streitig machen wollten.
Die Schule war dagegen nur eine lästige Nebensache. Wichtiger als der Unterricht erschien es mir, auf dem Pausenhof der Stärkste zu sein. Draußen war das Abenteuer, drinnen war nur Langeweile. In meinen Zeugnissen fanden sich Bemerkungen wie „Betragen unbefriedigend“ und „nur probeweise versetzt“.
Jeden Mittwoch allerdings besuchte ich eine „Kinderstunde“. Wir hörten Geschichten aus der Bibel, stets mit der Botschaft, dass Gott mich lieben würde und seinen Sohn Jesus extra meinetwegen auf die Welt geschickt habe, damit er mein Herz rein mache. Weil ich oft mit Schuldgefühlen zu kämpfen hatte, sprach mich das mächtig an. Eines Tages blieb ich mit der Kinderstundenfrau zurück und folgte ihrer Einladung, mit einem Gebet „Jesus ins Herz hineinzulassen“. Ich war sieben Jahre alt, und von jenem Tag an wusste ich tief in mir, dass da ein Gott war, dem ich nicht gleichgültig war und der mich nie verlassen würde.
Auf meine Freizeitvergnügen hatte dieser „Jesus im Herzen“ allerdings kaum Einfluss. Dazu gehörten auch Vandalismus und Ladendiebstähle. Erwischt wurde ich nie; ließ sich das Diebesgut nicht sofort spurlos verzehren, warf ich es vorsichtshalber meistens weg. Es machte mir Spaß, abends mit Steinen elektrische Straßenlampen zu zerstören. Einmal wollte ein älterer Junge immer nur mit den andern Jungs spielen, was mich so verletzte, dass ich bei seiner selbst gebauten Spielhütte Feuer legte und mich davonmachte. Als ich von Weitem die Rauchsäule sah und die Feuerwehr hörte, war mir allerdings nicht mehr so wohl …
Zu einer Wende kam es mit meinem Beitritt in den „Cevi“ oder die „Jungschar“, wie wir den „Christlichen Verein junger Menschen“ (CVJM) im Volksmund nannten. Ich war elf Jahre alt, und es gab kaum mehr einen Samstagnachmittag, an dem ich nicht hinging. Die Leiter interessierten sich für mein Leben, sie brachten mir die Stadt und die umliegenden Hügel und Wälder näher, und ihre väterliche Freundschaft empfand ich wie ein unbekanntes neues Lebensglück. Sie erzählten uns Jungs aus der Bibel, und ich begann, neben den Romanen von Karl May und Comics auch in der Bibel zu lesen.
Die sogenannten Kinderfreizeiten wurden zu den Höhepunkten meines Lebens. Ich schloss Freundschaften mit Jungs, die aus „gutem Hause“ kamen und ins Gymnasium gingen. Es schien im CVJM keine sozialen Unterschiede zu geben. Ich begann über alles in meinem Leben mehr oder weniger intensiv mit Gott zu sprechen. Dass ich meine Kleptomanie ablegen konnte, empfand ich als große Gebetserhörung. In den Jahren zuvor hatte ich mich oft mit Schuldgefühlen in den Schlaf geweint, weil ich das Stehlen nicht lassen konnte.
Nach der Schule startete ich eine Berufsausbildung zum Bauzeichner. Daneben pflegte ich zwei Leidenschaften: das Klettern und den CVJM.
Gründe zur Flucht in die Berge und in den CVJM hatte ich genügend: Der eine ältere Bruder rutschte vollends in die Drogenszene ab, der andere unternahm mehrere Selbstmordversuche. Glücklicherweise hatten wenigstens meine drei jüngeren Geschwister in der Jugendarbeit des CVJM einen Halt im Leben gefunden. Es gab für mich nichts Schöneres, als mitzuerleben, wie andere Menschen den Weg zu jenem Gott fanden, den ich selbst kennengelernt hatte, und wie sie daraus Kraft und Lebensfreude schöpften. Dafür wollte ich leben, und so übernahm ich in der christlichen Jugendarbeit immer größere Verantwortung.
Meine Eltern trennten sich, viel zu spät, wie mir schien, denn immer wieder hatte es heftigen Streit zwischen ihnen gegeben. Mit achtzehn mietete ich mir ein Zimmer, schloss meine Lehre zum Bauzeichner ab und entschied mich für eine zweite Ausbildung zum Pflegefachmann. Finanziell war es ein schwieriges Jahr, doch immer wieder fanden sich in meinem Briefkasten Umschläge mit Geld, hineingelegt von Leuten, denen ich von meiner überaus knappen Kasse nie erzählt hatte und die mir auch nicht besonders nahestanden.
Die dreijährige praktische Ausbildung im Spital machte mir von Anfang an klar, dass Pflegefachmann mein „Traumberuf“ war. Auch das gemeinsame Leben in zwei Wohngemeinschaften empfand ich als große Bereicherung. In meiner Freizeit ließ ich mich im Geländesport, Skifahren und Bergsteigen zum Jugendleiter ausbilden.
1980 beauftragten mich meine Freunde beim CVJM, in einem reichen Vorort von Basel, Riehen, eine neue Kinderarbeit zu gründen. Mit einem jüngeren Freund zog ich auf die andere Stadtseite und begann eine eigene Jungschararbeit. Darüber hinaus mieteten wir eine alte Zehn-Zimmer-Villa mit großem Garten, die schon nach kurzer Zeit von einer illustren Schar bewohnt wurde. Mein gebrechlicher Großvater, meine inzwischen geschiedene Mutter, mein alkoholkranker Onkel, zeitweise mein aus der Drogenrehabilitation kommender Bruder Roland, Freundinnen aus dessen Drogenszene, gestrandete Menschen oder ledige Mitarbeiter der Jungschar wohnten hier mit uns zusammen. Die meiste Arbeit in der WG übernahm wohl meine Mutter, die mir aber immer wieder versicherte, es mache sie glücklich. Sie hatte ihren unerschütterlichen Glauben an Gott, eine unerhörte Großzügigkeit schwachen Menschen gegenüber und eine enorme Lebenskraft, die mich prägte.
Mein Leben – bestehend aus Spital, Jungschar, WG und Bergabenteuern (Letztere erlebte ich meist mit meinem besten Freund Urs Mayer) – nahm eine Wende, als zwei Theologiestudenten in unsere WG zogen. Ralf Dörpfeld und Volker Heitz nahmen mich mit auf die Plätze und Straßen Basels, wo sie mit Theater und Liedern predigten und das Gespräch mit Passanten suchten. Für mich bedeutete es Mutprobe und Abenteuer, mich in meiner Heimatstadt öffentlich zum Christsein zu bekennen; zugleich gab es meinem Glauben neuen Aufschwung. Ich half mit beim Start einer neuen Freikirche, die schnell wuchs und später unter dem Namen „Evangelische Gemeinde Basel (EGB)“ bekannt wurde.
Mein vier Jahre jüngerer Bruder Erich, ebenfalls im CVJM aktiv, verliebte sich in dieser Zeit in eine junge Frau, Christine Tanner. Sie erwiderte allerdings seine Gefühle nicht. Die Gründe waren mir schleierhaft, denn er war ein gut aussehender, sportlicher Typ. Erich hatte eine ausgesprochen künstlerische Begabung, weshalb er die Kunstgewerbeschule Basel absolvierte. Ich war ziemlich stolz auf meinen Bruder, Christine empfand ich hingegen als kühle und unnahbare Schönheit.
Nach vier Jahren rieten mir Freunde, meinen Beruf an den Nagel zu hängen und meine Stärken vollzeitlich in einer christlichen Arbeit einzusetzen. Man empfahl mir eine Schulung für „Gemeindebau“ in England, mit deren Abschluss ich später an einem bekannten „Mission College“ Theologie und kulturübergreifende Kommunikation studieren könnte. Aber das wollte ich nicht. Erstens liebte ich meinen Pflegeberuf, und zweitens wollte ich mein Geld nicht als „Berufs-Christ“ verdienen. Darum bewarb ich mich an drei Fachschulen für Krankenpflege als Lehrer – mit berufsbegleitender Lehrerausbildung. Zu meiner Überraschung erhielt ich von allen drei Schulen eine Zusage. Zur gleichen Zeit allerdings wurde in meinem Darm ein Geschwür entdeckt. Ich bagatellisierte, doch meine Ärztin mahnte, die Diagnose sei nicht ungefährlich, und ich solle doch bitte etwas Tempo vom Gaspedal nehmen …
Ich zog Bilanz: Ich war 27 Jahre alt, die Jungschar Riehen, angewachsen von 18 auf 80 Kinder, hatte fähige Mitarbeiter und immer noch die stete Unterstützung älterer Christen vor Ort. Der Mietvertrag unserer WG-Villa würde in einem Jahr auslaufen. Darum ließ ich mich überzeugen und zog 1984 mit dem Segen der Gemeinde, der WG und der Jungschar nach England.
England und Manila
England und Manila
England war eine neue Welt. Im ersten Jahr geriet ich mitten in einen geistlichen Aufbruch einer evangelischen Freikirche, die sich „Ichthus“-Bewegung nannte. Die Leute übten sich in neutestamentlichen Gaben wie Krankenheilungen oder dem Beten in fremden Sprachen. In Schulhallen wurden moderne Gottesdienste mit viel Musik und spannenden, alltagstauglichen Bibelauslegungen veranstaltet. Ich war bei der Gründung kleiner Tochtergemeinden im Südosten Londons dabei. Eifrig zogen wir durch die von Graffiti gezeichneten Wohnsilos mit den dunklen Sozialwohnungen und versuchten, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
In den nächsten zwei Jahren belegte ich am „All Nations Christian College“ ANCC unweit von Cambridge einen Diplomkurs. Weil das akademische Jahr in England aus dreimal zehn Wochen besteht, blieben mir jeweils zwanzig Wochen, um in der Schweiz als Krankenpfleger zu arbeiten und dadurch das Studium zu finanzieren. Außerdem behielt ich so den Kontakt zu meinen Freunden und meiner Familie in Basel.
Im Studium inspirierten mich nebst der Theologie vor allem die Themen über andere Religionen und Kulturen. Die Hälfte der Dozenten kam aus der Dritten Welt. Sie warfen öfter Fragen auf, als welche zu beantworten. Das erweiterte meinen Horizont und mein Denken, auch und gerade in Glaubensfragen.
Zum zweiten Studienjahr gehörte ein Praktikum. Ich war beeindruckt von den Vorlesungen über „Urban Mission“ und hörte von einer kleinen verwegenen Gruppe aus Neuseeland, den „SERVANTS“, die in den Slums von Manila unter einfachsten Verhältnissen mit den Armen lebten. Ich bekam das Buch „Companion to the Poor“ („Mit den Armen leben“) von Viv Grigg in die Hände. Darin berichtet er über seine Monate mit den Armen in den Slums und fordert Christen heraus, sich mit ihrem Leben mit den Armen zu solidarisieren.
Zur gleichen Zeit erhielt ich die Einladung zu einem Einsatz mit einem bekannten nordamerikanischen Missionswerk, dessen Missionare in traditioneller Weise unter verwahrlosten Kindern und Jugendlichen arbeiteten. Ich flog nach Manila und stellte mir die Aufgabe, zwei grundverschiedene Missionskonzepte zu vergleichen.
Das nordamerikanische Missionswerk war eine eindrückliche Erfahrung: Von den vierzig ausländischen Mitarbeitern lebten die meisten mit ihrem ganzen amerikanischen Luxus in den streng bewachten reichen Stadtvierteln. Die Arbeit auf den Straßen, in den Gefängnissen und Heimen wurde hingegen von 160 Filipinos geleistet. Mit fünf von ihnen, alles ledige Männer, lebte ich fünf Wochen in einem von Riesenschaben verseuchten fensterlosen Verschlag. Unter einem Wellblechdach und über einer Garage. Wir hatten Strom, Wasser, WC und eine verschlossene Stahltür. Es war also kein Slum, aber doch sehr erbärmlich, laut und stinkig, und wir schliefen auf Holzpritschen.
Die einheimischen Mitarbeiter waren bettelarm, aber gebildet, was man an ihrem Englisch erkannte. Sie nahmen mich mit auf ihre Einsätze in die Gefängnisse, zu den Jugendbanden und Straßenkindern und in das Rotlichtmilieu, wo sie nachts eine Teestube betrieben. Was ich dort erlebte, erschütterte mich zutiefst. Not gab es auch in Basel und London, doch Manila war eine andere Liga. Kinder und ganze Familien lebten buchstäblich im Schmutz der Straße. Zum ersten Mal begegnete ich Menschen, die Hunger und Demütigungen ganz real erleiden mussten, die von der Gesellschaft ignoriert oder als unterbezahlte Arbeitskräfte missbraucht wurden und sich das Recht zum Leben täglich neu erkämpfen mussten. Ich sah Kinderarbeit, Bettler und Prostitution. Vorher schien ich ausgeblendet zu haben, dass es Menschen gab, die konkret und wirklich hungerten. Das passte nicht in meine Theologie. Diese Begegnung mit den Armen kostete mich beinahe meinen Glauben an einen gütigen Gott.
Bald hatte ich das Vertrauen einiger einheimischer Mitarbeiter des Missionswerks. Ich spürte neben ihrem Eifer für die ganz Armen auch Vorbehalte und sogar unterschwellige Bitterkeit über die tiefe wirtschaftliche Kluft zwischen den Missionaren aus den USA und Kanada und ihnen selbst, den Filipinos. Es war grotesk: Weiße Mitarbeiter fuhren bei Arbeitssitzungen in ihren zum Teil brandneuen Geländewagen vor, während die philippinischen Mitarbeiter nicht einmal die gesetzlich vorgeschriebenen Minimallöhne und Sozialleistungen erhielten. Wenige Jahre später wurde das Missionswerk von philippinischen Mitarbeitern beim Arbeitsgericht verklagt, verlor den Prozess und musste seine Arbeit aufgeben.
Das Missionskonzept von SERVANTS sah völlig anders aus: Am Ende meines Praktikums besuchte ich drei Familien und ein paar Singles aus Neuseeland und Australien, die im Auftrag der SERVANTS inmitten verschiedener Slums von Manila lebten. Ich übernachtete zweimal bei ihnen in ihren Wellblechhütten und nahm an ihren gemeinsamen Zeiten in einem Gästehaus außerhalb der Armenviertel teil. Was ich dort hörte, ließ mich nie mehr los. Die SERVANTS hatten einerseits Spaß zusammen, andererseits wurden aufwühlende Erlebnisse ausgetauscht. Es gab ein echtes Miteinander – mit Raum für brutale Ehrlichkeit und Streit, für Trost und Gebet. Ich wurde vorbehaltlos mit hineingenommen in ihr Ringen darum, einen Weg mit den Armen in den Slums zu gehen.
Die SERVANTS hatten kein großartiges Programm wie das nordamerikanische Missionswerk. Stattdessen lernten sie die Sprache der Einheimischen, es entstanden Freundschaften mit den Nachbarn in den Slums. Es gab bescheidene Selbsthilfeprojekte und Gottesdienste in drei jungen kleinen Gemeinden. Alles war bescheiden und experimentell, es kam ständig zu irgendwelchen Rückschlägen. Aber sie waren im wahrsten Sinne des Wortes „Diener“, sie hatten Zeit und ließen sich ihr Engagement mehr kosten als nur Geld. Und sie träumten davon, dass Gott die Dinge verändern würde. Dieses Miteinander erschien mir als eine Art „Jesus-Weg“.
Zurück in der Schweiz, fielen meine Berichte dementsprechend aus, und sie taten ihre Wirkung. Ein Jahr später wurde ich von der jungen EGB-Gemeinde und den Freunden aus dem CVJM Basel in einem schönen Gottesdienst verabschiedet. Sie versicherten mir, ich sei ihr „verlängerter Arm“ zu den Armen. Ich fühlte mich getragen.
Zuerst flog ich nach Neuseeland zu einem siebenwöchigen Kurs für Slumworker. Anschließend ging es weiter auf die Philippinen …
Und hier bin ich nun, am 9. Juni 1988 – in einem engen Verschlag unter einem Blechdach in einem Slum bei Manila.
Nehmen ist selig
Nehmen ist selig
„Gusto kong matuto ng Tagalog, dahil gusto ko maging kaibigan ninyo.“ Mein Sprachhelfer Noel, der Älteste meiner Gastfamilie Rinion, hat mir den Satz beigebracht: „Ich möchte gerne Tagalog lernen, damit ich euer Freund werden kann.“
Mit diesem Sätzchen hausiere ich nun schon seit Wochen von Hütte zu Hütte und sorge für Heiterkeit. Ich habe die fremdartigen Wörter nachgeahmt und eingeübt, aber offensichtlich klinge ich reichlich komisch, meine Zuhörer jedenfalls amüsieren sich köstlich. Aber da muss ich mich durchstrampeln, denn die Sprache ist im Moment das Wichtigste. Bei den SERVANTS gilt als eiserne Regel, im ersten Jahr keine Hilfsaktionen oder Projekte anzureißen, sondern ausschließlich die einheimische Sprache, Tagalog, zu lernen.
Über die Fröhlichkeit und den Humor der Einheimischen bin ich erleichtert. Für sie repräsentiere ich den starken und reichen Weißen, der dem kleinen Braunen „Hilfe“ zu bringen hat. Aber nun stehen sie vor einem dieser „Americanos“, wie sie uns alle nennen, und stellen überrascht fest, dass der ja gar keine Hilfe bringt. Im Gegenteil, der ist sogar auf Hilfe angewiesen – auf ihre Hilfe! Jetzt sind sie die Profis, sie kennen die Sprache, sie wissen, wie man hier das Leben bewältigt. Der Rollentausch gefällt ihnen, sie helfen mir gern. Mir dagegen fällt es nicht immer leicht, meine Hilflosigkeit zu ertragen. Oft genug bin ich angespannt, weil ich zu wenig Privatsphäre habe und zu viel Lärm um mich herum. Auf Schritt und Tritt begegne ich Ungerechtigkeit, Krankheit, Tod. Ich fühle mich machtlos und frustriert, reagiere laut oder ungeduldig oder ziehe mich traurig zurück. Die Leute spüren, wie überfordert und verletzlich ich bin. Das schafft Vertrauen – und Freundschaften.
Gestern sind mir hartnäckig drei junge „Baklas“ gefolgt, homosexuelle Transvestiten, und haben mich angemacht. „You are so handsome … I want to marry you … come on … let’s just have some fun …“ Ich hatte die größte Mühe, sie abzuschütteln. Und mit einem Mal spürte ich etwas von der Demütigung, der eine Frau ausgesetzt ist, die zum Lustobjekt degradiert wird. In diesen ersten Wochen habe ich bereits viele unerwartete Situationen erlebt, die mich ins Schleudern brachten.
Aus irgendeinem Grund zieht auf meinem Spaziergang eine winzige Hütte meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich werfe einen Blick hinein: Es ist dunkel und feucht und riecht nach Kot und Urin. Was für ein Dreckloch, schießt es mir durch den Kopf. Dann entdecke ich mitten im Schmutz drei Kinder, das kleinste etwa zwei, das älteste höchstens fünf Jahre alt. Sie sind unterernährt und verwahrlost. Weit und breit keine Eltern. Entsetzt springe ich zu Nanay Rinion und frage sie, was mit den Kindern sei.
„Der Vater ist Alkoholiker, er hat die Mutter verlassen.“
„Und wo ist die Mutter?“
„Die hat es wohl nicht ausgehalten, mitanzusehen, wie ihre Kinder hungern, und ist mit dem jüngsten Baby auch abgehauen.“
Es schüttelt mich. „Aber wer füttert jetzt die Kinder? Hast du die Hungerbäuchlein gesehen?“
„Nun, wir Nachbarn stellen ab und zu einmal etwas zum Essen hin. Sie tun uns ja auch leid, verdammt noch mal. Diesen Vater sollte man umbringen!“
„Nanay, die Kinder werden so nicht lange überleben.“
Nanay liest meine Gedanken und sagt schließlich: „Also gut, bring sie her. Wir haben zwar keinen Platz, aber bis wir einen neuen Ort für sie gefunden haben …“
Von wegen „im ersten Jahr nur Sprache“ … Mir kommt schon der erste Monat viel zu lang vor. Sie können doch nicht von mir verlangen, wegzuschauen! Als medizinisch ausgebildeter Pflegefachmann bin ich es gewöhnt, Leben zu erhalten. Darum lasse ich mich immer wieder zu kleinen Hilfsaktionen hinreißen, organisiere lebenswichtige Medikamente, Reis oder Milchpulver. Das zieht aber sogleich einen ganzen Rattenschwanz mit sich. Zum einen bin ich dann doch wieder „Helfer“, zum andern wollen die Nachbarn, dass ich ihnen ebenfalls helfe. Eifersucht ist ein großes Problem hier und kann gefährliche Folgen haben.
So zwinge ich mich, die Spannung so gut als möglich zu ertragen und mich mit Hilfsaktionen weitgehend zurückzuhalten. Ich höre einfach zu und leide stumm mit. Wenigstens darf ich für die Leute beten. Hier glauben alle an Gott, und Gebet erleben sie als konkrete Form von Zuwendung und Anteilnahme. Dass ich für sie beten darf, tut mir vermutlich ebenso gut wie ihnen.
Jon-Jon, der Teenager
Jon-Jon, der Teenager
Letzte Nacht habe ich entdeckt, wie die alten Eltern Rinion es schaffen, zu zweit auf dem schmalen Sofa unter dem kleinen Vordach vor der Hütte zu schlafen, ohne herunterzufallen: Sie liegen verkehrt zueinander, mit ihren Füßen jeweils in der Kopfgegend des Partners. Ich habe nie begriffen, weshalb die Rinions ihr Haus auch noch mit Haustieren teilen müssen. Es ist so schon eng genug …
Wenn Besuch da ist, wird es noch enger, und Besuch ist ziemlich oft da. Dann legt sich Jon-Jon, einer der Teenager, dem die Haustiere gehören, zum Schlafen auch schon mal kurzerhand zu mir auf meine Holzpritsche unter dem Blechdach. Oder er kommt, weil einer der beiden Ventilatoren im Haus auf meine Pritsche gerichtet ist und die Hitze der Sommernacht lindert. Dann schläft er tief und fest, während ich ständig aufwache, um mich von einem Arm oder Bein zu befreien. Für mich Europäer ist diese Nähe gewöhnungsbedürftig, für die ledigen Filipino-Männer jedoch so alltäglich, dass sie sogar eine eigene Bezeichnung dafür haben: „Makitulog“ („zusammen schlafen“). Aber Makitulog und Enge zum Trotz, Jon-Jon habe ich in diesen fünf Wochen seit meiner Ankunft fest in mein Herz geschlossen. Er ist ein fröhlicher Junge, immer zu einem Unfug oder Witz bereit.
Heute haben mein Sprachhelfer Noel und seine Frau Josslin ihr Baby Jonel getauft. Ich habe das Fest allerdings verpasst, weil ich zu einem Teamtreffen der SERVANTS in der Stadt war. Als ich zurückkomme, sitzt Jon-Jon unter der Fensteraussparung und starrt bedrückt ins Leere. Normalerweise hat er in dieser Stimmung seinen besten Freund bei sich, seinen Hund. Doch er ist allein.
„Bakit“, frage ich, „warum?“ Jon-Jon schluckt. Ich setze mich neben ihn und lege behutsam meinen Arm um seine Schultern.
„Sie haben meinen Hund aufgegessen“, sagt er und bricht in Tränen aus.
Sie haben diesen dreckigen, kranken Köter tatsächlich als Festmahl zur Taufe des kleinen Jonel aufgetischt. Vor Jon-Jon hatten sie es zuerst verheimlicht, aber es dauerte nicht lange, bis er merkte, woher das Fleisch stammte. Mich schaudert es. Zum Glück war ich bei der Feier nicht dabei. Ich hätte von dem Fleisch ebenfalls essen müssen, und bei jedem Bissen hätte ich das sieche alte Tier vor mir gesehen. Andererseits brauchen die Leute hier dringend Proteine, und Fleisch ist ein großer Luxus.
Jon-Jon schluchzt hemmungslos. Ich halte ihn noch ein wenig fest. Vielleicht hat dieser Verlust bei ihm eine alte Wunde aufgerissen. Er hatte mir vor einiger Zeit erzählt, wie sie sich vor drei Jahren in jenem Innercity-Slum, in dem er aufgewachsen war, gegen die gewaltsame Umsiedlung nach Bagong Silang gewehrt hatten. Zusammen mit den Nachbarn hatten sie Barrikaden errichtet gegen die Schlägerbanden der Landeigentümer, die vor den Bulldozern hergingen, um mit Schlagstöcken und Schusswaffen den Widerstand der Slumbevölkerung zu brechen und sie zu verjagen, damit die Bulldozer ihre Hütten niederwalzen konnten. Damals war es zu einer blutigen Auseinandersetzung mit der Schlägertruppe gekommen, es hatte Verletzte und zwei Tote gegeben. Eines der Opfer war ein Teenager, der an einer Schusswunde verblutete – Jon-Jons bester Freund.
Was wird aus einem Menschen, der schon als Teenager einen Verlust nach dem andern erleben muss? An diesem Abend schlafe ich nachdenklich und müde ein.
Nora und Boy
Nora und Boy
Ich spaziere an einer offenen Hütte vorbei und lächle der jungen Mutter zu, die gerade am Kochen ist. „Kain tayo“, ruft sie vergnügt, lädt mich ein, zum Essen zu bleiben. „Salamat“, antworte ich, lehne dankend ab. Aber es spricht nichts dagegen, mit ihr ein paar neue Tagalog-Sätzchen auszuprobieren, solange sie am Kochen ist.
Irgendwie kann ich ihr das verständlich machen und schließlich sagt sie, in überraschend gutem Englisch: „No problem, I am Nora, go ahead …“ Wer hier Englisch kann, zeigt es gerne. Englisch gehört zum guten Ton und zeugt von guter Ausbildung. Und Nora will die Gelegenheit beim Schopf packen – also mich – und ihr Englisch auffrischen.
Im weiteren Verlauf unseres gegenseitigen Sprachunterrichts wiederholt Nora die Einladung zum Essen. Ihre Gestik ist unmissverständlich. Ich habe keine Chance zu entkommen und gebe klein bei. Nora tischt eine dünne Reissuppe auf, und ich ahne, dass das die ganze Mahlzeit einer sehr armen Familie ist. Die Kinder, die herumtollen, sind süß, aber unglaublich dünn. Wenigstens scheinen sie gesund, geht es mir durch den Kopf.
Während wir an der heißen Suppe schlürfen und uns über die lustigen Kinder amüsieren, streckt plötzlich eine junge Frau den Kopf in die Hütte – die Tür steht weit offen, was wichtig ist, wenn ein lediger Mann und eine junge Frau sich im selben Raum befinden.
„Vater!“, schreien die Kinder wie aus einem Mund. „Sieh nur, der Americano hier ist unser neuer Freund.“ Jetzt realisiere ich, dass das hübsche und stark geschminkte Frauengesicht mit entsprechender Frisur einem jungen Mann gehört, der offensichtlich der Vater der Familie ist. Natürlich lasse ich mir meine Überraschung nicht anmerken.
„Das ist Boy“, stellt mir Nora ihren Ehemann vor, als wäre seine Verkleidung als Frau das Normalste der Welt. „Er kommt eben aus der Stadt, von seiner Arbeit.“
Am Abend erzähle ich meiner Gastfamilie von der komischen Begegnung.
„Der Vater hat eben nur als Frau Arbeit gefunden, also macht er sich für die Arbeit zur Frau“, erklärt mir die alte Mutter Rinion. „Welche Art von Arbeit?“, frage ich und merke im gleichen Augenblick, wie naiv ich bin. Nanay seufzt schwer und sagt langsam: „Wenn Kinder hungern, sind viele Eltern zu jeder Art Arbeit bereit.“
Der Satz geht mir auch am Abend auf der Holzpritsche noch nach. Die Kinder hungern, aber wenn draußen ein „Americano“ vorübergeht, laden auch die ärmsten Filipinos ihn mit einem „kain tayo“ ein: „Lass uns zusammen essen.“ Wenn jemand sein „kain tayo“ mindestens dreimal wiederholt, dann ist es ihm ernst mit der Einladung und es wäre sehr unhöflich, sie abzulehnen.
Sogar die einfachsten Slumhütten sind innen oft peinlich sauber gehalten. Und weil die Umgebung gewöhnlich alles andere als sauber ist, bin ich als Gast verpflichtet, die Schuhe auszuziehen, bevor ich eintrete. Meist wird Wasser zum Trinken angeboten. Wenn ich aus Angst vor verschmutztem Wasser ablehne, kommt es vor, dass der Gastgeber schnell im nächsten „Sari-Sari“, so nennt man den an jeder Ecke vorhandenen kleinen Familienladen, eine Cola organisiert. Dafür macht er notfalls kurzerhand Schulden. Einen Fremden zu bewirten bedeutet ihm viel.
Wenn ich mich etwas vorsehe und diese innere Verpflichtung meines Gastgebers vorausahne, tue ich gut daran, selber schnell eine große Cola oder ein paar Früchte, am besten gleich für die ganze Familie, zu organisieren. Das nennen sie „pasalubong“ und bedeutet so viel wie „Mitbringsel“. Ob manche darauf bereits hoffen, wenn sie die Einladung aussprechen? Mag sein. Aber angesichts ihrer erbärmlichen Lebensumstände würde ich ihnen das nicht verübeln. Ich jedenfalls erlebe die spontane Gastfreundschaft als echt und eindrücklich.
Jonels Tod
Jonels Tod
Sieben Wochen bin ich nun schon in Bagong Silang. Zeit für einen kurzen Rückzug ins SERVANTS-Haus. Wir Slumworker aus dem Westen müssen hin und wieder auftauchen und Luft holen; das Elend ununterbrochen zu ertragen wäre zu viel verlangt. Diesmal werde ich wohl drei Tage weg sein.
Bevor ich gehe, erkläre ich Noel und Josslin noch, wie sie die WHO-Dehydrationslösung „Orisol“ zubereiten und verabreichen sollen, für alle Fälle, weil Jonel leichten Durchfall hat. Durchfall ist bei Säuglingen ja nichts Außergewöhnliches. Jonel wird gestillt, er ist gut genährt und vollwangig, oft voller Lachen und sprudelndem Leben, der Sonnenschein der Hütte. Aber sicher ist sicher. Und dann: raus hier!
Das SERVANTS-Haus ist für uns alle eine Oase. Wir laden ab und tanken auf. Das Haus dient allen als offizielle Wohnadresse, mitsamt Telefon, Fax und einem Tresor für Pässe und Papiere. Eine Sekretärin und eine Hausangestellte halten uns den Rücken frei; zusammen mit einem Hausleiter-Ehepaar geben sie uns Slumworkern ein wenig Heimat, stehen für Gespräche und Besuche zur Verfügung, bieten die Möglichkeit zum Übernachten.
Wir sind etwa zwanzig Slumworker, Familien mit Kindern genauso wie Singles aus Neuseeland, Australien und England. Alle paar Wochen treffen wir uns hier, hören uns gegenseitig zu, weinen und lachen, sprechen einander Segen und Mut zu. Das Ausmaß an Elend, mit dem wir konfrontiert sind, bringt uns an unsere Grenzen und kehrt bei jedem das Beste und das Schlechteste von innen nach außen. So blickt man in andere Welten hinein und lässt andere in die eigene Welt hineinblicken. Diese Offenheit und dieses Vertrauen befreien und tragen, keiner braucht sich etwas vorzumachen, und vorgetäuschte Stärken und Souveränitäten zerschellen bald einmal an der Wirklichkeit. Manchmal kommt es vor, dass müde oder ausgebrannte Mitarbeiter genötigt werden, ausgiebig Urlaub zu nehmen – oder endgültig nach Hause zurückzukehren. Die Neuen werden besonders intensiv betreut.
Wir pflegen in unserem Haus einige Rituale. Das Gebet gehört dazu, oft auch eine kleine Bibellektüre. Konfessionelle Gewohnheiten gibt es keine, angesichts der hiesigen Realität wäre so etwas läppisch. Wir zelebrieren das Gemeinsame und lassen dabei die Unterschiedlichkeiten zu.
Abhängige sind wir sowieso alle, auch finanziell. Wir leben von der Unterstützung der Freunde und Kirchgemeinden in der Heimat. Die Idee ist, dass wir alles miteinander teilen, wie die ersten Christen. Inzwischen staune ich nicht einmal mehr, dass das auch wirklich funktioniert, ob bei privaten Auslagen oder bei Projektkosten. Was „genügsam leben“ konkret bedeutet, darüber sprechen wir immer wieder.
Das Abendmahl wird diesmal von einem Australier gestaltet, und zwar mit Chips und Cola. Jesus Christus ist auch da, da bin ich mir sehr sicher, er lächelt und freut sich. Dafür fehlt ein katholischer Bruder: Vom Abendmahl respektive von der Kommunion schließt er sich jeweils konsequent aus. Weil er uns in Erinnerung rufen will, wie schmerzhaft der konfessionelle Bruch in der Christenheit sei. Mich beschäftigt anderes wesentlich mehr. Aber ich schätze es, dass er mich an seinem Empfinden teilhaben lässt, wie es umgekehrt ja auch der Fall ist. So bringen wir uns gegenseitig weiter.
Wir lachen viel in diesen drei Tagen, essen gut und machen sogar einen kurzen Ausflug. Entsprechend entspannt tauche ich darum wieder ein in „meine“ Hütte in „meinem“ Slum. Doch als ich meine Gastfamilie fröhlich begrüßen will, schnappe ich nach Luft. An der Wand, an der normalerweise Noel und Josslin schlafen, liegt Jonel. Aufgebahrt.
Wie benommen setze ich mich auf die einzige Holzbank und starre auf das weiße, aufgedunsene Gesichtchen der kleinen Leiche. „Wir haben alles nach Vorschrift verabreicht“, versichern mir Noel und Josslin, ohne dass ich sie gefragt hätte. „Aber der Durchfall ist stärker geworden und Jonel zusehends schwächer. Dann sind wir mit ihm den weiten Weg in die Stadt, ins Spital gerast, aber es war zu spät.“
Das darf nicht wahr sein. Nicht in „meiner“ Familie! Ich bin wie gelähmt, nicht einmal heulen kann ich. Noel entgeht es nicht, und dann sagt er doch tatsächlich: „Jesus hatte Jonel so lieb, er hat ihn zu sich genommen.“ Jetzt tröstet er mich auch noch – er mich statt ich ihn.
Nach dem ersten Schock packt mich die Wut über eine unfähige und zynische Regierung, die die Menschen an einen Ort umsiedelt, nein aussetzt, an dem es kein sauberes Wasser und keine Arbeit gibt, keine Mittel zum Leben. Und über die ganze Welt, die dieses Elend untätig zulässt, und über die hunderttausend Christen dieser Stadt, deren Christsein darin besteht, es in ihren klimatisierten Mittelklassekirchen auszusitzen!
Neun Tage lang liegt das tote Kind dann im Haus. Verwandte aus der Provinz reisen an. Alle sollen ausgiebig trauern und Abschied nehmen können. Der kleine Sarg ist verschlossen, man kann das verstorbene Kind nur noch durch ein kleines Glasfenster sehen. In das kleine Körperchen haben sie Formalin gespritzt, um die Verwesung zu verzögern. Ich nehme trotzdem Verwesungsgeruch war.
Auf dem Tisch liegen ein paar verwelkte Blumen, neben einer brennenden Kerze und einer offenen Büchse, als Sammelkasse. Das Geld soll der Familie bei den Beisetzungskosten helfen. Vor der Hütte haben Rinions mit Schnüren ein Dach aus einer Stoffplane gespannt, das die Besucher und die Nachbarn tagsüber vor der Sonne und nachts vor dem Tau schützen soll. Die Nachbarn betreiben darunter fast ununterbrochen ein Glücksspiel. Ein Anteil der Einnahmen geht an die Trauerfamilie. Die Stimmung ist sonderbar. Die Leute weinen und lachen, spielen und trinken, die ganze Nacht bis zum Morgengrauen. Nur Josslin sitzt da und starrt wie abwesend vor sich hin. Zwischendurch schluchzt sie laut auf.
Während der Tage der Trauer darf der Boden nicht gekehrt werden. Bei Missachtung würde ein anderes Glied der Familie dem Toten folgen und ebenfalls sterben. Die Familienangehörigen sollten eigentlich nicht schlafen, so will es eine alte animistische Überlieferung. Physisch durchzustehen ist das allerdings kaum. Waschen darf sich die Trauerfamilie auch nicht. Die Rinion-Geschwister Mira, Beda, Pura und Jon-Jon halten sich allerdings nicht daran, was mich nun nicht im Geringsten stört … Offensichtlich haben die drei aktiven Christen von der Living-Spring-Gemeinschaft meines australischen Freundes Rob ihre Angst vor den Geistern weitgehend abgelegt und sind dabei, sich von den Unterwerfungen des Animismus loszulösen. Mit ihrer Gitarre singen sie auch immer wieder frohe Lieder und bringen damit etwas Licht in die bedrückte Stimmung.
Ich fühle mich müde und krank, habe mir eine Erkältung eingefangen … ein absurdes Wort bei dieser Hitze. Aber ich bekomme zur richtigen Zeit ein Geschenk des Himmels, in Form meines Schweizer Freundes Christian Auer, der für eine gute Woche auf Besuch kommt. Er ist Student des Schweizerischen Tropeninstituts und wird sich anschließend den „Smokey Mountains“ widmen, einem besonders grässlichen Slum, wo er für seine Diplomarbeit Parasiten und den Impfzustand bei Kindern untersucht. Das Gespräch mit Christian und das gemeinsame Gebet tun mir gut. Sie helfen mir, richtig zu trauern. So komme ich einigermaßen über die Runden.
Meine kleine Klinik
Meine kleine Klinik
Mitte August. Neun Wochen. Und dreiundvierzig dauert es noch, bis mein Sprachlehrjahr gemäß der eisernen Regel der SERVANTS vorbei ist und ich mich der „eigentlichen“ Arbeit widmen kann. Aber was spricht denn dagegen, jetzt schon ein wenig mit der „eigentlichen“ Arbeit zu beginnen, abgesehen von der eisernen Regel? Als Krankenpfleger zu arbeiten, würde meinen Sprachunterricht doch auch unterstützen!
„Rob, hör mal, was denkst du über eine kleine ambulante Klinik? Eine Gesundheitsversorgung, die ich wenigstens an zwei Tagen der Woche führen könnte?“
Rob und seine Frau Lorraine zeigen sich mäßig begeistert. Andererseits wissen sie selber, wie schwer es fällt, sich mit der Sprache zu beschäftigen statt mit der Not. Und sie wissen, wie wohl es tut, etwas zu tun. Wenn ich Lorraines Kindergarten sehe, in welchem viele Kinder für die Grundschule vorbereitet werden, und ihr Ernährungsprogramm, in dem von 220 unterernährten Kindern schon im ersten Jahr 108 ihr Normalgewicht erreicht haben ...
Vor meiner Ankunft hatte Joan, eine ältere SERVANTS-Mitarbeiterin, in Bagong Silang eine Art Pflaster- und Salbenklinik unterhalten. Nach ihrer Rückkehr nach Neuseeland hatte sie eine Lücke hinterlassen. Rob und Lorraine wussten das. „Ich könnte mich an den übrigen Tagen bestimmt besser auf das Sprachstudium konzentrieren“, versichere ich Rob, „und den kranken Nachbarn würde ich nicht immer sofort helfen, sondern sie jeweils auf die Klinikzeiten verweisen.“
Nach einigem Hin und Her willigen Rob und Lorraine ein. Ich bin begeistert! Die Arbeit wartet, es gibt ja weit und breit kein Spital und kaum Ärzte. Noch vor einigen Wochen hat ein Privatarzt hier gearbeitet, gegen Bezahlung – bis er infolge einer „Electrocution“ ums Leben kam. So nennen es die Slumbewohner, wenn man illegal eine fremde Stromleitung anzapft und dabei einen Fehler macht …
Tage später ist es so weit: „Meine“ Klinik ist eingerichtet, eine niedrige Holzhütte mit Wellblechdach. Mittendrin stehe ich und schwitze. Links ein Übersetzer, rechts ein aufgeschlagenes Handbuch mit dem treffenden Titel „Where there is no Doctor“ („Wo der Arzt fehlt“). Daneben rudimentäre chirurgische Instrumente für die Wundversorgung, ein Gaskocher für deren Sterilisation, Blutdruckgerät, Ohrenspiegel, eine Kiste mit viel Paracetamol gegen Schmerzen und Fieber, diverse Antibiotika, Mittel gegen Durchfall, Desinfektionslösung, Verbandmaterial und eine Menge Salben. Ein Bild von unfreiwilliger Komik. Zu lachen gibt es allerdings wenig, angesichts der realen Nöte der Menschen draußen. Die Warteschlange ist lang, und ich bin überfordert.