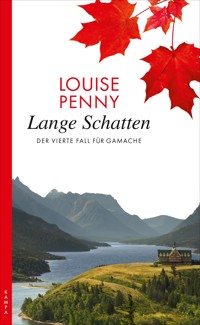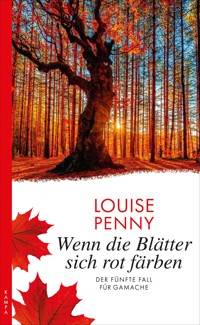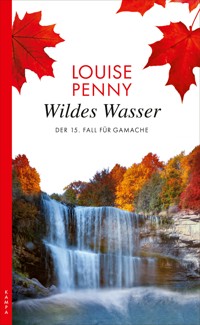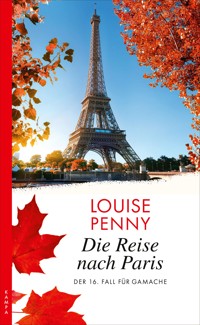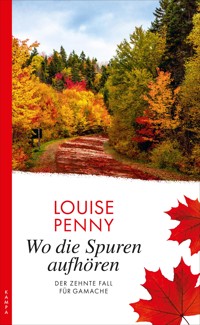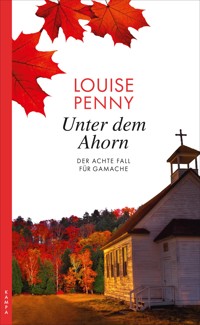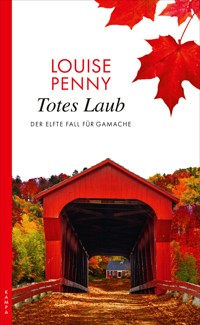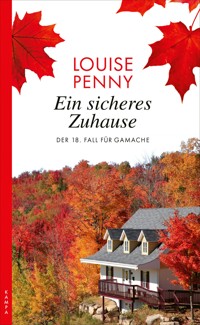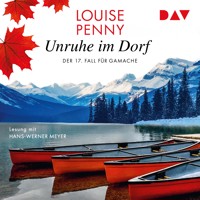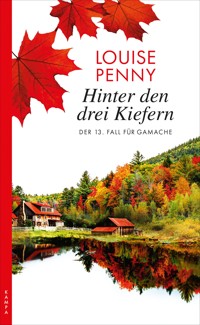
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Three Pines. In den Wäldern Kanadas, nur eine Stunde von Montréal entfernt, liegt dieses idyllische Dorf. Aber am Morgen nach Halloween legt sich ein Schatten über Three Pines. Mitten im Dorf steht eine düster verkleidete Gestalt. Niemand weiß, wer sie ist und was sie vorhat. Auch Armand Gamache, der Polizeichef von Québec, der in Three Pines ein Wochenendhaus besitzt, um sich von seiner aufreibenden Arbeit zu erholen, kann ihr kein Wort entlocken. Was sollte er auch tun? Herumzustehen ist schließlich keine Straftat. Aber spätestens als eine Leiche gefunden wird, bricht Unruhe aus: Warum hat Gamache es nicht geschafft, die Dorfbewohner zu schützen? Monate später, als der Fall vor Gericht kommt, zweifeln alle an der Kompetenz des Superintendent. Und auch Gamache ist sich nicht sicher, ob sein Plan wirklich aufgeht. Ein riskanter Plan ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Louise Penny
Hinter den drei Kiefern
Ein Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck
Kampa
Für Lise Desrosiers, die ich in meinem Garten gefunden habe und die nun in meinem Herzen lebt.
1
»Nennen Sie uns bitte Ihren Namen.«
»Armand Gamache.«
»Und Sie sind der Leiter der Sûreté du Québec?«
»Der Chief Superintendent, ja.«
Gamache saß aufrecht auf dem Holzstuhl. Es war heiß an diesem Vormittag im Juli. Drückend. Er schmeckte den Schweiß auf seiner Oberlippe, dabei war es erst zehn Uhr. Es fing erst an.
Er konnte sich schönere Orte als den Zeugenstand vorstellen. Und auch schönere Beschäftigungen, als Zeuge zu sein. Gegen einen anderen Menschen auszusagen. Nur wenige Male in seiner Laufbahn hatte er Befriedigung dabei empfunden, sogar Freude, aber dieses Mal gehörte nicht dazu.
Armand Gamache saß auf dem unbequemen Stuhl, unter Eid, und gestand sich ein, dass er zwar an das Gesetz glaubte, in dessen Dienst er sein ganzes Leben gearbeitet hatte, mehr noch aber seinem Gewissen verpflichtet war.
Und das erwies sich als ziemlich unerbittlicher Richter.
»Soweit ich weiß, haben Sie auch die Festnahme vorgenommen.«
»Das stimmt.«
»Ist es nicht ungewöhnlich, dass der Chief Superintendent selbst eine Festnahme vornimmt?«
»Ich bekleide diesen Posten erst seit kurzem, wie Sie wissen. Daher ist für mich alles noch ungewöhnlich. Aber in diesem besonderen Fall konnte ich praktisch nicht anders.«
Der Staatsanwalt lächelte. Da er mit dem Rücken zu den Zuschauern und den Geschworenen stand, sah das sonst niemand. Außer vielleicht die Richterin, der nur wenig entging.
Und was Judge Corriveau sah, war kein besonders freundliches Lächeln. Eher ein höhnisches Grinsen. Es überraschte sie, weil der Staatsanwalt und der Chief Superintendent doch eigentlich auf derselben Seite standen.
Wobei ihr klar war, dass die beiden sich deswegen noch lange nicht mögen oder schätzen mussten. Auch sie hatte Kollegen, die sie nicht besonders schätzte, allerdings glaubte sie nicht, dass sie sie jemals mit einem solchen Ausdruck angesehen hatte.
Während sie versuchte, aus den beiden schlau zu werden, wurde sie von Gamache taxiert. Er versuchte ebenso, aus ihr schlau zu werden.
Welcher Richter einem Fall zugeteilt wurde, war entscheidend. Es konnte Einfluss auf das Urteil haben. Und es hatte noch nie so viel Bedeutung gehabt wie in diesem Fall. Nicht nur die Auslegung des Gesetzes hing davon ab, sondern auch die Atmosphäre im Gerichtssaal. Wie streng würde es zugehen? Wie viel Spielraum gäbe es?
War der Richter aufmerksam? Schon halb im Ruhestand? Fieberte er dem Feierabendbier entgegen? Oder hatte er es sich schon morgens gegönnt?
Diese Richterin gewiss nicht.
Maureen Corriveau war neu auf dem Richterstuhl. Es war ihr erster Mordprozess, wie Gamache wusste. Sie tat ihm leid. Sie hatte keine Ahnung, welches Pech sie mit diesem Fall hatte. Dass sie hier wenig Erfreuliches erwartete.
Sie war mittleren Alters, und ihr Haar wurde langsam grau, ohne dass sie etwas dagegen unternahm. Vielleicht ein Zeichen von Autorität oder Reife. Oder weil sie niemanden mehr beeindrucken musste. Sie war eine hervorragende Prozessanwältin und Partnerin in einer Kanzlei in Montréal gewesen. Sie war blond gewesen. Dann kam der Aufstieg. In Großbritannien würde man sagen, sie sei Kronanwältin geworden. Ein wenig musste sie sich wie ein Fallschirmspringer beim Absprung aus einem Flugzeug fühlen.
Die Richterin drehte sich wieder zu ihm. Sie hatte einen durchdringenden Blick. Klug. Aber Gamache fragte sich, wie viel sie tatsächlich sah. Und wie viel ihr entging.
Sie wirkte gelassen. Aber das hieß nichts. Er wirkte wahrscheinlich auch gelassen.
Er sah sich im vollbesetzten Gerichtssaal des Palais de Justice in Vieux-Montréal um. Die meisten, die man hier hätte erwarten können, waren zu Hause geblieben. Einige, wie Myrna, Clara und Reine-Marie, würden in den Zeugenstand gerufen werden und wollten erst kommen, wenn sie mussten. Andere Dorfbewohner – Olivier, Gabri, Ruth – hatten einfach keine Lust, Three Pines zu verlassen, nur um die Fahrt in die stickige Großstadt auf sich zu nehmen und die Tragödie erneut zu durchleben.
Dafür war Jean-Guy Beauvoir hier, Gamaches Stellvertreter, ebenso Chief Inspector Isabelle Lacoste, Leiterin der Mordkommission.
Früh genug würden sie in den Zeugenstand gerufen werden. Vielleicht würde es aber auch nicht dazu kommen.
Er wandte seinen Blick wieder zum Chief Crown Prosecutor, Generalstaatsanwalt Barry Zalmanowitz. Dabei streifte er den von Judge Corriveau. Zu seinem Verdruss neigte sie leicht den Kopf. Und ihre Augen wurden ein kleines bisschen schmaler.
Was hatte sie in seinen Augen gesehen? Hatte die frischgebackene Richterin mitbekommen, was er zu verbergen versuchte? Unbedingt zu verbergen versuchte?
Wenn sie es sah, dann würde sie es bestimmt missverstehen. Sie würde glauben, dass er Zweifel an der Richtigkeit der Anklage hatte.
Die bezweifelte Armand Gamache jedoch keineswegs. Er wusste genau, wer den Mord begangen hatte. Er machte sich nur ein wenig Sorgen, dass etwas schiefgehen könnte. Und ein überaus hinterhältiger Mörder entkäme.
Er sah zu, wie der Staatsanwalt bedächtig zu seinem Tisch ging, seine Brille aufsetzte und sorgfältig, geradezu effekthascherisch, ein Blatt Papier studierte.
Das Blatt war vermutlich leer, dachte Gamache. Oder es war eine Einkaufsliste. Ziemlich sicher war es ein Kniff, eine Finte. Ein Zaubertrick.
Gerichtsverfahren waren, genau wie katholische Messen, das reinste Theater. Er meinte den Weihrauch zu riechen und das Glockengebimmel zu hören.
Die Geschworenen, die von der Hitze noch nicht ganz betäubt waren, folgten jeder Bewegung des gewieften Staatsanwalts. Wie von ihm bezweckt. Aber er spielte nicht die Hauptfigur in diesem Drama. Diese Rolle hatte jemand inne, der nicht auf der Bühne stand und höchstwahrscheinlich niemals ein Wort sagen würde.
Der Staatsanwalt nahm seine Brille wieder ab, und Gamache hörte das leise Rascheln der Seidenrobe der Richterin, die ihre Ungeduld kaum noch verbarg. Die Geschworenen mochten beeindruckt sein, die Richterin war es nicht. Und die Geschworenen würden es auch nicht mehr lange sein. Dafür waren sie zu klug.
»Soweit ich weiß, gibt es ein Geständnis«, sagte der Staatsanwalt und bedachte den Leiter der Sûreté mit einem professoralen Blick, den er sich bei Gamache hätte sparen können.
»Es gab ein Geständnis, ja.«
»Geschah das im Lauf der Vernehmung, Chief Superintendent?«
Gamache bemerkte, dass der Staatsanwalt erneut seinen Rang genannt hatte, als könnte jemand in dieser Position eigentlich keinen Fehler machen.
»Nein. Das war bei mir zu Hause, und das Geständnis wurde freiwillig abgelegt.«
»Einspruch.« Der Verteidiger sprang auf, ein wenig spät, dachte Gamache. »Das ist irrelevant. Es gab kein Mordgeständnis.«
»Das stimmt. Das Geständnis, von dem ich spreche, betraf nicht den Mord«, sagte der Staatsanwalt. »Aber es führte direkt zu der Anklage, stimmt das, Chief Superintendent?«
Gamache sah zur Richterin. Wartete auf ihre Entscheidung über den Einspruch.
Sie zögerte.
»Abgelehnt«, sagte sie. »Sie dürfen antworten.«
»Der Besuch erfolgte freiwillig«, sagte Gamache. »Und ja, das Geständnis war zum damaligen Zeitpunkt von zentraler Bedeutung für unser weiteres Vorgehen, das zur Anklageerhebung führte.«
»Waren Sie von diesem Besuch überrascht?«
»Euer Ehren«, sagte der Verteidiger und sprang erneut auf. »Einspruch. Subjektiv und irrelevant. Warum soll es von Bedeutung sein, ob Monsieur Gamache überrascht war oder nicht?«
»Stattgegeben.« Die Richterin wandte sich an Gamache. »Antworten Sie nicht.«
Gamache hatte nicht vorgehabt, die Frage zu beantworten. Die Richterin hatte recht. Seine Antwort wäre subjektiv. Aber er hielt sie nicht für irrelevant.
War er überrascht gewesen?
Als er gesehen hatte, wer da auf der Veranda seines Hauses in dem kleinen Dorf in Québec stand, war er natürlich überrascht gewesen. Erst hatte er nicht genau sagen können, wer sich in dem schweren Mantel mit der über den Kopf gezogenen Kapuze verbarg. Mann, Frau? Jung, alt? Gamache meinte noch, die Hagelkörner zu hören, die gegen sein Haus prasselten, als sich der bitterkalte Novemberregen in Eisregen verwandelt hatte.
Wenn er jetzt, in der Julihitze, nur daran dachte, fröstelte ihn.
Ja. Er war überrascht gewesen. Er hatte nicht mit dem Besuch gerechnet.
Für das, was dann kam, war das Wort Überraschung zu schwach.
»Ich möchte nicht, dass mein erster Mordprozess vor einem Berufungsgericht endet«, sagte die Richterin so leise, dass nur Gamache sie hören konnte.
»Ich glaube, dafür ist es zu spät, Euer Ehren. Dieser Fall begann vor einem höheren Gericht und dort wird er auch enden.«
Die Richterin rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Ihr war unbehaglich. Etwas hatte sich geändert. Durch diesen seltsamen Austausch.
Worte konnte sie entschlüsseln, egal wie kryptisch sie waren. Es war Gamaches Blick, der sie irritierte. Sie fragte sich, ob er sich dieses Blicks bewusst war.
Auch wenn Judge Corriveau nicht sagen konnte, was es war, wusste sie, dass der Chief Superintendent der Sûreté nicht so schauen sollte. Während er sich im Zeugenstand befand. Bei einem Mordprozess.
Maureen Corriveau kannte Armand Gamache kaum. Nur vom Hörensagen. Allerdings waren sie sich im Lauf der Jahre oft auf den Fluren des Palais de Justice über den Weg gelaufen.
Sie hatte damit gerechnet, den Mann nicht zu mögen. Einer, der andere Menschen jagte. Ein Mann, der seinen Lebensunterhalt dem Tod verdankte. Nicht, dass er ihn provozierte, aber er profitierte davon.
Ohne Mord kein Gamache.
Sie erinnerte sich an eine zufällige Begegnung, als er noch die Mordkommission der Sûreté geleitet hatte und sie Strafverteidigerin gewesen war. Sie waren sich auf dem Flur begegnet, und sie hatte seinen Blick aufgefangen. Durchdringend, wachsam, nachdenklich. Und auch damals hatte noch etwas anderes darin gelegen.
Dann war er weitergegangen, den Kopf leicht gesenkt, seinem Begleiter zugewandt. Einem jüngeren Mann, von dem sie wusste, dass er sein Stellvertreter war. Der jetzt auch im Gerichtssaal war.
Ein zarter Duft nach Sandelholz und Rosen war zurückgeblieben. Kaum wahrnehmbar.
Maureen Corriveau war nach Hause gegangen und hatte ihrer Frau davon erzählt.
»Ich bin ihm gefolgt und habe mich ein paar Minuten in den Gerichtssaal gesetzt, um mir seine Zeugenaussage anzuhören.«
»Warum?«
»Reine Neugier. Ich habe noch nie mit ihm zu tun gehabt, aber ich dachte, falls es jemals dazu kommt, sollte ich vorbereitet sein. Außerdem musste ich ein bisschen Zeit rumbringen.«
»Und? Wie war er? Warte, lass mich raten.« Joan drückte den Finger gegen die Nasenspitze und sagte: »Yo, der Arsch hat dem Typen eins übern Schädel gezogen. Warum verschwenden wir ’n hier unsre Zeit mit ’nem Prozess, ihr Fettärsche. Macht ihn fertig!«
»Das ist ja unheimlich«, sagte Maureen. »Warst du etwa dabei? Ja, er hat sich in Edward G. Robinson verwandelt.«
Joan lachte. »Na ja, Jimmy Stewart und Gregory Peck haben es eben nie zum Leiter der Mordkommission geschafft.«
»Stimmt auch wieder. Er hat Schwester Prejean zitiert.«
Joan legte ihr Buch weg. »Während eines Prozesses?«
»Im Zeugenstand.«
Gamache war im Zeugenstand ruhig und entspannt, aber nicht unbeteiligt gewesen. Ein großer Mann in einem gut geschnittenen Anzug, elegant, wenn auch nicht auf den ersten Blick attraktiv. Er saß aufrecht und aufmerksam da. Respektvoll.
Seine fast vollständig ergrauten Haare waren frisch geschnitten. Sein Gesicht war glattrasiert. Selbst von der Empore aus konnte Maureen Corriveau die tiefe Narbe an seiner Schläfe sehen.
Und dann hatte er es gesagt.
»Niemand ist so schlecht wie das Schlechteste, das er je getan hat.«
»Warum zitiert er eine Nonne, die gegen die Todesstrafe kämpft?«, fragte Joan. »Und gerade diese Worte?«
»Ich glaube, es war eine vorsichtig vorgetragene Bitte um Milde.«
»Aha«, sagte Joan und dachte kurz nach. »Wobei das Gegenteil natürlich auch stimmt. Niemand ist so gut wie das Beste, das er je getan hat.«
Jetzt saß Judge Corriveau in ihrer Richterrobe zu Gericht und versuchte herauszufinden, was Chief Superintendent Gamache im Schilde führte.
So nah war sie ihm noch nie gekommen und auch noch nie so lange. Die tiefe Narbe an seiner Schläfe war noch da und würde es natürlich immer bleiben. Als hätte ihn seine Arbeit gebrandmarkt. Aus der Nähe konnte sie die Fältchen um seinen Mund sehen. Und um die Augen. Spuren des Lebens. Es waren Lachfalten. Sie hatte auch welche.
Ein Mann auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Gelassen. Zufrieden mit dem, was er getan hatte und jetzt tun musste.
Aber was war das in seinen Augen?
Der Blick, den Maureen Corriveau vor langer Zeit auf dem Flur erhascht hatte, hatte sie so überrascht, dass sie Gamache gefolgt war und seiner Zeugenaussage zugehört hatte.
Es war Freundlichkeit gewesen.
Aber was sie heute sah, war etwas anderes. Es war Sorge. Ganz eindeutig, dachte sie. Er war besorgt.
Und das war sie jetzt auch, selbst wenn Judge Corriveau nicht hätte sagen können, warum.
Sie drehte sich weg, und beide wandten ihre Aufmerksamkeit dem Staatsanwalt zu. Er spielte mit einem Stift, und gerade als er sich gegen seinen Tisch lehnen wollte, warf ihm die Richterin einen so strengen Blick zu, dass er sich augenblicklich wieder aufrichtete. Und den Stift ablegte.
»Dann will ich die Frage anders formulieren«, sagte er. »Wann hatten Sie den ersten Verdacht?«
»Wie die meisten Morde«, sagte Gamache, »nahm auch dieser seinen Anfang lange vor der eigentlichen Tat.«
»Dann wussten Sie also noch vor dem Tod des Opfers, dass ein Mord geschehen würde?«
»Nein. Das nicht.«
Nein?, fragte sich Gamache. Wie er es sich seit dem Fund der Leiche jeden Tag fragte. Vor allem aber fragte er sich, wie er es nicht hatte voraussehen können.
»Ich will Sie noch mal fragen, Chief Superintendent, wann wussten Sie es?«
In Zalmanowitz’ Stimme schwang jetzt eine gewisse Ungeduld mit.
»Ich wusste, dass etwas nicht stimmt, als die Gestalt in der schwarzen Robe im Dorf erschien.«
Unruhe entstand im Gerichtssaal. Die auf die Seite verbannten Reporter beugten sich über ihre Laptops. Er konnte das Tippen durch den ganzen Saal hören. Ein moderner Morsecode, der Eilmeldungen verbreitete.
»Mit ›Dorf‹ meinen Sie Three Pines«, sagte der Staatsanwalt und sah zu den Reportern, als wäre es bemerkenswert, dass der Staatsanwalt den Namen des Dorfes, in dem Gamache lebte und das Opfer gestorben war, kannte. »Südlich von Montréal an der Grenze zu Vermont, ist das korrekt?«
»Ja.«
»Soweit ich weiß, ist es recht klein.«
»Ja.«
»Hübsch? Sogar friedlich?«
Zalmanowitz schaffte es, »hübsch« wie langweilig klingen zu lassen und »friedlich« wie fade. Aber Three Pines war keins von beidem.
Gamache nickte. »Ja. Es ist sehr hübsch.«
»Und abgelegen.«
Aus dem Mund des Staatsanwalts hörte sich »abgelegen« wie abseitig an, als wäre die zunehmende Entfernung von der Stadt gleichbedeutend mit Zivilisationsferne. Was stimmen konnte, dachte Gamache. Aber er wusste, was die sogenannte Zivilisation mit sich brachte, und auch, dass in den Städten genauso viele Raubtiere lebten wie in den Wäldern.
»Weniger abgelegen als versteckt«, erklärte Gamache. »Die meisten Leute stolpern über Three Pines, weil sie sich verirrt haben. Durchgangsverkehr gibt es dort eigentlich nicht.«
»Es liegt also im Niemandsland?«
Beinahe hätte Gamache gelächelt. Die Bemerkung war vielleicht beleidigend gemeint, aber sie traf tatsächlich zu.
Reine-Marie und er hatten beschlossen, nach Three Pines zu ziehen, weil es so hübsch und versteckt war. Es war ein Refugium, Zufluchtsort vor den Sorgen und Grausamkeiten der Welt, mit denen er täglich zu tun hatte. Der Welt jenseits des Waldes.
Sie hatten dort ein Zuhause gefunden. Sich niedergelassen. Zwischen den Kiefern und Blumenbeeten, den Dorfläden und Dorfbewohnern. Die erst zu Freunden geworden waren und dann zu einer Familie.
Sodass es sich nicht nur wie etwas sehr Sonderbares anfühlte, als das schwarze Ding auf dem hübschen friedlichen Dorfanger auftauchte und die spielenden Kinder vertrieb. Nicht nur wie ein Eindringling. Es war ein Übergriff.
Gamache erinnerte sich, dass er dieses Unbehagen schon am Abend zuvor gespürt hatte. Als die Gestalt in der schwarzen Robe das erste Mal auf der alljährlichen Halloween-Party im Bistro erschienen war.
Aber seine Alarmglocken schrillten erst, als er am nächsten Morgen zum Fenster hinausgesehen hatte und sie immer noch da gewesen war. Auf dem Dorfanger. Sie starrte zum Bistro.
Starrte einfach vor sich hin.
Jetzt, Monate später, sah Armand Gamache den Staatsanwalt an. In seiner schwarzen Robe. Dann zum Tisch der Verteidigung. Die Verteidiger in ihren schwarzen Roben. Und zur Richterin, neben ihm, ein wenig erhöht, in ihrer schwarzen Robe.
Sie starrten. Auf ihn.
Offenbar, dachte Gamache, entkam man den Gestalten in schwarzen Roben nicht.
»Eigentlich«, ergänzte er, »begann es am Abend zuvor. Auf der Halloween-Party.«
»Waren da alle verkleidet?«
»Nicht alle. Es herrschte kein Kostümzwang.«
»Und Sie?«, fragte der Staatsanwalt.
Gamache funkelte ihn an. Es war keine sachdienliche Frage. Aber sie zielte darauf ab, ihn bloßzustellen.
»Wir hatten beschlossen, jeweils als der andere hinzugehen.«
»Sie und Ihre Frau? Sie haben sich als Frau verkleidet, Chief Superintendent?«
»Nicht ganz. Wir zogen Namen aus einem Hut. Ich zog den von Gabri Dubeau, der zusammen mit seinem Partner Olivier die Pension im Dorf betreibt.«
Mit Oliviers Hilfe hatte er sich Gabris dorfbekannte rosa Plüschschlappen und einen Kimono ausgeliehen. Es war ein einfaches und überaus bequemes Kostüm.
Reine-Marie war als ihre Nachbarin Clara Morrow gegangen. Clara war eine sehr erfolgreiche Porträtmalerin, wobei sie vor allem sich selbst zu malen schien.
Reine-Marie hatte ihre Haare toupiert, bis sie nach allen Seiten abstanden, und hatte Kekse und ein Erdnussbutter-Sandwich darin befestigt. Dann hatte sie sich überall mit Farbe bekleckert.
Clara wiederum war als ihre beste Freundin Myrna Landers gegangen. Sie waren alle etwas besorgt, dass sie sich Schuhcreme ins Gesicht schmieren würde, auch wenn Myrna gesagt hatte, dass sie nicht beleidigt wäre, solange Clara sich am ganzen Körper damit einschmieren würde.
Ausnahmsweise hatte Clara sich nicht bemalt. Stattdessen hatte sie einen Kaftan getragen, den sie aus den Schutzumschlägen alter Bücher gebastelt hatte.
Myrna war, bis sie in den Ruhestand ging, Psychologin in Montréal gewesen und betrieb jetzt den Buchladen neben dem Bistro. Clara hatte die Theorie, dass die Dorfbewohner sich mühselig irgendwelche Probleme aus den Fingern sogen, nur um eine Weile bei Myrna sitzen zu können.
»Aus den Fingern saugen?«, hatte Ruth, die alte Dichterin, gesagt und Clara angeblitzt. »Du watest doch knietief in Problemen. Da bleibt für die anderen kein einziges übrig.«
»Stimmt gar nicht«, sagte Clara.
»Ach nein? Bald ist deine große Einzelausstellung, und bisher hast du nur Schrott produziert. Wenn das kein Problem ist, dann weiß ich auch nicht.«
»Es ist kein Schrott.« Wobei keiner ihrer Freunde Clara zur Seite sprang.
Gabri war als Ruth auf die Halloween-Party gegangen. Er hatte eine graue Perücke aufgesetzt und sich so geschminkt, dass er wie Nosferatu aussah. Dann hatte er einen abgewetzten, mottenzerfressenen Pulli angezogen und sich eine ausgestopfte Ente unter den Arm geklemmt.
Den ganzen Abend hatte er Scotch geschlürft und Gedichtzeilen vor sich hingebrabbelt.
»Die Türen weit offen steht das Cottage
Verlassen auf der Höh –
Kein Bellen, kein Hufschlag zum Gruß
Nicht einmal eine Bö.«
»Das ist nicht von mir, du Rindvieh«, sagte Ruth. Sie trug einen abgewetzten, mottenzerfressenen Pulli und hielt eine echte Ente im Arm.
»Des Grases kleine Halme seh ich«, sagte Gabri. »Das Grün wippt frei und freut sich.«
»Hör auf«, sagte Ruth und hielt sich die Ohren zu. »Das ist Mord an meiner Muse.«
»Und ich frage mich, ob sie in fernen Zeiten«, fuhr Gabri unbeirrt fort, »werden sein große, dicke Zwiebeln.«
Das letzte Wort sprach er wie »Zwib-eln« aus.
Selbst Ruth musste lachen, während in ihren Armen Rosa, die Ente, »Fuck, fuck, fuck« quakte.
»Ich hab den ganzen Tag daran gearbeitet«, sagte Gabri. »So schwer ist diese Dichterei gar nicht.«
»Das war also am einunddreißigsten Oktober des letzten Jahres«, sagte der Staatsanwalt.
»Nein. Es war der erste November. Am eigentlichen Halloween-Abend sind wir alle zu Hause geblieben, damit wir den Kindern, die an unsere Türen klopften, Süßigkeiten geben konnten. Die Party findet immer am nächsten Abend statt.«
»Am ersten November. Wer war außer den Dorfbewohnern anwesend?«, fragte der Staatsanwalt.
»Matheo Bissonette und seine Frau Lea Roux.«
»Madame Roux, die Politikerin«, sagte der Staatsanwalt. »Soweit ich weiß, wartet eine große Parteikarriere auf sie.«
Hinter sich hörte er wieder Tippen auf den Laptops. Sirenengesang. Beweis, dass er es in die Nachrichten schaffen würde.
»Ja«, sagte Gamache.
»Freunde von Ihnen? Haben Sie bei Ihnen übernachtet?«
Natürlich kannte der Staatsanwalt die Antworten auf diese Fragen. Er stellte sie für die Richterin und die Geschworenen. Und die Reporter.
»Nein. So gut kannte ich die beiden nicht. Sie waren zusammen mit ihren Freunden Katie und Patrick Evans da.«
»Ah ja. Das Ehepaar Evans.« Der Staatsanwalt sah zur Verteidigung und dann wieder zu Gamache. »Der Bauunternehmer und seine Frau, die Architektin. Sie bauen Glashäuser, nicht wahr? Sind das auch Freunde von Ihnen?«
»Ja, sie sind auch Bekannte«, korrigierte Gamache ihn mit fester Stimme. Ihm gefiel der Unterton nicht.
»Natürlich«, sagte Zalmanowitz. »Und warum waren sie im Dorf?«
»Sie kommen jedes Jahr. Die vier sind seit Studienzeiten miteinander befreundet. Sie haben zur selben Zeit die Université de Montréal besucht.«
»Sie sind jetzt alle Anfang dreißig?«
»Ja.«
»Seit wann kommen sie nach Three Pines?«
»Seit vier Jahren. Immer dieselbe Woche im Spätsommer.«
»Nur nicht letztes Jahr, da kamen sie Ende Oktober.«
»Ja.«
»Seltsame Zeit für einen Besuch. Das Herbstlaub ist schon gefallen, und zum Skifahren ist es noch zu früh. Ziemlich trist, oder?«
»Vielleicht sind die Zimmer in der Pension dann günstiger«, sagte Gamache mit einem beflissenen Gesichtsausdruck. »Es ist sehr nett dort.«
Als er an diesem Morgen von Three Pines Richtung Montréal aufgebrochen war, kam Gabri angelaufen, eine braune Papiertüte und einen Becher Kaffee in der Hand.
»Wenn du über die Pension sprechen musst, könntest du dann ›die schöne Pension‹ sagen? Reizend ginge auch.«
Er hatte hinter sich gedeutet. Es wäre keine Lüge. Das ehemalige Gasthaus auf der anderen Seite des Dorfangers mit der breiten Veranda und den Giebeln war reizend. Besonders im Sommer. Wie die anderen Häuser im Dorf hatte es einen üppig blühenden Vorgarten. Rosen und Lavendel und Fingerhut und duftender Phlox.
»Sag bloß nicht atemberaubend«, riet ihm Gabri. »Das klingt aufgesetzt.«
»Und das wollen wir ja nicht«, sagte Gamache. »Du weißt, dass das ein Mordprozess ist.«
»Ja«, sagte Gabri mit ernster Miene und reichte ihm Kaffee und Croissants.
Und jetzt saß Gamache im Gerichtssaal und hörte dem Staatsanwalt zu.
»Wie kamen die Freunde überhaupt auf Three Pines?«, fragte Monsieur Zalmanowitz. »Hatten sie sich verirrt?«
»Nein. Lea Roux und Dr. Landers kennen sich von früher her. Myrna Landers war ihre Babysitterin. Lea und Matheo hatten Myrna ein paarmal besucht und Gefallen an dem Dorf gefunden. Sie hatten ihren Freunden davon erzählt, und irgendwann veranstalteten sie dort ihre Jahrestreffen.«
»Verstehe. Dann haben das also Lea Roux und ihr Mann angezettelt.« Er ließ es wie etwas Verdächtiges klingen. »Unterstützt durch Madame Landers.«
»Dr. Landers, und von ›anzetteln‹ kann keine Rede sein. Es waren völlig normale Zusammenkünfte.«
»Ach ja? Sie nennen das, was geschehen ist, normal?«
»Bis zum letzten November, ja.«
Der Staatsanwalt nickte in einer Weise, die überlegen wirken sollte, so als würde er sich von Chief Superintendent Gamache nicht an der Nase herumführen lassen.
Es war lächerlich, dachte Judge Corriveau. Aber die Geschworenen waren wie gebannt.
Und dann fragte sie sich erneut, warum der Staatsanwalt seinen eigenen Zeugen in ein schlechtes Licht rückte. Den Leiter der Sûreté, Himmel noch mal.
Die Temperaturen stiegen, drinnen wie draußen. Sie sah zu den alten Klimaanlagen, die in die Fenster eingebaut waren. Natürlich abgeschaltet. Zu laut. Der Krach würde nur ablenken.
Aber die Hitze lenkte inzwischen auch ab. Und dabei war es noch nicht einmal Mittag.
»Wann wurde Ihnen klar, Chief Superintendent, dass es nicht normal war?«, fragte Zalmanowitz.
Erneut hob der Staatsanwalt Gamaches Rang hervor, aber jetzt deutete sein Ton darauf hin, dass er ihm eine gewisse Inkompetenz unterstellte.
»Das war während der Halloween-Party im Bistro«, sagte Gamache, der sich nicht provozieren ließ. »Einige der Gäste trugen Masken, wobei die meisten zu erkennen waren, besonders, wenn sie etwas sagten. Aber einer nicht. Einer der Gäste trug eine bodenlange schwarze Robe und eine schwarze Maske. Handschuhe, Stiefel. Über den Kopf hatte er eine Kapuze gezogen.«
»Hört sich nach Darth Vader an«, sagte der Staatsanwalt, und aus den Zuschauerreihen war Kichern zu hören.
»Zuerst dachten wir das auch. Aber es war kein Star-Wars-Kostüm.«
»Was sollte das Kostüm dann darstellen?«
»Reine-Marie«, Gamache wandte sich erklärend an die Geschworenen, »meine Frau«, alle nickten, »überlegte, ob er den Vater aus dem Film Amadeus darstellen wollte. Aber der trug einen Dreispitz. Während unser Gast diese Kapuze aufhatte. Myrna dachte, es könnte ein Jesuit sein, nur trug er kein Kreuz.«
Und dann war da sein seltsames Verhalten. Während die Leute um ihn herum feierten, stand dieser Gast völlig still da.
Die anderen gaben es bald auf, ihn anzusprechen. Ihn über sein Kostüm auszufragen, um herauszufinden, was es darstellen sollte. Es dauerte nicht lange, und keiner kümmerte sich mehr um ihn. Und um die Gestalt öffnete sich ein Raum. So als würde sie in ihrer eigenen Welt leben. Ihrem eigenen Universum. In dem es keine Halloween-Party gab. Keine Feiernden. Kein Lachen. Keine Freundschaft.
»Was glaubten Sie denn, was die Gestalt darstellen sollte?«
»Ich glaubte, dass er der Tod war«, sagte Armand Gamache.
Im Gerichtssaal herrschte auf einmal Stille.
»Und was haben Sie gemacht?«
»Nichts.«
»Tatsächlich? Der Tod kommt zu Besuch, und der Leiter der Sûreté und ehemalige Chief Inspector der Mordkommission tut nichts?«
»Er war ein verkleideter Mensch«, sagte Gamache geduldig.
»Das mögen Sie sich an diesem Abend gesagt haben«, sagte der Staatsanwalt. »Wann wurde Ihnen klar, dass er tatsächlich der Tod war? Lassen Sie mich raten. Als Sie vor der Leiche standen?«
2
Nein. Die Gestalt auf der Halloween-Party war verstörend, aber erst am nächsten Morgen, als er aus dem Schlafzimmerfenster in den feuchten Novembertag hinaussah, begann Gamache zu denken, dass etwas ganz und gar nicht stimmte.
»Ist da etwas, Armand?«, fragte Reine-Marie, die aus der Dusche kam und zu ihm trat.
Ihre Augenbrauen senkten sich, als sie aus dem Fenster sah. »Was tut er da?«, fragte sie leise.
Alle anderen waren nach Hause, ins Bett gegangen, nur die Gestalt in dem dunklen Umhang nicht. Sie war zurückgeblieben. Dort geblieben. Und war immer noch dort. Stand auf dem Dorfanger in ihrem Wollumhang. Und der Kapuze. Starrte geradeaus.
Gamache konnte es aus dem Winkel nicht sehen, aber er vermutete, dass die Gestalt auch immer noch die Maske trug.
»Ich weiß es nicht«, sagte Armand.
Es war Samstagmorgen, und er trug bequeme Sachen. Cordhose und Hemd und einen dicken Herbstpullover. Es war Anfang November, und das Wetter ließ sie es nicht vergessen.
Nach dem strahlenden Oktober mit seinen bunten Blättern war der Morgen, wie so oft im November, grau und trüb heraufgedämmert.
November war der Übergangsmonat. Eine Art Purgatorium. Es war der feuchte, kalte Atem zwischen Sterben und Tod. Zwischen Herbst und Winterstarre.
Keiner mochte den November.
Gamache zog seine Gummistiefel an und ging hinaus, Henri, den deutschen Schäferhund, und die kleine Gracie ließ er zurück, und sie sahen ihm verwundert nach. Sie waren es nicht gewohnt, zurückgelassen zu werden.
Es war kühler, als er erwartet hatte. Kühler als am Abend zuvor.
Noch bevor er den Dorfanger erreicht hatte, waren seine Hände eiskalt, und er bereute es, Handschuhe und Mütze nicht mitgenommen zu haben.
Gamache stellte sich vor die dunkle Gestalt.
Sie trug die Maske. Nichts außer den Augen war zu sehen. Und selbst die waren von einer Art Schleier verdeckt.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
Seine Stimme war ruhig, beinahe freundlich. Als wäre dies nur eine höfliche Unterhaltung. Eine völlig normale Situation.
Kein Grund, feindselig zu sein. Das konnte er später immer noch werden, falls es sein musste.
Aber die Gestalt blieb still. Nicht, dass sie still stand, sie war ja nicht aus Holz. Sie wirkte selbstsicher, fast gebieterisch. So, als würde nicht nur sie an diesen Platz gehören, sondern als gehörte er ihr.
Wobei Gamache vermutete, dass dieser Eindruck eher von der Robe und dem Schweigen herrührte als von dem Menschen dahinter.
Es überraschte ihn immer wieder, wie viel wirkungsvoller Schweigen gegenüber Worten war. Wenn man jemanden aus der Fassung bringen wollte. Aber er selbst konnte sich den Luxus des Schweigens nicht leisten.
»Warum sind Sie hier?«, fragte Gamache. Zuerst auf Französisch, dann auf Englisch.
Dann wartete er. Zehn Sekunden. Zwanzig. Fünfundvierzig Sekunden.
Im Bistro blickten Myrna und Gabri durch das Bleiglasfenster.
Zwei Männer, die sich anstarrten.
»Gut«, sagte Gabri. »Armand wird ihn verscheuchen.«
»Wer ist das?«, fragte Myrna. »Er war gestern Abend auf der Party.«
»Stimmt, aber ich habe keine Ahnung, wer er ist. Olivier auch nicht.«
»Fertig?«, fragte Anton, der Spüler und Frühstückskellner.
Er griff nach Myrnas Teller, auf dem nur noch Krümel lagen. Doch dann hielt seine Hand inne. Und er starrte wie die anderen beiden aus dem Fenster.
Myrna blickte zu ihm hoch. Er war ziemlich neu hier, hatte sich jedoch schnell eingewöhnt. Olivier hatte ihn zum Spülen und Kellnern eingestellt, aber Anton hatte nicht damit hinterm Berg gehalten, dass er gerne den Posten des Küchenchefs haben würde.
»Es gibt nur einen Koch«, hatte Anton eines Tages Myrna anvertraut, als er in ihrem Laden nach alten Kochbüchern suchte. »Aber bei Olivier hört es sich an, als hätte er eine ganze Kompanie.«
Myrna lachte. Das sah Olivier ähnlich. Immer versuchte er, Eindruck zu schinden, selbst bei Leuten, die ihn dafür zu gut kannten.
»Haben Sie eine bestimmte Spezialität?«, fragte sie, als sie den Betrag in ihre alte Registrierkasse tippte.
»Ich mag die kanadische Küche.«
Sie sah ihn an. Er musste Mitte dreißig sein. Zu alt jedenfalls und zu ehrgeizig für einen Job als Hilfskellner. Er klang gebildet und machte etwas her. Schlank und sportlich. Die dunkelbraunen Haare waren an den Seiten kurz geschnitten und oben länger, sodass sie ihm in die Stirn fielen und ihn jungenhafter aussehen ließen, als er war.
Jedenfalls sah er gut aus. Und war ein ehrgeiziger Koch.
Wenn sie zwanzig Jahre jünger wäre …
Träumen durfte man ja wohl noch. Und sie tat es.
»Kanadische Küche. Was ist das?«
»Eben«, hatte Anton lächelnd gesagt. »Das weiß keiner genau. Ich würde sagen, es umfasst das, was das Land hergibt. Und die Flüsse. Die Natur hier ist verschwenderisch. Und ich bin ein Jäger und Sammler.«
Das sagte er mit einem anzüglichen Blick, so wie ein Voyeur vielleicht sagen würde: »Ich schaue anderen gerne dabei zu.«
Myrna hatte gelacht, war errötet und hatte einen Dollar für beide Kochbücher verlangt.
Jetzt starrte Anton, über ihren Tisch gebeugt, aus dem Fenster.
»Was ist das?«, fragte er flüsternd.
»Waren Sie gestern Abend nicht auch im Bistro?«, fragte Gabri.
»Doch, aber ich war die ganze Zeit in der Küche. Ich bin nicht rausgekommen.«
Myrna sah von dem Ding auf dem Dorfanger zu dem jungen Mann. Eine Party direkt hinter den Schwingtüren, und er hatte Geschirr spülen müssen. Wie in einem viktorianischen Melodram.
Er schien ihre Gedanken zu erraten und sah sie mit einem Lächeln an.
»Ich hätte rauskommen können, aber ich bin kein Partytyp. Lieber bin ich in der Küche.«
Myrna nickte. Sie verstand. Jeder hatte einen Ort, wusste sie, an dem er sich nicht nur am wohlsten, sondern auch am kompetentesten fühlte. Für sie war es ihr Buchladen. Für Olivier das Bistro. Für Clara das Atelier.
Für Sarah die Bäckerei. Und für Anton eben die Küche.
Aber manchmal war dieses Gefühl auch trügerisch. Der Ort wirkte zwar wie eine Zuflucht, war in Wirklichkeit aber ein Gefängnis.
»Was sagt er?«, fragte Anton, setzte sich und deutete auf Gamache und die Gestalt in der Robe.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte Armand. »Suchen Sie vielleicht jemanden?«
Er bekam keine Antwort. Die Gestalt rührte sich nicht. Aber er sah Atemwölkchen an der Stelle, an der ihr Mund sein musste.
Ein Lebenszeichen.
Der Atem kam regelmäßig. Wurde ausgestoßen wie die lange, stetige Dampfwolke eines fahrenden Zuges.
»Ich heiße Gamache. Armand Gamache.« Er machte eine kurze Pause. »Ich bin der Leiter der Sûreté du Québec.«
Bewegten sich die Augen leicht? Hatte der Mann ihn angesehen und dann den Blick gleich wieder abgewandt?
»Es ist kalt«, sagte Armand und rieb seine eisigen Hände aneinander. »Lassen Sie uns reingehen. Wir könnten einen Kaffee trinken und dazu vielleicht Rührei mit Speck essen. Ich wohne gleich da drüben.«
Er deutete auf sein Haus. Er fragte sich, ob es klug war, ihm zu zeigen, wo er wohnte. Aber dann dachte er, dass er das wahrscheinlich schon wusste. Armand war gerade von dort gekommen. Es war wohl kaum ein Geheimnis.
Er wartete, dass die Gestalt sich zu seiner Einladung äußerte, und überlegte einen Moment, was Reine-Marie wohl davon halten würde, wenn er seinen neuen Freund mit nach Hause brächte.
Als die Antwort ausblieb, streckte Armand die Hand nach dem Arm der Gestalt aus, um sie mit sanfter Gewalt zu überreden.
Im Bistro waren alle Gespräche versiegt, das Frühstücksgeschäft kam zum Erliegen.
Alle, die Gäste und die Bedienung, sahen zu den beiden Männern auf dem Dorfanger.
»Er zieht ihn weg«, sagte Olivier, der zu ihnen trat.
Anton wollte sich erheben, aber Olivier winkte ab. Kein Grund zur Eile, jetzt, wo alles stillstand.
Sie sahen zu, wie Armand die Hand sinken ließ, ohne den Mann anzufassen.
Armand Gamache stand jetzt selbst völlig reglos da. Während die Gestalt zum Bistro, zum Buchladen, zur Bäckerei und zu Monsieur Béliveaus Gemischtwarenladen hinüberstarrte, starrte Gamache sie an.
»Seien Sie vorsichtig«, flüsterte er schließlich.
Und dann drehte er sich um und ging zurück nach Hause.
Nachmittags stand die verhüllte Gestalt immer noch da.
Armand und Reine-Marie gingen auf dem Weg zu Claras Haus auf der anderen Seite des Dorfangers an ihr vorbei.
Den Mann umgab ein unsichtbarer Graben. Nach und nach hatten sich die Dorfbewohner hinausgewagt und gingen ihren Geschäften nach. Aber um ihn hatte sich ein großer Kreis gebildet, den niemand betrat.
Auf der Wiese spielten keine Kinder, und die Leute gingen schneller als sonst und mit gesenktem Blick.
Der angeleinte Henri gab ein leises Knurren von sich und wechselte auf die andere Seite von Gamache. Sein Fell war gesträubt, und die riesigen Ohren waren nach vorne gerichtet, dann legte er sie wieder an seinen großen und, man musste es leider sagen, etwas hohlen Kopf an.
Alles Wichtige bewahrte Henri in seinem Herzen auf. Im Kopf hatte er vor allem Kekse. Aber er war klug genug, um in sicherer Entfernung zu der Gestalt zu bleiben.
Auch Gracie, die zusammen mit ihrem Bruder Leo vor einigen Monaten in einem Abfalleimer entdeckt worden war, war angeleint.
Wie gebannt blickte sie auf die Gestalt und weigerte sich, sich auch nur einen Zentimeter weiterzubewegen. Reine-Marie musste sie auf den Arm nehmen.
»Sollen wir etwas sagen?«, fragte Reine-Marie.
»Besser, wir kümmern uns nicht um ihn«, sagte Armand. »Vielleicht sucht er gerade die Aufmerksamkeit. Wenn wir ihn nicht beachten, geht er vielleicht weg.«
Das war aber vermutlich nicht der Grund, warum Armand ihn ignorieren wollte, dachte Reine-Marie. Wahrscheinlich wollte er nicht, dass sie sich der Gestalt näherte. Und wenn sie ehrlich war, wollte sie das auch nicht.
Im Laufe des Vormittags war sie automatisch immer wieder ans Fenster getreten. In der Hoffnung, dass die Gestalt weg war. Aber sie stand weiter auf dem Dorfanger. Regungslos. Durch nichts zu bewegen.
Ohne dass Reine-Marie hätte sagen können, wann das passiert war, war er ab irgendeinem Zeitpunkt für sie kein »er« mehr. Die Gestalt verlor jede Menschlichkeit. Sie war zu einem »es« geworden. Kein Mensch mehr.
»Kommt rein«, sagte Clara. »Unser Besucher ist immer noch da, wie ich sehe.«
Sie bemühte sich, gelassen zu klingen, aber ihre Anspannung war deutlich zu spüren. Ihnen ging es nicht anders.
»Hast du eine Ahnung, wer das ist, Armand?«
»Nein, leider nicht. Ich glaube allerdings nicht, dass er noch lange bleibt. Wahrscheinlich ist es ein Scherz.«
»Wahrscheinlich.« Sie wandte sich an Reine-Marie. »Ich habe die neuen Kisten neben den Kamin im Wohnzimmer gestellt. Ich dachte, wir könnten sie dort durchgehen.«
»Neu« traf es nicht ganz.
Clara half Reine-Marie bei der, wie es langsam aussah, unendlichen Aufgabe, das sogenannte Archiv des Geschichtsvereins durchzusehen. Es bestand im Grunde nur aus Kisten und noch mehr Kisten mit Fotografien, Dokumenten, Kleidern. Seit über hundert Jahren von Speichern und aus Kellern zusammengesammelt. Auf Flohmärkten und aus Kirchenkellern gerettet.
Reine-Marie hatte angeboten, die Sachen durchzusehen. Es war eine mühselige Suche nach Trouvaillen unter einem Haufen Trödel. Aber es machte ihr Spaß. Reine-Marie war Leitende Bibliothekarin und Archivarin in der Bibliothèque et Archives nationales du Québec gewesen und hatte, wie ihr Mann, eine Leidenschaft für Geschichte. Besonders die von Québec.
»Iss doch mit uns zu Mittag, Armand«, sagte Clara. In der Küche roch es nach Suppe. »Ich habe ein Baguette aus der Bäckerei besorgt.«
»Non, merci. Ich war gerade auf dem Weg ins Bistro.« Er hielt ein Buch in die Höhe. Sein Samstagsnachmittagsritual. Mittagessen, ein Bier und ein Buch vor dem Kamin im Bistro.
»Keins von Jacqueline«, sagte Reine-Marie und deutete auf das Baguette.
»Nein. Es ist von Sarah. Darauf habe ich geachtet. Aber ich habe ein paar von Jacquelines Brownies mitgebracht. Ist das wichtig?«, fragte Clara und schnitt das knusprige Baguette in Scheiben. »Dass ein Bäcker weiß, wie man Baguette backt?«
»Hier?«, fragte Reine-Marie. »Alles entscheidend.«
»Ja«, sagte Clara. »Glaube ich auch. Die arme Sarah. Sie will die Bäckerei an Jacqueline übergeben, aber ich weiß nicht …«
»Nun, vielleicht sind Brownies genug«, sagte Armand. »Ich schätze, ich könnte mich daran gewöhnen, Brownies mit Brie zu belegen.«
Clara stöhnte auf, dann überlegte sie kurz. Vielleicht …
»Jacqueline ist erst seit ein paar Monaten hier«, erklärte Reine-Marie. »Sie kann es ja noch lernen.«
»Sarah sagt, dass man das mit dem Baguette entweder raushat oder nicht«, sagte Clara. »Scheint mit der Art des Knetens und der Temperatur der Hände zu tun zu haben.«
»Warm oder kalt?«, fragte Armand.
»Das weiß ich nicht«, sagte Clara. »So viel wollte ich sowieso nicht wissen. Ich will lieber glauben, dass Baguettes Magie sind, nicht irgendwas Angeborenes.« Sie legte das Brotmesser hin. »Die Suppe ist fast fertig. Wollt ihr mein neuestes Bild sehen, während ich sie aufwärme?«
Es sah Clara nicht ähnlich, von sich aus anzubieten, eines ihrer Bilder zu zeigen, besonders wenn es noch in Arbeit war. Wenigstens hofften Armand und Reine-Marie, dass es das noch war, als sie zögernd durch die Küche ins Atelier gingen.
Früher hätten sie das seltene Angebot, eines von Claras erstaunlichen Porträts zu betrachten, begeistert ergriffen. Aber vor kurzem war deutlich geworden, dass Claras Vorstellung von einem »fertigen« Bild sich von der aller anderen unterschied.
Armand fragte sich, was Clara sah und sie nicht.
Im Atelier war es dämmrig, die Fenster ließen nur Nordlicht herein, und an einem bewölkten Novembertag war das herzlich wenig.
»Die sind fertig«, sagte sie und deutete im Dunkeln auf die Leinwände, die an einer Wand lehnten. Sie schaltete das Licht an.
Reine-Marie konnte es sich gerade noch verkneifen, zu fragen: »Bist du sicher?«
Einige der Porträts sahen fast fertig aus, aber die Haare waren nur mit Bleistift skizziert. Die Hände hingeworfene Flecken, Kleckse.
Die meisten Porträtierten waren erkennbar. Myrna. Olivier.
Armand trat zu Sarah, der Bäckerin, die an der Wand lehnte.
Dieses Bild war am weitesten gediehen. Aus dem faltigen Gesicht sprach Hilfsbereitschaft, wie sie Armand an ihr kannte. Eine fast spröde Würde. Und doch hatte Clara es geschafft, die Verletzlichkeit der Bäckerin einzufangen. So, als würde sie befürchten, der Betrachter erwarte etwas von ihr, das sie nicht bieten konnte.
Ja, das Gesicht, die Hände, die Haltung, alles bis ins Detail ausgearbeitet. Und trotzdem. Der Kittel war nur grob umrissen. So, als hätte Clara die Lust verloren.
Gracie und ihr Bruder Leo balgten sich auf dem Betonboden, und Reine-Marie beugte sich hinunter und kraulte sie.
»Was ist das?« Beim Klang der mürrischen Stimme zuckten alle zusammen.
Da stand Ruth mit Rosa auf dem Arm und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger ins Atelier.
»Himmel, das ist ja fürchterlich«, sagte die alte Dichterin. »Was für ein Murks. Hässlich wäre noch eine wohlmeinende Beschreibung.«
»Ruth«, sagte Reine-Marie. »Gerade du solltest wissen, dass Schöpfung ein Prozess ist.«
»Und nicht immer ein erfolgreicher. Aber jetzt sagt endlich. Was ist das?«
»Das ist Kunst«, sagte Armand. »Und es muss dir nicht gefallen.«
»Kunz? Wirklich?« Sie beugte sich vor und sagte: »Komm her, Kunz. Na, komm schon.«
Sie sahen sich an. Selbst für die demente Ruth war das merkwürdig.
Und dann fing Clara an zu lachen. »Sie meint Gracie.«
Sie deutete auf den kleinen Welpen, der mit Leo über den Boden kugelte.
Sie waren zwar zusammen in einer Mülltonne gefunden worden, aber Claras Leo entwickelte sich langsam zu einem Bild von Hund. Schlanker Wuchs und kurzes goldenes Fell, das am Hals ein wenig länger war. Leo war groß und noch etwas schlaksig, aber schon jetzt hoheitsvoll.
Das konnte man von Gracie nicht behaupten. Sie war ein Kümmerling, wenn man es nicht beschönigen wollte. Vielleicht war sie nicht einmal ein Hund.
Das hatte keiner sagen können, als Reine-Marie sie vor einigen Monaten mit nach Hause gebracht hatte. Und die Zeit hatte nicht geholfen.
Bis auf vereinzelte verschiedenfarbige Fellbüschel war sie unbehaart. Ein Ohr war keck in die Höhe gereckt, das andere hing schlaff herunter. Ihr Kopf schien täglich weiterzuwachsen, der Rest nur einen Hauch. Manchmal hatte Reine-Marie den Eindruck, als sei Gracie geschrumpft.
Aber sie hatte leuchtende Augen. Und sie schien zu wissen, dass sie vor einem schlimmen Schicksal bewahrt worden war. Ihre Liebe zu Reine-Marie war grenzenlos.
»Komm her, Kunz«, versuchte Ruth es erneut, dann richtete sie sich auf. »Nicht nur hässlich, auch noch doof. Kennt nicht mal seinen Namen.«
»Gracie«, sagte Armand. »Sie heißt Gracie.«
»Ja verflixt noch mal, warum sagst du dann, sie heißt Kunz?« Sie sah ihn an, als hätte er eine Schraube locker.
Sie kehrten in die Küche zurück, wo Clara die Suppe umrührte. Armand küsste Reine-Marie und ging zur Tür.
»Nicht so schnell, Tintin«, sagte Ruth. »Du hast uns gar nichts über dieses Ding mitten in unserem Dorf erzählt. Ich hab gesehen, wie du mit ihm gesprochen hast. Was hat er gesagt?«
»Nichts.«
»Nichts?«
Für Ruth war die Vorstellung, nichts zu sagen, völlig abwegig.
»Aber warum ist er noch da?«, fragte Clara, die auf einmal nicht mehr so tat, als interessierte es sie nicht. »Was will er? Hat er die ganze Nacht da gestanden? Kannst du nichts unternehmen?«
»Warum ist der Himmel blau?«, fragte Ruth. »Kommt die Pizza tatsächlich aus Italien? Hast du jemals Kreide gefressen?«
Sie sahen sie an.
»Das sind doch alles dumme Fragen. Nebenbei bemerkt, die Antworten auf deine Fragen lauten, weiß nicht, weiß nicht, und Edmonton.«
»Der Typ trägt eine Maske«, sagte Clara zu Armand, ohne Ruth Beachtung zu schenken. »Da stimmt was nicht. Mit dem stimmt was nicht. Im Kopf.«
Sie tippte sich an die Stirn.
»Ich kann nichts tun«, sagte er. »Es verstößt in Québec nicht gegen das Gesetz, sich das Gesicht zu bedecken.«
»Aber er trägt doch keine Burka«, sagte Clara.
»Herrgott«, sagte Ruth. »Wo ist das Problem? Hast du Phantom der Oper nicht gesehen? Er könnte jeden Moment zu singen anfangen, und dann haben wir hier die allerbesten Plätze.«
»Du nimmst das nicht ernst«, sagte Clara.
»Doch. Ich hab nur keine Angst. Wobei mir Ignoranz Angst macht.«
»Wie bitte?«, fragte Clara.
»Ignoranz«, wiederholte Ruth, die den drohenden Unterton in Claras Stimme entweder nicht gehört hatte oder nicht hören wollte. »Alles, was anders ist, alles, was du nicht verstehst, hältst du sofort für eine Bedrohung.«
»Aber du bist ein Musterbeispiel an Toleranz, was?«, fragte Clara.
»Komm schon«, sagte Ruth. »Es gibt einen Unterschied zwischen gruselig und bedrohlich. Gut, es mag ja sein, dass er Angst macht. Aber getan hat er nichts. Und wenn er das wollte, dann wäre es wahrscheinlich schon geschehen.«
Ruth wandte sich beifallheischend an Gamache, aber der reagierte nicht.
»Da zieht einer aus Jux ein Halloween-Kostüm an«, fuhr sie fort. »Mitten am Tag, und du kriegst Angst. Pah. Du wärst eine große Nummer in Salem gewesen.«
»Von allen hier bist du ihm am nächsten gekommen«, sagte Reine-Marie zu ihrem Mann. »Was ist es deiner Meinung nach?«
Er blickte auf die Hunde auf dem Boden, Gracie an Henri geschmiegt, der leise murmelnd schnarchte. Mehr als einmal hatte Armand Henri beneidet. Bis Henris Trockenfutter neben seine Wasserschüssel gestellt wurde. Da war der Neid schlagartig verflogen.
»Es geht nicht um das, was ich denke«, sagte er. »Ich bin sicher, dass er bald wieder fort ist.«
»Zier dich doch nicht so«, sagte Clara, und ihr Lächeln milderte ihren genervten Ton nur wenig. »Ich hab dir meins gezeigt« – sie deutete auf das Atelier – »jetzt musst du mir deins zeigen.«
»Es ist nur ein Eindruck«, sagte er. »Bedeutungslos. Ich habe keine konkrete Vorstellung davon, wer oder was er ist.«
»Armand«, sagte Clara warnend.
Und er ergab sich.
»Der Tod«, sagte er und sah zu Reine-Marie. »Das habe ich gedacht.«
»Der Sensenmann?«, fragte Ruth mit einem Schnauben. »Hat er mit einem krummen Finger auf dich gedeutet?«
Sie hob ihren knochigen Finger und deutete damit auf Armand.
»Ich habe nicht gesagt, dass er tatsächlich der Tod ist«, sagte er. »Aber ich glaube, derjenige, der in dem Kostüm steckt, will, dass wir diese Assoziation haben. Er will, dass wir Angst bekommen.«
»Ach tatsächlich«, sagte Clara.
»Tja, da seid ihr nur leider auf dem falschen Dampfer«, sagte Ruth. »Der Tod sieht nämlich anders aus.«
»Woher willst du denn das wissen?«, fragte Clara.
»Weil wir alte Freunde sind. Er besucht mich fast jede Nacht. Wir sitzen in der Küche und plaudern. Er heißt Michael.«
»Der Erzengel?«, fragte Reine-Marie.
»Ja. Alle halten den Tod für eine Schreckgestalt, aber in der Bibel ist es Michael, der die Sterbenden aufsucht und ihnen in ihrer letzten Stunde beisteht. Er ist schön und hat die Flügel auf dem Rücken zusammengefaltet, damit er nicht versehentlich die Möbel umwirft.«
»Habe ich richtig gehört? Der Erzengel Michael besucht dich?«, fragte Reine-Marie.
»Habe ich richtig gehört?«, sagte Clara. »Du liest die Bibel?«
»Ich lese alles«, sagte Ruth zu Clara, dann wandte sie sich Reine-Marie zu. »Ja, das tut er. Aber er bleibt nicht lange. Er hat viel um die Ohren. Er schaut nur auf einen Drink vorbei und tratscht über die anderen Engel. Raphael ist ein richtiger Mistkerl, kann ich dir sagen. Ein gemeiner alter Fiesling.«
Einem von ihnen entkam ein Hmmm.
»Und was erzählst du ihm?«, fragte Armand.
»Armand«, sagte Reine-Marie warnend, damit er die alte Frau nicht weiter anstachelte. Aber das wollte er gar nicht. Er war tatsächlich neugierig.
»Ich erzähle ihm alles über euch. Zeig ihm eure Häuser und mache ein paar Vorschläge. Manchmal lese ich ihm ein Gedicht vor: Aus der öffentlichen Schule in die private Hölle / Des Familientheaters«, zitierte sie und hob das Gesicht zur Decke, versuchte, sich an den Rest zu erinnern. »Wohin soll ein Junge auf seinem Rad fahren / Wenn die gerade Straße abbiegt?«
Einen Moment lang starrten die anderen sie an, lauschten den Worten nach, die sie zum Schweigen gebracht hatten.
»Ist das von dir?«, fragte Clara.
Ruth nickte und lächelte. »Ich weiß, dass es noch nicht fertig ist. Ehrlich gesagt, ist Michael nicht besonders hilfreich. Er mag Limericks lieber.«
Armand musste unwillkürlich lachen.
»Und vor der Morgendämmerung verschwindet er wieder«, sagte Ruth.
»Und lässt dich zurück?«, fragte Clara. »Das ist nicht nett.«
»Pass auf, was du sagst«, murmelte Reine-Marie.
»Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Nicht annähernd. Er ist gerne bei mir, weil ich keine Angst habe.«
»Wir haben alle vor etwas Angst«, sagte Armand.
»Ich meinte, dass ich vor dem Tod keine Angst habe«, sagte Ruth.
»Vielleicht hat ja der Tod Angst vor ihr«, sagte Clara.
»Ich hätte gerne zwei davon«, sagte Katie Evans und deutete auf die Brownies. Verziert mit geschmolzenen Marshmallows.
Sie erinnerten sie an früher.
»Und Sie, Madame?«
Jacqueline wandte sich an die andere Frau. Lea Roux.
Sie erkannte sie, aber das war nichts Ungewöhnliches. Roux war Mitglied der Nationalversammlung und tauchte oft in den Nachrichten auf. In französisch- und englischsprachigen Talkshows in der ganzen Provinz wurde sie um ihre Meinung in politischen Fragen gebeten. Sie konnte gut reden, war aber nicht arrogant. War witzig, ohne sarkastisch zu sein. Warmherzig, ohne süßlich zu sein. Sie war zum neuen Liebling der Medien aufgestiegen.
Und jetzt war sie hier. In der Bäckerei. In Lebensgröße.
Beide Frauen waren großgewachsen, ohne allzu kräftig zu sein. Auf jeden Fall hatten sie Ausstrahlung und überragten die winzige Bäckerin um einiges. Aber mochten sie auch Ausstrahlung haben, Jacqueline hatte Selbstgebackenes. Und sie hatte den Verdacht, dass ihr das im Moment Macht über die beiden gab.
»Ich glaube«, sagte Lea und begutachtete das aufgereihte Gebäck hinter der Glasscheibe, »ich nehme eine Tarte au citron und ein Millefeuille.«
»Seltsam«, sagte Katie und trat zu Sarah, der die Bäckerei gehörte und die gerade die Auslage mit Biscotti auffüllte.
Keiner musste fragen, was sie meinte.
Sarah wischte sich die Hände an der Schürze ab und nickte mit einem Blick aus dem Fenster.
»Ich wünschte, es würde verschwinden«, sagte die Bäckerin.
»Hat einer eine Ahnung, was das soll?«, fragte Lea zuerst Sarah, die den Kopf schüttelte, dann Jacqueline, die den Kopf schüttelte und wegsah.
»Es ist schlimm«, sagte Sarah. »Ich verstehe nicht, warum niemand etwas unternimmt. Armand sollte etwas unternehmen.«
»Ich glaube nicht, dass man da sehr viel unternehmen kann. Auch Monsieur Gamache nicht.«
Lea Roux hatte in dem Komitee gesessen, das Gamache als Leiter der Sûreté bestätigt hatte. Sie hatte erklärt, dass sie ihn kannte, flüchtig. Dass sie sich einige Male begegnet waren.
Wobei fast alle in dem Zwei-Parteien-Komitee Armand Gamache kannten. Er bekleidete schon lange eine hohe Position bei der Sûreté und hatte bei der Aufdeckung dieses gewaltigen Korruptionsskandals mitgewirkt.
Es hatte nur eine kurze Diskussion und keine Debatte gegeben.
Vor zwei Monaten war Armand Gamache dann als Chief Superintendent der mächtigsten Polizeieinheit in Québec vereidigt worden. Vielleicht der mächtigsten in ganz Kanada.
Doch trotz all seiner Macht, wusste Lea Roux, konnte er wegen dieses Wesens auf dem Dorfanger nichts unternehmen.
»Sie wissen, dass Sie diese Sachen auch im Bistro bestellen können«, sagte Sarah, als sie gingen, und deutete auf die kleinen Schachteln in ihren Händen. »Wir beliefern Olivier und Gabri.«
»Merci«, sagte Katie. »Wir nehmen sie mit in die Buchhandlung, um sie uns mit Myrna zu teilen.«
»Sie mag die Brownies«, sagte Sarah. »Seit Jacqueline da ist, sind sie ein echter Verkaufsschlager.«
Sie warf der sehr viel jüngeren Frau einen mütterlich stolzen Blick zu.
Bis auf die Sache mit dem Baguette war Jacqueline die Antwort auf Sarahs Gebete. Sarah war mittlerweile Ende sechzig, und es wurde ihr zu viel, jeden Morgen um fünf Uhr aufzustehen, um Brot zu backen und den ganzen Tag auf den Beinen zu sein.
Die Bäckerei zu schließen, kam nicht infrage. Und sie wollte sich auch noch nicht ganz aufs Altenteil zurückziehen. Nur das laufende Geschäft wollte sie übergeben.
Und dann war vor drei Monaten Jacqueline gekommen.
Wenn sie nur lernen würde, wie man ein gutes Baguette buk.
»Mmm, das sieht gut aus«, sagte Myrna, während sie den Tee einschenkte und Lea das Gebäck auspackte.
Dann setzten sich die drei um den Holzofen in Myrnas Buchladen, auf das Sofa und die Sessel im Erker, von wo aus sie die verhüllte Gestalt sehen konnten.
Nachdem sie ein paar Minuten lang darüber geredet hatten, ohne zu einem Schluss gekommen zu sein, wandten sie sich Katies neuestem Projekt zu. Ein Glashaus auf den Magdalenen-Inseln.
»Ehrlich?«, sagte Myrna, deren überraschter Ausruf durch den Brownie in ihrem Mund gedämpft wurde. »Auf den Maggies?«
»Ja, dort scheint im Moment ziemlich viel Geld in Umlauf zu sein. Das Hummergeschäft läuft offenbar gut.«
Lea hob eine Augenbraue, sagte aber nichts.
Es gab eine völlig neue Ware, die Reichtum schuf, wo einstmals harte Arbeit und Armut geherrscht hatten.
»Ein Glashaus auf den Inseln zu bauen, ist bestimmt schwierig«, sagte Myrna.
Die nächste halbe Stunde sprachen sie über Wetter, Geographie, Architektur und über das Zuhause. Das Thema Zuhause im Unterschied zu Haus faszinierte Myrna, und sie hörte den beiden jüngeren Frauen mit großer Bewunderung zu.
Sie fand Katie interessant. Mochte sie. Aber mit Lea verband sie, dass sie vor vielen Jahren ihre Babysitterin gewesen war.
Damals war Myrna sechsundzwanzig gewesen, hatte gerade ihren Abschluss gemacht und kratzte alles Geld zusammen, um ihren Studienkredit abzubezahlen. Lea war vier. Winzig, wie eine Maus. Ihre Eltern lebten in Scheidung, und Lea, ein Einzelkind, hatte sich fast nicht mehr aus dem Haus getraut vor Angst. Vor Unsicherheit.
Myrna war für sie eine große Schwester geworden, Mutter, Freundin. Beschützerin und Förderin. Und Lea war für sie eine kleine Schwester geworden, Tochter und Freundin.
»Ihr solltet Anton kennenlernen«, sagte Myrna und sah zufrieden zu, wie Lea das Gebäck verdrückte.
»Anton?«
»Oliviers neuen Geschirrspüler.«
»Er gibt seinem Geschirrspüler einen Namen?«, fragte Katie lächelnd. »Meiner heißt einfach Bosch.«
»Ach ja?«, sagte Lea. »Meiner heißt Gustav. Er hat nur schmutziges Zeug im Sinn.«
»Haha«, sagte Myrna. »Anton ist ein Mensch, wie ihr ganz genau wisst. Er möchte Koch werden. Am liebsten würde er eine Küche kreieren, die ausschließlich auf einheimischen Produkten beruht.«
»Bäume«, sagte Katie. »Gras.«
»Anglos«, sagte Lea. »Lecker. Den würde ich gerne kennenlernen. Wahrscheinlich gibt es Förderprogramme, an die er sich wenden könnte.«
»Tut mir leid«, sagte Myrna. »Du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit so etwas gefragt.«
»Ich helfe gerne«, sagte Lea. »Und wenn ich dafür zum Essen eingeladen werde, umso besser.«
»Prima. Wie wär’s mit heute Abend?«
»Heute Abend kann ich nicht. Wir fahren zum Abendessen nach Knowlton. Aber es wird schon klappen, bevor wir wieder heimfahren.«
»Wann wird das sein?«
»In ein paar Tagen«, sagte Katie.
Das war, dachte Myrna, seltsam vage für jemanden, der bestimmt einen straffen Zeitplan hatte.
Als alle Kunden gegangen waren, schob Jacqueline die Kekse in den Ofen und stellte den Küchenwecker.
»Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich …«
»Nein, gehen Sie nur«, sagte Sarah.
Jacqueline musste nicht sagen, wohin sie ging. Sarah wusste Bescheid. Und sie wünschte ihr alles Gute. Wenn sie und der Spüler heirateten und er Koch würde, dann würde auch Jacqueline hierbleiben.
Sarah war nicht stolz auf diese selbstsüchtigen Gedanken, aber wenigstens wünschte sie Jacqueline nichts Böses. Es gäbe bestimmt Schlimmeres, als Anton zu heiraten.
Wenn Anton nur dasselbe für Jacqueline empfände. Wenn sie nur Baguette backen könnte, dachte Sarah und wischte über die Theke. Ja. Das wäre gut.
In Sarahs Welt war ein gutes Baguette ein Zauberstab, mit dem sich alle Probleme lösen ließen.
Jacqueline eilte nach nebenan in die Küche des Bistros. Es war früher Nachmittag. Sie mussten das Abendessen vorbereiten, aber für einen Spüler war es eine recht ruhige Zeit.
»Ich wollte gerade zu dir«, sagte Anton. »Hast du es gesehen?«
»Ist ja kaum zu übersehen.«
Sie küsste ihn auf die Wange, und er erwiderte den Kuss, aber so hätte er auch Sarah küssen können.
»Sollen wir etwas sagen?«, fragte Jacqueline.
»Was denn?«, sagte er und senkte die Stimme. »Wem denn?«
»Monsieur Gamache, natürlich«, sagte sie.
»Nein«, sagte Anton bestimmt. »Tu das nicht, versprich es mir. Wir wissen ja nicht, was es ist …«
»Wir haben eine ziemlich konkrete Vermutung«, sagte sie.
»Aber wissen tun wir es nicht.« Er senkte die Stimme noch mehr, als der Koch zu ihnen herübersah. »Wahrscheinlich verschwindet er wieder.«
Jacqueline hatte gute Gründe, sich Sorgen zu machen, aber im Moment ging es ihr darum, wie Anton auf die Gestalt reagierte.
Armand saß im Bistro und las.
Er spürte Blicke auf sich. Alle mit derselben Botschaft.
Unternimm was wegen des Dings auf dem Dorfanger.
Sorg dafür, dass es verschwindet.
Was hatte man vom Leiter der gesamten Sûreté als Nachbarn, wenn er einen nicht beschützen konnte?
Er schlug die Beine übereinander und lauschte dem Knistern des offenen Feuers. Er spürte die Wärme, roch das Ahornholz und merkte, wie die Blicke seiner Nachbarn sich in ihn bohrten.
Er hatte nicht den bequemen Sessel am offenen Kamin gewählt, sondern sich ans Fenster gesetzt. Wo er das Ding sehen konnte.
Wie Reine-Marie hatte Armand gemerkt, dass er im Laufe des Tages aufgehört hatte, an die Gestalt auf der Wiese als »er« zu denken. Sie war zu einem »es« geworden.
Und Gamache wusste besser als die meisten, wie gefährlich das war. Jemanden zu entmenschlichen. Denn unter diesem Gewand steckte ein Mensch, so seltsam er sich auch verhalten mochte.
Seine eigene Reaktion fand er ebenfalls interessant. Er wollte, dass es wegging. Er wollte hinaus auf den Dorfanger gehen und es verhaften. Ihn.
Weswegen?
Weil er seinen Frieden störte.
Es brachte nichts, wenn er allen erzählte, dass keine Bedrohung bestand. Weil er nicht wusste, ob das stimmte. Was er dagegen wusste, war, dass ihm die Hände gebunden waren. Der Umstand, dass er Leiter der Sûreté war, verhinderte sogar eher, dass er etwas tat.
Reine-Marie hatte an seiner Seite gestanden, als er den Eid geleistet hatte. Gamache in seiner Ausgehuniform, mit den goldenen Epauletten und den goldenen Tressen und dem goldenen Gürtel. Und mit den Orden, die er nur ungern trug. Jeder erinnerte ihn an ein Ereignis, von dem er wünschte, es wäre nie geschehen. Aber es war geschehen.
Resolut und entschlossen hatte er dagestanden.
Sein Sohn und seine Tochter sahen zu. Auch seine Enkelkinder sahen zu, als er die Hand hob und schwor, dass er für Amt, Anstand und Gerechtigkeit eintreten werde.
Unter dem Publikum im voll besetzten großen Saal der Nationalversammlung waren ihre Freunde und Nachbarn.
Jean-Guy Beauvoir, sein langjähriger Stellvertreter und inzwischen auch sein Schwiegersohn, hielt seinen Sohn auf dem Arm. Und sah zu.
Gamache hatte Beauvoir gefragt, ob er mit ihm ins Büro des Chief Superintendent wechseln wolle. Um erneut Stellvertreter zu sein.
»Ist das nicht Vetternwirtschaft?«, hatte Beauvoir gefragt. »Eine lang gepflegte Tradition in Québec.«
»Du weißt, dass mir Traditionen sehr viel bedeuten«, sagte Gamache. »Aber du zwingst mich zu dem Bekenntnis, dass du für die Arbeit am besten geeignet bist, Jean-Guy, und die Ethikkommission stimmt zu.«
»Muss komisch für dich sein.«
»Oui. Die Sûreté ist jetzt eine Meritokratie. Also …«
»Bau keinen Scheiß?«
»Ich wollte sagen, vergiss die Croissants nicht, aber das andere passt auch.«
Und Jean-Guy hatte oui gesagt. Und merci. Nun sah er zu, wie Chief Superintendent Gamache mit dem Obersten Richter von Québec Hände schüttelte und sich dann zum Publikum umdrehte.
Er stand einer Behörde mit Tausenden Beamten vor, zuständig für den Schutz einer Provinz, die Gamache liebte. Einer Bevölkerung, in der er weder Opfer noch Bedrohung sah, sondern Brüder und Schwestern. Seinesgleichen, die es zu achten und zu schützen galt. Und manchmal zu verhaften.
»Offenbar gehören zu diesem Job mehr als nur Cocktailpartys und Wohltätigkeitsveranstaltungen«, hatte er zu Myrna während eines ihrer ruhigen Gespräche gesagt.
In der Tat hatte er die letzten Monate damit verbracht, intensive Gespräche mit den Leitern verschiedener Abteilungen zu führen und sich durch Dossiers über das organisierte Verbrechen, Drogenhandel, Morde, Cyber-Kriminalität, Geldwäsche, Brandstiftung und Dutzende andere Probleme zu arbeiten.
Schon bald war klar, dass die Lage sehr viel schlimmer war, als selbst er es sich vorgestellt hatte. Und immer schlimmer wurde. An dieser zunehmenden Verschärfung war der Drogenhandel schuld.
Die Kartelle.
Sie waren die Keimzelle des Bösen. Für die Morde, die Überfälle. Die Geldwäsche. Die Erpressungen.
Die Einbrüche, die sexuellen Übergriffe. Die blinde Gewalt von verzweifelten jungen Männern und Frauen. In den Innenstädten hatte sie sich bereits ausgebreitet. Aber sie beschränkte sich nicht darauf. Inzwischen suchte sie auch ländliche Gebietet heim.
Gamache hatte gewusst, dass es ein wachsendes Problem gab, aber von dem Ausmaß hatte er keinen Begriff gehabt.
Bis jetzt.
Tagsüber watete Chief Superintendent Gamache durch einen Morast des Abscheulichen, Gottlosen, Tragischen, Grauenvollen. Und dann fuhr er nach Hause. Nach Three Pines. In sein Refugium. Um sich zu seinen Freunden an den Kamin des Bistros zu setzen oder zusammen mit Reine-Marie in sein behagliches Wohnzimmer. Henri und die lustige kleine Gracie zu ihren Füßen.
Gesund und munter.
Bis dieses schwarze Ding auftauchte. Und nicht mehr verschwand.
»Haben Sie noch einmal das Gespräch gesucht?«, fragte der Staatsanwalt.
»Um was zu sagen?«, fragte Chief Superintendent Gamache im Zeugenstand. Von seinem Platz aus konnte er sehen, wie sich die Leute in den Zuschauerreihen mit Papier Luft zufächelten, um wenigstens die Illusion eines Lüftchens in der erstickenden Hitze zu erzeugen.
»Sie hätten beispielsweise fragen können, was er vorhat.«
»Das hatte ich schon. Unter anderen Umständen würden Sie mich, einen Polizeibeamten, fragen, warum ich einen Bürger belästige, der nichts anderes tut, als arglos in einem Park herumzustehen.«
»Einen maskierten Bürger«, sagte der Staatsanwalt.
»Ja«, sagte Gamache. »Und um mich zu wiederholen: Es ist nicht gegen das Gesetz, sich zu maskieren. Seltsam, das ja. Und ich muss Ihnen nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Das hat es nicht. Aber mir waren die Hände gebunden.«
Das rief bei den Zuschauern Gemurmel hervor. Zum Teil stimmten sie ihm zu. Zum Teil waren sie überzeugt, dass sie sich anders verhalten hätten und dass der Chef der Sûreté auf jeden Fall etwas hätte tun sollen.
Gamache erkannte den Tadel in ihrem Raunen und war sich auch darüber klar, woher er kam. Aber diese Leute saßen in einem Gerichtssaal und wussten, was geschehen war.
Er dagegen wusste, dass er nichts hätte tun können, um es zu verhindern. Sobald der Tod sich erst einmal auf den Weg gemacht hatte, konnte man ihn nur schwer aufhalten.
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Wir aßen zu Abend und blieben noch eine Weile auf und sahen fern, dann ging Madame Gamache zu Bett.«
»Und Sie?«