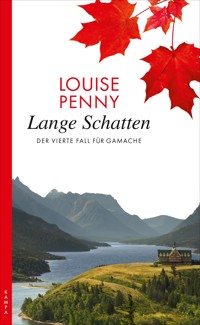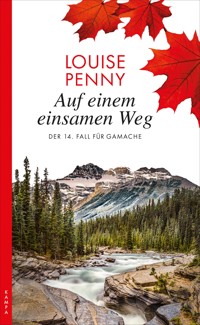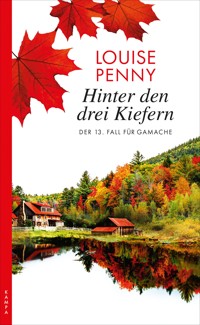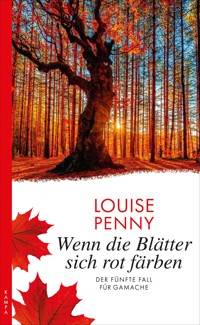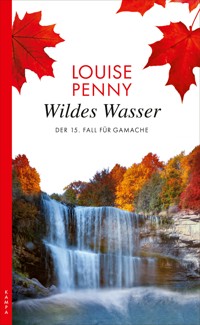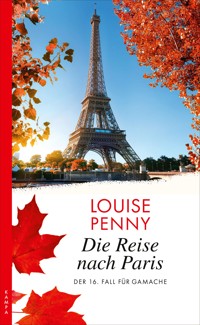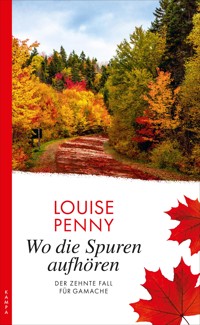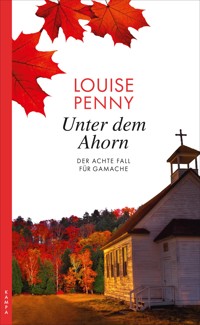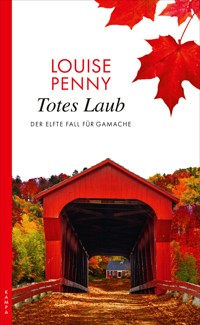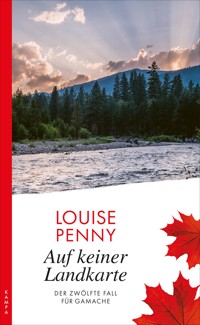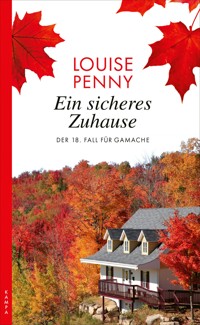
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Nach einem harten Winter erwacht Three Pines zu neuem Leben. Während die Dorfbewohner Vorbereitungen für einen ganz besonderen Gedenktag treffen, machen sich Chief Inspector Armand Gamache und Jean-Guy Beauvoir zunehmend Sorgen: Ein junger Mann und seine Schwester sind nach Three Pines zurückgekehrt. Als die Ermittler sie kennengelernt haben, waren Fiona und Samuel noch Kinder. Ihre Mutter war ermordet worden, an einem trostlosen Novembermorgen am Ufer eines gottverlassenen Sees. Es war der erste gemeinsame Fall der Ermittler. Was wollen die Geschwister Jahre später in Three Pines? Während Gamache versucht, Antworten zu finden, wird der 160 Jahre alte Brief eines Steinmetzes entdeckt. Darin beschreibt der Mann, wie ihn die Angst überkam, als er im Dorf eine Dachkammer zumauerte. Die Bewohner von Three Pines finden den Raum und beschließen, ihn zu öffnen. Gamache merkt bald, dass mehr darin steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Durch die Enthüllung betritt ein alter Feind ihre Welt und bedroht, was Gamache am meisten bedeutet: sein Zuhause.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Ein sicheres Zuhause
Roman
Kampa
Für Hardye und Don Moel
1
»Oh, merde.«
Harriet blickte in den Spiegel, die Zahnbürste ragte aus ihrem Mund. Es war der erste Juni, und sie hatte vergessen, rabbit, rabbit, rabbit zu sagen.
Rasch holte sie es mit Zahnpastaschaum auf den Lippen nach, aber sie befürchtete, dass es zu spät war. Dass die Worte nicht mehr wirken würden. Wo sie doch gerade an diesem Tag den Beistand einer höheren Macht brauchen konnte.
»Merde.«
»Es wird dir Glück bringen, mein Kleines«, hatte Auntie Myrna ihrer Nichte versprochen, als sie ihr die Beschwörungsformel beigebracht hatte. »Es wird dich beschützen.«
Das war vor vielen Jahren gewesen, aber so richtig saß die Rabbit-Formel immer noch nicht. An den meisten Monatsersten, an denen man sie sprechen musste, erinnerte Harriet sich daran, aber ausgerechnet an diesem, als sie Glück am nötigsten hatte, musste sie sie vergessen. Was vermutlich daran lag, dass ihr so viel anderes im Kopf herumging.
»Scheiße.«
Glaubte sie wirklich, dass es etwas brachte, wenn sie rabbit, rabbit, rabbit sagte? Nein. Natürlich nicht. Wie auch? Es war ein dummer Aberglaube. Die Worte hatten überhaupt keine Macht. Woher kamen sie überhaupt? Und warum ausgerechnet rabbit, Kaninchen?
Einfach albern.
Sie war Ingenieurin, sagte sie sich, als sie sich für ihre morgendliche Laufrunde fertig machte. Ein vernunftbegabtes Wesen. Aber das war ihre Tante auch. Benutzte Auntie Myrna die Beschwörungsformel überhaupt selbst? Oder war es ein Witz gewesen, den das schüchterne Kind zu ernst genommen hatte?
Sie schob den Gedanken an die Beschwörungsformel beiseite, rief sich zur Räson und begann ihren Tag.
Es wird schon klappen, sagte sie sich, als sie durch den warmen Junimorgen rannte. Alles wird gut.
Aber Harriet Landers irrte sich. Sie hätte besser rabbit, rabbit, rabbit sagen sollen.
Es war Anfang November, als der Chief Inspector Clotilde Arsenault das erste Mal sah. Er schloss den Kragen seines Parkas und kniete sich wie ein Büßer vor einem grausigen Altar neben sie.
Willst du mein Geheimnis wissen?
»Ja«, flüsterte Armand Gamache. »Erzähl es mir.«
Er achtete nicht auf das spöttische Schnauben hinter sich, sondern sah weiter in die besorgten Augen der Toten.
Der Leiter der Sûreté du Québec war vom Sonntagsfrühstück mit seiner jungen Familie weggerufen worden. Von seiner Heimatstadt Montréal war er nach Nordosten geflogen, um am Ufer dieses gottverlassenen Sees neben einer Leiche zu knien, die halb in dem eiskalten Wasser lag. Die grauen Wellen, die mit jeder Minute an Kraft zunahmen, hatten sie an Land gespült.
Weiter draußen auf dem See waren weiße Schaumkronen zu sehen, und selbst in dieser geschützten Bucht schlugen sie gegen die Frau und bewegten ihre Gliedmaßen, als wollten sie das Leben verspotten oder als hätte die Frau beschlossen, gar nicht tot zu sein und würde sich jeden Moment erheben.
Das machte die ohnehin morbide Szene zusätzlich makaber.
Es war ein trostloser Tag. Der erste November. Der Nordwind verhieß Regen. Vielleicht Schneeregen. Vielleicht Eisregen. Oder sogar Schnee.
Der Wind peitschte die Wellen noch mehr auf und jagte sie über den See. Stieß die Frau weiter, bot sie Gamache dar. Drängte sie ihm auf.
Aber er konnte nicht. Noch nicht. Auch wenn er sie am liebsten ans steinige Ufer gezogen hätte. Er wollte ihr Gesicht trocken reiben, die glasigen Augen schließen. Sie in die warme Hudson’s-Bay-Decke wickeln, die auf dem Rücksitz des Streifenwagens lag, der ihn hierhergebracht hatte.
Natürlich tat er nichts dergleichen. Stattdessen betrachtete er sie weiter aufmerksam. Um jedes Detail zu erfassen. Alles Sichtbare und nicht Sichtbare.
Ihr Alter ließ sich nur schwer schätzen. Nicht jung. Nicht alt. Das Wasser und der Tod hatten ihre Züge geglättet und die Altersspuren weggewischt. Dennoch sah sie sorgengeplagt aus.
Und sie hatte ganz offensichtlich Grund dazu gehabt.
Blonde Haare, die wie ein Gespinst über ihr Gesicht gebreitet waren. Eine feine Strähne lag über einem ihrer offenen Augen. Unwillkürlich blinzelte Gamache an ihrer statt.
Er musste ihr Alter nicht schätzen, weil er es kannte. Sechsunddreißig. Und ihren Namen kannte er auch, obwohl sie die Leiche noch nicht nach einem Ausweis abgesucht und sie nicht offiziell identifiziert hatten.
Sie war die Frau, die von ihren beiden Kindern zwei Tage zuvor als vermisst gemeldet worden war.
Kinder, die jetzt Waisen waren.
»Fotos?«, fragte er und sah sich nach seiner Stellvertreterin um.
»Schon erledigt«, sagte Inspector Linda Chernin. »Die Spurensicherung hat die nähere Umgebung abgesucht. Auf dem See und am Ufer sind Teams unterwegs, die nach der Stelle suchen, an der man sie ins Wasser geworfen hat. Wir warten auf den Leichenbeschauer, bevor wir sie bewegen, patron.«
Hinter ihm war ein »Pfff« und ein gemurmeltes »Patron, ja leck mich« zu hören.
Inspector Chernin kniff die Lippen zusammen, und ihr Blick wurde hart. Sie wollte sich den Agent vorknöpfen, aber ein Blick von Gamache ließ sie innehalten.
Gerade noch.
Harriet lief durch den strahlenden frischen Junimorgen in der Mitte der Schotterstraße, die aus Three Pines hinausführte.
Ihr Blick suchte die Umgebung ab. Ständig war sie sich des dichten Waldes und dessen, was sich darin verbergen mochte, bewusst. Bären. Elche. Tollwütige Füchse. Borreliose übertragende blutsaugende Zecken.
Bigfoot. Das ermordete Kind, das jetzt andere Kinder ermordete.
Bei der Erinnerung an die albernen Geistergeschichten, die im Dorf am Lagerfeuer erzählt wurden, lächelte sie. Dennoch legte sie einen Zahn zu. Harriet war schon viel in ihrem Leben gerannt. Und jetzt mit Anfang zwanzig rannte sie immer schneller. Immer weiter. Nur weg.
»Verletzungen?«, fragte Gamache.
Er konnte keine erkennen, aber der Leichenbeschauer würde ihnen mehr sagen können. Hoffte er.
»Hier.« Inspector Chernin deutete auf den Kopf des Opfers.
Gamache beugte sich über die Leiche, um die Stelle an der Seite des Kopfs besser sehen zu können. Ein Schatten verdrängte das bisschen Sonne, das durch die dunkelgrauen Wolken fiel.
»Würde es Ihnen etwas ausmachen?«, fragte er und warf einen Blick über die Schulter. Der Schatten verschwand, und er beugte sich weiter vor.
Ein heftiger Schlag hatte den Schädel der Frau eingedrückt.
»Das könnte auch post mortem passiert sein«, sagte Chernin. »Die Kinder des Opfers haben den Kollegen erzählt, dass sie getrunken hat und depressiv war.«
»Gehen Sie von einem Selbstmord aus?«, fragte Gamache und hockte sich auf die Fersen. Er spürte, wie seine Beine vom Knien und von der Kälte langsam taub wurden.
Eine Böe wehte ihm feine Wassertröpfchen ins Gesicht. Er drehte dem See den Rücken zu, nicht um sich, sondern um die Tote zu schützen. Nicht, dass sie es noch spüren würde, es war reiner Reflex.
Hinter sich hörte er erneutes Schnauben, dieses Mal amüsiert.
»Selbstmord? Soll das ein Witz sein? Nach allem, was man hört, hat sie gesoffen und rumgehurt. Umgebracht hat sie sich sicher nicht. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Wobei man es ihr nicht vorwerfen könnte. Ich an ihrer Stelle hätt’s getan. So jemand verschwendet nur Ressourcen.«
Gamache wechselte noch ein paar ruhige Worte mit Inspector Chernin, dann stand er auf. Langsam und bedächtig drehte er sich zu dem unglückseligen jungen Mann um.
Wäre der Agent etwas schlauer gewesen, wäre er nicht so vernagelt und darauf aus gewesen, sich selbst ein Bein zu stellen, hätte er vielleicht den Ausdruck in Chief Inspector Gamaches Augen bemerkt.
»Kommen Sie bitte mit mir mit.«
Gamache streckte die Hand aus, und der Agent wappnete sich gegen den absehbaren Stoß. Aber es kam kein Stoß. Stattdessen deutete der Chief Inspector auf eine abseits gelegene Felszunge.
Dort blieb er stehen. Nachdem er den jungen Mann einen Moment lang betrachtet hatte, sprach er. Seine tiefe Stimme klang ruhig. Gelassen. Aber sie war kraftvoller als jedes Gebrüll, das der Agent jemals gehört hatte. Und er war oft angebrüllt worden.
»Agent Beauvoir, wagen Sie es nie wieder …«
»… Ich frage mich, was passiert wäre, wenn dein Vater und ich uns nie kennengelernt hätten«, sagte Jean-Guy Beauvoir.
Er sah zu seiner Frau Annie, die ihre kleine Tochter Idola badete. Dann versuchte er wieder, dem zappelnden Honoré, der es eilig hatte, zu seinen Freunden auf den Dorfanger zu kommen, einen Pullover überzustreifen.
Dass die beste Freundin ihres Sohnes die derangierte alte Dichterin Ruth Zardo war, amüsierte die Eltern und beunruhigte sie zugleich.
»Du meinst, wenn er dich nicht in der öden Sûreté-Dienststelle aufgestöbert hätte, wo du in einem Spind geschmachtet hast?«
»Ich meine, wenn er nicht mein Genie erkannt und mich gebeten hätte, ihm beim Lösen des schwierigsten Mordfalls aller Zeiten zu helfen.«
»In ganz Kanada«, sagte Annie, die das nicht zum ersten Mal hörte.
»Auf der ganzen Welt«, ergänzte Jean-Guy.
Er ließ Honoré los, der aus dem Bad flitzte, die Treppe hinunterhüpfte und die Fliegentür hinter sich zukrachen ließ, als er ins Freie lief.
»Die Frau im See«, sagte Annie.
»Ja. Und übrigens, ich war in keinem Spind.«
»Aber nur, weil du zu groß warst, um da reingesteckt zu werden.«
»Weil ich so ein harter Hund war. Und das bin ich immer noch.« Er beugte sich lächelnd zu seiner Tochter. »Dein Papa ist groß und stark und wird dich immer beschützen, ma belle Idola, Idola, Idola.«
Als er Idola in die großen mandelförmigen Augen blickte, lachte sie. Glucksend.
In der Hinsicht war sie wie ihre Mutter. Heiter und unbeschwert.
»Mein Vater hat von deinem Auftritt an diesem Tag erzählt«, sagte Annie und rieb das Kind mit einem Handtuch trocken. »Das klang weniger nach hartem Hund als nach unangenehmem Kläffer.«
Jean-Guy lachte. »Das ist das Codewort für Genie in der Sûreté.«
»Ach so. Dann bist du eindeutig brillant.« Sie hörte ihn vergnügt schnauben, als er sich umdrehte und zum Fenster hinaus auf den Dorfanger von Three Pines blickte.
Harriet Landers sperrte den Buchladen auf und huschte auf Zehenspitzen in den ersten Stock.
Das wäre nicht nötig gewesen. Auntie Myrna war schon wach und stand in einem ihrer zeltartigen Kaftane in der Küche des Lofts und kochte Kaffee. Neben ihr stand ihr Freund Billy und briet Eier mit Speck.
Harriet hatte es bereits beim Öffnen der Tür gerochen, aber gedacht, dass es aus dem Bistro nebenan kam.
Sie war seit Kurzem Veganerin, und ihr einziger Schwachpunkt war Rührei mit Speck. Und echte Milch im Kaffee. Und Croissants. Vorsichtshalber fragte sie die Bäckerin Sarah nicht, ob sie mit richtiger Butter gemacht wurden.
Für Beschwörungsformeln reichte ihr magisches Denken offenbar nicht, aber immerhin für Croissants.
»Bereit?«, fragte Billy, nachdem sie mit Frühstücken fertig waren.
Harriet hatte geduscht und sich umgezogen und ihr Bett auf dem Schlafsofa gemacht.
Sie holte tief Luft. »Bereit.«
Auntie Myrna, die daran zweifelte, schloss sie in die Arme. »Es wird bestimmt gut gehen. Wir sind da. Du siehst wunderschön aus«, flüsterte sie.
Harriet lächelte und glaubte ihr kein Wort.
Jean-Guy stand mit dem Rücken zum Schlafzimmer und sah hinaus auf das friedliche kleine Québecer Dorf.
Annie spürte, dass er im Geist nicht mehr im Schlafzimmer ihrer Eltern in Three Pines war. Vielmehr stand er am eiskalten Ufer eines Sees, der gerade eine Leiche angespült hatte. Die Erinnerung daran lag immer dicht unter der Oberfläche. Und es war nicht einmal nur eine Erinnerung.
Dieser Tag hatte alles verändert.
Es war der Tag, an dem ein missmutiger kleiner Sûreté-Kläffer den Leiter der landesweit erfolgreichsten Mordkommission kennengelernt hatte. Es war der Tag, an dem Annies künftiger Ehemann ihren Vater kennengelernt hatte.
Was wäre passiert, wenn die beiden sich nicht begegnet wären? Was wäre passiert, wenn die Frau im See nicht ermordet worden wäre? Was, wenn ihr Vater nicht beschlossen hätte, die Mordermittlung selbst zu leiten?
Was, wenn er nicht in den Keller jener Sûreté-Dienststelle gegangen wäre? Abgelegen, aber doch nicht abgelegen genug.
Warum hatte er es getan? Es hatte keinen Grund gegeben. Chief Inspector Gamache war noch nicht mal am Leichenfundort gewesen. In dem Keller warteten keine Beweise auf ihn. Nur ein grantiger junger Agent, verbannt und vergessen.
Und doch hatte Armand Gamache es getan.
Weil er musste. Weil es Schicksal war, wie Annie Gamache wusste.
Vom Schlafzimmerfenster aus beobachtete Jean-Guy, wie sein fünfjähriger Sohn stehen blieb, nach rechts und links sah und dann über die Schotterstraße auf den Dorfanger blickte, wo mehrere Jungen und Mädchen Fußball spielten. Der schmale Junge tat gerne ungestüm, sogar verwegen, während er im Gegenteil ziemlich behutsam war. Nicht ängstlich, aber vorsichtig.
In dieser Hinsicht ähnelte er seinem Vater. Voller Kraft und Elan und Vorsicht.
Eine alte Frau und eine Ente sahen den Kindern von einer Bank aus zu. Honoré rannte hin, gab beiden ein Küsschen, dann drehte er sich um und rempelte ein anderes Kind an.
Aus dem offenen Fenster im Haus seiner Schwiegereltern konnte Jean-Guy ihr kreischendes Gelächter hören.
Ruth schüttelte auf der Bank in gespielter Missbilligung den Kopf, dann nahm sie einen Schluck aus einem Becher, in dem sich Kaffee befinden könnte, worauf aber niemand gewettet hätte.
Trotz des Lachens, der strahlenden Sonne und der verheißenen Wärme an diesem jungen Junimorgen rieb Jean-Guy die Hände aneinander und verschränkte dann fröstelnd die Arme vor der Brust.
Bei der Erinnerung an jenen Novembermorgen an dem verlassenen See war ihm kalt geworden. Die Kälte, die ihm vor so vielen Jahren bis ins Mark gedrungen war, war nie ganz verschwunden.
Aber nicht nur die Vergangenheit hatte ihn erschaudern lassen. Sondern auch die Gegenwart, das, was heute, an diesem Tag passieren würde. So viele Jahre später.
»Es gibt immer noch eine Geschichte«, flüsterte Jean-Guy. »Mehr, als das Auge schaut.«
Sein Blick wanderte von den Kindern und der Dichterin zu dem einsamen Mann, der um den Dorfanger schritt. Wie es eine Wache täte. Nicht um Verbrecher am Ausbrechen zu hindern. Sondern um die drinnen vor der Welt draußen, der man nicht immer trauen konnte, zu beschützen. Wobei gerade dieser Mann, der keinen Grund hatte, der Welt zu trauen, es tat.
Jean Guy wusste, dass sein Schwiegervater als Leiter der Québecer Mordkommission Dinge gesehen hatte, die kein Mensch sehen sollte. Tag um Tag. Leiche um Leiche. Armand Gamache hatte das Schlimmste gesehen, was Menschen einander antun konnten. Taten, die die meisten Herzen verhärtet und einen guten Menschen zynisch, verzweifelt und schließlich gleichgültig gemacht hätten.
Und doch schien er unempfänglich, geradezu blind für das Grauen zu sein, selbst wenn er sich gerade damit beschäftigte.
Als Jean-Guy, mittlerweile sein Stellvertreter, ihn irgendwann auf die Gefahr aufmerksam gemacht hatte, die diese Blindheit für das Team, für die Bürger, die er zu schützen geschworen hatte, darstellte, hatte der Chief Inspector ihn gebeten, sich zu setzen. Gamache hatte sich nach vorne gebeugt, die Ellbogen auf die Knie gestützt, die Finger verschränkt, und es ihm erklärt.
Ja, Jean-Guy habe recht. Er habe das Schlimmste gesehen, wirklich furchtbare Dinge. Das hätten sie beide. Aber sie hätten auch das Beste gesehen. Sie beide.
Er sah dem jüngeren Mann in die Augen und forderte ihn auf, einen Moment lang den Blick von all der Brutalität und Gewalt abzuwenden und auf die noch viel mutigeren Taten zu richten. Taten, die Anstand und Integrität erforderten. Selbstbeherrschung.
Vergebung.
Nicht große Helden, nicht Übermenschen hatten sie vollbracht. Sondern ganz normale Männer und Frauen, denen nichts Bedeutendes anhaftete. Einige waren Polizisten. Viele andere nicht.
Was uns blind mache, erklärte er Beauvoir, seien die schrecklichen Taten. Sie verdeckten den Anstand, sodass er übersehen wurde. Man erinnerte sich so leicht an die Grausamkeiten, weil sie eine Wunde hinterließen, eine Narbe, hinter dem das andere verschwand. Das Beste. Aber die grausamen Taten, die grausamen Menschen waren die Ausnahme.
»Daran müssen Sie immer denken, Jean-Guy. Wir sind nicht dann blind, wie Sie sagen, wenn wir an das grundlegende Gute im Menschen glauben, sondern wenn wir es nicht sehen.«
Jean-Guy Beauvoir hörte zu und nickte, war aber nicht überzeugt. Was nicht hieß, dass er den Chief für zu weich hielt. Weit gefehlt.
Gamache war nüchtern und wenn nötig auch gnadenlos.
Zwar konnte er Waffen nicht ausstehen und trug an normalen Arbeitstagen auch keine. Aber er zögerte nicht, sie zu benutzen. Wenn es nötig war. Für jemanden, der Waffen verachtete, zielte und schoss er mit erstaunlicher Präzision.
Den Chief Inspector verfolgten Gespenster, selbst an diesem strahlenden Junimorgen. Und trotz alledem blieb Armand Gamache ein hoffnungsvoller, sogar glücklicher Mann.
Er hatte sich dafür entschieden, sein Leben damit zu verbringen, Mörder aufzuspüren, sich in Wahnsinnige hineinzuversetzen. In die dunklen Höhlen und Ritzen zu kriechen, in denen Morde geboren und genährt, gehegt und schließlich freigesetzt wurden.
Während Gamache zum Forscher menschlicher Gefühle geworden war, war Jean-Guy Beauvoir der Jäger. Sie waren ein perfektes Paar aus Ungleichen.
Jean-Guy sah seinem Schwiegervater zu, wie er für seinen Deutschen Schäferhund Henri einen vollgesabberten Tennisball warf, und machte sich keine Illusionen, wer der Anführer war. Er würde ihm überallhin folgen. Und hatte es getan.
Hatte es. Beinahe. Überallhin. Beinahe …
Wieder spürte er die Kälte.
Henri sprang dem Ball hinterher, gefolgt von dem alten Fred, der niemals den Glauben aufgab, er hätte eine Chance, den Ball als Erster zu erreichen. Und als Dritte die winzige Gracie, die Billy Williams in einer Mülltonne gefunden und die Reine-Marie adoptiert hatte.
Gracie war ein Hund, vielleicht aber auch nicht. Die Wetten standen gerade auf Meerschweinchen, dicht gefolgt von Igel.
Armand beugte sich nach unten und nahm den Ball, den Henri neben seine Füße in den Matsch gelegt hatte. Der Hund wedelte so heftig mit dem Schwanz, dass sein ganzer Körper wackelte. Dann kraulte Armand Henri hinter den Ohren und flüsterte ihm etwas zu, vermutlich, dass er ein Braver sei.
So nah hätte er dem Hund dabei gar nicht kommen müssen. Henri hätte es auch gehört, wenn Jean-Guy es von dem Schlafzimmerfenster im ersten Stock aus geflüstert hätte.
Die Ohren des Schäferhunds waren so riesig, dass sie, wie die Dorfbewohner vermuteten, auch Signale aus dem Weltall empfangen könnten. Sollte es dort draußen Leben geben, wäre Henri der Erste, der davon wüsste.
Jetzt küsste Armand Fred auf den müffelnden Kopf, tätschelte Gracie, richtete sich auf und warf den Ball erneut. Dann nahm er seinen Samstagmorgenspaziergang in der Sonne wieder auf.
Ein glücklicher und zufriedener Mann. Verfolgt von Gespenstern.
Jean-Guy Beauvoir hatte Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie Gamache es schaffte, im Gleichgewicht zu bleiben, sich seine Menschlichkeit zu bewahren, während die Ehen so vieler seiner Kollegen zerbrachen, sie Drogen, Alkohol, Verzweiflung, Zynismus verfielen. Korruption. Bei Gewalt wegsahen, der eigenen und der anderer Polizisten.
Armand Gamache leitete eine Abteilung, die das Schlimmste, was die Menschheit hervorbrachte, aufspüren musste. Tagein, tagaus.
Die fürchterlichste Aufgabe übernahm er selbst. Nämlich den Familien die Nachricht zu überbringen.
Er setzte sich der abgrundtiefen Trauer aus, wenn die Welt dieser Ehemänner, Ehefrauen, Väter, Mütter zusammenbrach. Der Kinder.
Mit wenigen Worten schmetterte er diese Menschen nieder. Brachte sie um. Sie würden niemals wieder dieselben sein. Von nun an lebten sie in einer Hölle, in der das Undenkbare geschah. Wo die Grenzen für alle Zeiten durch ein »Vorher« und ein »Nachher« umrissen waren.
Das richtete Armand Gamache an.
Wie er es schaffte, die Trauer und die Verantwortung zu tragen und trotzdem hoffnungsvoll zu bleiben, hatte Jean-Guy jahrelang nicht verstanden. Aber jetzt tat er es.
Armand Gamache schaffte es, weil er am Ende jedes dieser schrecklichen Tage hierher zurückkehrte. In dieses winzige Dorf. Three Pines. Das auf keiner Karte zu finden war. Das in einem Tal umgeben von Hügeln und Wäldern lag. Geschützt wie in einer riesigen Hand.
Jeden Abend kehrte er zu Reine-Marie zurück.
Er saß im Bistro und nippte an einem Scotch, ließ sich von den anderen erzählen, was den Tag über passiert war. Von Clara der Malerin. Myrna der Buchhändlerin. Ruth der Dichterin und Rosa, ihrer frechen Ente. Gabri und sein Lebensgefährte Olivier gesellten sich zu ihnen an den Kamin oder an warmen Sommerabenden auf die Terrasse, wo sich ihre Stimmen mit dem Zirpen der Grillen und dem leisen Plätschern des Flusses Bella Bella vermischten.
Monsieur Béliveau, Billy Williams, Sarah die Bäckerin und Robert Mongeau, der neue Pfarrer, und seine Frau Sylvie und viele andere Freunde würden da sein.
Alle hatten dieses Dorf entdeckt, das nur Verirrte fanden.
Jeden Abend aufs Neue erlebte Armand Gamache, dass es das Gute gab. Und jeden Morgen fuhr er los, um sich dem Grauen zu stellen. Um den Felsen wegzurollen und in die Höhle zu treten. Geschützt von der Gewissheit, dass egal, was er dort entdeckte, er immer zurück nach Hause finden würde.
Nur gab es, soweit Beauvoir wusste, einen Felsen, den Gamache nicht bewegen, eine Höhle, die er nicht betreten wollte.
Ja. Es gab einen Menschen, vor dem Armand Gamache Angst hatte.
2
»Wagen Sie es nie wieder …«, setzte der Chief Inspector an.
Die leise gesprochenen Worte drangen über den Wind und das Tosen der sich brechenden Wellen hinweg in die Ohren des jungen Mannes, als wären sie direkt dort hineingeflüstert worden.
»… so …«
Agent Beauvoir wappnete sich dagegen, dass der Chief Inspector sagen würde: »… mit mir zu reden, Sie dummer, arroganter kleiner Scheißer.«
Stattdessen kam …
»… in Gegenwart einer Leiche zu reden. Das ist nicht nur eine Tote, das ist nicht nur ein Rätsel. Sie ist ein Mensch, dessen Leben genommen wurde. Geraubt. Eine solche Sprache, ein solches Verhalten toleriere ich nicht.«
Spritzwasser von den Wellen, die gegen die Felsen krachten, brannte auf ihren Gesichtern, aber während Beauvoir zusammenzuckte, rührte sich der Chief Inspector nicht. Drehte nicht einmal den Kopf weg. Seine dunkelbraunen Augen blieben ruhig auf Beauvoir gerichtet.
Jedes Wort, das der Mann sagte, verwirrte den jungen Agent noch mehr. Machte ihm noch mehr Angst.
Schreien, brüllen, drohen verstand er, provozierte es sogar bewusst.
Aber das? Es war nicht nur eine ihm fremde Sprache, es war die Sprache eines Aliens. Als käme dieser Mann aus einer Welt, die Beauvoir nicht kannte. Er konnte einzelne Wörter ausmachen, aber ihre Bedeutung war ihm unverständlich.
Und dann wurde es noch schlimmer.
»Wir haben eine Pflicht«, sagte der Chief Inspector. Seine Stimme wurde nicht lauter, selbst als der Wind pfiff und das Wasser des Sees über sein Gesicht rann. »Heilig oder nicht. Dem ermordeten Menschen gegenüber und allen, die ihn liebten und denen er wichtig war. Zu dieser Pflicht gehört, dafür zu sorgen, dass ihre Menschlichkeit gewahrt bleibt. Ist das klar, Agent Beauvoir?«
Sag’s nicht, sag’s nicht. Sag. Es. Nicht.
»Klar ist, Chief, dass Sie eine Lachnummer sind, ein Witz in der Sûreté.«
Stopp. Stopp. Um Himmels willen. Er ist nicht dein Feind.
Und doch empfand er genau das. Gamache mit seiner leisen, sanften Stimme stellte eine Bedrohung für Beauvoirs Verteidigungslinien dar, für den Schutzwall, den er schon so lange um sich errichtet hatte.
»In Ihrer Abteilung versammelt sich der ganze Abschaum, den sonst keiner will. Mit Ihnen wollen nur Trottel arbeiten. Sie tragen ja nicht mal eine Waffe. Das weiß jeder.«
Er feuerte die Worte wie eine Ladung Schrotkugeln auf seinen Vorgesetzten ab.
Das war Selbstmord. Aber es war notwendig. Der panische Versuch, das Unvermeidliche noch aufzuschieben. Dass dieser Mann seinen Schutzwall überwand. Dahinter blickte. Und deshalb schlug Beauvoir wild um sich. Und sagte das Beleidigendste, was man einem Cop – was man einem Menschen – sagen konnte.
Er machte sich auf den Gegenangriff gefasst. Aber der kam nicht. Der ältere Mann stand nur da, sein Gesicht nass vom Seewasser, seine damals erst leicht ergrauten Haare vom Wind zerzaust.
Die anderen zu Gamaches Team gehörenden Agents um sie herum beobachteten sie. Offenbar machte der eine oder andere Anstalten einzugreifen, denn der Chief Inspector gab ihnen ein Zeichen, sich zurückzuhalten.
Beauvoir hob die Stimme, um die Geräusche der Wellen, des Windes und des auf ihre Kleidung prasselnden Wassers zu übertönen, die klangen, als wollte die Natur ihn zum Schweigen bringen.
»Nur ein Idiot würde auf Sie hören.«
Was als Nächstes passierte, schockierte den jungen Agent und machte ihm Angst. Und es veränderte sein Leben.
Armand Gamache spazierte im frühmorgendlichen Sonnenschein an den drei hoch aufragenden Kiefern vorbei. An der Bank vorbei, auf der Ruth saß und den Mittelfinger zum Gruß hob.
Er lächelte der alten Frau zu und ging weiter, an seinem Enkel vorbei, der mittlerweile völlig verdreckt war. An Monsieur Béliveaus Gemischtwarenladen und Sarahs Bäckerei vorbei. An Oliviers Bistro vorbei.
Die Tür des Buchladens öffnete sich, und Armand drehte den Kopf, um seine Freundin und Nachbarin Myrna Landers zu begrüßen.
»Heute ist der große Tag«, sagte Armand zu ihr, als sie zusammen weitergingen. »Können wir dich mitnehmen?«
»Danke, aber ich fahre mit meinem eigenen Auto. Ich bringe Harriet hin.«
Myrna musterte ihren Freund. Seine Haare wellten sich leicht über den Ohren und waren fast vollständig grau, obwohl er noch nicht einmal sechzig war. Das Morgenlicht ließ die Falten in seinem Gesicht noch deutlicher hervortreten. Sorgen, Trauer und Schmerz hatten sie gegraben. Die tiefe Falte, besser gesagt die tiefe Narbe an seiner Schläfe rührte allerdings von etwas anderem her.
Armand drehte sich zu ihr. »Wie fühlst du dich?«
»Du meinst wegen nachher? Nervös. Harriet ist beinahe krank vor Angst. Sie hat Panikattacken.«
Armand nickte. Er war auch nervös, aber nicht wegen Harriet. Er sagte sich, dass das lächerlich war. Was sollte schon passieren?
Reine-Marie trat auf die Veranda und winkte. Das Frühstück war fertig.
Als Gamache lächelte, erinnerte sich Myrna daran, dass die tiefsten Falten in seinem Gesicht vom Lachen stammten.
»Willst du mitkommen?«, fragte er.
»Danke, ich habe schon gefrühstückt.«
Sie begleitete ihn bis zu dem Weg zu seinem Haus.
Es versprach nicht nur warm, sondern heiß zu werden. Die Stauden waren schon weit. Lupinen, knallroter Mohn und Iris blühten, und Pfingstrosen, die den mörderischen Winter überlebt hatten, trieben Knospen. Die Ahornbäume und wilden Kirschen in den umliegenden Wäldern hatten hellgrünes Laub.
»Fiona wird auch dort sein«, sagte Armand wie nebenbei. »Gestern Abend bekam ich die Bestätigung.«
Myrna kniff die Lippen zusammen und holte tief Luft. »Verstehe. Hast du die Familien gefragt? Die Überlebenden?« Dabei wusste sie genau, dass er es getan hatte.
»Ja. Ich habe sie vor zehn Tagen getroffen. Ich habe ihnen alles erklärt und die endgültige Entscheidung ihnen überlassen. Es ist schon lange her.«
»Wie gestern«, sagte Myrna, und Armand wusste, dass sie recht hatte.
Wäre es Annie gewesen, würde es sich immer noch wie gestern anfühlen. Wie heute. Wie genau diese Minute.
»Ich habe mit Nathalie Provost gesprochen«, sagte er.
Sie war, wie Myrna wusste, die Sprecherin der Opfer und Familien. Das öffentliche Gesicht einer nationalen Tragödie.
»Sie sind einverstanden.«
»Ob ich das wäre, weiß ich nicht. Aber du wirst dich gefreut haben.« Myrnas Stimme klang flach, nicht überzeugt.
Armand zögerte und sah zum Dorfanger. »Da ist noch was.«
Myrna lachte leise und freudlos auf. »Klar. Da ist immer noch was. Lass mich raten. Er wird auch kommen. Der Bruder.«
»Wir können ihn nicht davon abhalten. Sie will, dass er dabei ist.«
Myrna nickte. Sie hatten gewusst, dass die Möglichkeit bestand. Dennoch, was sollte schon passieren?
Im ersten Stock dachte Jean-Guy dasselbe, als er sich an jenen Novembertag erinnerte.
Die Nachricht vom Fund einer Leiche im eisigen Wasser des Lac Plongeon war bis in den Keller der abgelegenen Sûreté-Dienststelle vorgedrungen. Agent Beauvoir vermutete, dass es die vermisste Frau war.
Ein richtiger Fall. Eine richtige Leiche. Und diese inkompetenten, neidischen Arschgesichter von oben hielten ihn davon fern.
Agent Beauvoir saß auf einem Hocker und wachte über den Beweismittelkrempel von Pipifax-Verbrechen, die niemals vor Gericht kommen würden. Er tröstete sich, indem er zum x-ten Mal sein Kündigungsschreiben entwarf und dabei nichts von dem aussparte, was er tatsächlich von der Sûreté hielt. Nicht, dass er das nicht schon längst alles verkündet hätte.
Deshalb war er ja in diesem dunklen Keller gelandet.
Und trotz der vielen Schreiben, die er entworfen hatte, hatte Agent Jean-Guy Beauvoir noch nicht den letzten, unumkehrbaren Schritt getan.
Was Captain Dagenais anging, schrieb Beauvoir im Geiste, könnte man kein dümmeres, inkompetenteres Arschloch von Dienststellenleiter und keinen größeren Vollpfosten finden …
Schritte. Jemand kam herunter. Er war mit den schweren Schritten des Captains vertraut, aber diese klangen anders.
Und dann trat der Mann in sein Blickfeld.
Chief Inspector Gamache stand in der Tür. Wie eine Erscheinung. Beauvoir erhob sich von seinem Hocker und spürte, wie seine Wangen sich verfärbten, so als hätte man ihn dabei ertappt, wie er etwas Verbotenes tat.
Da stand der Leiter der Mordkommission, mitten in dieser Einöde. Sogar im Kellergeschoss der Einöde.
Wie konnte das sein?
Natürlich. Die Leiche im See. Gamache war höchstpersönlich für die Ermittlungen hergekommen. Bestimmt weil er von diesem inkompetenten Vollpfosten, der die Dienststelle leitete, gehört hatte.
Der Mann in der Tür war Ende vierzig, groß, nicht dick, aber kräftig. Sein Sûreté-Mantel stand offen, und Beauvoir sah, dass er Hemd und Krawatte trug. Ein Tweedjackett. Graue Flannellhose. Keine Waffe.
Er sah eher wie ein Collegeprofessor aus als wie einer, der Mörder jagte.
Der Chief Inspector neigte den Kopf zur Seite und lächelte. Ganz leicht.
»Bonjour. Ich heiße Armand Gamache«, sagte er und ging mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. »Und wie heißen Sie?«
»Beauvoir. Jean-Guy. Agent.« Er hatte keine Ahnung, warum er plötzlich rückwärts sprach.
»Ich bin hier, um den Tod der Frau zu untersuchen, deren Leiche von Wanderern gefunden wurde. Ich vermute, dass Sie den See kennen.«
»Moi?«, sagte Beauvoir. Jean-Guy. Agent.
»Antworte dem Mann, Idiot«, sagte Dagenais. Gamache drehte sich um und musste dem Captain einen scharfen Blick zugeworfen haben, weil der einen Schritt zurücktrat und nichts mehr sagte, auch wenn die Miene, mit der er seinen Untergebenen ansah, Bände sprach.
Blamier mich bloß nicht. Vermassel das nicht.
»Ja, den kenn ich.«
»Bon. Wenn Ihr Captain nichts dagegen hat, können Sie mich vielleicht dorthin fahren und mir bei den Ermittlungen helfen. Es ist immer gut, einen Ortskundigen dabeizuhaben.«
Dagenais’ Augenbrauen schossen in die Höhe. »Sind Sie sicher? Wir haben auch andere …«
»Ja, der junge Mann hier ist genau der Richtige. Merci.«
Agent Beauvoir grinste seinen Captain frech an, als er dem Chief Inspector die Treppe hoch, durch die kleine Dienststelle und dann durch die Tür folgte. Dass Gamache ihn ausgesucht hatte, konnte nur eines bedeuten, wurde Beauvoir klar. Selbst im Hauptquartier musste man von seinem Scharfsinn erfahren haben.
Am Auto nahm Dagenais Gamache beiseite.
Der Wind wurde stärker und brachte den dichten Kiefernwald zum Rauschen. Der Captain zog die Schultern an die Ohren, während er sprach.
»Seien Sie vorsichtig bei dem. Er macht nur Probleme. Ich habe gerade eine Beurteilung geschrieben, in der ich empfohlen habe, ihn zu entlassen.«
»Warum?«
»Anmaßung. Aber nicht nur das. Er ist aggressiv. Unzufrieden. So etwas ist ansteckend.«
Gamache gab ihm recht. Interne Streitereien unter bewaffneten Leuten waren ein Desaster, besonders wenn ihre Wut und ihr Ressentiment auf eine ungeschützte Bevölkerung trafen.
Das hatte er schon erlebt. Und ja, es begann oft mit einem einzelnen Querulanten.
Gamache hatte Gerüchte über Verstöße in dieser Dienststelle gehört, weshalb er auch, als die Meldung über einen möglichen Mordfall hereinkam, beschlossen hatte, die Ermittlungen selbst zu übernehmen.
Er sah zu dem jungen Polizisten, der gerade hinterm Lenkrad Platz nahm. Dann sah er zu Captain Dagenais.
Dieser Beauvoir war nicht grundlos in den Keller geschickt worden. An solche Orte wurden Querulanten verbannt. Und doch …
Als er in das Auto blickte, sah er gerade noch, wie Beauvoir seinen Kollegen den Mittelfinger zeigte. Gamache seufzte. Und doch …
Auf der Fahrt zur Leichenfundstelle gab der Chief Inspector dem jungen Agent Anweisungen. Was zu tun war, was nicht zu tun war.
»Haben Sie das verstanden?«, fragte er, als er nur Schweigen erntete.
»Ja. Ist ja keine Raketenwissenschaft.«
Beauvoir wartete auf eine Zurechtweisung für diese Frechheit, und als keine kam, lächelte er. Er wusste genau, wie der Mann tickte. Er war zwar ein Vorgesetzter, aber sonst zeichnete Chief Inspector Gamache sich durch nichts aus. Beauvoir vermutete, dass er das Ergebnis der Sûreté-PR-Maschine war. Eine gediegene, langweilige, vertrauenerweckende Gestalt, die dazu da war, die leichtgläubige Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Nichts weiter.
Beauvoir hatte schon auf der Polizeiakademie gehört, dass der Mann nicht mal eine Waffe trug. Welcher Polizist lief denn unbewaffnet rum?
Ein feiger, der tat das. Ein Schwächling, der sich darauf verließ, dass andere übernahmen, wenn es gefährlich wurde.
Ein paar Minuten später bogen sie von der schmalen Schnellstraße auf eine schlaglochübersäte Schotterpiste ab. Einige holprige Kilometer später erreichten sie endlich den See.
Es war ein trostloser Ort, fand selbst Gamache, der sich schon in den entlegensten Winkeln wiedergefunden hatte.
Tiefe Wolken hingen über dichtem Wald. Es gab keine Häuser, keine Hütten, keine Lichter. Keine Anlegestellen, keine Kanus. Hier kam nur selten jemand vorbei, hin und wieder vielleicht ein Bär, ein Hirsch oder ein Elch. Und ein Mörder.
Agent Beauvoir wollte aussteigen, aber der Chief Inspector hielt ihn zurück.
»Es gibt noch etwas, das Sie wissen müssen.«
»Ja, ich hab’s kapiert. Kein Beweismaterial vernichten. Nicht die Leiche anfassen. Das haben Sie mir alles erklärt.«
Langweiler.
»Es gibt«, sagte der Chief, der sich nicht aus der Ruhe bringen ließ, »vier Sätze, die zur Weisheit führen. Tun Sie damit, was Ihnen beliebt.«
Beauvoir ließ sich zurücksinken und starrte den Chief Inspector an. Tun Sie damit, was Ihnen beliebt? Wer redete denn so?
Von dieser geschwollenen Ausdrucksweise ganz abgesehen, kannte Beauvoir niemanden, der mehr als drei Wörter aneinanderhängte, ohne »fuck«, »tabernac« oder »merde« einzuschieben. Besonders sein Vater. Und was das anging, auch seine Mutter. Und bestimmt hatten sie noch nie ein Wort wie Weisheit benutzt.
Sagesse.
Er sah den älteren Mann an, der nicht viel jünger als sein Vater war, ihm aber im Übrigen so wenig ähnelte wie nur irgend möglich. Dieser Mann sprach leise und sanft, und Jean-Guy Beauvoir merkte, dass er sich unbewusst vorbeugte. Und lauschte.
»Es tut mir leid. Ich hatte unrecht. Ich weiß nicht.« Beim Aufzählen hob Chief Inspector Gamache jeweils einen Finger, bis alle ausgestreckt waren. »Ich brauche Hilfe.«
Beauvoir sah Gamache in die Augen, und dort entdeckte er etwas, das ihm ebenfalls neu war. Etwas, womit er nicht gerechnet hatte.
Er brauchte einen Moment, um es richtig einzuordnen. Um das Wort zu finden, das den Blick am besten beschrieb. Und als es ihm einfiel, wich alles Blut aus Beauvoirs Gesicht, aus seinen Gliedmaßen. Er spürte, wie seine Hände kalt wurden, und ihm war auf einmal schwindlig.
Er sah in diesen Augen Güte.
Es war erschreckend.
In seiner Eile, sich in Sicherheit zu bringen, fiel er beinahe aus dem Auto. Er verstand diesen Mann, diese Worte, diesen Blick nicht, die seinen sorgfältig errichteten Schutzwall bedrohten.
Wobei er nicht der Einzige war, den diese Begegnung überraschte.
Armand Gamache war in den Keller gegangen, weil er wusste, dass dort die Sonderlinge zu finden waren. Er brauchte einen verlässlichen, ortskundigen Polizisten, und wer eignete sich besser, als der Aufrührer in einer Truppe oder der, der aus ihr ausgeschlossen war? Ein Agent, der in den Keller verbannt wurde, weil die anderem ihm nicht trauten.
Allerdings hatte er nicht damit gerechnet, diesen unglückseligen jungen Agent wiederzuerkennen. Nicht, dass er ihm schon einmal begegnet war, dessen war Gamache sich sicher. Und doch gab es da eine Vertrautheit. So wie wenn man unerwartet in jemanden hineinläuft, den man vor langer Zeit einmal gekannt hatte.
Aber Captain Dagenais hatte vermutlich recht. Dieser Agent Beauvoir hatte etwas Gefährliches. Er war wendig und aggressiv wie ein Frettchen.
Dieser junge Mann machte Probleme und hatte welche.
Und dennoch erkannte Gamache ihn wieder, und das war es, was ihn erschreckt hatte.
Als Agent Beauvoir dann am Seeufer seine Schimpfkanonade losgelassen hatte, bei der praktisch jedes lebendige Wesen zusammengezuckt war, hatte Gamache noch einmal darüber nachgedacht.
Er musste sich geirrt haben. Hatte einen Fehler gemacht. Es war eine Sinnestäuschung. Eine Illusion. Oder vielmehr Desillusion.
An dem felsigen Ufer, nass gespritzt von der Gischt, starrte Armand Gamache Jean-Guy Beauvoir an und stand vor der Wahl. Einer, die über ihrer beider Schicksal entschied, über ihre Zukunft. Auch wenn Gamache den Umfang zu diesem Zeitpunkt nicht ermessen konnte.
Sollte er das Offensichtliche, Vernünftige und Logische tun und diesen anmaßenden jungen Agent, der mit Sicherheit eine Belastung für die Sûreté und eine Gefahr für die Öffentlichkeit war, zurück zu der Dienststelle schicken? Wo man ihn bald entlassen würde? Und aufatmen würde?
Oder.
»Sie sind unfähig«, brüllte Beauvoir, und seine Stimme übertönte die tosenden Wellen. »Dumm. Und dumm ist gefährlich. Die alle werden«, sein Arm fuhr herum, und sein Finger deutete auf die Männer und Frauen am Ufer, »zu Tode kommen, wenn Sie nicht aufpassen.«
Über Beauvoirs Schulter hinweg sah Gamache Inspector Chernin auf sie zukommen, ihre Miene entschlossen. Aber ein Blick von ihm ließ sie gerade noch innehalten.
Er sah wieder zu Beauvoir. Er hatte genug. Er würde diesem anmaßenden Agent sagen, dass er zurück zu seiner Dienststelle fahren und seine Waffe und Dienstmarke abgeben solle. Er sei erledigt.
Stattdessen hörte Armand Gamache sich sagen: »Hinter der Leiche im Becken; hinter dem Geist auf der Golfbahn / Hinter der tanzenden Frau und dem hemmungslos trinkenden Mann …«
Seine Stimme war so leise, dass Agent Beauvoir sich fragte, ob er das tatsächlich gehört hatte oder ob es eine Sinnestäuschung gewesen war. Ob Wind und Wellen Spielchen mit ihm spielten.
Das war die Reaktion des Chief Inspector auf seinen verbalen Ausfall? Darauf, dass er vor seinem Team Feigling genannt wurde? Statt ihn scharf zurechtzuweisen, zitierte der Mann ein Gedicht? Was für ein armseliger Feigling.
Und dennoch war die Reaktion sehr viel erschreckender, als es irgendeine scharfe Erwiderung hätte seinen können.
Agent Beauvoir stand verwirrt da. Fassungslos. Erstarrt. Mit schierer Willenskraft schaffte er es, sich wegzudrehen und auf den See zu blicken, der gerade eine Leiche ausgespuckt hatte.
»Hinter dem müden Blick, dem Anfall von Kopfweh und dem Klagelaut.« Die Stimme schien jetzt aus dem Inneren von Beauvoirs Kopf zu kommen. Unnachgiebig fuhr sie fort.
»Gibt es immer noch eine Geschichte, mehr, als das Auge schaut.«
Chief Inspector Armand Gamache streckte die Hand aus und umfasste Beauvoirs Arm. Nicht schmerzhaft fest, eher wie man einen Ertrinkenden davor bewahren würde unterzugehen.
»Schon gut«, sagte er. »Manchmal sind die Dinge anders, als man denkt. Es ist alles in Ordnung, mein Sohn.«
Dann lächelte er.
Das kalte Wasser, das auf Beauvoirs Gesicht prasselte, schmeckte seltsam salzig. Bei diesen Worten, bei dieser Berührung kippte etwas in Beauvoir. Es kam ihm so vor, als hätte Armand Gamache in diesem Moment seinen Schutzwall nicht nur angegriffen, sondern eingerissen. Und als stünde er jetzt in den Ruinen von Beauvoirs jungem Leben.
Statt dass er zurückwich, merkte Beauvoir, wie er von diesem Mann, diesem Fremden angezogen wurde. Er spürte, wie er sich an ihn band, so wie ein Matrose sich bei einem heftigen Sturm am Mast festband, um nicht über Bord gespült zu werden.
Jean-Guy Beauvoir fühlte sich absolut verletzlich, aber er fühlte sich auch das erste Mal in seinem Leben sicher.
Wobei ihm sofort klar war, dass das mit einem Preis verbunden war. Wenn das Schiff unterging, dann würde er mit ihm untergehen. Das war der Deal. Sein Leben und seine Zukunft waren von nun an unauflöslich mit diesem Mann verknüpft. Vielleicht waren sie das immer schon gewesen.
Als Beauvoir auf den See hinaussah, bemerkte er aber noch etwas anderes.
Das Herannahen eines grimmigen Sturms.
3
Nachdem sie Honoré abgespritzt und ihr Samstagsfrüh- stück aus bananengefüllten Crêpes mit knusprigem Speck und Ahornsirup beendet hatten, gingen Annie und Jean-Guy mit den Kindern zum Auto, um nach Montréal zurückzufahren.
Armand hielt Idola auf dem Arm, als Reine-Marie ihrer Tochter und Honoré zum Abschied einen Kuss gab. Dann wandte sie sich ihrem Schwiegersohn zu. »Sehen wir uns nachher?«
»Klar.«
Er klang sehr viel begeisterter, als er war. Das Letzte, was Jean-Guy an diesem wunderschönen Junitag wollte, war, in einem stickigen Saal zu sitzen und Reden zu hören. Während Annie und die Kinder zu einem Barbecue mit Freunden um die Ecke von ihrer Montréaler Wohnung gingen.
Er tat das für Armand. Jean-Guy musste in dem Saal sein, falls an diesem Tag etwas aus dem Verborgenen ans Licht kam.
Armand küsste seine Enkelin, dann gab er sie Annie und drehte sich zu Honoré, ging in die Hocke und breitete die Arme aus. Der Junge rannte los und warf sich hinein. Obwohl Armand damit gerechnet hatte, kippte er fast um. Nicht mehr lange, und der Junge würde ihn tatsächlich umwerfen.
Honoré befreite sich aus der Umarmung und kramte in den Taschen seines Großvaters, wo er in der einen ein Pfefferminzbonbon und in der anderen eine Lakritzpfeife fand. Das war ihr Abschiedsritual.
Als sie Three Pines verließen und an der winzigen Kirche und der Bank auf dem Hügelkamm vorbeifuhren, sah Jean-Guy in den Rückspiegel. Reine-Marie winkte, aber Armand hatte die Schultern hochgezogen und die Arme verschränkt, als wollte er sich vor einer Kälte schützen, die nur er spürte.
Er und Inspector Beauvoir.
Vielleicht war der Chief Inspector ja doch nicht mit Blindheit geschlagen. Vielleicht konnte er sehen, was kommen würde.
Es gibt immer noch eine Geschichte, dachte Jean-Guy. Mehr, als das Auge schaut.
Nachdem sie das eigens für diesen Anlass gekaufte Kleid angezogen hatte, blickte Harriet in den Spiegel.
Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das.
Sie holte mehrmals tief Luft, wobei sie jedes Mal den Atem anhielt, bevor sie langsam wieder ausatmete. Das hatte man ihr beigebracht, für den Fall, dass sie eine Panikattacke hatte. Dann sah sie sich um, um sicherzugehen, dass sie allein war.
Harriet Landers war ein sehr vorsichtiger Mensch und stolz darauf, wenn sie das übermütige Verhalten ihrer Kommilitoninnen betrachtete. Als sie jedoch mitbekam, dass diese auf Partys gingen, sich betranken, in den Ferien nach Kuba, Mexiko und Florida flogen, hatte Harriet angefangen, sich zu fragen, ob »vorsichtig« das richtige Wort war.
Rasch bückte sie sich, um das Geschenk für ihre Tante aus dem Rucksack zu holen. Sie spürte das Gewicht in der Hand und wusste, dass Auntie Myrna überrascht sein würde.
Bis Armand und Reine-Marie einen Parkplatz gefunden und den Saal erreicht hatten, war er schon mit Hunderten Eltern und Freunden gefüllt, die sich gegenseitig begrüßten. Und kaum glauben konnten, dass der Tag endlich gekommen war. An dem sie aufhören konnten, Schecks auszustellen.
Wobei sie alle den Verdacht hatten, dass dieser Tag niemals wirklich kommen würde. Aber die größte Last war von ihnen genommen.
Ihre Kinder waren mit dem Studium fertig und hatten mit dieser Art Abschluss tatsächlich die Chance, eine Stelle zu finden.
Armand und Reine-Marie erinnerten sich gut daran, in ähnlichen Sälen gesessen zu haben, als zuerst Daniel, dann Annie ihr Abschlusszeugnis erhielten.
Aber der heutige Anlass weckte sehr viel komplexere Gefühle.
Gamaches Blick wanderte über die Versammlung hinweg, beobachtete, registrierte. Die stolzen Eltern und Großeltern. Die gelangweilten und missmutigen jüngeren Geschwister, die zum Fenster hinaussahen. In die Sonne.
Der geübte Blick des Chief Inspector nahm die mit den Eltern plaudernden Professoren in ihren Talaren wahr, den Kanzler in seiner Festrobe. Die Techniker auf der Bühne, bereit loszulegen.
Aber sein Blick kehrte immer wieder zu dem großen jungen Mann neben der Tür zurück. In Jeans und Hoodie stach er heraus.
Dunkle, zu einem Knoten geschlungene Haare. Ein kleines Bärtchen. Und eine Beule. Beulte sich sein Sweatshirt wirklich aus?
Gamache wollte schon zu ihm gehen, als ein uniformierter Polizist an den Mann herantrat. Gamache beobachtete die Szene. Wachsam. Vorbereitet.
Dann entspannte er sich und lächelte erleichtert.
Der junge Mann war ein Zivilpolizist, den die Montréaler Polizei dort postiert hatte. Er sah zu Gamache und salutierte knapp.
Gamache nickte. Dann sah er sich weiter um.
Das hatte er sich über die Jahre angewöhnt. Es war eine Gewohnheit und eine Notwendigkeit. Menschenmengen waren für einen Polizisten immer ein Problem, und das galt hier und an diesem Tag erst recht. Den Morgen hatte er zum Teil damit zugebracht, sich an die Anfänge zu erinnern. Mit Beauvoir. Jean-Guy. Agent. Als er jetzt durch die Menge wanderte, dachte er auch an seine Anfänge bei der Sûreté. Und an das erste Mal, als er hierhergekommen war, zur École Polytechnique, der Technischen Hochschule der Université Montréal.
Es war seine letzte Praktikumswoche beim Montréaler Rettungsdienst unter der Obhut einer Sanitäterin gewesen. Er hatte zwar schon das Studium an der Akademie der Sûreté abgeschlossen und sich bei der Abteilung für organisierte Kriminalität beworben, wartete aber noch auf den Bescheid und hatte sich deshalb für dieses zusätzliche Praktikum gemeldet.
Es war ein kalter Tag Anfang Dezember gewesen. Er hatte gerade einen Flug für den Besuch bei seinem Patenonkel Stephen Horowitz in Paris gebucht. Am ersten Weihnachtsfeiertag würde er fliegen. Es war der billigste Flug gewesen.
Armand und seine Betreuerin packten bei Schichtende gerade zusammen, als der Notruf einging.
An der École Polytechnique sei es zu einem Zwischenfall gekommen. Das war alles. Weitere Informationen gab es nicht. Armand warf einen Blick auf die Uhr in der Rettungsstelle. Kurz vor 18 Uhr.
»Komm, Gamache«, sagte die Sanitäterin. »Fahren wir hin. Wahrscheinlich ist es nichts. Ein betrunkener Student. Danach lade ich dich auf ein Bier ein.«
Sie fuhren hin.
Sie irrte sich.
Es war der 6. Dezember 1989. Und es war kein betrunkener Student.
»Bonjour, Armand.«
Überrascht drehte er sich um. »Nathalie!«
Nach einer Umarmung musterten sie einander. Ihre Haare waren mittlerweile von grauen Strähnen durchzogen. Und sie hatten Falten bekommen.
Wie es passierte, wenn Leute sich nicht gegen das Altern stemmten.
Nathalie Provost war eine junge Studentin der Ingenieurswissenschaften gewesen, als sie sich kennengelernt hatten.
Sie wollte ganz normal ihre Seminare besuchen, bevor das Semester an Weihnachten zu Ende ging. Als es passierte.
Armand war nicht viel älter als sie. Als alle. Als sie sich kennenlernten. Als es passierte.
Nathalie sah sich in dem vollen Saal um, dann drehte sie sich zu Reine-Marie und umarmte auch sie. Mittlerweile waren sie alte Freunde.
»Ein schöner Tag«, sagte Nathalie, und sie wussten, dass sie mehr als das Frühlingswetter meinte.
»Das stimmt«, sagte Reine-Marie.
»Ich hoffe, ihr bleibt zum Empfang.«
»Natürlich lassen wir uns den nicht entgehen.«
In dem Moment traf Myrna ein. In ihrem auffallenden knallrosa und quietschgrün gemusterten Kaftan war sie kaum zu übersehen. Reine-Marie winkte ihr. Wie ein Ozeandampfer pflügte Myrna durch die Menge und legte neben Reine-Marie an, die sie Nathalie vorstellte.
»Landers«, sagte Nathalie. »Sind Sie mit Harriet verwandt?«
»Harriet ist meine Nichte. Ich übernehme die volle Verantwortung für ihre Intelligenz.«
Nathalie lachte.
Myrna sah zur Bühne, wo ein riesiger Strauß weißer Rosen auf dem Tisch stand. Nathalie folgte ihrem Blick.
»Wir dürfen es niemals vergessen«, sagte Myrna.
»Da besteht keine Gefahr«, sagte Reine-Marie.
»Ich hoffe, das stimmt«, sagte Nathalie. »Aber sicher bin ich mir nicht. Es ist so leicht, sich rückwärts zu bewegen und zu behaupten, das sei Fortschritt. Nein, es reicht nicht, nicht zu vergessen. Wir müssen uns erinnern.« Sie musterte die vor ihr stehende Frau. »Myrna Landers. Sie sind Psychologin.«
»Im Ruhestand.«
»Nicht ganz«, sagte Nathalie. »Ich habe Ihren Bericht über Fiona Arsenault gelesen, den Sie auf Armands Bitte hin geschrieben haben. Sie haben sie darin unterstützt, dass sie ihren Abschluss machen konnte.« Nathalie musterte die Frau vor sich, die sich bei diesen Worten zu winden schien. »Hätte ich das nicht sagen sollen? War Ihr Bericht nicht korrekt?«
»Nein, nein, er war korrekt. Soweit möglich.«
»Und das heißt?«
»Das heißt vermutlich, ich wünschte, das Thema wäre nicht aufgekommen.« Myrna warf Armand einen Blick zu. »Es ist schwierig. Psychologie ist keine exakte Wissenschaft, anders als die Ingenieurswissenschaften.«
»Und selbst Gebäude und Brücken stürzen ein.«
Unbehagliches Schweigen breitete sich aus, als Nathalie Provost den schmalen Ring an ihrem rechten kleinen Finger drehte.
Als Agent Gamache und die Rettungssanitäterin an jenem Dezemberabend in der École Polytechnique eintrafen, fanden sie dort das reinste Chaos vor.
Die Sonne war untergegangen, und das Gebäude wurde vom Licht der Scheinwerfer erleuchtet, das von riesigen Schneehaufen zurück auf die imposante Universität geworfen wurde.
In der eisigen Luft hingen die Abgase der Einsatzwagen.
Die Sanitäterin sagte ihm, er solle beim Rettungswagen bleiben, während sie versuchte herauszufinden, was passiert war. Was immer noch passierte. Sie kehrte kein bisschen schlauer, aber wesentlich blasser zurück.
»Vor dem Gebäude haben sich taktische Einheiten postiert«, erklärte sie ihm. »Sie sind bewaffnet.«
»Aber reingegangen sind sie noch nicht?«
»Nein.«
Die Informationen, die sie erhielten, waren widersprüchlich und verstümmelt. Selbst ein frischgebackener Sûreté-Agent wusste, dass man in einer solchen Notlage eines unbedingt vermeiden musste: Verwirrung. Aber auch die hing in der Luft.
Sie hörten, dass sich in dem Gebäude ein Schütze aufhielt. Zwei Schützen. Drei. Eine ganze Gruppe.
Er sei tot. Er würde immer noch schießen.
Die ersten Studenten rannten um Hilfe schreiend aus dem Gebäude. Gamache und andere Rettungskräfte liefen ihnen entgegen, legten den benommenen und verschreckten jungen Männern Decken um und suchten sie nach Wunden ab, während höherrangige Polizisten sie mit Fragen bombardierten. Weil sie dringend verlässliche Informationen brauchten.
Und doch wartete die taktische Einheit. Worauf?
Schließlich kam die Meldung. Der Schütze habe sich selbst erschossen. Es gebe mehrere Opfer. Sie könnten reingehen.
Armand und die Sanitäterin liefen unmittelbar hinter den bewaffneten Polizisten durch die Eingangstür und wurden von höllengleichem Lärm empfangen. Schmerzensschreie. Weinen, Hilferufe. Gebrüllte Befehle.
Aber nicht nur Befehle. Auch Warnungen.
Ein weiterer Angreifer könnte sich in einem Seminarraum verstecken. Bewaffnet. Vielleicht mit Geiseln.
Seminarräume könnten mit Sprengfallen versehen sein. Nagelbomben.
Armands Herz raste, seine Augen waren weit aufgerissen. Er versuchte, seinen Atem unter Kontrolle zu bekommen, sich zu beruhigen. Klar im Kopf zu bleiben. Sich an sein Training zu erinnern.
Aber in seinem Kopf kreischte es. Hau ab. Los. Renn. Nach Hause. Du musst hier weg. Hau ab.
Eine solche Angst hatte er bisher nicht gekannt. Wusste nicht, dass es ein solches Grauen gab.
In jedem Seminarraum erwartete er den Mann zu sehen. Die Waffe.
Bei jeder Tür, die er aufriss, war er auf den Einschlag gefasst. Von Kugeln oder Nägeln. Holzsplittern, Scherben.
Wenn nichts dergleichen geschah, wenn der Raum leer war bis auf umgeworfene Tische und Stühle, rannte er weiter. Zur nächsten Tür, zum nächsten Seminarraum. Die Sanitäterin und er rannten den langen, unendlich langen Korridor entlang. Folgten den Schreien. Stießen Türen auf. Sahen sich rasch um. Jedes Detail unnatürlich scharf und klar.
Dann endlich fanden sie sie. Sie lagen an der Wand ihres Seminarraums. Tote und Verwundete. Plötzlich war es völlig still. Die Verwundeten hatten keine Kraft mehr, um nach Hilfe zu schreien. Oder auch nur vor Schmerz zu stöhnen. Sie hatten nur noch die Kraft, nach Atem zu ringen.
Schnell ging er zu der ersten offensichtlich lebenden Frau, die allerdings stark blutete.
»Wie heißt du?«, fragte er, als er sich neben sie kniete und sein Blick und seine Hände sich rasch über ihre blutgetränkte Kleidung bewegten. Auf der Suche nach der Wunde.
»Nathalie«, flüsterte sie.
»Nathalie. Ich heiße Armand. Ich will dir helfen.« Er holte Verbandszeug aus seinem Sanitätskoffer. »Wo hast du Schmerzen?«
Sie konnte es ihm nicht sagen. Sie war wie betäubt und stand unter Schock.
Er entdeckte eine Wunde. Zwei. Drei.
Die Frau, fast noch ein junges Mädchen, war viermal getroffen worden.
An den schlimmsten Wunden legte er einen Kompressionsverband an und redete dabei die ganze Zeit. Zwang sich, ruhig zu klingen. Sagte ihr, dass es ihr bald wieder gut ginge.
»Ça va bien aller.«
Er wiederholte ihren Namen.
Sie zitterte. Nathalie. Ihre Lippen wurden blau. Nathalie. Er zog seine Jacke aus und breitete sie über sie.
Die ganze Zeit über stellte er ihr banale Fragen, um sie bei Bewusstsein zu halten. Von einer Kopfwunde rann Blut in ihre Augen. Er wischte es weg, aber sie hatten sich geschlossen.
»Wo wohnst du?« »Welche Seminare besuchst du?« »Schlaf nicht ein, Nathalie.«
Armand blieb bei ihr, hielt ihre von ihrem eigenen Blut klebrige Hand, rief nach einer Tragbahre. Brüllte nach einer Tragbahre.
»Ça va bien aller, Nathalie.«
Nach einigen Minuten, die ihm wie Stunden erschienen, kamen endlich Sanitäter mit einer Tragbahre. Sie umklammerte seine Hand, als sie sie aus dem Seminarraum brachten.
Die Sanitäterin packte seinen Arm und rief: »Komm. Weiter. Da sind noch mehr.«
Armand musste seine Hand losreißen, bevor Nathalie auf dem Korridor verschwand. Dann lief er in die andere Richtung und suchte dort nach Überlebenden.
Erst nach einer halben Stunde und weiteren Opfern drehte sich die Sanitäterin, die sich gerade über eine Frau beugte und nach dem nicht mehr vorhandenen Puls suchte, zu ihm um und sah ihn entsetzt an.
»Frauen. Mein Gott, das sind alles Frauen.«
Armand sah sich um. Er war so beschäftigt gewesen, hatte nur funktioniert, hatte versucht, zu helfen und den Schrecken und das Grauen im Zaum zu halten, dass er es nicht bemerkt hatte.
Sie hatte bemerkt, was ihm entgangen war.
Der Schütze hatte es ausschließlich auf Frauen abgesehen, sie verwundet, ermordet.
Die vierzehn weißen Rosen auf der Bühne standen jeweils für eine der jungen Frauen, die an diesem Tag getötet worden waren, vor dreißig Jahren, einen Steinwurf entfernt von der Stelle, an der sie jetzt standen.
Der Mörder hatte die Männer weggeschickt. Und dann hatte er die Frauen erschossen. Weil sie glaubten, dass es keine Konsequenzen hätte, wenn sie eine reine Männerwelt betraten. Weil sie es wagten, Ingenieurinnen zu werden.
Sie wurden umgebracht, weil sie Frauen waren. Weil sie Meinungen hatten. Und Lüste und Wünsche.
O ja, und weil ich Brüste hatte
und eine süße Frucht im Leib.
Wenn von bösen Geistern die Rede ist,
kommt all das sehr gelegen.
Später, Jahre später würde Armand diese Worte von Ruth Zardo, seiner Lieblingsdichterin, lesen. Und er würde die Wahrheit darin erkennen.
Wie eine Krähe hockt der Tod auf meiner Schulter.
… oder wie ein Richter, der von Hurerei und Sühne spricht
und sich die Lippen leckt.
Vierzehn weiße Rosen. Vierzehn Mordopfer.
Dreizehn Verletzte. Unter anderem Nathalie Provost.
Die Tat wurde als das Montréal-Massaker bekannt. Die einprägsame Alliteration machte es für die Schlagzeilenleser leichter verdaulich. Etwas Schreckliches war passiert. Sie lasen den Bericht und schüttelten mit echtem Bedauern den Kopf. Aber weiter setzten sich die meisten nicht damit auseinander.
Das Montréal-Massaker.
Für die Familien der Opfer und die Überlebenden war das Geschehen mit keinen Worten zu beschreiben. Es war viel größer als die fetten Schlagzeilen und auch zu nah. Persönlicher. Umfassender. Schlimmer.
Einer der Polizisten war in das Gebäude gelaufen und hatte unter den Toten seine eigene Tochter gefunden.
Das hatte Armand verfolgt, erst recht, als er und Reine-Marie ein paar Jahre später Annie bekamen. Er versuchte, es sich vorzustellen, aber es gelang ihm nicht …
Viele der Familien und Überlebenden kehrten jedes Jahr an die École Polytechnique zurück, um der Abschlussfeier beizuwohnen. Mehr als dreißig Jahre hatten sie diejenigen, die auf die Bühne traten, um ihre Zeugnisse entgegenzunehmen, unterstützt und ihnen applaudiert. Sie waren in gewisser Weise Stellvertreterinnen ihrer Töchter, Schwestern, Freundinnen. Kommilitoninnen. Denen es nicht vergönnt war.
Die Absolventinnen waren der Beweis, dass der Attentäter nicht gewonnen hatte. Dass Hass und Ignoranz nicht gewonnen hatten. Wobei selbst jetzt noch das Murmeln der bösen Geister zu hören war, wenn man genau hinhörte. Es verstummte nie ganz.
Auch viele der Helfer, der Polizisten und Sanitäter, die an jenem Tag als Erste vor Ort gewesen waren, besuchten jede Abschlussfeier. Aus Solidarität.
Die für Armand bei seinem Praktikum verantwortliche Sanitäterin war vor einigen Jahren an Brustkrebs gestorben. Sie hatte sich wie Armand einer Kampagne zur Waffenkontrolle angeschlossen. Er engagierte sich heute noch für diese Kampagne und trat für eine noch schärfere Gesetzgebung ein. Ausgestattet mit der Autorität eines leitenden Sûreté-Beamten, führte er ins Feld, dass es keinerlei Grund gab, warum ein Normalbürger eine Waffe besitzen sollte. Und noch viel weniger halbautomatische Schusswaffen. Die nur dazu entwickelt worden waren, Menschen zu töten.
Einige Monate nach dem Attentat suchte Nathalie Provost Agent Gamache auf und gab ihm seine Rettungssanitäterjacke zurück.
»Ich habe sie reinigen lassen«, sagte die junge Frau und hielt sie ihm entgegen. »Aber …«
Es waren Flecken darauf, die sich nicht entfernen ließen. Und das war auch gut so.
Ja. Armand Gamache hasste Waffen.
Unter all den Aussagen vor dem Parlament waren es die klaren, nachdenklichen, starken Stimmen der Familien der Opfer und der Überlebenden, die die Legislative davon überzeugten, strengere Gesetze zu erlassen. Auch wenn im Privaten einige Politiker klagten, dass eine strengere Waffenkontrolle eine gewaltige Überreaktion war. Dass nur Frauen ermordet worden waren, sei Zufall gewesen.
Das Montréal-Massaker sei tragisch gewesen, aber es habe keine allgemeine Aussagekraft. Es sei die Tat eines verrückten Einzeltäters gewesen. Keine Anklage gegen die Gesellschaft.
Verständlicherweise seien die Frauen aufgebracht. Aufgewühlt. Aber man müsse ihren Forderungen jetzt nicht nachgeben. Das wäre ein Fehler.
Die Schießerei, die Verleugnung, das Beiseitewischen aller Belege für eine institutionalisierte Frauenfeindlichkeit, der Widerstand gegen eine schärfere Waffenkontrolle, die herablassende Haltung von Zeitungsredakteuren und Politikern führte nur zu einer Radikalisierung der Frauen.
Vor dem Attentat waren sie Studentinnen.
Jetzt waren sie Kriegerinnen.
Vorher war ich keine Hexe, schrieb Ruth Zardo. Aber jetzt bin ich eine.
Vor jenem Tag, jener langen Nacht, hatte Agent Gamache zur Abteilung für organisierte Kriminalität gehen wollen. Hatte sich beworben. Auf den Bescheid gewartet.
Am nächsten Tag zog er seine Bewerbung zurück. Und bewarb sich stattdessen bei der Mordkommission.
4
»Patron?«
Sowohl Chief Inspector Gamache als auch Agent Beauvoir drehte sich zu Inspector Chernin.
Ein Mann, ein Fremder, war zu Chernin neben die Leiche getreten, die immer noch halb im Wasser, halb am Ufer lag. Er wirkte ein wenig verloren, sehr verfroren und noch viel unglücklicher.
Der Leichenbeschauer, vermutete Gamache. Aus der nächstgrößeren Stadt hergerufen.
Der Chief Inspector ließ Beauvoirs Arm los, und der junge Agent fühlte sich sogleich wie befreit, aber auch haltlos. Ihm wurde klar, wie nah »frei« und »haltlos« beieinanderlagen.
Gamache ging an ihm vorbei, dann warf er einen Blick zurück. »Kommen Sie?«
»Ja«, war alles, was Beauvoir hervorbrachte. Er stolperte ihm am Ufer entlang hinterher und glitt hin und wieder auf den glitschigen Felsen aus.
»Und halten Sie den Mund, ja? Sie haben wahrscheinlich schon zu viel gesagt.«
»Es ist Mord«, rief Agent Beauvoir ihm nach. »Sie wurde ermordet.«
Gamache blieb stehen. »Sie können nicht gut mit Befehlen umgehen, oder?«
»Aber das ist doch wichtig. Es war kein Selbstmord oder Unfall. Die Wunde. Sehen Sie sich die Form an. Schauen Sie sich an, was im Schädel des«, angesichts von Gamaches finsterem Blick korrigierte er sich, »der Frau steckt. Es, sie … ihr, sein …«, jetzt war er völlig verwirrt, wie er es sagen sollte. Er deutete auf seinen Kopf und sagte: »Das da kommt nicht von einem Felsen oder Stein im See.«
»Was war es denn Ihrer Meinung nach?«
»Wie, Meinung? Ich weiß es. Sie wurde mit einem Ziegel erschlagen. Jemand hat sie mit einem Ziegel erschlagen und sie dann in den See geworfen.«
Gamache sah Beauvoir nachdenklich an, dann ging er weiter zu Chernin und dem Leichenbeschauer.
Er stellte sich vor. »Können Sie schon etwas sagen?«
»Nur dass sie tot ist«, erwiderte Dr. Mignon. »Mehr weiß ich erst, wenn sie auf meinem Untersuchungstisch liegt.«
Das war zwar unbefriedigend, aber nicht anders zu erwarten. Chief Inspector Gamache wusste, dass die meisten Landärzte, die zu Leichenbeschauern berufen wurden, diese Position nur akzeptierten, weil sie mit dringend gebrauchtem zusätzlichen Einkommen und keinerlei Verantwortung verbunden war.
Die meisten unvorhergesehenen Todesfälle waren völlig unverdächtig. Jagdunfälle. Selbstmorde. Verkehrsunfälle. Alle tragisch. Aber keine Morde.
Die meisten Leichenbeschauer im ländlichen Québec bekamen ihr gesamtes Berufsleben lang kein Mordopfer zu Gesicht.
Aber diesen armen Mann hatte es getroffen. Zum Glück war er pflichtbewusst genug, dass er sich nicht wissender gab, als er war.
Dr. Mignon sah auf die Leiche, dann auf seine durchweichten, verdreckten Schuhe und dann, als ein Seetaucher rief, über das nebelverhangene Wasser.
»Schrecklicher Ort, um zu sterben«, sagte er. »Ich vermute mal, dass sie die Vermisste ist. Hab davon in den Nachrichten gehört.« Sein Blick kehrte zu der Leiche zurück. »Die armen Kinder.«
Die Augen der Frau waren noch offen, ihr rechter Arm hob und senkte sich mit den Wellenbewegungen. Gleichmäßig. Beinahe anmutig. Als winkte sie zur Begrüßung oder zum Abschied.
Wie im Fall von »frei« und »haltlos« war auch das schwer zu unterscheiden.
Nachdem er sie noch einmal etwas gründlicher untersucht hatte, richtete sich der Arzt auf und streifte seine Handschuhe ab.
»Eine schwere Kopfwunde an der Seite. Sonst sind keine Verletzungen zu erkennen. Ich muss sie genauer untersuchen. Schauen, ob sie Wasser in der Lunge hat.«
Wenn ja, war sie noch am Leben gewesen, als sie im See landete, dann könnte es ein Unfall oder Selbstmord gewesen sein. Wenn nicht, war sie tot gewesen, und es war eindeutig Mord.
Zwar kannte Gamache die Antwort auf diese Frage bereits, aber er wollte warten, zu welchen Schlüssen der Leichenbeschauer kam.
»Merci«, war alles, was er sagte.
Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie Agent Beauvoir geradezu zitterte vor Anstrengung, nicht mit seiner Meinung herauszuplatzen. Zugutezuhalten war ihm, dass er es schaffte.
Gamache nickte Inspector Chernin zu. Die Leiche durfte jetzt bewegt werden.