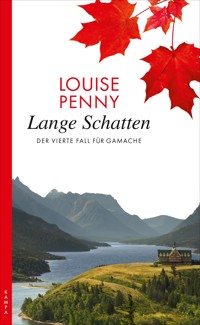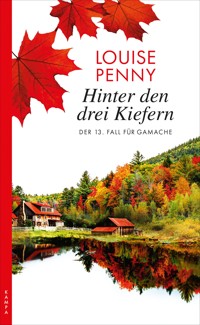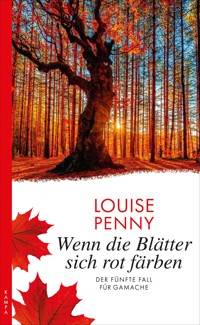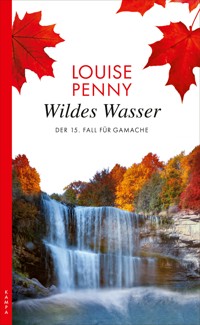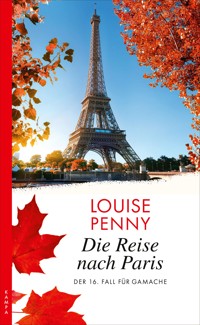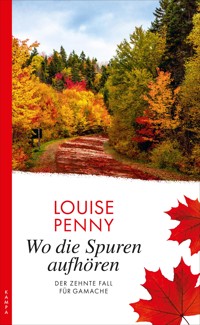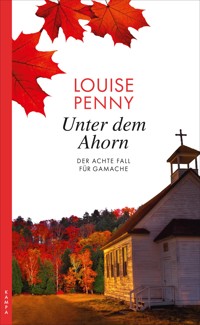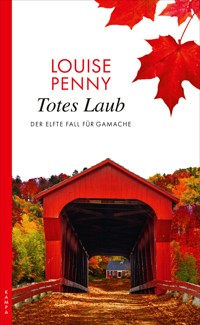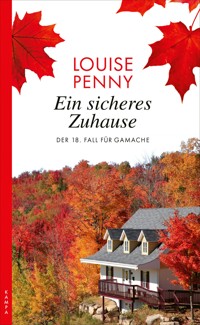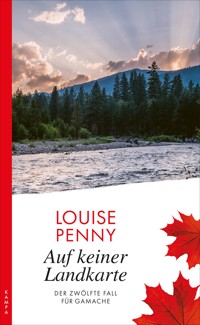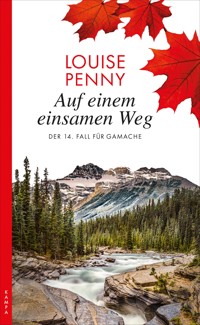
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Ein geheimnisvolles Testament führt Armand Gamache zu einem verlassenen Bauernhaus. Zusammen mit Myrna, der Buchhändlerin von Three Pines, und einem jungen Mann ist er zum Nachlassverwalter einer gewissen Bertha Baumgartner bestimmt worden. Wer war diese verschrobene Frau, die von allen »Baronin« genannt wurde, aber als Putzfrau arbeitete? Ihren drei Kindern hat sie je 5 Millionen Dollar hinterlassen, die es allerdings nur in ihrer Phantasie gab. Wenig später wird eine Leiche in dem verfallenen Haus gefunden. Zeit für die Ermittlungen hat Gamache eigentlich nicht, obwohl er als Chef der Sûreté du Québec suspendiert ist. Denn Gamache hat zwar das größte Drogenkartell zerschlagen, dabei aber die Justiz manipuliert. Noch schlimmer ist allerdings, dass nicht das ganze Lager des Kartells sichergestellt werden konnte. Wie kann Gamache verhindern, dass der Stoff in Montréal seine tödliche Wirkung entfaltet, ganz ohne sein Team von der Sûreté? Für Gamache beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - auf einem einsamen Weg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Louise Penny
Auf einem einsamen Weg
Ein Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Gabriele Werbeck und Andrea Stumpf
Kampa
Für Hope Dellon. Meine wunderbare Lektorin und gute Freundin. Whale oil beef hooked.
1
Armand Gamache fuhr im Schritttempo über die schnee- bedeckte Nebenstraße und hielt schließlich an.
Geschafft, dachte er. Er lenkte das Auto zwischen den hohen Kiefern hindurch, bis er die Lichtung erreichte.
Dort parkte er und blickte aus dem warmen Wageninneren in den kalten Tag hinaus. Schneeflocken segelten auf die Windschutzscheibe und schmolzen. Sie fielen jetzt schneller und erschwerten die Sicht. Gamache blickte auf den Brief auf dem Beifahrersitz, den er tags zuvor bekommen hatte.
Er rieb sich das Gesicht und setzte seine Lesebrille auf. Las ihn noch einmal. Er hatte ihn an diesen verlassenen Ort gebracht.
Er stellte den Motor ab. Stieg aber nicht aus.
Nervös war er nicht. Die Angelegenheit war weniger beunruhigend als rätselhaft.
Dennoch war sie so befremdlich, dass er alarmiert war. Nicht übermäßig, noch nicht. Aber er war auf der Hut.
Armand Gamache war kein ängstlicher Mann, aber er war vorsichtig. Wie sonst hätte er an der Spitze der Sûreté du Québec überdauern können? Allerdings war keineswegs sicher, dass ihm das tatsächlich gelungen war.
Er vertraute auf seinen Verstand und auf seine Instinkte.
Und was sagten sie ihm jetzt?
Sie sagten ihm ganz klar, dass diese Angelegenheit seltsam war. Aber das, dachte er mit einem Grinsen, hätten ihm auch seine Enkelkinder sagen können.
Er nahm sein Handy und hörte es unter der Nummer, die er gewählt hatte, einmal, zweimal klingeln, dann wurde abgehoben.
»Salut, ma belle, ich bin angekommen«, sagte er.
Zwischen Armand und seiner Frau Reine-Marie gab es die Abmachung, dass sie im Winter, wenn Schnee lag, einander Bescheid gaben, wenn sie unterwegs waren und ihr Ziel erreicht hatten.
»Wie war die Fahrt? In Three Pines schneit es immer stärker.«
»Hier auch. Aber ich bin gut durchgekommen.«
»Wo bist du eigentlich, Armand? Was ist das für ein Ort?«
»Schwer zu beschreiben.«
Er versuchte es trotzdem.
Vor ihm stand etwas, das einmal ein Zuhause gewesen war. Dann ein Haus. Und jetzt war es nur noch ein Gebäude. Und selbst das würde man nicht mehr lange sagen können.
»Es ist ein altes Farmhaus«, sagte er. »Es macht einen verlassenen Eindruck.«
»Bist du denn auch an der richtigen Adresse? Erinnerst du dich, wie du mich von meinem Bruder abholen wolltest und zu dem falschen Bruder gefahren bist? Und darauf bestanden hast, dass ich da sei?«
»Das ist doch schon eine Ewigkeit her«, sagte er. »Und die Häuser in Ste.-Angélique sehen alle gleich aus, und deine hundertsiebenundfünfzig Brüder sehen auch alle gleich aus. Außerdem mochte er mich nicht, und ich war ziemlich sicher, dass er mich einfach nur loswerden wollte und ich dich in Ruhe lassen sollte.«
»Das kann man ihm ja wohl kaum vorwerfen, schließlich warst du an der falschen Adresse. Du Meisterdetektiv.«
Armand lachte. Das war vor Jahrzehnten gewesen, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Als ihrer Familie dann klar geworden war, wie sehr sie ihn liebte und, wichtiger noch, wie sehr er Reine-Marie liebte, hatte sie ihn doch noch ins Herz geschlossen.
»Ich bin schon richtig. Da steht noch ein Auto.«
Das andere Auto war von einer feinen Schneeschicht bedeckt. Er vermutete, dass es seit ungefähr einer halben Stunde dort stand, nicht länger. Dann sah er wieder zum Farmhaus.
»Hier hat schon lange niemand mehr gewohnt.«
Es dauerte eine Weile, bis ein Haus so verfiel. Das passierte nur, wenn sich jahrelang niemand darum kümmerte.
Bald würde es in seine einzelnen Bestandteile zerfallen.
Die Fensterläden hingen schief in den Angeln, der hölzerne Handlauf war verfault und hatte sich verzogen, die Treppenstufen hingen durch. Eines der oberen Fenster war vernagelt, sodass es aussah, als würde ihm das Haus zublinzeln. Als wüsste es etwas, das er nicht wusste.
Er legte den Kopf schief. Konnte es sein, dass sich das Haus leicht zur Seite neigte? Oder verwandelte es seine Einbildungskraft in eins aus Honorés Schlafliedern?
Da war ein krummer Mann, der lief an einem krummen Straßensaum.
Fand einen krummen Stock, gelehnt an einen krummen Baum.
Kam eine krumme Katze, fing eine krumme Maus.
Und alle lebten zusammen in einem kleinen krummen Haus.
Das war ein krummes Haus. Unwillkürlich fragte sich Gamache, ob er darin auf eine krumme Sache stoßen würde.
Nachdem er sich von Reine-Marie verabschiedet hatte, sah er erneut zu dem anderen Auto im Hof und auf das Kennzeichen mit dem Motto von Québec: JEMESOUVIENS.
Ich erinnere mich.
Wenn er wie jetzt die Augen schloss, tauchten unwillkürlich Bilder auf. So lebendig und eindringlich, wie der Moment selbst es gewesen war. Und nicht nur an jenem Tag im letzten Sommer, als die schrägen Sonnenstrahlen auf seine blutigen Hände gefallen waren.
Er sah all die Tage. All die Nächte. All das Blut. Seines und das anderer. Von Menschen, deren Leben er gerettet hatte. Und von jenen, denen er es genommen hatte.
Um sich seine geistige Gesundheit, seine Menschlichkeit, seine innere Balance zu erhalten, musste er auch die schönen Ereignisse in sich wachhalten.
Reine-Marie gefunden zu haben. Ihr Sohn, ihre Tochter. Jetzt die Enkel.
Ihren Zufluchtsort in Three Pines gefunden zu haben. Die ruhigen Stunden mit Freunden. Die heiteren Feste.
Der Vater eines guten Freundes war an Demenz erkrankt und vor Kurzem gestorben. In seinem letzten Lebensjahr hatte er seine Familie und seine Freunde nicht mehr erkannt. Zu allen war er freundlich, aber manche strahlte er an. Das waren diejenigen, die er instinktiv erkannte. Er hatte sie in seinem Herzen bewahrt, nicht in seinem beschädigten Kopf.
Das Herz bewahrte Erinnerungen sehr viel besser als der Kopf. Die Frage war nur, was die Leute in ihrem Herzen bewahrten?
Chief Superintendent Gamache hatte mehr als genug Leute kennengelernt, deren Herz von Hass zerfressen war.
Er sah auf das krumme Haus und fragte sich, von welcher Erinnerung es zerfressen wurde.
Nachdem er automatisch das Kennzeichen in seinem Gedächtnis abgespeichert hatte, wanderte sein Blick über den Hof.
Hier und da erhoben sich große Schneehaufen, unter denen sich offenbar rostige Fahrzeuge verbargen. Ein ausgeweideter Pick-up. Ein alter, inzwischen wohl schrottreifer Traktor. Und etwas, das wie ein kleiner Panzer aussah, wahrscheinlich aber ein alter Öltank war.
Hoffte er.
Gamache setzte seine Mütze auf und wollte gerade die Handschuhe überstreifen, als er zögerte und den Brief ein weiteres Mal in die Hand nahm. Nicht dass viel drinstand. Nur ein paar kurze Sätze.
Sie waren nicht bedrohlich, wären beinahe komisch gewesen, hätten sie nicht von der Hand eines Toten gestammt.
Der Brief war von einem Notar, der Gamache bat, geradezu befahl, sich um zehn Uhr morgens an diesem abgelegenen Haus einzufinden. Punkt zehn. Bitte. Seien Sie pünktlich. Merci.
Er hatte bei der Chambre des Notaires du Québec Erkundigungen über den Notar eingezogen.
Maître Laurence Mercier.
Vor sechs Monaten war er an Krebs gestorben.
Und doch war hier ein Brief von ihm.
Es gab keine E-Mail- oder Absenderadresse, nur eine Telefonnummer, unter der Armand angerufen hatte, aber niemand hatte abgehoben.
Beinahe hätte er die Datenbank der Sûreté nach Maître Mercier durchsuchen lassen, hatte sich dann aber dagegen entschieden. Nicht dass Gamache Persona non grata in der Sûreté du Québec gewesen wäre. Also, nicht ganz. Da er jedoch suspendiert war, bis die Ermittlungen zu den Ereignissen im letzten Sommer abgeschlossen waren, wollte er die Hilfsbereitschaft seiner Kollegen nicht überstrapazieren. Auch nicht die von Jean-Guy Beauvoir. Seinem Stellvertreter. Seinem Schwiegersohn.
Gamache sah erneut zu dem einstmals soliden Haus und lächelte. Spürte eine Verwandtschaft mit ihm.
Manchmal brach etwas unerwartet zusammen. Nicht immer war das ein Hinweis darauf, dass es nicht wertgeschätzt worden war.
Er faltete den Brief zusammen und steckte ihn in seine Brusttasche. Gerade als er aussteigen wollte, klingelte sein Handy.
Gamache blickte auf die Nummer. Starrte sie an. Das leise Lächeln war von seinem Gesicht wie weggewischt.
Wagte er es dranzugehen?
Wagte er es, nicht dranzugehen?
Während es immer weiter klingelte, starrte er durch die Windschutzscheibe, die Sicht durch den mittlerweile dicht fallenden Schnee so stark behindert, dass er die Welt nur unvollkommen sah.
Er fragte sich, ob er sich in Zukunft bei dem Anblick eines alten Farmhauses, dem Geräusch leise rieselnden Schnees oder dem Geruch feuchter Wolle an diesen Moment erinnern würde, und wenn, ob das mit einem Gefühl der Erleichterung oder des Schreckens verbunden sein würde.
»Oui, allô?«
Der Mann stand am Fenster und sah angestrengt hinaus.
Der Blick aus dem Fenster wurde durch die überfrorenen Scheiben verzerrt, aber er hatte gesehen, wie das Auto ankam, und mit Ungeduld verfolgt, wie der Mann parkte und dann einfach dasaß.
Nach etwa einer Minute stieg der Mann aus, aber er ging nicht zum Haus, sondern stand neben dem Auto, ein Handy am Ohr.
Er war der erste der invités.
Diesen ersten Gast erkannte der Mann natürlich. Wer würde ihn nicht erkennen. Oft genug hatte er ihn gesehen, wenn auch nur in den Nachrichten. Niemals leibhaftig.
Dass er wirklich auftauchen würde, hatte er kaum geglaubt.
Armand Gamache. Der ehemalige Leiter der Mordkommission. Der gegenwärtige, wenn auch suspendierte Chief Superintendent der Sûreté du Québec.
Er verspürte ein leichtes, aufgeregtes Kribbeln. Eine Berühmtheit war hier. Ein Mann, der zugleich größte Anerkennung und heftigste Ablehnung erfuhr. Von einigen Zeitungen wurde er als Held betrachtet. Von anderen als Verbrecher. Der die schlimmsten Seiten der Polizeiarbeit repräsentierte. Oder die besten. Machtmissbrauch. Jemand, der Verantwortung übernahm und mutig genug war, den eigenen Ruf, vielleicht mehr, für das Wohl der Gesellschaft aufs Spiel zu setzen.
Der etwas tat, was sonst niemand tun wollte. Oder konnte.
Durch die vereiste Scheibe und die dicht fallenden Schneeflocken sah er einen Mann Ende fünfzig. Groß, mindestens eins achtzig. Und kräftig. In dem Daunenanorak sah er dick aus, aber im Daunenanorak sah jeder dick aus. Das Gesicht war dagegen schmal, und es wirkte erschöpft. Um seine Augen lagen Fältchen, und zwischen seinen Augenbrauen bildeten sich jetzt zwei tiefe Falten.
Es fiel ihm schwer, Gesichter zu deuten. Er sah die Linien, konnte sie aber nicht lesen. Er vermutete, dass Gamache wütend war, aber es könnte auch einfach Konzentration sein. Oder Überraschung. Vielleicht sogar Freude.
Aber das bezweifelte er.
Inzwischen schneite es heftiger. Gamache hatte seine Handschuhe nicht angezogen. Sie waren auf den Boden gefallen, als er aus dem Auto ausgestiegen war. So verloren die meisten Québecer ihre Fäustlinge oder Fingerhandschuhe und sogar ihre Mützen. Während der Fahrt lagen sie auf dem Schoß, und bis man ausstieg, hatte man sie vergessen. Im Frühling war das ganze Land mit Hundehaufen, Würmern und durchweichten Handschuhen und Mützen übersät.
Armand Gamache stand in dem Schneetreiben, die bloße Hand am Ohr. Er umklammerte das Telefon und hörte zu.
Als er an der Reihe war, etwas zu sagen, beugte er den Kopf, die Knöchel weiß von dem festen Griff um das Handy oder von der beißenden Kälte. Dann machte er ein paar Schritte von seinem Auto weg, drehte Wind und Schnee den Rücken zu und sprach.
Der Mann konnte nicht hören, was gesagt wurde, bis ein Windstoß einen Satz auffing und über den verschneiten Hof mit den einstmals geschätzten Besitztümern zu ihm trug. Ins Haus. Das einst geschätzt worden war.
»Das werden Sie bereuen.«
Dann nahm der Mann aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Ein weiteres Auto fuhr auf den Hof.
Der zweite der invités.
2
»Armand?«
Das Lächeln des Erkennens und der Erleichterung gefror auf ihren Lippen, als sie seine Miene sah.
Die Bewegung, mit der er sich ihr zuwandte, war beinahe aggressiv. Sein ganzer Körper war angespannt, bereit. Als wappnete er sich gegen einen Angriff.
Sie konnte zwar Gesichter lesen und Körpersprache deuten, auf seinen Gesichtsausdruck konnte sie sich jedoch keinen Reim machen. Außer dem Naheliegenden.
Überraschung.
Aber da war noch mehr. Viel mehr.
Und dann war es weg. Sein Körper entspannte sich, und sie sah, wie Armand ein einziges Wort in sein Handy sagte, eine Taste drückte und es dann wegsteckte.
Bevor Armand die Fassade der Höflichkeit darüber errichtete, zeigte sich etwas auf seinem Gesicht, das sie noch mehr erstaunte.
Schuld.
Und dann erschien das Lächeln.
»Myrna! Was tust du denn hier?«
Armand versuchte, eine erfreute Miene aufzusetzen, aber es fiel ihm schwer. Sein Gesicht war taub, beinahe eingefroren.
Er wollte nicht übertreiben und wie ein grinsender Idiot aussehen. Sich gegenüber dieser klugen Frau, die außerdem eine Nachbarin war, nicht verraten.
Myrna Landers war Psychologin im Ruhestand, führte den Buchladen in Three Pines und war mittlerweile eine gute Freundin von Reine-Marie und Armand Gamache.
Er vermutete, dass sie seine instinktive Reaktion bemerkt hatte. Und gleichzeitig nicht ganz durchschaute. Oder jemals erraten würde, mit wem er gesprochen hatte.
Er hatte sich völlig auf das Gespräch konzentriert. Auf seine Wortwahl. Darauf, was am anderen Ende gesagt wurde. Und in welchem Ton. Und darauf, seinen eigenen Ton zu kontrollieren. Er war so konzentriert gewesen, dass sich jemand von hinten hatte anschleichen können.
Gut, es war eine Freundin. Aber es hätte genauso gut keine Freundin sein können.
Erst als Kadett, dann als kleiner Beamter bei der Sûreté. Als Inspector. Als Leiter der Mordkommission und schließlich als Chef des gesamten Ladens hatte er stets wachsam sein müssen. Er hatte sich Wachsamkeit antrainiert, bis sie ihm in Fleisch und Blut übergegangen war. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
Nicht dass er auf Schritt und Tritt mit Gefahren rechnete. Seine Wachsamkeit war einfach ein Teil seiner selbst, so wie seine Augenfarbe. So wie seine Narben.
Sie war Teil seiner DNA und gleichzeitig Ergebnis seiner Erfahrungen.
Das Problem bestand nicht darin, dass er in diesem Moment seine Wachsamkeit aufgegeben hatte. Im Gegenteil. Sie war so groß gewesen, so intensiv, dass ein paar entscheidende Minuten nichts anderes zu ihm durchgedrungen war. Er hatte den Motor des Autos nicht gehört. Er hatte die vom Schnee gedämpften Schritte nicht gehört.
Gamache war kein ängstlicher Mann, aber jetzt spürte er einen kurzen Anflug von Sorge. Dieses Mal war nichts Schlimmes passiert. Aber das nächste Mal?
Die Bedrohung musste nicht groß sein. Wenn sie groß wäre, würde er sie wahrnehmen.
Es war so gut wie immer etwas Kleines.
Ein übersehenes oder missverstandenes Zeichen. Ein blinder Fleck. Ein Moment der Ablenkung. Eine so ausschließliche Konzentration auf etwas Bestimmtes, dass alles andere in den Hintergrund trat. Eine falsche Annahme, die man für eine Tatsache hielt.
Und dann –
»Alles in Ordnung?«, fragte Myrna Landers, als Armand zu ihr trat und sie auf beide Wangen küsste.
»Ja, mir geht’s gut.«
Sie spürte die Kälte auf seinem Gesicht und die Feuchtigkeit des Schnees, der darauf geschmolzen war, und auch die Anpannung unter der heiteren Oberfläche.
Sein Lächeln grub tiefe Falten in seine Augenwinkel. Die braunen Augen selbst erreichte es nicht. Sie blieben wachsam, der Blick scharf, auch wenn noch immer Wärme darin lag.
»Gut«, hatte er gesagt, und trotz ihrer Besorgnis lächelte sie.
Es war ein Code, den sie beide verstanden, eine Anspielung auf ihre Nachbarin in Three Pines. Ruth Zardo. Eine begnadete Dichterin. Eine der berühmtesten des Landes. Nur verbarg sich ihr Talent unter einer nicht gerade dünnen Schicht Wahnsinn. Der Name Ruth Zardo wurde mit ebenso viel Bewunderung wie Furcht ausgesprochen. So als beschwöre man ein Wesen herauf, das sowohl schöpferisch als auch zerstörerisch war.
Ruths letzter Gedichtband hieß Mir geht’s G.U.T. Das klang nicht schlecht, bis man, oft zu spät, mitbekam, dass »G.U.T.« für Gallig, Unsicher, Todtraurig stand.
Ja, Ruth Zardo war vieles. Unter anderem nicht hier, zu ihrer beider Glück.
Armand bückte sich und hob die Fäustlinge auf, die von Myrnas mächtigem Schoß in den Schnee gefallen waren. Er schlug sie gegen seinen Anorak, bevor er sie ihr zurückgab. Dann bemerkte er, dass seine Handschuhe ebenfalls verschwunden waren, ging zu seinem Auto und fand sie dort schon halb unter dem frisch gefallenen Schnee begraben.
Aus dem zweifelhaften Schutz des Hauses heraus beobachtete der Mann all das.
Ohne jemals ein Wort mit der Frau, die gerade eingetroffen war, gewechselt zu haben, mochte er sie nicht. Sie war groß und schwarz und eben eine Frau. Nichts davon fand er attraktiv. Aber schlimmer noch war, dass Myrna Landers fünf Minuten zu spät gekommen war und statt ins Haus zu eilen und Entschuldigungen zu stammeln, stand sie herum und plauderte. Als würde er nicht warten. Als hätte er keinen genauen Zeitpunkt genannt.
Denn das hatte er.
Allerdings wurde sein Ärger ein wenig von der Erleichterung gemildert, dass sie überhaupt aufgetaucht war.
Er musterte die beiden. Es war ein Spiel, das er gerne spielte. Beobachten. Sich vorstellen, was die Leute als Nächstes taten.
Fast immer lag er falsch.
Myrna und Armand zogen jeder einen Brief aus der Tasche.
Sie verglichen die beiden Schreiben. Identisch.
»Das ist –«, sie sah sich um, »– ein bisschen seltsam, findest du nicht?«
Er nickte und folgte ihrem Blick zu dem maroden Haus.
»Kennst du die Leute?«, fragte er.
»Welche Leute?«
»Na die, die hier wohnen. Gewohnt haben.«
»Nein. Du?«
»Nein. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte oder warum wir hier sind.«
»Ich habe unter der Nummer angerufen«, sagte Myrna. »Aber es hat niemand abgehoben. Es gab keine Möglichkeit, mit diesem Laurence Mercier in Kontakt zu treten. Er ist Notar. Schon mal von ihm gehört?«
»Nein. Aber eins weiß ich.«
»Was denn?« Myrna ahnte, dass sie gleich etwas Unschönes hören würde.
»Er ist vor sechs Monaten gestorben. An Krebs.«
»Was soll dann –«
Sie wusste nicht, wie sie fortfahren sollte, und verstummte. Sie blickte zum Haus, dann zurück zu Armand. Beide waren fast gleich groß, und auch sie sah in ihrem Daunenanorak dick aus, aber in ihrem Fall war es keine Täuschung.
»Du weißt, dass der Mann, der dir diesen Brief geschrieben hat, vor Monaten gestorben ist, und kommst trotzdem her«, sagte sie. »Warum?«
»Neugier«, sagte er. »Und du?«
»Na, ich wusste ja nicht, dass er tot ist.«
»Aber komisch fandest du es auch. Warum bist du also gekommen?«
»Aus demselben Grund. Neugier. Was soll schon Schlimmes passieren?«
Das war eine reichlich dumme Bemerkung, dachte selbst Myrna.
»Sobald Orgelmusik ertönt, hauen wir ab, Armand. Abgemacht?«
Er lachte. Wobei er natürlich wusste, dass immer etwas Schlimmes passieren konnte. Hunderte Male hatte er daneben gekniet.
Myrna legte den Kopf in den Nacken und starrte hinauf zum Dach, das unter dem Gewicht des seit Monaten fallenden Schnees durchhing. Sie sah die gesprungenen und fehlenden Fensterscheiben und blinzelte, als große, sanfte, unerbittliche Schneeflocken auf ihr Gesicht fielen und ihre Augen trafen.
»Glaubst du, dass es gefährlich ist?«, fragte sie.
»Wahrscheinlich nicht.«
»Wahrscheinlich?« Ihre Augen weiteten sich ein wenig. »Du hältst es für möglich?«
»Vermutlich kommt die einzige Gefahr von dem Haus selbst.« Er deutete mit dem Kopf auf das durchhängende Dach und die schiefen Mauern. »Und nicht von jemandem darin.«
Sie gingen darauf zu. Als er den Fuß auf die erste Stufe setzte, brach sie durch. Er warf Myrna unter hochgezogenen Augenbrauen einen Blick zu, und sie lächelte.
»Das liegt eher an zu vielen Croissants als am morschen Holz«, sagte sie, und er lachte.
»Da hast du recht.«
Einen Moment lang hielt er inne, betrachtete die Stufen, dann das Haus.
»Du bist dir nicht ganz sicher, ob es nicht doch gefährlich ist, oder?«, fragte sie. »Entweder das Haus oder derjenige, der sich darin aufhält.«
»Nein«, gab er zu. »Ich weiß es nicht. Möchtest du lieber hier draußen warten?«
Ja, dachte sie.
»Nein«, sagte sie und folgte ihm hinein.
»Maître Mercier.« Mit ausgestreckter Hand kam ihnen der Mann entgegen.
»Bonjour«, sagte Gamache, der zuerst eingetreten war. »Armand Gamache.«
Mit einem raschen Blick musterte er seine Umgebung, beginnend mit dem Mann.
Klein, schlank, weiß. Mitte vierzig.
Lebendig.
Der Strom im Haus war abgestellt worden und damit auch die Heizung, sodass die Luft eisig und muffig war. Wie in einem Kühlraum.
Der Notar hatte seinen Mantel anbehalten, und Armand sah, dass er Schmutzränder hatte. Der Anorak von Armand allerdings auch. Im Québecer Winter war es nahezu unmöglich, in ein Auto zu steigen oder es zu verlassen, ohne sich mit Matsch und Salz zu beschmutzen.
Aber der Mantel von Maître Mercier hatte nicht nur Schmutzränder, er hatte auch Flecken. Und war abgetragen.
Der Mann wirkte etwas verwahrlost. So schäbig wie seine Kleidung. Zugleich umgab ihn jedoch etwas Gravitätisches, beinahe Hochmütiges.
»Myrna Landers«, sagte Myrna, trat vor und streckte ihm die Hand entgegen.
Maître Mercier nahm sie, ließ sie aber sofort wieder los. Es war eher ein kurzes Streifen als ein Händeschütteln.
Gamache bemerkte, dass sich Myrnas Haltung verändert hatte. Sie wirkte nicht mehr ängstlich, vielmehr sah sie mit einem fast mitleidigen Blick auf ihren Gastgeber.
Es gab Menschen und Tiere, die automatisch eine solche Reaktion hervorriefen. Diese Fähigkeit war genauso wirkungsvoll wie ein Abwehrpanzer, ein giftiger Stachel oder schnelle Beine.
Es war die Fähigkeit, so hilflos und bedürftig zu wirken, dass man keine Bedrohung in ihnen sah. Manchmal wurden sie sogar adoptiert. Beschützt. Versorgt. Aufgenommen.
Und fast immer bereute man es.
Es war noch zu früh, um zu sagen, ob Maître Mercier ein solcher Mensch war, aber er rief diese Reaktion hervor, selbst bei einer derart erfahrenen und scharfsinnigen Frau wie Myrna Landers.
Selbst bei ihm, bemerkte Gamache. Er spürte, wie seine Wachsamkeit in der Gegenwart dieses traurigen kleinen Mannes nachließ.
Aber nicht völlig.
Gamache nahm seine Mütze ab, strich über seine grauen Haare, sah sich um.
Die Haustür führte direkt in die Küche, wie es in Farmhäusern oft der Fall war. Das Mobiliar schien aus den Sechzigern zu stammen. Vielleicht sogar aus den Fünfzigern. Die Schränke waren aus Sperrholz, das in einem fröhlichen Kornblumenblau gestrichen war, das gelbe Laminat der Arbeitsflächen war zerschrammt und der Linoleumboden abgetreten.
Alles von Wert war verschwunden. Die Armaturen waren abmontiert, und bis auf eine mintgrüne Uhr über der Spüle, die vor langer Zeit stehen geblieben war, hing nichts an den Wänden.
Kurz stand ihm ein Bild vor Augen, wie der Raum vielleicht einmal ausgesehen hatte. Alles glänzte, nicht neu, aber sauber und gepflegt. Leute gingen hin und her, bereiteten ein Essen für Thanksgiving oder Weihnachten vor. Kinder jagten herum wie wilde Fohlen, und Eltern versuchten, sie zu zähmen. Um dann aufzugeben.
Er bemerkte Striche am Türstock. Zur Markierung der Größe. Bevor die Zeit stehen geblieben war.
Ja, dachte er, dieser Raum, dieses Haus war einmal heiter gewesen. Fröhlich.
Wieder sah er ihren Gastgeber an. Den Notar, der existierte und doch nicht existierte. War das sein Zuhause gewesen? War er hier einmal heiter und fröhlich gewesen? Wenn, dann war davon nichts mehr zu spüren. Auch das war verschwunden.
Maître Mercier lud sie mit einer Geste ein, am Küchentisch Platz zu nehmen. Sie setzten sich.
»Bevor wir anfangen, würde ich Sie bitten, das hier zu unterzeichnen.«
Mercier schob Gamache ein Blatt Papier zu.
Armand lehnte sich zurück, weg von dem Papier. »Bevor wir anfangen«, sagte er, »würde ich gerne wissen, wer Sie sind und warum wir hier sind.«
»Das möchte ich auch gerne wissen«, sagte Myrna.
»Zu gegebener Zeit«, sagte Mercier.
Das war eine seltsame Antwort, zum einen, weil es eine so formelle und altmodische Wendung war, zum anderen, weil er ihnen ihre Bitte damit rundweg abschlug. Eine Bitte, die nachvollziehbar war und von Leuten kam, die keineswegs hier hätten sein müssen.
Mercier sprach und sah aus wie eine Figur aus einem Dickens-Roman. Allerdings nicht der Held. Gamache fragte sich, ob Myrna dasselbe dachte.
Der Notar legte einen Stift auf das Papier und nickte Gamache auffordernd zu, der den Stift allerdings nicht nahm.
»Hören Sie«, sagte Myrna, legte ihre große Hand auf die von Mercier und spürte das Zucken darin. »Mein Lieber.« Ihre Stimme war ruhig, warm, klar. »Wenn Sie die Frage nicht beantworten, werde ich gehen. Und das wollen Sie vermutlich nicht.«
Gamache schob das Blatt Papier wieder zurück zu dem Notar.
Myrna tätschelte Merciers Hand, und Mercier starrte sie an.
»Also«, sagte sie. »Wie kommt es, dass Sie von den Toten wiederauferstanden sind?«
Mercier sah sie an, als wäre sie die Verrückte, dann wandte er den Kopf ab, und Gamaches und Myrnas Augen folgten seinem Blick zum Fenster hinaus.
Ein drittes Auto war vorgefahren. Ein Pick-up. Ein junger Mann sprang heraus, seine Fäustlinge fielen in den Schnee. Aber er beugte sich rasch hinunter und hob sie auf.
Armand fing Myrnas Blick auf.
Der Neuankömmling trug eine rot-weiß gestreifte Zipfelmütze mit einem Bommel am Ende. Sie war so lang, dass sie ihm vom Rücken baumelte und der Bommel über den Schnee schleifte, als er von seinem Pick-up wegtrat.
Der junge Mann bemerkte es, nahm den Zipfel und wickelte ihn wie einen Schal einmal um seinen Hals, bevor er ihn sich mit Verve über die Schulter warf. Myrna konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
Wer er auch war, er war so erfrischend, wie ihr toter Gastgeber verstaubt war.
Dr. Seuss trifft auf Charles Dickens.
Ein Kater macht Theater trifft auf Bleak House.
Ein Klopfen, dann trat er ein. Er sah sich um, seine Augen blieben an Gamache hängen, der aufgestanden war.
»Allô, bonjour«, sagte der fröhliche junge Mann. »Monsieur Mercier?«
Er streckte die Hand aus. Gamache ergriff sie.
»Nein. Armand Gamache.«
Sie schüttelten Hände. Die Hand des jungen Mannes war schwielig und sein Händedruck fest und freundlich. Selbstbewusst, entspannt.
»Benedict Pouliot. Salut. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Der Verkehr über die Brücke ist echt heftig.«
»Das ist Maître Mercier«, sagte Gamache und machte einen Schritt zur Seite, damit er den Notar sah.
»Hallo, Sir«, sagte der junge Mann und schüttelte dem Notar die Hand.
»Und ich bin Myrna Landers«, sagte Myrna, gab ihm die Hand und lächelte, ein klein wenig zu breit, dachte Armand.
Obwohl es nicht leichtfiel, diesen gutaussehenden jungen Mann nicht anzulächeln. Nicht weil man sich über ihn amüsierte. Sondern weil er umgänglich wirkte und völlig ungekünstelt zu sein schien. Sein strahlender Blick war aufmerksam.
Benedict nahm seine Mütze ab und strich sich die blonden Haare glatt, die auf eine Art geschnitten waren, die Myrna noch nie gesehen hatte und die sie auch nie wieder sehen wollte. Oben auf dem Kopf waren die Haare raspelkurz, ab den Ohren hingen sie lang herunter. Sehr lang.
»So«, sagte er und rieb erwartungsvoll die Hände aneinander, vielleicht aber auch, weil es so kalt war. »Wo fangen wir an?«
Sie sahen alle Mercier an, der weiterhin Benedict anstarrte.
»Es ist mein Haarschnitt, oder?«, sagte der junge Mann. »Den hat mir meine Freundin verpasst. Sie macht gerade einen Stylistenkurs, und für die Abschlussprüfung musste sie eine neue Frisur kreieren. Gefällt’s Ihnen?«
Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare, während die anderen schwiegen.
»Sieht toll aus«, sagte Myrna und bestätigte damit Armand, dass Liebe oder Schwärmerei tatsächlich blind machte.
»Hat sie auch Ihre Mütze gemacht?«, fragte Armand und deutete auf den riesigen rot-weißen Haufen aus feuchter Wolle am Ende des Tischs.
»Ja. Abschlussarbeit in ihrem Designkurs. Schön, was?«
Armand grunzte unbestimmt, zumindest hoffte er das.
»Sie haben mir den Brief geschickt, Sir, oder?«, sagte Benedict zu Mercier. »Wollen Sie mich zuerst herumführen oder sollen wir gleich die Pläne ansehen? Gehört das Haus Ihnen?«, fragte er Armand und Myrna. »Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob man es retten kann. Es ist in einem ziemlich miserablen Zustand.«
Gamache und Myrna sahen sich an, als ihnen klar wurde, was er meinte.
»Wir sind kein Paar«, sagte Myrna lachend. »Wir wurden genau wie Sie von Maître Mercier hierher eingeladen.«
Myrna und Armand zogen ihre Briefe heraus und legten sie auf den Tisch.
Benedict beugte sich kurz darüber, dann richtete er sich wieder auf. »Das versteh ich nicht. Ich dachte, ich sollte wegen eines möglichen Auftrags kommen.«
Er legte seinen Brief auf den Tisch. Bis auf den Namen und die Adresse war er mit den anderen beiden identisch.
»Was machen Sie denn?«, fragte Myrna, und Benedict reichte ihr eine Visitenkarte.
Sie war blutrot, diamantförmig und mit etwas Unlesbarem bedruckt.
»Von Ihrer Freundin?«, fragte Myrna.
»Ja. Aus dem Businesskurs.«
»Abschlussarbeit?«
»Ja.«
Myrna reichte die Karte Gamache, der seine Lesebrille aufsetzen und die Visitenkarte zum Fenster halten musste, um überhaupt etwas erkennen zu können.
»Benedict Pouliot. Baufachmann«, las er laut vor. »Da steht keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.«
»Nein. Das hätte Punktabzug gegeben. Geht’s hier jetzt um einen Auftrag oder nicht?«
»Nein«, sagte Mercier. »Setzen Sie sich.«
Benedict setzte sich.
Eher wie ein Welpe als eine Katze, dachte Gamache, als er neben Benedict Platz nahm.
»Warum sollte ich dann herkommen?«, fragte Benedict.
»Das haben wir auch gerade gefragt«, sagte Myrna, die ihren Blick von Benedict losriss und wieder auf den Notar richtete.
3
»Nennen Sie bitte Ihren Namen.«
»Sie kennen meinen Namen, Marie«, sagte Jean-Guy. »Wir haben mehrere Jahre zusammengearbeitet.«
»Bitte, Sir«, sagte sie mit freundlicher, aber fester Stimme.
Jean-Guy starrte sie an, dann sah er zu den beiden anderen Beamten im Sitzungszimmer.
»Jean-Guy Beauvoir.«
»Rang?«
Er bedachte sie mit einem genervten Blick, den sie gelassen erwiderte.
»Kommissarischer Leiter der Mordkommission der Sûreté du Québec.«
»Merci.«
Sie warf einen Blick auf den Laptop, der vor ihr stand, dann wandte sie sich wieder ihm zu.
»Hier geht es nicht um Sie, falls Sie das beruhigt.« Sie lächelte, er nicht. »Ihre Suspendierung wurde vor einigen Monaten aufgehoben. Wir haben allerdings nach wie vor ein paar Fragen, was die Entscheidungen und das Vorgehen von Monsieur Gamache angeht.«
»Chief Superintendent Gamache«, sagte Beauvoir. »Und warum gibt es da noch immer Fragen? Sie haben ihn vernommen, und er hat Ihnen Rede und Antwort gestanden. Inzwischen müsste doch jeder Zweifel ausgeräumt sein. Es ist fast ein halbes Jahr her. Das sollte doch wirklich langsam reichen.«
Wieder sah er zu den beiden Beamten, die er immer noch als Kollegen betrachtete. Dann wieder zu ihr. Sein Blick war mittlerweile weniger feindselig als verwundert.
»Was wollen Sie eigentlich?«
Jean-Guy hatte an vielen solchen Befragungen teilgenommen und geglaubt, die Situation im Griff zu haben, weil er wusste, dass sie alle dasselbe Interesse hatten. Aber als sie ihn jetzt von der anderen Seite des Tischs ansahen, wurde ihm klar, dass er sich getäuscht hatte.
Er hatte den Raum in der Annahme betreten, es ginge nur noch um Formalitäten. Ein letztes Gespräch, und dann würde auch der Chef entlastet sein und auf seinen Posten zurückkehren.
Die Atmosphäre war tatsächlich freundlich, fast freundschaftlich gewesen. Anfangs.
Beauvoir war sicher, sie würden ihm mitteilen, dass eine Erklärung in Vorbereitung sei, wonach eine gründliche Untersuchung stattgefunden habe. Außerdem würde darin das Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht werden, dass die verdeckte Operation der Sûreté im letzten Sommer in einem Blutbad geendet hatte.
Aber schlussendlich würden sie ihre Unterstützung für die unkonventionellen und mutigen Entscheidungen von Chief Superintendent Gamache zum Ausdruck bringen. Ebenso ihre unerschütterliche Unterstützung für das Sûreté-Team bei dieser letztlich überaus erfolgreichen Operation. Isabelle Lacoste, die Leiterin der Mordkommission, würde belobigt werden. Sie hatte vielen Menschen das Leben gerettet und dafür einen hohen Preis bezahlt.
Dann würde alles vorbei sein.
Chief Superintendent Gamache würde seine Arbeit wieder aufnehmen, und alles würde wieder seinen normalen Gang gehen.
Beunruhigend war lediglich der Umstand, dass die im Sommer begonnene Untersuchung noch immer, bis weit in den Québecer Winter hinein, andauerte.
»Sie waren der Stellvertreter Ihres Schwiegervaters, als die Entscheidungen hinsichtlich der hier untersuchten Operation getroffen wurden, nicht wahr?«
»Ja, ich habe mit Chief Superintendent Gamache zusammengearbeitet. Das wissen Sie.«
»Ja. Ihrem Schwiegervater.«
»Meinem Chef.«
»Ja. Dem Verantwortlichen. Das wissen wir, Chief Inspector, aber danke für die Klarstellung.«
Die anderen nickten. Mitleidig. Voller Verständnis dafür, dass Beauvoir sich in einer schwierigen Lage befand.
Erstaunt begriff Beauvoir, dass sie erwarteten, er würde sich von Gamache distanzieren.
Es fiele ihm leichter, sich von einem Arm oder Bein zu trennen. Seine Position war kein bisschen schwierig. Im Gegenteil, sie war ganz einfach. Er stand zu Gamache.
Aber langsam schwante ihm Böses.
»Keiner von uns hat sich schuldig gemacht, mon vieux«, hatte Gamache vor Monaten gesagt, als die unvermeidliche Untersuchung begonnen hatte. »Das weißt du. Nach allem, was geschehen ist, müssen sie diese Fragen stellen. Kein Grund zur Sorge.«
Nicht schuldig, hatte sein Schwiegervater gesagt. Nicht gesagt hatte er, dass sie unschuldig waren. Was ja auch nicht richtig gewesen wäre.
Jean-Guy Beauvoir war entlastet worden und hatte die kommissarische Leitung der Mordkommission übernommen.
Die Suspendierung von Chief Superintendent Gamache war jedoch nicht aufgehoben worden. Trotzdem war Beauvoir zuversichtlich gewesen, dass es nur eine Frage der Zeit war.
»Diese letzte Befragung noch«, hatte er an diesem Morgen zu seiner Frau gesagt, als sie ihren Sohn gefüttert hatten, »und dein Vater wird entlastet sein.«
»Hm-hm«, sagte Annie.
»Was?«
Er kannte seine Frau gut. Sie war zwar Anwältin, aber es gab wohl kaum einen Menschen, der weniger zynisch war als sie. Jetzt spürte er ihre Zweifel.
»Das zieht sich schon so lange hin. Ich habe einfach Angst, dass die Sache zu einem Politikum wird. Sie brauchen einen Sündenbock. Dad hat eine Tonne Opioide die Grenze passieren lassen. Er hätte sie aufhalten können. Jemandem müssen sie die Schuld geben.«
»Aber das meiste hat er doch zurückgeholt. Außerdem hatte er gar keine andere Wahl. Wirklich.« Er stand auf und küsste sie. »Im Übrigen war’s keine Tonne.«
Honoré warf mit einem Batzen Haferschleim, der Jean-Guys Wange traf und von dort auf Annies Kopf plumpste. Er zupfte ihn aus ihren Haaren, betrachtete ihn, dann steckte er ihn sich in den Mund.
»Du hättest einen prima Gorilla abgegeben«, sagte Annie.
Jean-Guy befingerte ihren Kopf, als wäre er ein Gorilla, der einen Artgenossen laust, während Annie lachte und Honoré mit noch mehr Haferschleim warf.
Annie würde vermutlich nie die schönste Frau in irgendeiner Runde sein. Kein Fremder würde ihr einen zweiten Blick schenken.
Doch wenn er es tat, dann würde er vielleicht etwas sehen, was Jean-Guy erst nach vielen Jahren und einer gescheiterten Ehe bemerkt hatte. Wie wunderschön Glück war. Und Annie Gamache strahlte Glück aus.
Daher würde sie nicht nur immer der klügste Mensch weit und breit sein, sondern eben auch der schönste, davon war er zutiefst überzeugt. Und wer das nicht sah, hatte eben Pech.
Er hob Honoré aus seinem Hochstuhl und ging mit ihm auf dem Arm zur Tür.
»Viel Spaß«, sagte er und gab beiden einen Kuss.
»Einen Moment noch«, sagte Annie.
Sie nahm Jean-Guydas Lätzchen ab, wischte ihm das Gesicht und sagte: »Sei vorsichtig. Du steckst da mit drin.«
»Du meinst, mit in der Scheiße?« Jean-Guy schüttelte den Kopf. »Nein. Die Angelegenheit findet heute ein Ende. Ich glaube, sie müssen einfach nur sagen können, dass es eine gründliche Untersuchung gegeben hat. Und die gab es ja auch. Aber nach einem genaueren Blick auf die Sachlage werden sie deinem Vater dafür danken, dass er das getan hat. Sie werden begreifen, dass er vor einer total beschissenen Entscheidung stand und getan hat, was getan werden musste.«
»Bitte keine Kraftausdrücke vor dem Kleinen. Du willst doch nicht, dass sein erstes Wort Scheiße ist«, sagte sie. »Aber ich gebe dir recht. Dad hatte keine andere Wahl. Nur werden sie das vielleicht anders sehen.«
»Dann sind sie blind.«
»Nein, nur Menschen«, sagte Annie und nahm ihm Honoré ab. »Und Menschen müssen sich irgendwo verstecken können. Vermutlich verstecken sie sich hinter Dad. Und bereiten sich darauf vor, ihn den Löwen zum Fraß vorzuwerfen.«
Beauvoir ging schnellen Schritts zur U-Bahn und zu der, wie er meinte, letzten internen Vernehmung, bevor endlich wieder Alltag einkehrte.
Er hielt den Kopf gebeugt, konzentrierte sich auf den Bürgersteig und die weiche, dünne Schneeschicht, die das Eis darunter verbarg.
Ein falscher Schritt konnte schlimm enden. Ein verknackster Knöchel. Eine gebrochene Hand, mit der man den Sturz hatte abfangen wollen. Ein Schädelbasisbruch.
Es war immer das nicht Nichtsichtbare, was einem Schaden zufügte.
Und als er jetzt in dem Sitzungszimmer saß, fragte sich Jean-Guy Beauvoir, ob Annie recht gehabt hatte und er tatsächlich etwas übersehen hatte.
4
»Wer sind Sie?«, fragte Gamache, beugte sich vor und sah den Mann am Kopfende des Tisches eindringlich an.
»Das wissen wir schon, Sir«, sagte Benedict.
Er sprach langsam. Geduldig. Myrna musste den Kopf senken, um ihr entzücktes, amüsiertes Lächeln zu verbergen.
»Er. Ist. Ein. Notar.« Beinahe hätte der junge Mann Armands Hand getätschelt.
»Oui, merci«, sagte Armand. »Das habe ich schon begriffen. Aber Laurence Mercier ist vor sechs Monaten gestorben. Also, wer sind Sie?«
»Hier steht es doch«, sagte Mercier und deutete auf die unleserliche Unterschrift. »Lucien Mercier. Laurence war mein Vater.«
»Und Sie sind auch Notar?«
»Ja. Ich habe die Kanzlei meines Vaters übernommen.«
Gamache wusste, dass Notare in Québec ähnliche Tätigkeitsbereiche wie Rechtsanwälte hatten und alles von Grundstücksverkäufen bis zu Eheverträgen erledigten.
»Warum benutzen Sie sein Briefpapier?«, sagte Myrna. »Das erweckt einen falschen Eindruck.«
»Aus Sparsamkeit und Umweltschutzgründen. Ich mag keine Verschwendung. Wenn ich die Geschäfte meines Vaters erledige, benutze ich seinen Briefkopf. Das ist für die Klienten auch weniger verwirrend.«
»Dem würde ich widersprechen«, murmelte Myrna.
Mercier zog vier Mappen aus seinem Aktenkoffer und teilte sie aus. »Sie sind hier, weil Sie in Bertha Baumgartners Letztem Willen genannt sind.«
Eine Weile schwiegen alle und verdauten die Nachricht, dann sagte Benedict: »Echt?«, während Armand und Myrna gleichzeitig »Wer?« fragten.
»Bertha Baumgartner«, wiederholte der Notar. Und dann nannte er den Namen ein drittes Mal, weil die beiden älteren invités ihn nach wie vor verständnislos ansahen.
»Nie von ihr gehört«, sagte Myrna. »Du?«
Armand dachte kurz nach. Er lernte jede Menge Leute kennen und war sich ziemlich sicher, dass er sich erinnern würde. Aber es fiel ihm niemand ein. Der Name sagte ihm nichts.
Armand und Myrna drehten sich zu Benedict, dessen hübsches Gesicht Neugier ausdrückte, mehr aber auch nicht.
»Sie?«, fragte Myrna, und er schüttelte den Kopf.
»Hat sie uns Geld hinterlassen?«, fragte Benedict.
Das klang nicht gierig, dachte Gamache. Eher verwundert. Und ja, vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll.
»Nein«, erwiderte Mercier mit freudiger Miene, die sich sofort ins Gegenteil verkehrte, als der junge Mann kein bisschen enttäuscht wirkte.
»Warum sind wir also hier?«, fragte Myrna.
»Sie sind die Testamentsvollstrecker.«
»Was?«, sagte Myrna. »Sie machen Witze.«
»Vollstrecker? Was soll das heißen?«, fragte Benedict.
»Sie sind mit der Abwicklung des Testaments betraut«, erklärte Mercier.
Als Benedict nach wie vor verwirrt dreinschaute, sagte Armand: »Es bedeutet, dass Bertha Baumgartner uns die Aufgabe übertragen hat, dafür zu sorgen, dass ihrem Letzten Willen nachgekommen wird. Damit ihre Wünsche auch tatsächlich erfüllt werden.«
»Dann ist sie tot?«, fragte Benedict.
Armand wollte schon antworten, dass das ja wohl offenkundig sei. Aber gerade eben war »tot« kein bisschen offenkundig gewesen, also war Madame Baumgartner vielleicht …
In Erwartung einer Bestätigung drehte sich Gamache zu dem Notar.
»Ja. Sie ist vor gut einem Monat gestorben.«
»Und bis dahin hat sie hier gewohnt?«, fragte Myrna, sah zu der durchhängenden Decke hoch und überlegte, wie lange sie zur Tür brauchte, wenn die Decke nicht mehr nur durchhing, sondern durchbrach. Vielleicht könnte sie auch einfach aus dem Fenster springen.
Mit Sicherheit würde sie weich landen, was nicht nur am Schnee läge, sondern auch daran, dass sie fast ausschließlich aus Gummibärchen bestand.
»Nein, sie hat in einem Seniorenheim gelebt«, sagte Mercier.
»Ist das hier also so was wie ein Geschworenendienst?«, fragte Benedict.
»Pardon?«, sagte der Notar.
»Na ja, wenn man zum Geschworenen berufen wird. Unsere Staatsbürgerpflicht, so in der Art. Wenn man zum Dings wird … wie haben Sie es noch mal genannt?«
»Testamentsvollstrecker«, sagte Mercier. »Nein, damit ist es nicht zu vergleichen. Sie hat Sie eigens dazu bestimmt.«
»Aber warum uns?«, fragte Armand. »Wir kannten sie nicht mal.«
»Ich habe keine Ahnung, und traurigerweise können wir sie nicht mehr fragen«, sagte Mercier, der dabei kein bisschen traurig aussah.
»Ihr Vater hat nichts dazu gesagt?«, fragte Myrna.
»Er hat nie über seine Klienten gesprochen.«
Gamache sah auf den Stapel Papier, der vor ihm lag, und bemerkte den roten Stempel in der oberen linken Ecke. Er wusste, wie Testamente aussahen. Man wurde nicht Ende fünfzig, ohne das eine oder andere gelesen zu haben. Und Gamache hatte einige gelesen, unter anderem sein eigenes.
Das hier war tatsächlich ein echtes, beglaubigtes Testament.
Er überflog das oberste Blatt und stellte fest, dass es vor zwei Jahren verfasst worden war.
»Sehen Sie sich bitte die zweite Seite an«, sagte der Notar. »Unter Ziffer 4 stehen Ihre Namen.«
»Einen Moment noch«, sagte Myrna. »Wer war Bertha Baumgartner? Irgendetwas müssen Sie doch über sie wissen.«
»Ich weiß nur, dass sie tot ist und mein Vater sich um ihren Nachlass gekümmert hat. Nach seinem Tod habe ich das übernommen. Und jetzt Sie. Bitte blättern Sie zu Seite zwei.«
Und tatsächlich, da standen ihre Namen. Myrna Landers aus Three Pines, Québec. Armand Gamache aus Three Pines, Québec. Benedict Pouliot, Rue Taillon 267, Montréal, Québec.
»Sind Sie das?« Mercier sah sie nacheinander an, und jeder von ihnen nickte. Er räusperte sich und hob an, das Testament zu verlesen.
»Einen Moment«, sagte Myrna. »Das ist verrückt. Irgendeine Fremde wählt uns willkürlich aus und macht uns zu ihren Testamentsvollstreckern? Geht das überhaupt?«
»Ja, natürlich«, sagte der Notar. »Wenn man Lust hat, kann man auch den Papst dazu ernennen.«
»Echt? Cool«, sagte Benedict, dessen Gedanken sich vor lauter Möglichkeiten überschlugen.
Gamache war nicht ganz derselben Meinung wie Myrna. Er bezweifelte, dass es willkürlich war. Er blickte auf die Namen in Bertha Baumgartners Testament. Ihre Namen. Da standen sie ganz eindeutig. Er vermutete, dass es dafür einen Grund gab. Auch wenn dieser Grund alles andere als eindeutig war.
Ein Polizist, eine Buchhändlerin, ein Bauhandwerker. Zwei Männer, eine Frau. Verschiedenen Alters. Zwei lebten auf dem Land, einer in der Stadt.
Es gab kein Muster. Sie hatten nichts miteinander gemein, außer dass ihre Namen in diesem Dokument erschienen.
Und dass keiner von ihnen Bertha Baumgartner gekannt hatte.
»Und muss man es machen, wenn man dazu ernannt ist?«, fragte Myrna. »Müssen wir es machen?«
»Natürlich nicht«, sagte Mercier. »Können Sie sich vorstellen, dass der Heilige Vater einen solchen Nachlass abwickelt?«
Sie versuchten es. Nach dem Lächeln auf seinem Gesicht zu urteilen, schien nur Benedict es zu schaffen.
»Dann können wir uns also weigern?«, fragte Myrna.
»Ja. Wollen Sie das denn?«
»Ja, also, ich weiß nicht. So schnell kann ich das nicht entscheiden. Ich hatte keine Ahnung, warum Sie mich haben kommen lassen.«
»Was haben Sie denn geglaubt?«, fragte Mercier.
Myrna ließ sich auf ihrem Stuhl zurücksinken und erinnerte sich.
An dem Morgen, an dem der Brief eintraf, war sie im Buchladen gewesen.
Sie hatte sich einen Becher starken Tee eingeschenkt und sich in den bequemen Sessel mit der tiefen Delle gesetzt, der sich ihrem Körper ganz und gar angepasst hatte.
Im Holzofen prasselte ein Feuer, und draußen vor dem Fenster lag ein strahlender Wintertag. Der Himmel war von einem vollkommenen tiefen Blau, und die Sonne glitzerte auf den schneebedeckten Wiesen, der Straße, dem Eislaufplatz und den Schneemännern auf dem Dorfanger. Das ganze Dorf glitzerte.
Es war einer jener Tage, an denen es einen nach draußen trieb. Auch wenn man es eigentlich besser wusste. Denn kaum war man im Freien, packte einen die Kälte, brannte in der Lunge, zog einem bei jedem Atemzug die Nasenlöcher zusammen. Sie ließ die Augen tränen. Die Wimpern vereisen, sodass die Lider zusammenklebten.
Und doch stand man atemlos da. Nur noch ein paar Minuten. Um den Tag noch ein wenig zu genießen. Bevor man sich ins Haus zurückzog, zum Ofen und zu heißer Schokolade, Tee oder starkem Café au lait.
Und der Post.
Sie hatte den Brief wieder und wieder gelesen und dann unter der aufgeführten Nummer angerufen, um sich zu erkundigen, warum der Notar sie sehen wollte.
Da niemand abhob, nahm sie den Brief mit ins Bistro, wo sie mit Clara Morrow und Gabri Dubeau, ihren Freunden und Nachbarn, zum Lunch verabredet war.
Während Clara und Gabri über das Thema Schneeskulpturen, den Hockey- und Mützenwettbewerb und die Erfrischungen für den bevorstehenden Winterkarneval redeten, schweifte Myrna in Gedanken immer wieder ab.
»Hallo«, sagte Gabri. »Jemand zu Hause?«
»Hm?«
»Wir brauchen deine Hilfe«, sagte Clara. »Das Schneeschuhrennen um den Dorfanger. Findest du eine oder zwei Runden besser?«
»Eine für die Altersklasse eins bis sieben«, sagte Myrna. »Anderthalb für die Altersklasse acht bis zwölf und zwei für alle anderen.«
»Nun, das war klar und deutlich«, sagte Gabri. »Und jetzt die Mannschaften für die Schneeballschlachten …«
Myrnas Gedanken schweiften wieder ab. Wie von ferne bekam sie mit, dass Gabri aufstand und weitere Holzscheite in das Feuer des offenen Kamins am anderen Ende des Bistros warf. Er blieb einen Moment stehen, um mit Gästen zu plaudern, die gerade aus der Kälte hereingekommen waren, mit den Füßen stampften und ihre kalten Hände aneinanderrieben.
Wärme empfing sie und der Geruch nach brennenden Ahornscheiten, ofenwarmen Tourtières und frisch gebrühtem Kaffee, der die Balken und Holzdielen imprägniert hatte.
»Ich muss dir etwas zeigen«, flüsterte Myrna Clara zu, während Gabri beschäftigt war.
»Warum flüsterst du?«, auch Clara senkte die Stimme. »Ist es was Schweinisches?«
»Natürlich nicht.«
»Natürlich?«, sagte Clara und hob die Augenbrauen. »Dafür kenn ich dich zu gut.«
Myrna lachte. Clara kannte sie tatsächlich gut. Aber auch sie kannte Clara gut.
Ihrer Freundin standen die braunen Haare vom Kopf ab, als hätte sie einen Stromschlag abbekommen. Sie sah ein bisschen wie ein mittelalter Sputnik aus. Was auch ihre Kunst erklären würde.
Clara Morrows Bilder waren wie aus einer anderen Welt. Und doch waren sie auf geradezu schmerzhafte Weise durch und durch menschlich.
Sie malte Porträts, wenigstens waren es auf den ersten Blick Porträts. Die wunderbar gemalte Haut spannte sich über Male des Leids und der Freude, bei manchen hing sie auch schlaff herunter. Sie malte Verlustängste und Glücksgefühle. Sie malte Gelassenheit und Verzweiflung. Alles in einem Porträt.
Clara fing mit Pinsel, Leinwand und Ölfarbe ihre Sujets ein, um sie zu befreien.
Während dieses Prozesses schaffte sie es, sich selbst über und über mit Farbe zu bekleckern. Wangen, Haare, Fingernägel. Sie war selbst ein Work in progress.
»Ich zeig’s dir nachher«, sagte Myrna, als Gabri zu ihrem Tisch zurückkehrte.
»Wenn du’s so spannend machst, sollte es besser richtig schweinisch sein«, sagte Clara.
»Schweinisch?«, fragte Gabri. »Erzähl.«
»Myrna meint, die Erwachsenen sollten beim Schneeschuhrennen nackt sein.«
»Nackt?«, fragte Gabri und warf Myrna einen Blick zu. »Ich bin ja nicht prüde, aber die Kinder …«
»Himmel!«, rief Myrna. »Das habe ich doch gar nicht gesagt. Clara lügt.«
»Wobei, wenn es spätabends stattfindet, sobald die Kinder im Bett sind …«, sagte Gabri. »Könnte klappen, wenn wir Fackeln um den Dorfanger herum aufstellen. Dann würden wir garantiert auch ein paar Geschwindigkeitsrekorde aufstellen.«
Myrna funkelte Clara an. Gabri, Präsident des Carnaval d’Hiver, verzog keine Miene.
»Gut, vielleicht nicht ganz nackt, sondern –« Gabri sah sich unter den Gästen des Bistros um und stellte sie sich nackt vor. »Vielleicht sollten sie Badesachen tragen.«
Clara zog die Augenbrauen zusammen, nicht missbilligend, sondern überrascht. Das war gar keine schlechte Idee. Vor allem wenn man bedachte, dass während des langen, langen, dunklen, dunklen Québecer Winters die meisten Gespräche im Bistro sich um die Flucht in wärmere Gefilde drehten. Darum, sich in Bikini und Badehose an irgendeinem Strand zu fläzen.
»Wir könnten es Flucht in die Karibik nennen«, sagte sie.
Myrna verdrehte seufzend die Augen.
Eine alte Frau am anderen Ende des Bistros bemerkte das und dachte, das Augenverdrehen hätte ihr gegolten.
Ruth Zardo starrte zurück.
Myrna fing den Blick auf und überlegte, wie ungerecht es doch von der Natur war, die alte Dichterin weißer werden zu lassen, aber nicht weiser.
Wobei hinter den dichten Scotch-Schwaden durchaus Weisheit zu finden war.
Ruth widmete sich wieder ihrem Mittagessen aus Scotch und Chips. Das Notizbuch auf dem Tisch enthielt zwischen den verknitterten Seiten weder Reime noch kluge Gedanken, sondern den Kloß im Hals.
Sie sah aus dem Fenster, dann schrieb sie:
Scharf wie Eissplitter
durchstoßen die Schreie der Kinder den Himmel
Neben Ruth auf dem Sofa schimpfte Rosa: »Fuck, fuck, fuck.« Vielleicht war es auch: »Quak, quak, quak.« Aber wer Rosa kannte, wusste, dass »Fuck« wahrscheinlicher war.
Graziös streckte Rosa ihren langen Hals vor und pickte behutsam einen Chip aus der Schüssel, während Ruth durch das Fenster zusah, wie die Kinder auf ihren Schlitten von der kleinen Kirche zum Dorfanger sausten. Sie notierte:
Oder in der schneekappigen Dorfkirche
sich schließlich hinknien und
beten um das, was wir nicht haben konnten.
Das Essen wurde serviert. Clara und Myrna hatten beide Heilbutt mit Senfsamen, Curryblättern und gegrillter Tomate bestellt. Für seinen Lebensgefährten Gabri hatte Olivier Moorhuhn mit gegrillten Feigen und Blumenkohlpüree zubereitet.
»Ich werde den Premierminister einladen«, sagte Gabri. »Er könnte den Karneval eröffnen.«
Jedes Jahr lud er Justin Trudeau ein. Und nie bekam er eine Antwort.
»Vielleicht könnte er auch am Rennen teilnehmen?«, fragte Clara.
Gabri sah sie groß an.
Justin Trudeau. Der um den Dorfanger lief. In einer Speedo-Badehose.
Das Gespräch verlor merklich an Niveau.
Myrna war nicht mit dem Herzen dabei und auch nicht mit dem Kopf, selbst wenn sie sich einen Moment lang Trudeau vorstellte, bevor sie wieder an den zusammengefalteten Brief in ihrer Tasche dachte.
Was würde passieren, wenn sie nicht hinfuhr?
Die Sonne färbte den Schnee draußen rosa und blau. Kreischende Kinder, die auf ihren Schlitten den Hügel hinunterrasten, waren zu hören, schwindlig von dieser unwiderstehlichen Mischung aus Vergnügen und Angst. Alles wirkte so idyllisch.
Aber.
Aber wenn der Zufall oder das Schicksal es so wollte und man weit weg von zu Hause von sich zusammenballenden Wolken überrascht wurde, der Schneefall zum Schneesturm wurde, dann sah es schlecht aus.
Ein Québecer Winter, so heiter und friedlich, konnte sich gegen die Menschen wenden. Konnte töten. Und das tat er jedes Jahr. Männer, Frauen, Kinder, die im Herbst noch lebten, sahen den Schneesturm nicht kommen und erlebten den Frühling nicht mehr.
Der Winter auf dem Land war ein prachtvoller, herrlicher, glänzender Mörder.
Québecer mit grauen Haaren und faltigen Gesichtern erreichten dieses Alter nur, weil sie klug, vernünftig und vorsichtig genug waren, nach Hause zu gehen. Und den Schneesturm von einem munter brennenden Kamin aus zu betrachten, in der Hand eine heiße Schokolade oder ein Glas Wein und ein gutes Buch.
Es gab nur wenig, was beängstigender war, als bei einem Schneesturm im Freien zu sein, aber es gab auch nur wenig, was heimeliger war, als währenddessen drinnen zu sein.
Wie bei so vielem im Leben lag zwischen Wohl und Wehe nur eine Handbreit, das wusste Myrna.
Während Gabri und Clara über die Vorzüge von All-inclusive-Resorts gegenüber normalen Hotels und Kreuzfahrten redeten, dachte Myrna über den Brief nach und beschloss, die Entscheidung dem Schicksal zu überlassen.
Wenn es schneite, würde sie zu Hause bleiben. Wenn nicht, würde sie fahren.
Und jetzt saß Myrna zusammen mit dem seltsamen Notar und dem verrückten jungen Handwerker in der seltsamen Küche an dem seltsamen Tisch, sah in den immer heftiger fallenden Schnee hinaus und dachte:
Scheißschicksal. Wieder mal reingelegt.
»Myrna hat recht«, sagte Armand und legte eine große Hand auf das Testament. »Wir müssen erst entscheiden, ob wir das überhaupt machen wollen.« Er sah die anderen beiden an. »Was meint ihr?«
»Können wir das Ding erst mal lesen?«, fragte Benedict und deutete auf das Testament. »Und uns dann entscheiden?«
»Nein«, sagte der Notar.
Myrna stand auf. »Wir sollten darüber reden. Unter uns.«
Armand ging um den Tisch, beugte sich zu Benedict, der immer noch dasaß, und sagte leise: »Sie können sich gerne zu uns gesellen.«
»Ja, klasse. Gute Idee.«
5
Auf dem Weg von der Küche ins Esszimmer blieb Ga- mache kurz stehen und betrachtete die Markierungen am Türstock.
Er beugte sich vor und entdeckte verblasste Namen neben den Strichen.
Anthony mit drei, vier, fünf und so weiter, den Türstock hoch.
Caroline mit drei, vier, fünf …
Und dann war da noch Hugo, drei, vier, fünf und so weiter. Aber diese Striche lagen dichter beieinander. Wie die Jahresringe eines alten Eichenbaums, der nicht sehr schnell wuchs. Und nicht sehr hoch.
Hugo hinkte weit hinter seinen Geschwistern her. Aber neben seinem Namen klebte bei jedem Strich ein Aufkleber. Ein Pferd. Ein Hund. Ein Teddybär. Sodass der kleine Hugo trotzdem hervorstach.
Armand sah zurück in die ausgeräumte Küche. Dann in das leere Esszimmer mit der stockfleckigen Tapete.
Was ist hier passiert?, fragte er sich.
Was in Madame Baumgartners Leben hatte dazu geführt, dass sie Fremde zu Testamentsvollstreckern ernannte? Wo waren Anthony, Caroline und Hugo?
»Das Dach leckt«, sagte Benedict und breitete seine große Hand über einen Wasserfleck an der Esszimmerwand. »Die Feuchtigkeit dringt in die Wände. Und die modern. Schöner Mist. Sehen Sie sich nur die Böden an.«
Sie sahen sich die Böden an. Altes Kiefernholz. Das sich aufwarf.
Er öffnete den Reißverschluss seiner Winterjacke, und zum Vorschein kam ein selbstgestrickter Pullover, der abwechselnd flauschig und glatt war, und ein Teil sah aus, als bestünde er aus Stahlwolle.
Myrna konnte sich nicht vorstellen, dass er angenehm zu tragen war, aber wahrscheinlich hatte ihn seine Freundin gestrickt.
Er muss sie lieben, dachte sie. Sehr. Und sie ihn. Alles, was sie macht, ist für ihn. Dass die Sachen scheußlich waren, schmälerte die Geste nicht. Es sei denn natürlich, sie machte sie absichtlich scheußlich. Um ihn wie einen Idioten aussehen zu lassen und um ihn zu quälen mit der auf der jungen Haut kratzenden und reibenden Stahlwolle.
Entweder liebte sie Benedict sehr oder sie verabscheute ihn. Sehr.
Und entweder bemerkte er das nicht, oder er genoss es, gequält und schlecht behandelt zu werden, was ja manchmal vorkam.
»Also«, sagte Myrna. »Wollen Sie Testamentsvollstrecker sein?«
»Was würde das heißen?«, fragte Benedict. »Was müssten wir tun?«
»Wenn das Testament unkompliziert ist, nicht viel«, sagte Armand. »Dann müssen wir nur dafür sorgen, dass die Steuern und anfallenden Kosten bezahlt werden und die richtigen Leute die Vermächtnisse erhalten. Die Bestimmungen erfüllt werden. Dabei hilft einem der Notar. Testamentsvollstrecker sind normalerweise Verwandte oder Freunde. Leute, denen der Verstorbene vertraut hat.«
Sie sahen sich an. Sie waren weder Freunde noch Verwandte von Bertha Baumgartner. Und doch waren sie hier.
Armand sah sich um, ob ein Foto an einer der feuchten Wände hing oder auf den Boden gefallen war. Etwas, das ihm sagen könnte, wer diese Bertha Baumgartner gewesen war. Aber da war nichts. Nur die verwischten Striche am Türstock. Und das Pferdchen, das Hundchen, der Teddybär.
»Das hört sich nicht besonders schlimm an«, sagte Benedict.
»Wenn das Testament unkompliziert ist«, sagte Armand. »Wenn nicht, kann es viel Zeit verschlingen. Über einen langen Zeitraum.«
»Tage?«, fragte Benedict. Als er keine Antwort erhielt, fügte er hinzu: »Wochen? Monate?«
»Jahre«, sagte Armand. »Manche Testamente erfordern Jahre, besonders wenn die Erben miteinander streiten.«
»Und das tun sie oft«, sagte Myrna. Sie drehte sich einmal um die eigene Achse. »Weil sie gierig sind. Aber es sieht so aus, als hätten sie sich hier schon bedient. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viel übrig ist, was man teilen müsste.«
Armand neben ihr gab eine Art Grollen von sich.
Sie sah ihn an und nickte. »Ich weiß. Es mag in unseren Augen nicht viel sein, aber für Leute, die kaum etwas besitzen, kann ein bisschen mehr schon ein Vermögen sein.«
Er schwieg weiter.
Er war anderer Ansicht. Bei einem Testament, einem Nachlass ging es oft um mehr als Geld, Grund und andere Besitztümer. Derjenige, dem am meisten hinterlassen wurde, konnte als derjenige gelten, der am meisten geliebt wurde. Es gab verschiedene Arten von Gier. Und Bedürftigkeit.
Und Testamente wurden manchmal als letzter Affront benutzt, als letzte, von einem Toten ausgesprochene Beleidigung.
»Kriegt man Geld dafür?«, fragte Benedict.
»Ein bisschen vielleicht. Normalerweise ist es aber eine Gefälligkeit«, sagte Armand.
Benedict nickte. »Und woher wissen wir, ob es ein unkompliziertes Testament ist?«
»Das wissen wir erst, wenn wir es lesen«, sagte Myrna.
»Aber wir können es erst lesen, wenn wir uns dafür entschieden haben«, ergänzte Benedict.
»Eine Interdependenz«, sagte Gamache zu dem verständnislos dreinblickenden jungen Mann. »Ich denke, wir sollten vom Schlimmsten ausgehen, wenn wir überlegen, ob wir es machen.«
»Und wenn wir’s nicht machen?«, fragte Myrna.
»Dann wird das Gericht andere Testamentsvollstrecker bestellen.«
»Aber sie wollte uns«, sagte Benedict. »Ich frage mich nur, warum.« Nachdenklich hielt er inne. Sie meinten fast, ihn denken zu hören. Schließlich schüttelte er den Kopf. »Nee. Mir fällt kein Grund ein. Sie beide kennen sich, oder?«
»Wir sind Nachbarn«, sagte Myrna. »Wir wohnen in demselben Dorf ungefähr zwanzig Minuten von hier.«
»Ich lebe mit meiner Freundin in Montréal. Ich war noch nie in dieser Gegend. Vielleicht meinte sie ja einen anderen Benedict Pouliot.«
»Wohnen Sie in der Rue Taillon in Montréal?«, fragte Armand, und als der junge Mann nickte, fuhr er fort: »Dann hat sie Sie gemeint.«
Benedict warf Armand einen Blick zu, als würde er ihn zum ersten Mal sehen. Er hob eine Hand an die Schläfe, legte einen Finger darauf. »Das sieht ja schlimm aus. Was ist da passiert? Ein Unfall?«
Armand hob die Hand und fuhr über die erhabene Narbe. »Nein. Da hat mich jemand verletzt.«
Mehr als einmal, dachte Myrna, sagte aber nichts.
»Ist schon eine Weile her«, versicherte Armand dem jungen Mann. »Es ist alles verheilt.«
»Muss ziemlich weh getan haben.«
»Ja. Aber ich denke, andere hat es schlimmer erwischt.«
Er hat offenbar keine Ahnung, wer Armand ist, dachte Myrna. Und, dass Armand nicht vorhatte, es ihm zu sagen.
»Wie dem auch sei, wir sollten zu einer Entscheidung kommen«, sagte sie und ging zum Fenster. »Der Schnee fällt immer dichter.«
»Du hast recht«, sagte Armand. »Wir müssen bald aufbrechen. Also, machen wir’s oder nicht?«
»Was meinst du?«, fragte Myrna.
Er hatte sich bereits entschieden. Er hatte sich in dem Moment entschieden, als der Notar erklärte, warum er sie hergebeten hatte.
»Ich habe keine Ahnung, warum Madame Baumgartner uns ausgewählt hat, aber sie hat es getan. Ich sehe keinen Grund, warum ich ablehnen sollte. Ich bin dabei. Außerdem –«, er lächelte Myrna an, »– bin ich neugierig.«
»Und wie du das bist«, sagte sie, dann sah sie Benedict an. »Und Sie?«
»Jahre, haben Sie gesagt?«, fragte er.
»Im schlimmsten Fall«, erwiderte Gamache. »Ja.«
»Es könnte also Jahre dauern, ohne dass wir Geld dafür kriegen«, fasste Benedict zusammen. »Ach, scheiß drauf. Ich bin auch dabei. So schlimm wird’s schon nicht werden.«
Myrna betrachtete den hübschen jungen Mann mit dem fürchterlichen Haarschnitt und dem Stahlwollepullover. Wenn er das ertrug, dachte sie, dann ertrug er auch nervende Fremde, die sich über Kleinkram stritten.
»Und du?«, fragte Armand Myrna.
»Ich? Ich war von vornherein dabei«, sagte sie lächelnd. Und dann bebte es und die Fenster klapperten im Wind, der um die Ecken pfiff. Das Haus knarrte, dann knirschte es laut.
Myrna spürte, wie Panik in ihr aufstieg. Und immer größer wurde. Sie waren in dem Haus nicht sicher. Aber draußen waren sie es auch nicht.
Und sie mussten noch zurück nach Three Pines fahren.
»Wir müssen los.«
Schnell ging sie wieder in die Küche und sah zum Fenster hinaus. Sie konnte kaum noch ihr Auto erkennen, das unter dem wehenden, treibenden, wirbelnden Schnee verschwunden war.
»Wir machen es«, sagte sie zu Mercier. »Aber jetzt brechen wir auf.«
»Was?«, sagte Mercier und erhob sich.
»Wir brechen auf«, sagte Armand. »Und das sollten Sie auch. Wo ist Ihre Kanzlei?«
»Sherbrooke.«
Das war mindestens eine Stunde Autofahrt entfernt.
Da sie ihre Mäntel und Stiefel nicht abgelegt hatten, mussten sie nur ihre Handschuhe und Mützen zusammensuchen, dann gingen sie zur Hintertür.
»Einen Moment«, sagte Mercier und setzte sich wieder. »Wir müssen das Testament verlesen. Madame Baumgartner hat festgelegt, dass das hier zu geschehen hat.«
»Madame Baumgartner ist tot«, sagte Myrna. »Und ich will diesen Tag überleben.«
Sie zog sich ihre Strickmütze über den Kopf und folgte Benedict aus dem Haus.
»Nun, Monsieur«, sagte Armand. »Wir gehen. Und Sie auch.«
Benedict und Myrna wateten durch den stellenweise schon knietiefen Schnee zu ihrem Auto. Der junge Mann hatte eine Schaufel aus einem Schneehaufen gezogen und machte sich daran, Myrnas Auto auszugraben.
Mercier lehnte sich zurück und verschränkte die Arme.
»Los«, sagte Armand, und als der Notar sich nicht rührte, packte er ihn am Arm und zog ihn hoch.
»Holen Sie Ihre Sachen«, befahl er, und nachdem Mercier ihn kurz verdutzt angesehen hatte, folgte er ihm.
Armand sah auf sein iPhone. Es hatte kein Signal. Der Sturm hatte alles zum Erliegen gebracht.
Er sah zum Fenster hinaus, dann ließ er seinen Blick durch das knarrende, knirschende, krumme Haus wandern.
Sie mussten schleunigst los.
Er stopfte die Papiere in den Aktenkoffer und reichte ihn dem Notar. »Kommen Sie.«
Als Gamache die Tür öffnete, peitschte ihm der Schnee ins Gesicht und raubte ihm die Luft zum Atmen. Er kniff die Augen zusammen und blinzelte, um etwas zu sehen.
Der Lärm war ohrenbetäubend.
Ein wildes Heulen und Jaulen. Von allen Seiten drang es auf sie ein, zerrte an ihnen. Die Welt zerstob. Und sie mittendrin.
Schnee sammelte sich auf seinem Gesicht. Gamache drehte den Kopf weg und sah Benedict verzweifelt schaufeln, um Myrnas Auto aus den Schneemassen zu befreien. Kaum hatte der junge Mann einen Teil freigeräumt, fuhr der Wind in den Schnee und trieb ihn zurück.