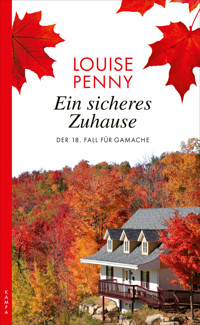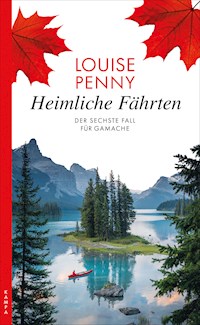
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Carnaval de Québec, der größte Winterkarneval der Welt. Es ist bitterkalt - und überwältigend schön. Chief Inspector Gamache ist jedoch nicht wegen der Festlichkeiten in die Stadt gekommen. Er muss sich von einem verhängnisvollen Einsatz erholen: Bei einer Schießerei auf einem verlassenen Fabrikgelände wurde nicht nur Gamache selbst schwer verletzt, es sind auch mehrere seiner Männer ums Leben gekommen. Gamache sucht Ablenkung bei seinem Freund und ehemaligen Mentor Émile Comeau, geht mit seinem Hund spazieren, isst hervorragend und sitzt stundenlang in der Bibliothek der Literary and Historical Society in der Altstadt. Als im Keller der Bibliothek eine Leiche gefunden wird, steckt Gamache schnell mitten in den Ermittlungen. Das Opfer, der als verrückt verschriene Hobbyarchäologe Augustin Renaud, war besessen davon, die sterblichen Überreste des Gründers von Québec zu finden. Aber kann das Geheimnis um Samuel de Champlains Grabstätte so schrecklich sein, dass jemand deswegen einen Mord begeht? Unterdessen erhält Gamache sorgenvolle Post aus Three Pines: Ein Dorfbewohner sitzt wegen Mordes hinter Gittern, und wer, wenn nicht Gamache, könnte den Fall neu aufrollen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Louise Penny
Heimliche Fährten
Der sechste Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Dieses Buch ist den zweiten Chancen gewidmet –
denen, die sie geben,
und denen, die sie ergreifen.
1
Zwei Stufen auf einmal nehmend, stürmten sie die Treppe hinauf. Gleichzeitig versuchten sie, so wenig Lärm wie möglich zu machen. Gamache gab sich große Mühe, ruhig zu atmen, als ob er zu Hause säße und alles in bester Ordnung wäre.
»Sir?«, kam die junge Stimme aus seinem Kopfhörer.
»Sie müssen mir glauben. Ihnen wird nichts passieren.«
Der Chief Inspector hoffte, der junge Agent möge ihm die Anspannung nicht anhören. Und wie er versuchte, seiner Stimme einen festen, bestimmten Ton zu verleihen.
»Ich glaube Ihnen.«
Sie erreichten den Treppenabsatz. Inspector Beauvoir blieb stehen und sah seinen Vorgesetzten an. Gamache schaute auf die Uhr.
47 Sekunden. Genügend Zeit.
Die Stimme des Agent in seinem Headset schilderte ihm, wie gut sich der Sonnenschein auf seinem Gesicht anfühlte.
Auch die restlichen Mitglieder des Teams waren jetzt oben angekommen, alle in Schutzwesten, die automatischen Waffen im Anschlag, die wachsamen Blicke auf den Chef gerichtet. Auch Inspector Beauvoir neben ihm wartete auf seine Entscheidung. Welche Richtung? Sie waren fast da. Wenige Meter vor dem Ziel.
Gamache spähte in einen dunklen, verdreckten Flur des verlassenen Fabrikgebäudes, dann in einen anderen.
Sie sahen völlig gleich aus. Durch die schmutzigen, zerbrochenen Fenster der langen Korridore sickerte Licht, und mit ihm der Dezembertag.
Noch 43 Sekunden.
Entschlossen deutete Gamache in den linken Flur, und lautlos rannten sie auf die Tür an seinem Ende zu. Das Gewehr fest im Griff, sprach der Chief Inspector im Laufen ruhig in das Headset.
»Es besteht kein Grund zur Sorge.«
»Noch vierzig Sekunden, Sir.« Jedes Wort hervorgestoßen, als bekäme der Mann am anderen Ende kaum mehr Luft.
»Hören Sie einfach auf mich«, sagte Gamache und zeigte auf eine Tür. Das Team stürmte los.
36 Sekunden.
»Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen etwas zustößt.« Gamaches Ton war entschieden, bestimmt, duldete keinen Widerspruch. »Sie werden heute mit Ihrer Familie zu Abend essen.«
»Ja, Sir.«
Das Einsatzteam umstellte die geschlossene Tür mit der schmutzigen Milchglasscheibe. Dahinter war es dunkel.
Gamache hielt inne und blickte auf die Tür, die Hand bereits erhoben, um das Signal zu geben, sie aufzubrechen. Um seinen Agent zu retten.
29 Sekunden.
Neben ihm stand Beauvoir bereit. Wartete auf das Kommando loszuschlagen.
Zu spät merkte Chief Inspector Gamache, dass er einen Fehler gemacht hatte.
»Mit der Zeit wird es schon wieder, Armand.«
»Avec le temps?« Gamache erwiderte das Lächeln des älteren Mannes und ballte die rechte Hand zur Faust. Um das Zittern zu unterbinden. Es war so schwach, dass es die Bedienung des Cafés in Quebec City bestimmt nicht bemerkt hatte. Und die zwei Studenten, die auf der anderen Seite des Durchgangs auf ihren Laptops tippten, erst recht nicht. Niemand würde es bemerken.
Nur jemand in unmittelbarer Nähe.
Er betrachtete Émile Comeau, der mit sicherer Hand ein Croissant brach. Gamaches Mentor und ehemaliger Vorgesetzter ging inzwischen auf die achtzig zu. Sein Haar war weiß und gepflegt, die Augen hinter seiner Brille von einem stechenden Blau. Noch immer war er schlank und agil. Allerdings bemerkte Armand Gamache mit jedem Treffen ein leichtes Erschlaffen der Gesichtszüge, eine leichte Verlangsamung der Bewegungen.
Avec le temps.
Seit fünf Jahren Witwer, wusste Émile Comeau um die Macht und die Länge der Zeit.
Gamaches Frau, Reine-Marie, war am frühen Morgen abgereist, nachdem sie mit den beiden Männern eine Woche in Émiles Haus in der Altstadt von Quebec City verbracht hatte. Sie hatten am Kamin in aller Stille gemeinsam zu Abend gegessen, waren in den engen, verschneiten Straßen spazieren gegangen. Hatten geredet. Geschwiegen. Zeitung gelesen, über den Vorfall gesprochen. Zu dritt. Zu viert, wenn man Henri, den Schäferhund, mitzählte.
Und an den meisten Tagen war Gamache allein in eine Bibliothek gegangen, um zu lesen.
Das hatten ihm Émile und Reine-Marie zugestanden, denn sie hatten gemerkt, dass er das Alleinsein gerade ebenso sehr brauchte wie ihre Gesellschaft.
Und dann wurde es für Reine-Marie Zeit abzufahren. Nachdem sie sich von Émile verabschiedet hatte, wandte sie sich ihrem Mann zu. Groß und kräftig, ein Mann, der gute Bücher und lange Spaziergänge jeder anderen Aktivität vorzog. Er sah eher aus wie ein distinguierter Professor Mitte fünfzig statt wie der Leiter der renommiertesten Mordkommission Kanadas, der Sûreté du Québec. Er begleitete sie zu ihrem Auto, kratzte die morgendliche Eisschicht von der Windschutzscheibe.
»Du weißt schon, dass du noch bleiben kannst.« Er lächelte sie an, als sie sich in dem frostigen neuen Tag gegenüberstanden. Henri hockte in einem Schneehaufen und beobachtete sie.
»Ich weiß. Aber du und Émile braucht auch Zeit für euch. Mir ist nicht entgangen, wie ihr euch angesehen habt.«
»Das Verlangen?« Der Chief Inspector lachte. »Ich dachte, es wäre uns nicht so leicht anzumerken.«
»Einer Ehefrau entgeht nichts.« Sie lächelte, blickte in seine dunkelbraunen Augen. Obwohl er einen Hut trug, war sein ergrauendes Haar zu sehen, die leichten Locken, die unter der Krempe hervorlugten. Und der Vollbart. Nach und nach hatte sie sich an seinen Bart gewöhnt. Jahrelang hatte er einen Schnurrbart getragen. Erst seit Kurzem, seit dem Vorfall, trug er einen Vollbart.
Sie zögerte. Sollte sie es sagen? Inzwischen schwirrten ihr die Worte unaufhörlich im Kopf, lagen ihr ständig auf der Zunge. Sie wusste aber, dass sie nutzlos wären, falls man das von Worten überhaupt sagen konnte. Jedenfalls würde es nicht geschehen, nur weil sie es aussprach. Wäre das möglich, hätte sie ihn in ihre Worte eingehüllt.
»Komm einfach nach Hause, sobald du kannst«, sagte sie stattdessen leichthin.
Er gab ihr einen Kuss. »Auf jeden Fall. In ein paar Tagen, spätestens in einer Woche. Ruf mich an, wenn du da bist.«
»D’accord.« Sie stieg ins Auto.
»Je t’aime.« Er streckte seine behandschuhte Hand durchs Fenster, um sie an der Schulter zu berühren.
Pass auf dich auf!, schrie sie in Gedanken. Muss das wirklich sein? Komm mit mir nach Hause. Sei vorsichtig!
Sie legte ihre behandschuhte Hand auf seine. »Je t’aime.«
Und dann fuhr sie los, zurück nach Montréal, und sah im Rückspiegel, wie er an der verlassenen frühmorgendlichen Straße stand, Henri selbstverständlich an seiner Seite. Beide schauten ihr nach, bis sie verschwand.
Der Chief Inspector sah ihr sogar noch hinterher, als sie um die Ecke gebogen war. Dann griff er sich eine Schaufel und räumte den pulvrigen Neuschnee von der Eingangstreppe. Als er, die Arme auf dem Griff verschränkt, kurz ausruhte, staunte er über die Schönheit des ersten Tageslichts, wenn es auf Schnee fiel. Er sah dann mehr bläulich als weiß aus, und wenn die zu kleinen Haufen zusammengewehten Flocken das Licht auffingen, umgestalteten und zurückwarfen, funkelten sie wie winzige Prismen. Wie etwas Lebendiges, Trunkenes.
So war auch das Leben innerhalb der Mauern der Altstadt. Gleichzeitig beschaulich und dynamisch, altehrwürdig und lebendig.
Der Chief Inspector nahm eine Handvoll Schnee und formte sie in seiner Faust zu einem Schneeball. Henri sprang sofort auf und wedelte so heftig mit dem Schwanz, dass sein ganzes Hinterteil hin und her schwenkte. Sein Blick bohrte sich in den Schneeball.
Gamache warf ihn hoch, und der Hund sprang, fing den Schneeball mit dem Maul auf und biss zu. Und als er auf allen vieren landete, war Henri wie immer überrascht, dass dieses Ding, das so kompakt gewesen war, so schnell verschwunden war.
Einfach weg, blitzschnell.
Aber nächstes Mal würde es anders sein.
Gamache lachte leise in sich hinein. Vielleicht hatte Henri ja recht.
In diesem Moment kam Émile, wegen der beißenden Februarkälte in einem dicken Wintermantel, aus dem Haus.
»Kommst du?« Der alte Mann setzte eine Strickmütze auf, zog sie sich über Stirn und Ohren und schlüpfte in Fäustlinge, dick wie Boxhandschuhe.
»Wohin? Zu einer Belagerung?«
»Frühstücken, mon vieux. Beeil dich, bevor dir jemand das letzte Croissant wegschnappt.«
Émile wusste, wie sein ehemaliger Untergebener zu motivieren war.
Ohne zu warten, bis Gamache die Schneeschaufel zurückgestellt hatte, ging er die verschneite Straße hinauf. Inzwischen waren auch andere Bewohner Quebec Citys wach. Sie kamen in das zarte Morgenlicht heraus, um Schnee zu räumen, das Eis von ihren Autos zu kratzen oder Kaffee und ein Morgenbaguette aus der Boulangerie zu holen.
Die zwei Männer gingen mit Henri die Rue Saint-Jean hinauf, an den Restaurants und Touristenshops vorbei zur Rue Couillard, einer kleinen Seitenstraße, wo sich das Chez Temporel befand.
Seit Superintendent Émile Comeau sich vor fünfzehn Jahren in der Altstadt Quebec Citys zur Ruhe gesetzt hatte, gingen sie regelmäßig in dieses Café, wenn Gamache seinen Mentor besuchte, um alle möglichen anfallenden Aufgaben für ihn zu erledigen. Schneeschippen, Brennholz für den Kamin aufschichten, Fenster gegen die Zugluft abdichten. Aber diesmal war es umgekehrt. Im Gegensatz zu den bisherigen Wintern war Chief Inspector Gamache diesmal nach Quebec City gekommen, weil er es war, der Hilfe brauchte.
»So.« Émile nahm die Tasse Café au Lait in seine schlanken Hände und lehnte sich zurück. »Wie kommst du bei deinen Recherchen voran?«
»Bisher konnte ich noch keine Hinweise finden, dass Captain Cook Bougainville schon vor der Schlacht von Québec begegnet ist. Aber das ist jetzt zweihundertfünfzig Jahre her. Die spärlichen Aufzeichnungen sind auch noch schlecht erhalten. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Es ist eine tolle Bibliothek, Émile. Manche Bücher sind jahrhundertealt.«
Comeau betrachtete seinen Freund, der von den arkanen Büchern der heimischen Bibliothek erzählte und von den erstaunlichen kleinen Erkenntnissen, die er aus ihnen über eine vor langer Zeit geschlagene und verlorene Schlacht gewonnen hatte. Verloren zumindest aus seiner Sicht. War da doch noch ein Funke in diesen von ihm so geschätzten Augen, in die er so oft an den Schauplätzen grauenhafter Verbrechen geblickt hatte, wenn sie gemeinsam auf Mörderjagd gewesen waren? Wenn sie Wälder, Dörfer, Felder durchstreift, Anhaltspunkte, Beweise und Verdachtsmomente gesichtet hatten. Hinab ins tiefe Dunkel klaffender Ängste. Émile erinnerte sich an das Zitat nicht weniger gut als an diese Tage. Ja, dachte er, das traf es genau. Klaffende Ängste. Sowohl ihre eigenen als auch die der Mörder. An den unterschiedlichsten Orten der Provinz hatten er und Gamache einander so gegenüber gesessen. Genau wie jetzt.
Doch jetzt war es Zeit, die Morde ruhen zu lassen. Kein Töten mehr, kein Sterben. Davon hatte Armand in letzter Zeit zu viel erlebt. Nein, da war es besser, sich in der Geschichte, in weit zurückliegenden Schicksalen zu vergraben. Eine intellektuelle Suche, mehr nicht.
Henri neben ihnen regte sich, und automatisch senkte Gamache die Hand, um dem Schäferhund beruhigend über den Kopf zu streichen. Und wieder fiel Émile das leichte Zittern auf. Im Moment kaum zu erkennen. Bei anderen Gelegenheiten stärker. Manchmal ganz weg. Es war ein verräterisches Zittern, und Émile kannte die schreckliche Geschichte dahinter.
Nur zu gern hätte er diese Hand ergriffen und gehalten und Armand versichert, dass alles gut würde. Denn das würde es.
Mit der Zeit.
Als er jetzt sein Gegenüber musterte, fiel ihm wieder die gezackte Narbe an seiner linken Schläfe auf, der sauber getrimmte Vollbart, den er sich hatte stehen lassen. Damit die Leute aufhörten, sie anzustarren. Damit die Leute den bekanntesten Polizeibeamten Québecs nicht erkannten.
Aber das spielte natürlich keine Rolle. Nicht sie waren es, vor denen Armand Gamache sich versteckte.
Die Bedienung des Chez Temporel kam mit frischem Kaffee.
»Merci, Danielle«, sagten die zwei Männer gleichzeitig, und als sie ging, lächelte sie die beiden an, die so unterschiedlich aussahen, aber einander so ähnlich zu sein schienen.
Sie tranken ihren Kaffee und aßen pain au chocolat und croissants aux amandes und sprachen über den Carnaval de Québec, der an diesem Abend begann. Gelegentlich verfielen sie in Schweigen und beobachteten die Männer und Frauen, die draußen auf der eiskalten Straße zur Arbeit hetzten. Jemand hatte ein dreiblättriges Kleeblatt in eine Vertiefung in der Mitte ihres Holztisches geritzt. Émile strich mit dem Finger darüber.
Und fragte sich, wann Armand so weit wäre, um über das Geschehene zu sprechen.
Es war halb elf, und in Kürze würde die monatliche Vorstandssitzung der Literary and Historical Society beginnen. Jahrelang waren diese Meetings abends, wenn die Bibliothek geschlossen war, abgehalten worden, doch dann waren immer weniger Mitglieder zu ihnen erschienen.
Deshalb hatte Porter Wilson, der Präsident der Gesellschaft, die Sitzung auf den Vormittag verlegt. Zumindest bildete er sich ein, für diese Veränderung verantwortlich gewesen zu sein. Denn im Sitzungsprotokoll war vermerkt, dass er den entsprechenden Antrag gestellt hatte, obwohl er sich zu erinnern glaubte, insgeheim dagegen gewesen zu sein.
Und doch, hier waren sie und kamen jetzt schon einige Jahre vormittags zusammen. Die anderen Mitglieder hatten sich mit der neuen Regelung abgefunden, genau wie Wilson. Da sie allem Anschein nach seine eigene Idee gewesen war, blieb ihm auch gar keine andere Wahl.
Der Umstand, dass sich der Vorstand überhaupt damit abgefunden hatte, war ein Wunder. Die letzte Änderung, die sie davor vorgenommen hatten, war der Austausch der abgenutzten Lederbezüge der Lit-and-His-Stühle gewesen, und das war inzwischen dreiundsechzig Jahre her. Mitglieder erinnerten sich noch an Väter und Mütter, gar an Großeltern, die auf unterschiedlichen Seiten dieser Mason-Dixon-Linie in Sachen Polsterung gestanden hatten. Erinnerten sich an giftige Bemerkungen, die zwar nur hinter geschlossenen Türen und vorgehaltener Hand gemacht wurden, aber vor Kindern. Die auch nach dreiundsechzig Jahren diesen unerhörten Wechsel von altem schwarzem Leder zu neuem schwarzem Leder nicht vergessen hatten.
Als Porter Wilson jetzt seinen Stuhl am Kopfende des Tischs hervorzog, stellte er fest, dass er abgenutzt aussah. Damit niemand, am allerwenigsten er selbst, es sehen konnte, setzte er sich schnell.
Vor seinem und jedem anderen Platz lagen penibel ausgerichtete kleine Papierstöße auf dem langen Holztisch. Elizabeth MacWhirters Werk. Er musterte Elizabeth. Unscheinbar, groß und schlank. Zumindest war sie das in ihrer Jugend gewesen. Jetzt sah sie wie gefriergetrocknet aus. Wie diese vorzeitlichen Kadaver, die aus Gletschern geborgen wurden. Immer noch unverkennbar menschlich, aber verwelkt und grau. Ihr Kleid war blau und praktisch, gut geschnitten und vermutlich aus feinstem Material. Schließlich war sie eine MacWhirter. Sprössling einer angesehenen, begüterten Familie. Einer Reederdynastie, die nicht dazu neigte, mit Reichtum – oder Intelligenz – zu protzen. Ihr Bruder hatte das Familienimperium etwa zehn Jahre zu spät verkauft. Aber es war noch Geld da. Elizabeth war ein bisschen langweilig, fand er, aber verantwortungsbewusst. Keine Führerpersönlichkeit, keine Visionärin. Niemand, der eine Gemeinschaft in Bedrängnis zusammenhalten konnte. Wie er. Und sein Vater vor ihm. Und sein Großvater.
Denn die winzige englische Community innerhalb der Altstadt von Quebec City war seit vielen Generationen in Bedrängnis. Es war eine Art von ständiger Bedrängnis, die manchmal nachließ, manchmal zunahm, aber nie vollständig verschwand. Genau wie die Anglos.
Porter Wilson hatte nie in einem Krieg gekämpft. Zuerst war er eine Spur zu jung, dann zu alt gewesen. Zumindest nicht in einem offiziellen Krieg. Ihm und den anderen Vorstandsmitgliedern war jedoch bewusst, dass sie sich trotzdem in einem ständigen Krieg befanden. Noch dazu in einem, den sie verlieren würden, wie er insgeheim fürchtete.
Elizabeth MacWhirter, die an der Tür die anderen Vorstandsmitglieder begrüßte, schaute zu Porter Wilson, der bereits am Kopfende des Tisches saß und seine Notizen überflog.
Er hatte in seinem Leben vieles erreicht, wusste Elizabeth. Der von ihm gegründete Chor, die Theatertruppe, die Räume für das Altersheim. Alles dank seiner Willenskraft und Persönlichkeit. Und alles blieb unbedeutender, als es hätte sein können, hätte er Rat gesucht und beherzigt.
Die Stärke seiner Persönlichkeit war sowohl Segen als auch Fluch. Wie viel mehr hätte er erreichen können, wäre er freundlicher gewesen. Andererseits traten Tatkraft und Freundlichkeit selten gemeinsam in Erscheinung, aber wenn doch, waren sie nicht aufzuhalten.
Porter war aufzuhalten. Er hielt sich sogar selbst auf. Und inzwischen war der Vorstand der Lit and His der einzige, der ihn ertrug. Elizabeth MacWhirter kannte Porter schon seit siebzig Jahren. Seit sie ihn in der Schule jeden Tag hatte allein zu Mittag essen sehen und sich zu ihm gesetzt hatte, um ihm Gesellschaft zu leisten. In dem Glauben, sie wolle sich nur an einen Angehörigen des großen Wilson-Clans heranmachen, strafte sie der junge Porter mit Verachtung.
Trotzdem leistete sie ihm weiter Gesellschaft. Nicht weil sie ihn mochte, sondern weil sie schon damals etwas wusste, was zu lernen Porter Wilson Jahrzehnte brauchen sollte. Die Anglos von Quebec City waren nicht mehr die Fernlaster, die Dampfschiffe, die eleganten Passagierdampfer der Gesellschaft und der Wirtschaft.
Sie waren nur noch ein Rettungsboot. Das steuerlos auf dem Meer trieb. Und mit den anderen Insassen eines solchen Boots legt man sich nicht an.
Elizabeth MacWhirter hatte das früh begriffen. Und wenn Wilson das Boot fast zum Kentern brachte, richtete sie es auf.
Sie musterte Porter Wilson und sah einen kleinen, energiegeladenen Mann mit einem Toupet. Sein Haar, wo nicht importiert, war in einem Schwarz gefärbt, um das ihn die Stühle beneidet hätten. Seine Augen waren braun und zuckten nervös in alle Richtungen.
Als Erster kam Mr. Blake herein. Er war das älteste Vorstandsmitglied und lebte praktisch in der Lit and His. Er legte den Mantel ab, unter dem er seine Uniform trug: grauer Flanellanzug, gebügeltes weißes Hemd, blaue Seidenkrawatte. Er war immer tadellos gekleidet. Ein Gentleman, der es schaffte, dass sich Elizabeth MacWhirter jung und schön fühlte. Sie war verliebt in ihn, seit sie ein schüchterner Teenager und er ein schneidiger Mittzwanziger gewesen war.
Er war damals attraktiv gewesen und war es auch sechzig Jahre später noch, auch wenn sein Haar jetzt dünn und weiß und sein ehemals sportlicher Körper rundlich und schlaff geworden war. Aber seine Augen waren klug und lebendig, sein Herz groß und stark.
»Elizabeth.« Lächelnd ergriff Mr. Blake ihre Hand, um sie kurz zu halten. Nie zu lang, nie zu vertraut. Nur so lang, dass sie wusste, dass sie gehalten worden war.
Er nahm auf seinem Stuhl Platz. Ein Stuhl, der ersetzt werden sollte, fand Elizabeth MacWhirter. Aber ehrlich gesagt galt das auch für Mr. Blake. Und eigentlich für sie alle.
Was würde passieren, wenn sie ausstarben und vom Vorstand der Literary and Historical Society nichts mehr übrig blieb als abgenutzte, leere Stühle?
»Ja, wir müssen uns beeilen. In einer Stunde beginnt unser Training.«
Tom Hancock traf ein, gefolgt von Ken Haslam. Als unwahrscheinliche Teamkollegen in einem grotesken Rennen, das demnächst stattfinden würde, waren die beiden neuerdings fast nur noch zu zweit anzutreffen.
Tom war Elizabeth’ Triumph. Ihre Hoffnung. Und nicht bloß, weil er der Pastor der St. Andrew’s Presbyterian Church nebenan war.
Er war jung und neu in der Gemeinde, erst vor drei Jahren nach Quebec City gezogen. Mit seinen dreiunddreißig Jahren war er etwa halb so alt wie das nächstjüngste Vorstandsmitglied. Noch nicht zynisch, noch nicht ausgelaugt. Er glaubte immer noch, seine Kirche würde neue Mitglieder finden und die englische Community würde plötzlich Babys hervorbringen, die den Wunsch verspürten, in Quebec City zu bleiben. Er glaubte der Regierung von Québec, wenn sie den Anglophonen berufliche Chancengleichheit versprach. Und Gesundheitsversorgung in ihrer eigenen Sprache. Und Bildung. Und Altersheime, in denen, wenn es keine Hoffnung mehr gab und nur noch der Tod auf sie wartete, das Pflegepersonal zumindest ihre Muttersprache verstand.
Es war ihm gelungen, im Vorstand den Glauben zu wecken, dass vielleicht noch nicht alles verloren war. Und vielleicht sogar, dass sie sich eigentlich gar nicht im Krieg befanden. In keiner schrecklichen Fortsetzung der Schlacht auf der Abraham-Ebene, keiner militärischen Auseinandersetzung, die diesmal die Engländer verlieren würden. Elizabeth schaute zu der seltsam zierlichen Statue von General James Wolfe hinauf. Der Märtyrerheld der zweihundertfünfzig Jahre zurückliegenden Schlacht schwebte über der Bibliothek der Literary and Historical Society wie ein hölzerner Vorwurf. Um ihre trivialen Scharmützel zu beobachten und sie fortwährend an die wichtige Schlacht zu erinnern, die er für sie geschlagen hatte. Bei der er gestorben war, allerdings nicht ohne vorher auf diesem blutgetränkten Acker den Sieg davonzutragen, den Krieg zu beenden und Québec für die Engländer zu erobern. Auf dem Papier.
Und jetzt blickte General Wolfe aus seiner Ecke in der wunderschönen alten Bibliothek auf sie herab. In jeder Hinsicht, vermutete Elizabeth MacWhirter.
»Und, Ken?« Tom Hancock nahm neben dem älteren Mann Platz. »Wie sieht’s aus? Bereit für das Rennen?«
Ken Haslams Antwort war nicht zu hören. Damit hatte Elizabeth MacWhirter auch nicht gerechnet. Zwar bewegten sich Haslams schmale Lippen, aber die Worte, die sie formten, waren nie wirklich zu hören.
Alle hielten inne, in der Hoffnung, dass vielleicht endlich der Moment gekommen wäre, in dem er ein Wort hervorbrachte, das mehr war als ein Wispern. Aber sie täuschten sich. Trotzdem redete Tom Hancock weiter auf Ken Haslam ein, als führten sie tatsächlich ein Gespräch.
Auch deswegen mochte Elizabeth MacWhirter den jungen Geistlichen. Weil er nicht der Versuchung erlag, Ken für dumm zu halten, weil er so still war. Sie wusste, dass er alles andere war als das. Inzwischen Mitte sechzig, war er der Erfolgreichste von ihnen allen und hatte eine eigene Firma aufgebaut. Doch damit nicht genug, hatte Ken Haslam noch etwas anderes Bemerkenswertes getan.
Er hatte sich für das berüchtigte Eiskanurennen angemeldet. Als Mitglied von Tom Hancocks Team. Damit war er nicht nur das älteste Mitglied seines, sondern aller Teams. Vielleicht sogar der Älteste, der jemals an dem Rennen teilgenommen hatte.
Als Elizabeth MacWhirter jetzt Ken Haslam, still und ruhig, und Tom Hancock, jung, vital und attraktiv, betrachtete, fragte sie sich, ob die zwei Männer vielleicht mehr Gemeinsamkeiten hatten, als es schien. Vielleicht gab es in beider Leben Dinge, über die sie nicht sprachen.
Nicht zum ersten Mal machte sich Elizabeth MacWhirter Gedanken über Tom Hancock. Warum er sich dafür entschieden hatte, ihr Pastor zu werden, und warum er innerhalb der Stadtmauern der Altstadt von Quebec City blieb. Man musste speziell gestrickt sein, um sich für ein Leben in einer regelrechten Festung zu entscheiden.
»Gut, fangen wir an«, sagte Porter Wilson und setzte sich noch aufrechter.
»Winnie ist noch nicht da«, sagte Elizabeth MacWhirter.
»Wir können nicht länger warten.«
»Warum nicht?«, fragte Tom Hancock ohne jeden Vorwurf. Trotzdem hörte Wilson einen heraus.
»Weil es schon nach halb elf ist und du derjenige bist, der zur Eile gedrängt hat«, sagte Wilson, zufrieden, dass dieser Punkt an ihn ging.
Wieder einmal schaffte es Porter, dachte Elizabeth MacWhirter, einen Freund anzuschauen und einen Feind zu sehen.
»Das ist durchaus richtig. Trotzdem habe ich nichts dagegen zu warten«, erwiderte Tom Hancock lächelnd. Er war nicht bereit, sich auf eine Auseinandersetzung einzulassen.
»Ich schon. Der erste Punkt der Tagesordnung?«
Sie berieten eine Weile über den Kauf neuer Bücher, bevor Winnie eintraf. Klein und energisch, war sie unerschütterlich loyal. Gegenüber der englischen Community, gegenüber der Lit and His, aber vor allem gegenüber ihrer Freundin Elizabeth.
Sie kam hereingerauscht, bedachte Porter Wilson mit einem vernichtenden Blick und setzte sich neben Elizabeth MacWhirter.
»Wie ich sehe, hast du ohne mich angefangen«, sagte sie, an ihn gewandt. »Ich habe dir doch gesagt, dass es bei mir etwas später wird.«
»Hast du. Was aber nicht heißt, dass wir hätten warten müssen. Wir sprechen gerade über die neuen Bücher, die wir kaufen wollen.«
»Und auf die Idee, dass man darüber am besten mit der Bibliothekarin sprechen sollte, bist du nicht gekommen?«
»Jetzt bist du ja hier.«
Der Rest der Anwesenden verfolgte den Wortwechsel wie ein Match in Wimbledon, wenngleich mit merklich weniger Interesse. Es war ziemlich klar, wer am Drücker war und wer gewinnen würde.
Fünfzig Minuten später hatten sie fast alle Tagesordnungspunkte abgehakt. Es war noch ein Haferkeks übrig, und alle Anwesenden starrten ihn an, waren aber zu höflich, ihn zu nehmen. Sie hatten über die Heizkosten gesprochen, über eine Veranstaltung, um neue Mitglieder anzuwerben, über die schäbigen alten Schmöker, die ihnen in Testamenten anstelle von Geld hinterlassen wurden. Die Bücher enthielten in der Regel Predigten oder grauenhafte viktorianische Lyrik oder langweilige Berichte über Fahrten auf dem Amazonas oder Reisen durch Afrika, um irgendwelche armen wilden Tiere zu schießen und auszustopfen.
Sie berieten, ob sie einen weiteren Bücherbasar veranstalten sollten, aber angesichts des jüngsten Debakels fiel diese Diskussion sehr kurz aus.
Elizabeth MacWhirter machte sich Notizen und musste sich zwingen, die Kommentare der einzelnen Mitglieder nicht stumm nachzuäffen. Es war eine Liturgie. Vertraut und seltsam tröstlich. Die gleichen Worte, bei jeder Sitzung immer aufs Neue wiederholt. Immer und immer wieder. Amen.
Plötzlich unterbrach ein Geräusch die einlullende Liturgie, ein Geräusch, so ungewöhnlich und erschreckend, dass Porter Wilson fast von seinem Stuhl aufsprang.
»Was war das?«, hauchte Ken Haslam. Für seine Verhältnisse war es fast ein Schrei.
»Die Türglocke, glaube ich«, sagte Winnie.
»Die Türglocke?«, fragte Wilson. »Ich wusste gar nicht, dass wir eine haben.«
»1897 eingebaut, nachdem der Lieutenant Governor zu Besuch kam und nicht eingelassen wurde«, sagte Mr. Blake, als wäre er dabei gewesen. »Hab sie nie selbst gehört.«
Doch da hörte er sie wieder. Ein langes, schrilles Läuten. Sobald alle eingetroffen waren, hatte Elizabeth die Eingangstür der Literary and Historical Society abgeschlossen. Um nicht gestört zu werden. Doch da kaum einmal jemand zu Besuch kam, war es mehr Gewohnheit als Notwendigkeit. Außerdem hatte sie einen Zettel an die massive Holztür gehängt. Wegen einer Vorstandssitzung öffnet die Bibliothek erst mittags wieder. Danke. Merci.
Die Glocke ertönte erneut. Inzwischen nahm der Besucher den Finger gar nicht mehr vom Klingelknopf.
Immer noch schauten sie einander fragend an.
»Ich geh nachsehen«, sagte Elizabeth MacWhirter.
Porter Wilson blickte auf seine Unterlagen hinab. Nur nichts überstürzen.
»Nein.« Winnie stand auf. »Ich geh. Bleib du nur.«
Sie sahen Winnie hinterher, als sie auf den Flur hinausging, hörten ihre Schritte auf der Holztreppe. Dann trat Stille ein. Nach einer Weile kamen ihre Schritte zurück.
Sie lauschten dem näherkommenden Klacken ihrer Absätze. Winnies Gesicht war blass und ernst, als sie in der Tür erschien.
»Da ist jemand. Jemand, der mit dem Vorstand sprechen will.«
»Und?«, fragte Wilson, dem wieder einfiel, dass eigentlich er den Vorsitz hatte, nachdem die nicht mehr ganz junge Frau nachsehen gegangen war. »Wer ist es?«
»Augustin Renaud«, antwortete sie und sah die Gesichter, die sie machten. Hätte sie »Dracula« gesagt, hätten sie nicht bestürzter sein können. Im Fall der Engländer äußerte sich »bestürzt« allerdings nur in hochgezogenen Augenbrauen.
Jede Braue im Raum war hochgezogen. Selbst General Wolfe hätte ein erstauntes Gesicht gemacht, wäre er dazu in der Lage gewesen.
»Ich habe ihn nicht hereingelassen«, sagte sie in die Stille hinein.
Wie um das zu unterstreichen, ertönte die Türglocke wieder.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Winnie, doch statt sich an Porter Wilson zu wenden, sah sie Elizabeth MacWhirter an. Das taten auch die anderen.
»Wir stimmen ab«, sagte Elizabeth MacWhirter schließlich. »Sollen wir ihn hereinlassen?«
»Er steht nicht auf der Tagesordnung«, führte Mr. Blake an.
»Richtig«, sagte Porter Wilson in dem Bemühen, die Kontrolle wieder an sich zu reißen. Aber selbst er sah Elizabeth MacWhirter an.
»Wer ist dafür, Augustin Renaud zum Vorstand sprechen zu lassen?«, fragte sie.
Nicht eine Hand wurde gehoben.
Ohne die Entscheidung im Protokoll zu vermerken, ließ Elizabeth MacWhirter ihren Stift sinken und stand mit einem knappen Nicken auf. »Ich werde es ihm sagen.«
»Ich komme mit«, sagte Winnie.
»Nein, meine Liebe, du bleibst hier. Ich bin gleich wieder zurück.« Sie blieb in der Tür stehen und ließ den Blick über die Anwesenden und General Wolfe streifen. »Ich bitte euch. Was soll schon so schlimm daran sein?«
Aber die Antwort darauf wussten alle. Wenn Augustin Renaud auftauchte, hieß das nie etwas Gutes.
2
Armand Gamache machte es sich auf dem abgenutzten Ledersofa unter der Büste von General Wolfe bequem. Er nickte dem alten Mann ihm gegenüber zu und zog die Briefe aus seiner Umhängetasche. Nach dem Stadtspaziergang mit Émile und Henri war er nach Hause gegangen, um seine Post und seine Notizen zu holen. Er hatte alles in seine Tasche gepackt und sich mit Henri erneut auf den Weg gemacht.
In die totenstille Bibliothek der Literary and Historical Society.
Dort blickte er jetzt auf den dicken braunen Umschlag, der neben ihm auf dem Sofa lag. Die Briefe aus seinem Büro in Montréal, die an Émiles Adresse weitergeleitet worden waren. Agent Isabelle Lacoste hatte seine Post durchgesehen und eine Nachricht beigefügt.
Cher Patron,
es war gut, neulich mit Ihnen zu sprechen. Ich beneide Sie um die paar Wochen in Québec. Ich liege meinem Mann ständig in den Ohren, dass wir mit den Kindern zum Carnaval fahren sollten, aber er findet, sie sind noch zu klein dafür. Wahrscheinlich hat er recht. In Wirklichkeit möchte ich einfach gern selbst hin.
Die Vernehmung des Verdächtigen (ganz schön schwer, ihn so zu nennen, wo wir doch alle wissen, dass es keinerlei Verdacht gibt, nur Gewissheit) geht weiter. Ich habe nicht gehört, was er, wenn überhaupt etwas, gesagt hat. Wie Sie wissen, wurde eine Royal Commission eingesetzt. Haben Sie schon vor ihr ausgesagt? Ich habe meine Vorladung heute erhalten. Ich bin nicht sicher, was ich ihnen erzählen soll.
Gamache ließ den Zettel kurz sinken. Agent Lacoste würde ihnen natürlich die Wahrheit erzählen. Wie sie sich für sie darstellte. Anders konnte sie aufgrund ihres Wesens und ihrer Ausbildung gar nicht. Vor seiner Abreise hatte er alle in seiner Abteilung angewiesen zu kooperieren.
Wie das auch er getan hatte.
Er wandte sich wieder der Nachricht zu.
Noch weiß niemand, wohin das alles führen oder wo es enden wird. Aber es wird alles Mögliche gemunkelt. Die Stimmung ist angespannt.
Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Isabelle Lacoste
Schwer geworden sank der Brief langsam in seinen Schoß. Er starrte geradeaus vor sich hin und sah Bilder von Agent Isabelle Lacoste, die ungebeten in seinem Bewusstsein aufblitzten. Wie sie sich über ihn beugte und auf ihn einzuschreien schien, obwohl er kein Wort hören konnte. Er spürte, wie sie mit ihren kleinen, kräftigen Händen seinen Kopf packte, sah, wie ihr Gesicht näher kam, wie ihr Mund sich bewegte, wie sie ihm mit eindringlichen Blicken etwas zu vermitteln versuchte. Spürte Hände, die ihm die Schutzweste vom Leib rissen. Sah das Blut an ihren Händen, sah ihren Gesichtsausdruck.
Dann sah er sie wieder.
Beim Begräbnis. Den Begräbnissen. In Uniform und in Reih und Glied mit dem Rest der berühmten Mordkommission der Sûreté du Québec. Und er, wie er seinen Platz an der Spitze des Trauerzugs einnahm. Was für ein bitterkalter Tag. Um diejenigen zu Grabe zu tragen, die in dieser verlassenen Fabrik unter seinem Kommando gestorben waren.
Er schloss die Augen und atmete tief ein, roch den Hauch von Moschus in der Luft der Bibliothek. Den Geruch von Alter und Beständigkeit, von Ruhe und Frieden. Von altmodischer Möbelpolitur, von Holz, von in abgegriffenem Leder gebundenen Wörtern. Er roch, ganz schwach nur, seinen eigenen Duft. Rosenwasser und Sandelholz.
Und er dachte an etwas Schönes, etwas Erfreuliches, an eine Art sicheren Hafen. Und fand ihn in Reine-Marie, erinnerte sich an ihre Stimme, die er am Morgen durchs Handy gehört hatte. Gutgelaunt. Zu Hause. In Sicherheit. Ihre Tochter Annie würde mit ihrem Mann zum Abendessen vorbeikommen. Einkäufe mussten erledigt, Blumen gegossen und E-Mails beantwortet werden.
Er konnte sie vor sich sehen, wie sie in ihrer Wohnung in Outremont beim Telefonieren am Regal stand, das sonnige Zimmer voller Bücher und Zeitschriften und bequemer Möbel, aufgeräumt und friedlich.
Das alles strahlte, wie auch Reine-Marie, eine gewisse Ruhe aus.
Und er spürte, wie sein rasender Puls langsamer, sein Atem ruhiger wurde. Mit einem letzten langen Atemzug schlug er die Augen auf.
»Möchte Ihr Hund etwas Wasser?«
»Wie bitte?« Gamache, der erst in die Gegenwart zurückfinden musste, sah den alten Mann, der ihm gegenübersaß, auf Henri deuten.
»Ich habe meinen Seamus auch immer hierher mitgenommen. Er hat zu meinen Füßen gelegen, während ich gelesen habe. Wie Ihr Hund. Wie heißt er?«
»Henri.«
Vom Klang seines Namens plötzlich hellwach, setzte sich der junge Schäferhund auf. Seine großen Ohren schlackerten hin und her, wie Satellitenschüsseln, die ein Signal aufzufangen versuchten.
»Bitte, Monsieur«, sagte Gamache mit einem Lächeln, »sagen Sie bloß nicht B-A-L-L, sonst ist alles zu spät.«
Sein Gegenüber lachte. »Seamus ist immer völlig aus dem Häuschen geraten, wenn ich B-U-C-H gesagt habe. Dann wusste er, dass wir hierherkommen. Ich glaube, ihm hat es hier noch besser gefallen als mir.«
Gamache kam nun schon fast eine Woche täglich in die Bibliothek und hatte mit Ausnahme der geflüsterten Unterhaltungen, die er mit der alten Bibliothekarin auf der Suche nach Büchern über die Schlacht auf der Abraham-Ebene geführt hatte, mit niemand gesprochen.
Er empfand es als Erleichterung, nichts sagen und nichts erklären zu müssen, nicht das Gefühl vermittelt zu bekommen, dass eine Erklärung gewünscht oder verlangt wurde. Das käme noch früh genug auf ihn zu. Erst einmal hatte er sich nach Frieden gesehnt und ihn in dieser kaum bekannten Bibliothek gefunden.
Obwohl er seinen Mentor seit Jahren regelmäßig besucht hatte und zu der Überzeugung gelangt war, das alte Québec bestens zu kennen, war er nie in diesem Gebäude gewesen. Hatte es unter all den schönen Wohnhäusern und Kirchen, Klöstern, Schulen, Hotels und Restaurants nicht einmal bemerkt.
Doch hier, ein Stück die Rue Saint-Stanislas hinauf, wo Émiles altes Steinhaus stand, hatte Gamache inmitten der Bücher einer alten englischen Bibliothek einen Zufluchtsort gefunden. Wo auch sonst?
»Möchte er Wasser?«, fragte der alte Mann noch einmal. Er schien helfen zu wollen, und obwohl Gamache nicht glaubte, dass Henri etwas brauchte, sagte er: »Ja, bitte.« Gemeinsam verließen sie die Bibliothek und gingen den holzvertäfelten Flur hinunter, vorbei an den Porträts ehemaliger Präsidenten der Literary and Historical Society. Es war, als wäre der alte Bau mit seiner eigenen Geschichte überkrustet.
Das verlieh ihm etwas Ruhiges, Beständiges. Obwohl das für den Großteil der Altstadt innerhalb der dicken Stadtmauern von Quebec City galt. Der einzigen Stadt Nordamerikas, die befestigt war, vor Angriffen geschützt.
In der jetzigen Zeit hatte das eher symbolische Bedeutung als praktische Gründe, aber Gamache wusste, dass Symbole mindestens ebenso viel bewirken konnten wie Bomben. Denn Männer und Frauen schieden dahin und Städte fielen, aber Symbole hatten Bestand und konnten sogar an Bedeutung gewinnen.
Symbole waren unsterblich.
Der alte Mann goss Wasser in eine Schüssel, und Gamache trug sie in die Bibliothek zurück und stellte sie auf ein Handtuch, damit kein Wasser auf die breiten dunklen Holzdielen kam. Henri zeigte natürlich kein Interesse.
Die beiden Männer setzten sich wieder. Gamache stellte fest, dass der Mann ein dickes Fachbuch über Gartenbau las. Er selbst wandte sich wieder seinen Briefen zu. Eine Auswahl von Schreiben, von denen Isabelle Lacoste dachte, sie könnten ihn interessieren. Die meisten von mitfühlenden Kollegen aus aller Welt, andere von Bürgern, die ihm ebenfalls ihre Empfindungen mitteilen wollten. Er las sie alle, beantwortete sie alle, war aber froh, dass ihm Agent Lacoste nur eine Auswahl geschickt hatte.
Ganz zum Schluss las er den Brief, von dem er bereits wusste, dass er dabei sein würde. Das war er immer. Jeden Tag. In einer inzwischen vertrauten Handschrift, hingeworfen, fast unleserlich, aber Gamache hatte sich an das Gekritzel gewöhnt und konnte es inzwischen entziffern.
Cher Armand,
diese Worte kommen mit meinen Gedanken und Gebeten, dass es Ihnen besser geht. Wir sprechen oft von Ihnen und hoffen, dass Sie uns besuchen kommen. Ruth sagt, Sie sollen Reine-Marie mitbringen, weil sie Sie eigentlich nicht leiden kann. Aber sie hat mich gebeten, Ihnen hallo zu sagen und dass Sie ihr vom Hals bleiben sollen.
Gamache musste grinsen. Das war noch eins der freundlicheren Dinge, die Ruth Zardo zu Menschen sagte. Fast liebevoll. Fast.
Allerdings habe ich auch eine Frage. Warum sollte Olivier die Leiche woandershin schaffen? Das ergibt keinen Sinn. Er hat es nicht getan.
Herzlich
Gabri
Wie immer hatte Gabri eine Lakritzpfeife beigelegt. Gamache nahm sie aus dem Umschlag, und nach kurzem Zögern bot er sie seinem Gegenüber an.
»Lakritze?«
Der Mann blickte zu Gamache auf, dann auf die schwarze Pfeife hinab.
»Sie bieten einem Fremden Süßigkeiten an? Da muss ich doch hoffentlich nicht die Polizei rufen.«
Gamache spürte, wie sich alles in ihm zusammenzog. Hatte ihn der Mann erkannt? War das eine versteckte Botschaft? Aber die blassblauen Augen des Mannes waren vollkommen arglos, und er lächelte. Er griff nach der Pfeife, brach sie mittendurch und gab Gamache das größere Stück zurück. Das Stück mit der Zuckerflamme, das größte und beste Stück.
»Merci, vous êtes très gentil.« Danke, sehr freundlich von Ihnen, sagte der Mann.
»C’est moi qui vous remercie.« Ich habe zu danken, erwiderte Gamache. Es war ein üblicher, aber deswegen keineswegs unaufrichtiger Wortwechsel zwischen dankbaren Menschen. Der Mann hatte perfektes, gebildetes, kultiviertes Französisch gesprochen. Vielleicht mit einem leichten Akzent, aber Gamache wusste, dass das möglicherweise ein Vorurteil seinerseits war, weil er den Mann als englischsprachig erkannt hatte, während er selbst frankophon war.
Sie aßen die Süßigkeit und lasen ihre Bücher. Henri machte es sich bequem, und um halb vier machte Winnie, die Bibliothekarin, das Licht an. Über der Altstadt und der alten Bibliothek innerhalb ihrer mächtigen Mauern ging bereits die Sonne unter.
Gamache fühlte sich an eine Matrjoschka-Puppe erinnert. Das äußerste Gesicht war das von Nordamerika, und dahinter befand sich das von Kanada und dahinter Québec. Und hinter Québec? Eine noch kleinere Gemeinschaft, die kleine englische Community. Und dahinter?
Dieser Ort. Die Literary and Historical Society. Die neben der Community auch alle ihre Aufzeichnungen, Gedanken, Erinnerungen und Symbole in sich barg. Gamache musste nicht zu der Figur über ihm hinaufschauen, um zu wissen, wen sie darstellte. Dieses Gebäude barg ihre Führer, ihre Sprache, ihre Kultur und ihre Errungenschaften. Von der frankophonen Mehrheit außerhalb seiner Mauern längst vergessen oder erst gar nicht wahrgenommen, aber hier am Leben gehalten.
Es war ein außergewöhnlicher Ort, von dessen Existenz kaum ein Frankokanadier wusste. Als er Émile davon erzählte, hatte es sein alter Freund zunächst für einen Witz, eine Erfindung, gehalten, und das, obwohl er nur zwei Straßen weiter wohnte.
Ja, es war wie eine Matrjoschka. Unter jeder Puppe eine kleinere, bis ganz drinnen dieses Kleinod zum Vorschein kam. Aber nistete es dort oder verbarg es sich nur?
Gamache beobachtete Winnie, wie sie in der Bibliothek mit ihren deckenhohen Bücherregalen und den indianischen Teppichen auf dem Parkett herumging, vorbei an dem langen Holztisch und der Sitzgruppe. Letztere bestand aus zwei Ledersesseln und dem abgenutzten Ledersofa, auf dem Gamache saß, seine Briefe und seine Bücher auf dem Couchtisch. Bogenfenster durchbrachen die Bücherregale und durchfluteten den Raum mit Licht, wenn es welches gab, das sie hereinlassen konnten. Aber das auffallendste Element der Bibliothek war der geschwungene Balkon über ihnen. Man erreichte ihn und die bis an die Stuckdecke reichende zweite Etage mit ihren Bücherregalen über eine gusseiserne Wendeltreppe.
Der Raum war voll von Büchern. Von Licht. Von Frieden.
Gamache konnte nicht fassen, dass er nie etwas von der Existenz dieses Orts gewusst hatte. Er war eines Tages eher zufällig darauf gestoßen, als er einen Spaziergang machte, um die Bilder aus seinem Kopf zu vertreiben. Aber schlimmer noch als die kurz aufblitzenden, ungebetenen Bilder waren die Geräusche. Die Schüsse und das unter dem Kugelhagel berstende Holz und Mauerwerk. Die lauten Rufe, dann die Schmerzensschreie.
Aber lauter als all das war die ruhige, vertrauensvolle junge Stimme in seinem Kopf.
»Ich glaube Ihnen, Sir.«
Armand und Henri verließen die Bibliothek und brachen zu ihrer Einkaufsrunde auf, kauften bei J.A. Moisan verschiedene Rohmilchkäse, Pâté und Lammfleisch, in dem Lebensmittelladen gegenüber Obst und Gemüse und in der Bäckerei Paillard in der Rue Saint-Jean ein frisches, warmes Baguette. Da er vor Émile nach Hause kam, legte er frische Scheite auf das Feuer, um das kalte Haus zu wärmen. Es war 1752 erbaut worden, und wenn seine Steinmauern auch einen Meter dick waren und problemlos einer Kanonenkugel standgehalten hätten, waren sie dem Winterwind doch wehrlos ausgeliefert.
Während Armand das Essen zubereitete, wurde es wärmer im Haus, und als Émile eintraf, war es wohlig warm und vom Duft von Rosmarin, Knoblauch und Lammfleisch erfüllt.
»Salut«, rief Émile von der Eingangstür. Kurz darauf erschien er mit einer Flasche Rotwein in der Küche und griff nach dem Korkenzieher. »Mmh, riecht ja schon köstlich.«
Gamache trug das Tablett mit Baguette, Käse und Pâté ins Wohnzimmer und stellte es auf den Tisch am Feuer. Émile brachte den Wein.
»Santé.«
Die zwei Männer saßen mit Blick auf den Kamin und prosteten sich zu. Als beide etwas zu essen hatten, sprachen sie über den Verlauf ihres Tages. Émile erzählte von seinem Mittagessen mit Freunden in der Bar des Château Frontenac und den Recherchen, die er für die Société Champlain anstellte. Gamache berichtete von den stillen Stunden in der Bibliothek.
»Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?« Émile nahm einen Bissen Wildschweinpâté.
Gamache schüttelte den Kopf. »Aber es muss dort irgendwo sein. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Wir wissen, dass die französischen Truppen 1759 allenfalls eine halbe Meile von hier entfernt auf die Engländer gewartet haben.«
Es war die Schlacht, die jedes Quebecer Schulkind im Unterricht durchnahm und in der Phantasie mit hölzernen Musketen und imaginären Pferden immer wieder neu austrug. Die schreckliche Schlacht, die das Schicksal der Stadt, der Region, des Landes und des Kontinents entscheiden sollte. Die Schlacht auf der Abraham-Ebene, auch Battle of Quebec genannt, die 1759 den Siebenjährigen Krieg ein für alle Mal beendete. Welche Ironie, dass nach den jahrelangen erbitterten Kämpfen, die Franzosen und Engländer um die Herrschaft über Neufrankreich geführt hatten, die Entscheidungsschlacht so kurz war. Aber brutal.
Während Gamache sprach, stellten sich beide Männer die Szenerie vor. Ein kalter Septembertag, die Truppen unter Général Montcalm eine Mischung aus französischen Eliteeinheiten und Quebecern, die mehr Erfahrung mit Guerillataktiken als mit konventioneller Kriegführung hatten. Die Franzosen wollten unbedingt die Belagerung Québecs aufheben, wo fürchterlicher Hunger herrschte. Mehr als fünfzehntausend Kanonenkugeln waren auf die kleine Stadt niedergegangen, und jetzt, kurz vor Wintereinbruch, musste dem Ganzen ein Ende gemacht werden, wenn nicht alle den Tod finden sollten. Männer, Frauen, Kinder. Krankenschwestern, Nonnen, Zimmerleute, Lehrer. Alle würden sterben.
Général Montcalm und sein Heer wollten aufs Ganze gehen und es in einer ruhmreichen Schlacht mit den starken englischen Truppen aufnehmen.
Montcalm, ein tapferer, erfahrener Soldat, ein Befehlshaber, der immer an vorderster Front stand und mit gutem Beispiel voranging. Für seine Männer ein Held.
Und sein Gegner? Ein ebenso fähiger und tapferer Kommandant, General Wolfe.
Québec war an einer Engstelle des Flusses auf einem Felsvorsprung erbaut worden. Das war ein gewaltiger strategischer Vorteil. Kein Feind konnte die Stadt direkt angreifen, dazu hätte er die steilen Felswände erklimmen müssen, und das war unmöglich.
Aber ein Stück flussaufwärts konnten sie angreifen, und dort wartete Montcalm. Es gab jedoch noch eine andere Möglichkeit, ein nur geringfügig weiter entferntes Areal. Dorthin schickte Montcalm, ganz der gewiefte Feldherr, einen seiner besten Männer, seinen Aide-de-camp, Colonel Bougainville.
Und so legte er sich Mitte September 1759 auf die Lauer.
Doch Montcalm hatte einen Fehler gemacht. Einen verhängnisvollen Fehler. Sogar mehrere, wie Armand Gamache, Student der Geschichte Québecs, zu beweisen entschlossen war.
»Eine hochinteressante Theorie, Armand«, sagte Émile. »Und du glaubst, der Schlüssel dafür ist in dieser kleinen Bibliothek zu finden? In einer englischen Bibliothek?«
»Wo sonst?«
Émile Comeau nickte. Er war erleichtert, dass sein Freund Interesse für etwas zeigte. Als Armand und Reine-Marie eine Woche zuvor zu ihm gekommen waren, hatte Émile einen Tag gebraucht, um sich an Gamaches Veränderungen zu gewöhnen. Und sie betrafen nicht nur den Vollbart und die Narben. Er wirkte auch gedrückt, niedergeschlagen, schien schwer unter den Vorfällen der jüngsten Vergangenheit zu leiden. Auch jetzt beschäftigte sich Gamache mit der Vergangenheit, aber wenigstens mit der eines anderen, nicht mit der eigenen. »Bist du schon dazu gekommen, deine Post zu lesen?«
»Ja, und ein paar Briefe habe ich sogar schon beantwortet.« Gamache holte das Bündel hervor. Nach kurzem Zögern rang er sich dazu durch, einen Brief herauszunehmen. »Würdest du den bitte mal lesen.«
Émile nahm einen Schluck von seinem Wein und begann zu lesen. Dann lachte er und gab Gamache den Brief zurück.
»Diese Ruth scheint wirklich einen Narren an dir gefressen zu haben.«
»Sie würde mir an den Zöpfen ziehen, hätte ich welche«, sagte Gamache grinsend. »Wenn mich nicht alles täuscht, kennst du sie sogar.« Und er zitierte:
»Wer kränkte dich einst
so über alle Maßen,
dass du jedem Annäherungsversuch
mit verächtlich gekräuselten Lippen begegnest?«
»Diese Ruth?«, sagte Émile. »Ruth Zardo? Die Dichterin?« Und dann sprach er das erstaunliche Gedicht zu Ende, das Werk, das inzwischen in Schulen ganz Québecs durchgenommen wurde.
»Indes wir, die gut dich kannten,
deine Freunde (und Gegenstand deiner Verachtung),
sehen konnten, deinen Mut im Angesicht der Furcht,
deinen Scharfsinn, deine Umsicht
und uns an dich erinnern werden
mit etwas, was an Liebe grenzt.«
Die zwei Männer schwiegen eine Weile, blickten in das prasselnde Feuer, jeder in seine eigenen Gedanken versunken. Über Liebe und Verlust und nicht mehr wiedergutzumachende Schäden.
»Ich dachte, sie wäre längst tot«, sagte Émile schließlich und bestrich das knusprige Brot mit Pâté.
Gamache lachte. »Gabri hat sie Reine-Marie vorgestellt, wie etwas, das sie beim Ausheben des Kellers gefunden haben.«
Émile griff erneut nach dem Brief. »Wer ist dieser Gabri? Ein Freund?«
Gamache zögerte. »Ja. Er wohnt in diesem kleinen Dorf, von dem ich dir erzählt habe. Three Pines.«
»Ich erinnere mich, dass du ein paarmal dort warst. Wegen irgendwelcher Mordermittlungen. Ich habe das Dorf mal auf der Landkarte gesucht. Südlich von Montréal, hast du gesagt. An der Grenze zu Vermont?«
»Ja.«
»Dann muss ich wohl blind gewesen sein«, fuhr Émile fort, »denn ich habe es nicht gefunden.«
Gamache nickte. »Anscheinend haben die Kartographen Three Pines übersehen.«
»Wie findet es dann überhaupt jemand?«
»Keine Ahnung. Vielleicht taucht es plötzlich vor einem auf.«
»Ich war blind, doch jetzt bin ich sehend«, zitierte Émile. »Nur sichtbar für einen Halunken wie dich?«
Gamache lachte. »Der beste Café au Lait und die besten Croissants von ganz Québec. Ich Halunke kann mich glücklich schätzen.« Er stand noch einmal auf und legte einen weiteren Packen Briefe auf den Couchtisch. »Diese hier wollte ich dir auch zeigen.«
Émile las sie, während Gamache seinen Wein trank und Käse und Baguette aß. Er fühlte sich wie zu Hause in diesem Zimmer, das so vertraut und gemütlich war wie sein eigenes.
»Alle von diesem Gabri«, sagte Émile schließlich und tätschelte den Packen Briefe neben sich. »Wie oft schreibt er dir?«
»Jeden Tag.«
»Jeden Tag? Ist er von dir besessen? Eine Bedrohung?« Émile beugte sich vor, sein Blick plötzlich scharf, ohne jede Spur von Humor.
»Nein, nein, keine Angst. Er ist ein Freund.«
»Warum sollte Olivier die Leiche woandershin schaffen?«, las Émile aus einem der Briefe. »Es ergibt keinen Sinn. Er hat es nicht getan. Er schreibt in jedem Brief das Gleiche.« Émile nahm ein paar weitere und überflog sie. »Was meint er damit?«
»Es geht um einen Fall, in dem ich vergangenen Herbst ermittelt habe, am Labor-Day-Wochenende. In Oliviers Bistro in Three Pines wurde eine Leiche gefunden. Das Opfer hatte einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Er war tödlich.«
»Nur einen?«
Seinem Mentor war die Bedeutung dieses Details sofort aufgefallen. Ein einziger tödlicher Schlag. Das kam äußerst selten vor. Wenn eine Person erschlagen wurde, bekam sie meist mehrere Schläge ab. Normalerweise geriet der Mörder in Wut und schlug immer weiter auf sein Opfer ein. Es blieb fast nie bei einem einzigen Schlag, fest genug, um tödlich zu sein. Jemand hatte also genügend Wut für einen brutalen Schlag gehabt, aber auch genügend Selbstbeherrschung, um es bei diesem einen zu belassen. Eine beängstigende Kombination.
»Das Opfer hatte keinen Ausweis einstecken, aber dann haben wir versteckt im Wald eine Hütte gefunden. Dort hat er gelebt, und dort ist er ermordet worden. Du hättest sehen sollen, was wir da alles gefunden haben, Émile.«
Comeau hatte eine blühende Phantasie, gespeist von Jahrzehnten grausiger Funde. Er wartete darauf, dass Gamache ihm das Grauen in der Hütte beschrieb.
»Die reinste Schatzkammer.«
»Schatzkammer?«
»Ja.« Gamache lächelte, als er Émiles Gesicht sah. »Damit haben wir auch nicht gerechnet. Es war unglaublich. Sie war voller Antiquitäten und Kunstgegenstände. Dinge von unschätzbarem Wert.«
Jetzt hatte er die uneingeschränkte Aufmerksamkeit seines Mentors. Die schlanken Hände ineinander verschränkt, saß Émile vornübergebeugt da, entspannt und aufmerksam. Einmal ein Jäger von Mördern, immer einer. Und einer, der Blut riechen konnte. Alles, was Gamache über Morde wusste, hatte er von diesem Mann gelernt. Und noch einiges mehr.
»Ich höre«, sagte Comeau.
»Signierte Erstausgaben, alte Keramiken, Kristallgläser. Tausende Jahre alt. Ein Paneel aus dem Bernsteinzimmer und Geschirr, das einmal Katharina der Großen gehört hat.«
Und eine Geige. Von einem Moment auf den nächsten war Gamache wieder in dieser Hütte und sah Agent Paul Morin vor sich. Wie er schlaksig, unsicher, jung nach der Geige griff, sie unter sein Kinn klemmte, sich in sie hineinlehnte. Und mit einem Mal ergab sein Körper einen Sinn, als ob er dafür gemacht war, dieses Instrument zu spielen. Er füllte die urige Blockhütte mit dem schönsten, zu Herzen gehendsten keltischen Klagelied.
»Armand?«
»Entschuldigung.« Gamache kehrte in das Steinhaus in Quebec City zurück. »Ich musste gerade an was denken.«
Sein Mentor sah ihn forschend an. »Alles in Ordnung?«
Gamache nickte und lächelte. »An eine Melodie.«
»Habt ihr herausgefunden, wer diesen Einsiedler umgebracht hat?«
»Ja, haben wir. Die Beweislast war erdrückend. Wir haben die Tatwaffe und andere Gegenstände aus der Hütte im Bistro gefunden.«
»War dieser Olivier der Mörder?« Émile hob die Briefe hoch, und Gamache nickte.
»Niemand konnte es so richtig glauben, ich auch nicht, aber es war so.«
Émile betrachtete seinen Gast. Er kannte Armand gut. »Du mochtest ihn, diesen Olivier?«
»Er war ein Freund. Ist ein Freund.«
Gamache erinnerte sich, wie er in dem lauten Bistro gesessen hatte und in seinen Händen den Beweis hielt, der seinem Freund zum Verhängnis wurde. Die erschreckende Einsicht, dass Olivier tatsächlich der Mörder war. Er hatte die Schätze des Mannes aus der Blockhütte geraubt. Aber nicht nur das. Er hatte ihm das Leben geraubt.
»Du hast gesagt, die Leiche wurde im Bistro gefunden. Aber ermordet wurde er in der Hütte? Ist es das, was Gabri meint? Warum sollte Olivier die Leiche aus der Hütte ins Bistro geschafft haben?«
Gamache sagte lange nichts, und Émile drängte ihn nicht. Er nahm einen Schluck Wein, hing seinen eigenen Gedanken nach, blickte in die zarten Flammen und wartete.
Schließlich sah Gamache Émile an. »Gabris Frage ist durchaus berechtigt.«
»Sind die beiden ein Paar?«
Gamache nickte.
»Na ja, er kann einfach nicht glauben, dass es Olivier war. Verständlich.«
»Stimmt, er kann es nicht glauben. Trotzdem ist es eine berechtigte Frage. Falls Olivier den Eremiten in seiner Hütte im Wald ermordet hat, warum ihn dann an einen Ort bringen, wo er gefunden würde?«
»Noch dazu in sein eigenes Lokal.«
»Nein, hier wird die Sache kompliziert. Er hat die Leiche in ein Wellnesshotel in der Nähe gebracht. Er gibt zu, sie dorthin geschafft zu haben, um es zu ruinieren. Er hat das Hotel als Bedrohung betrachtet.«
»Du hast also deine eigene Antwort.«
»Genau das ist der Punkt«, sagte Gamache und drehte sich zu Émile herum. »Olivier behauptet, er hätte den Eremiten bereits tot in seiner Hütte gefunden und daraufhin beschlossen, mit der Leiche der Konkurrenz zu schaden. Er sagt, er hätte die Leiche nie woandershin gebracht, wenn er den Mann ermordet hätte. Er hätte sie liegen lassen. Oder sie in den Wald geschleppt, damit sie von den Kojoten gefressen wurde. Weshalb sollte ein Mörder jemanden umbringen und dann dafür sorgen, dass seine Leiche gefunden wird?«
»Augenblick.« Émile ordnete seine Gedanken. »Du sagst, die Leiche wurde in Oliviers Bistro gefunden. Wie kam es dazu?«
»Für Olivier ist es einfach dumm gelaufen«, sagte Gamache. »Der Inhaber des Hotels hatte die gleiche Idee. Als er die Leiche bei sich fand, brachte er sie ins Bistro, um Olivier zu ruinieren.«
»Reizende Gegend. Super Klima in der Gastronomie.«
Gamache nickte. »Es hat eine Weile gedauert, aber schließlich haben wir die Hütte und ihren kostbaren Inhalt gefunden. Und die Beweise, dass der Eremit dort ermordet wurde. Die Spurensicherung hat uns bestätigt, dass nur zwei Personen in der Hütte gewesen sein können. Der Eremit und Olivier. Und dann haben wir in Oliviers Bistro mehrere Gegenstände aus der Hütte gefunden, einschließlich der Tatwaffe. Olivier hat zugegeben, sie gestohlen zu haben …«
»Ganz schön dumm.«
»Geldgierig.«
»Hast du ihn festgenommen?«
Gamache nickte, als er an diesen fürchterlichen Tag zurückdachte, an dem er die Wahrheit erfahren hatte und entsprechend hatte handeln müssen. Und er sah Oliviers Gesicht vor sich und, noch schlimmer, das von Gabri.
Dann der Prozess, die Beweisaufnahme, die Aussage.
Das Urteil.
Gamache blickte auf die Briefe auf dem Sofa hinab. Jeden Tag einer, seit Oliviers Verurteilung. Alle herzlich, alle mit der gleichen Frage.
Warum sollte Olivier die Leiche woandershin schaffen?
»Du nennst diesen Mann immer nur den Eremiten. Wer war er?«
»Ein tschechischer Immigrant. Er hieß Jakob, aber das ist alles, was wir über ihn wissen.«
Émilie sah ihn an, dann nickte er. Es war ungewöhnlich, dass ein Mordopfer nicht identifiziert werden konnte, aber nicht völlig ausgeschlossen, insbesondere wenn es sich um jemanden handelte, der eindeutig nicht hatte identifiziert werden wollen.
Die zwei Männer gingen ins Esszimmer mit der nackten Steinwand und der offenen Küche, die erfüllt war vom Duft von Lammbraten mit Gemüse. Nach dem Essen packten sie sich warm ein, legten Henri die Leine an und traten in die bitterkalte Nacht hinaus. Ihre Sohlen knirschten auf dem gefrorenen Schnee, als sie sich den Menschenmassen anschlossen, die zur Eröffnung des Carnaval de Québec durch den großen Torbogen in der Stadtmauer auf die Place D’Youville strömten.
Im Trubel der Festivitäten, inmitten der fiedelnden Musikanten, der Schlittschuh laufenden Kinder und des Feuerwerks, das den Himmel über der Stadt erhellte, wandte Émile sich Gamache zu.
»Warum hat Olivier die Leiche woandershin geschafft, Armand?«
Gamache wappnete sich gegen das unablässige Krachen, die Lichtexplosionen, die drängelnden, johlenden Menschenmassen um sie herum.
Am anderen Ende der verlassenen Fabrik sah er Jean-Guy Beauvoir getroffen zu Boden fallen. Er sah die bewaffneten Männer über sich, wie sie das Feuer eröffneten, an einem Ort, der nahezu unbewacht hätte sein sollen. Er hatte einen Fehler gemacht. Einen verhängnisvollen Fehler.
3
Am nächsten Morgen, einem Samstag, ging Gamache mit Henri im sanften Schneefall die Rue Sainte-Ursule hinauf, um im Petit Coin Latin zu frühstücken. Als er mit einer Schale Café au Lait vor sich auf sein omelette wartete, las er die Wochenendausgaben und beobachtete die Jecken auf ihrem Weg zu den crêperies entlang der Rue Saint-Jean. Es war schön, einerseits dazuzugehören, andererseits aber auch nicht und mit Henri an seiner Seite in der wohligen Wärme des etwas abseits gelegenen Bistros zu sitzen.
Nach der Lektüre von Le Soleil und Le Devoir faltete er die Zeitungen und wandte sich wieder einmal den Briefen aus Three Pines zu. Er konnte sich bestens vorstellen, wie der stattliche, redegewandte und imposante Gabri im Bistro saß, das jetzt er führte, und sich beim Schreiben über den langen hölzernen Tresen beugte. In den Feldsteinkaminen an beiden Enden des Raums mit der Holzbalkendecke brannten jetzt bestimmt knisternde Scheite und verströmten Licht und Wärme und einladende Behaglichkeit.
Und selbst in Gabris leichtem Tadel am Chief Inspector schwang immer Wohlwollen und Besorgnis mit.
Fast spürte Gamache seine Gutmütigkeit, als er mit einem Finger über die Umschläge strich. Aber noch etwas anderes spürte er: die unerschütterliche Überzeugung des Mannes.
Olivier hat es nicht getan. Gabri wurde nicht müde, es in jedem Brief zu wiederholen, als würde es wahr, wenn er es nur oft genug wiederholte.
Warum sollte er die Leiche woandershin schaffen?
Gamaches Finger hörte auf, das Papier zu streicheln. Er blickte aus dem Fenster, griff nach seinem Handy, wählte eine Nummer.
Nach dem Frühstück kämpfte er sich die steile, glatte Straße hinauf, bog dann links ab, in Richtung Literary and Historical Society. Hin und wieder stieg er in einen Schneehaufen, um Familien vorbeizulassen. Die Kinder dick eingepackt, mumifiziert zum Schutz gegen den eisig kalten Quebecer Winter, auf dem Weg zu Bonhomme’s Ice Palace oder zur Eisrutsche oder zur cabane à sucre mit ihrem warmen Ahornsirup, der sich auf dem Schnee zu Karamell verhärtete. Die Abende des Carnaval waren für die Studenten, um zu feiern und zu trinken, aber die Tage waren für die Kinder.
Wieder einmal staunte Gamache über die Schönheit dieser alten Stadt mit ihren engen, verwinkelten Gassen, den Steinhäusern, den Blechdächern, auf denen sich der Schnee türmte. Es war, als befände man sich in einer alten europäischen Stadt. Doch Quebec City war mehr als ein attraktiver Anachronismus, ein hübscher Themenpark. Es war ein lebendiger, pulsierender Zufluchtsort, eine kultivierte Stadt, die viele Male den Besitzer gewechselt, aber nie ihr Herz verloren hatte. Die Flocken fielen jetzt dichter, aber der Wind war fast zum Erliegen gekommen. Mit dem Schnee und den Lichtern, den von Pferden gezogenen calèches, den gegen die Kälte dick eingepackten Menschen sah die Stadt, obwohl zu jeder Jahreszeit schön, im Winter noch zauberhafter aus.
Am Ende der Straße blieb er stehen, um Atem zu schöpfen. Er geriet immer weniger schnell außer Atem, je mehr sich sein Gesundheitszustand besserte. Dank der langen, schweigsamen Spaziergänge mit Reine-Marie, Émile oder Henri oder manchmal auch allein.
Dieser Tage war er jedoch nie allein. Er sehnte sich danach, nach köstlicher Einsamkeit.
Avec le temps, hatte Émile gesagt. Mit der Zeit. Und vielleicht hatte er recht. Seine körperliche Kraft kehrte zurück, warum nicht auch seine geistige Gesundheit?
Als er weiterging, merkte er, dass ein Stück vor ihm etwas passiert war. Polizeiautos. Bestimmt Ärger mit ein paar verkaterten Studenten, die nach Québec gekommen waren, um mit dem offiziellen Getränk des Winter Carnival Bekanntschaft zu machen, mit Caribou, einer fatalen Mischung aus Portwein und Hochprozentigem. Gamache hatte zwar keinen Beweis, aber er war ziemlich sicher, dass sein Cariboukonsum dafür verantwortlich war, dass ihm seit seinen Zwanzigern die Haare ausfielen.
Als er sich der Literary and Historical Society näherte, sah er mehr Polizeiautos und eine Absperrung.
Er blieb stehen. Auch Henri blieb stehen und ließ sich wachsam auf die Hinterläufe nieder.
Die schmale Nebenstraße war ruhiger, weniger befahren als die Hauptstraßen. Nur fünf Meter weiter konnte er Menschen vorbeiströmen sehen, die nichts von dem mitbekamen, was hier vor sich ging.
Am Fuß der Eingangstreppe der alten Bibliothek standen Polizisten. Andere liefen herum. Am Straßenrand stand ein Kastenwagen der Telefongesellschaft, ein Krankenwagen war gerade eingetroffen. Aber keine Blaulichter, keine Hektik.
Das konnte nur eins von zwei Dingen bedeuten. Entweder war es ein blinder Alarm gewesen, oder es bestand kein Grund zur Eile mehr.
Gamache wusste bereits, was von beidem zutraf. Ein paar der Polizisten, die am Krankenwagen lehnten, lachten und stupsten sich an. Dem Chief Inspector, der auf der anderen Straßenseite stand, schwoll angesichts ihrer Heiterkeit der Kamm. Das war etwas, was er an Tatorten unter keinen Umständen duldete. Es gab im Leben durchaus Platz für Gelächter, aber nicht angesichts eines frischen gewaltsamen Todes. Und hier handelte es sich um einen Todesfall. Das sagte ihm nicht nur sein Riecher, sondern auch die Begleitumstände. Das große Polizeiaufgebot, die fehlende Eile, der Krankenwagen.
Und dass es ein gewaltsamer Tod war, verriet ihm die Absperrung.
»Gehen Sie weiter, Monsieur.« Einer der Polizisten, jung und übereifrig, kam auf ihn zu. »Hier gibt es nichts zu sehen.«
»Ich wollte eigentlich in die Bibliothek«, sagte Gamache. »Wissen Sie, was passiert ist?«
Der junge Polizist drehte sich einfach um und ging weg, aber das störte Gamache nicht. Stattdessen beobachtete er die Polizisten, die sich innerhalb der Absperrung unterhielten. Während er und Henri außerhalb standen.
Ein Mann kam die Steintreppe herunter und sprach kurz mit einem der Wache stehenden Polizisten, bevor er zu einem zivilen Streifenwagen ging. Als er ihn erreichte, blickte er sich um, dann bückte er sich, um einzusteigen. Tat es aber dann doch nicht. Stattdessen richtete er sich langsam wieder auf und sah Gamache direkt an. Er starrte ihn zehn Sekunden oder länger an, was nicht lange ist, wenn man einen Schokokuchen isst, aber wenn man jemand ansieht, schon. Behutsam schloss er die Autotür wieder, ging auf das Absperrband zu und stieg darüber. Als der junge Polizist das sah, löste er sich von seinen Kollegen, eilte auf den Polizisten in Zivil zu und begann, neben ihm her zu gehen.
»Ich habe ihm bereits gesagt, dass er verschwinden soll.«
»So, haben Sie?«
»Ja. Soll ich ihn noch mal auffordern zu gehen?«
»Nein. Sie sollen mitkommen.«
Unter den neugierigen Blicken der anderen überquerten die beiden die verschneite Straße und steuerten direkt auf Gamache zu. Dann geschah erst einmal nichts, und die drei Männer schauten sich nur an.
Schließlich machte der Zivilbeamte einen Schritt zurück und salutierte. Verdutzt starrte der junge Cop neben ihm den großen Mann in Winterjacke, Schal und Wollmütze und mit dem Schäferhund an seiner Seite an. Sah genauer hin. Auf den gestutzten ergrauenden Bart, die nachdenklichen braunen Augen, die Narbe.
Dann erbleichte er, machte ebenfalls einen Schritt zurück und salutierte.
»Chef.«
Chief Inspector Gamache salutierte seinerseits und gab den beiden Männern mit einer kurzen Handbewegung zu verstehen, die Förmlichkeiten sein zu lassen. Sie gehörten nicht einmal zu seiner Behörde. Er war bei der Sûreté du Québec, sie waren von der lokalen Polizei von Quebec City. Aber er kannte den Zivilbeamten von Konferenzen, an denen sie beide teilgenommen hatten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: