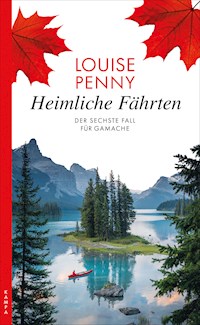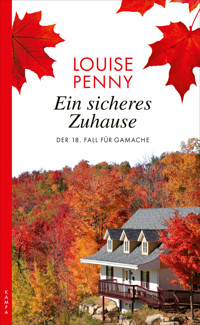Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Armand Gamache, ehemaliger Chief Inspector der Sûreté du Québec, hat sich in Three Pines zur Ruhe gesetzt. Die vergangenen Monate haben ihm viel abverlangt. Gemeinsam mit seiner Frau Reine-Marie sucht der einstige Leiter der Mordkommission in dem beschaulichen kanadischen Dörfchen Geborgenheit. Er genießt die Köstlichkeiten in Oliviers Bistro, verbringt unzählige Stunden in Myrnas Buchhandlung - und findet endlich eine Art inneren Frieden. Doch der droht jäh zu zerbrechen, als seine Freundin Clara Morrow ihn um Hilfe bittet: Ihr Mann Peter ist nicht wie vereinbart nach Hause zurückgekehrt. Genau ein Jahr wollte er fortbleiben. Ist ihm etwas zugestoßen? Gamache soll sich der Sache annehmen, und auch sein ehemaliger Stellvertreter Jean-Guy Beauvoir und die schrullige Dichterin Ruth Zardo erklären sich bereit, nach dem verschollenen Künstler zu suchen. Dessen Spur führt quer durch Europa und wieder zurück nach Kanada - und die ungleiche Ermittlertruppe hinaus aus dem idyllischen Three Pines und in den Norden Québecs, zur Mündung des großen Sankt-Lorenz-Stroms.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Wo die Spuren aufhören
Der zehnte Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Für Michael,
von Freude überrascht
1
Als Clara Morrow sich ihm näherte, fragte sie sich, ob er wieder dieselbe kleine Geste machen würde, die er bisher jeden Morgen gemacht hatte.
Sie war so winzig, so belanglos. So leicht zu übersehen. Beim ersten Mal.
Aber warum machte Armand Gamache sie immer wieder?
Clara kam sich ein wenig kindisch vor, dass sie sich das überhaupt fragte. Wahrscheinlich hatte sie gar nichts zu bedeuten. Doch bei einem Mann, der nicht dazu neigte, Geheimnisse preiszugeben, wirkte diese Geste geradezu verstohlen. Eine harmlose Bewegung, die sich nach einem Schatten zu sehnen schien, in dem sie sich verstecken konnte.
Und doch war er hier, im vollen Licht des neuen Tages, und saß auf der Bank, die Gilles Sandon kürzlich gebaut und auf der Kuppe des Hügels aufgestellt hatte. Vor Gamache lagen die Berge, die sich mit dichten Wäldern bedeckt von Québec bis Vermont zogen. Der Fluss Bella Bella, im Sonnenschein ein silbernes Band, schlängelte sich zwischen ihnen hindurch.
Und unten im Tal, angesichts dieser grandiosen Landschaft leicht zu übersehen, lag das bescheidene kleine Dorf Three Pines.
Armand kam nicht hierher, um sich den Blicken der anderen zu entziehen, aber auch nicht, um die Aussicht zu genießen. Stattdessen saß der große Mann jeden Morgen über ein Buch gebeugt auf der hölzernen Bank. Und las.
Als sie näher kam, sah Clara Morrow, wie es Gamache wieder tat. Er setzte seine Lesebrille mit den halbmondförmigen Gläsern ab, klappte das Buch zu und schob es in seine Tasche. Es war mit einem Lesezeichen versehen, aber er bewegte es nie. Wie ein Stein blieb es, wo es war, und markierte eine Stelle ziemlich weit hinten. Eine Stelle, der er sich näherte, die er aber nie erreichte.
Armand klappte das Buch nicht geräuschvoll zu, eher ließ er es von seiner eigenen Schwere zufallen. Ohne die Seite zu markieren, stellte Clara fest. Kein alter Beleg, keine Zug- oder Busfahrkarte an der Stelle, wo er zu lesen aufgehört hatte. Es war, als spielte es keine Rolle. Jeden Morgen begann er von Neuem. Kam dem Lesezeichen immer näher, hörte aber jedes Mal auf, bevor er es erreichte.
Und jeden Morgen schob Armand Gamache das schmale Bändchen in die Tasche seines leichten Sommersakkos, bevor sie den Titel sehen konnte.
Dieses Buch und Armands Verhalten beschäftigten sie immer mehr.
Sie hatte ihn sogar schon danach gefragt, vor gut einer Woche, als sie sich zum ersten Mal zu ihm auf die neue Bank über dem alten Dorf gesetzt hatte.
»Gutes Buch?«
»Ja.«
Armand Gamache hatte dabei gelächelt und so seine kurz angebundene Antwort abgeschwächt. Fast.
Von einem Mann, der selten jemanden abwimmelte, war es wie ein leichter Stoß.
Nein, dachte Clara, als sie ihn jetzt im Profil betrachtete. Zurückgestoßen hatte er sie nicht. Er war nur selbst einen Schritt zurückgewichen. Vor ihr. Vor ihrer Frage. Er hatte das abgegriffene Buch eingesteckt und sich zurückgezogen.
Die Botschaft war klar. Und Clara verstand sie. Aber das hieß nicht, dass sie sie beherzigen musste.
Armand Gamache blickte über den sattgrünen Mittsommerwald und die Berge, die sich ins Unendliche erstreckten. Dann senkte sich sein Blick auf das Dorf im Tal hinab, das wie in einer urzeitlichen Hand zu ruhen schien. Ein Stigma in der Landschaft Québecs. Keine Wunde, sondern ein Wunder.
Mit seiner Frau Reine-Marie und ihrem Schäferhund Henri machte er jeden Morgen einen Spaziergang. Immer wieder warfen sie den Tennisball, bis sie ihn irgendwann selbst apportieren mussten, weil Henri sich von einem wirbelnden Blatt oder einer Fliege oder den Stimmen in seinem Kopf ablenken ließ. Der Hund rannte dann zunächst dem Ball hinterher, blieb aber plötzlich stehen, um ins Nichts zu starren und seine riesigen Satellitenschüsselohren in alle Richtungen zu drehen. Als wollte er sie auf eine nur für ihn zu hörende Botschaft ausrichten. Nicht angespannt, aber neugierig. Ganz ähnlich lauschten auch Menschen, wurde Gamache bewusst, wenn der Wind Fetzen eines besonders geschätzten Musikstücks an ihr Ohr trug. Oder eine vertraute Stimme aus weiter Ferne.
Den Kopf auf die Seite gelegt, einen leicht bescheuerten Ausdruck im Gesicht, spitzte Henri dann die Ohren, während Armand und Reine-Marie apportierten.
Mit der Welt war alles in Ordnung, dachte Gamache, als er still im frühen Augustsonnenschein saß.
Endlich.
Bis auf Clara, die es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, ihm jeden Morgen auf der Bank Gesellschaft zu leisten.
Glaubte sie vielleicht, er sei einsam und sehne sich nach Gesellschaft, wenn Reine-Marie und Henri gegangen waren und er allein hier oben saß?
Doch das bezweifelte er. Clara Morrow war eine ihrer engsten Freundinnen geworden, und sie kannte ihn zu gut.
Nein, sie war aus ihren eigenen Gründen hier.
Jedenfalls war sein Interesse geweckt. Und beinahe konnte er sich vormachen, dass es sich dabei um seinen erwachenden Ermittlerinstinkt handelte und nicht um simple Neugier.
Sein ganzes Berufsleben lang hatte Chief Inspector Gamache Fragen gestellt und Antworten gesucht. Nicht nur Antworten, auch Fakten. Aber was er wirklich suchte, und was wesentlich gefährlicher und schwerer zu fassen war als Fakten, waren Gefühle. Weil sie ihn zur Wahrheit führten.
Und mochte die Wahrheit auch manche befreien, die Leute, hinter denen Gamache her war, brachte sie ins Gefängnis. Lebenslänglich.
Armand Gamache betrachtete sich mehr als Forscher denn als Jäger. Sein Ziel war, zu entdecken. Und was er entdeckte, vermochte ihn immer noch zu überraschen.
Wie oft hatte er schon einen Mörder vernommen und erwartet, auf gestockte Emotionen zu stoßen, auf eine sauer gewordene Seele? Und hatte stattdessen Gutmütigkeit gefunden, die auf Abwege geraten war.
Natürlich nahm er sie trotzdem fest. Aber inzwischen stimmte er mit Sister Prejean darin überein, dass niemand so schlecht war wie das Schlimmste, das er getan hatte.
Armand Gamache hatte das Schlimmste gesehen. Aber er hatte auch das Beste gesehen. Oft in ein und derselben Person.
Er schloss die Augen und hielt sein Gesicht in die frische Morgensonne.
Diese Zeiten lagen jetzt hinter ihm. Jetzt konnte er ausruhen. In der Höhlung der Handfläche. Und sich über seine eigene Seele Gedanken machen.
Er musste nichts mehr entdecken. Was er suchte, hatte er hier gefunden. In Three Pines.
Er war sich der Anwesenheit der Frau neben ihm bewusst und öffnete die Augen, hielt sie aber nach vorn gerichtet und beobachtete, wie das kleine Dorf unten im Tal zum Leben erwachte. Er sah seine Freunde und neuen Nachbarn ihre Häuser verlassen, um sich um ihre Gärten zu kümmern oder fürs Frühstück über den Dorfanger ins Bistro zu gehen. Er beobachtete, wie Sarah ihre Bäckerei öffnete. Dort hatte sie schon vor Tagesanbruch angefangen, Baguettes und Croissants und chocolatine zu backen, und jetzt war es Zeit, sie zu verkaufen. Sie hielt inne, um sich die Hände an der Schürze abzuwischen, und grüßte Monsieur Béliveau, der gerade den Gemischtwarenladen aufschloss. Schon seit ein paar Wochen saß Armand Gamache jeden Morgen auf der Bank und sah den Leuten bei ihren immer gleichen Tätigkeiten zu. Das Dorf hatte den Rhythmus, den Takt eines Musikstücks. Vielleicht war es das, was Henri hörte. Die Musik von Three Pines. Sie war wie ein Summen, ein Kirchenlied, ein tröstliches Ritual.
Gamaches Leben hatte nie einen Rhythmus gehabt. Jeder Tag war unvorhersehbar gewesen, und das schien ihm gut bekommen zu sein. Er hatte geglaubt, es sei Teil seines Wesens. So etwas wie Routine hatte es in seinem Leben nie gegeben. Bis jetzt.
Gamache musste sich gestehen, dass er ein wenig fürchtete, die Routine, die er jetzt so angenehm fand, könnte zu etwas Banalem verkommen und langweilig werden. Aber genau das Gegenteil war der Fall.
Die ständige Wiederholung schien ihm gutzutun. Je mehr er zu Kräften kam, umso mehr schätzte er diese Strukturiertheit. Seine täglichen Rituale empfand er dabei überhaupt nicht als einengend, sondern vielmehr als befreiend.
Aufruhr brachte alle möglichen unangenehmen Wahrheiten zutage. Aber um sich mit ihnen auseinanderzusetzen, war Ruhe nötig. Wenn er an diesem friedlichen Ort in der Sonne saß, war Armand Gamache endlich frei, sich mit all den Dingen zu befassen, die auf den Boden gefallen waren. Wie auch er gefallen war.
Er spürte das geringe Gewicht und die Kanten des Buchs in seiner Tasche.
Unten im Tal humpelte Ruth Zardo, gefolgt von ihrer Ente Rosa, aus ihrem heruntergekommenen Cottage. Die alte Frau sah sich um, schaute dann die unbefestigte Straße hinauf, die aus dem Dorf führte. Weiter, immer weiter konnte Gamache den Blick aus ihren stählernen alten Augen den staubigen Weg hinaufwandern sehen. Bis er seinen traf. Und an ihm haften blieb.
Ruth hob ihre geäderte Hand zum Gruß. Und als hisste sie die Dorffahne, streckte sie ihm einen erhobenen Finger entgegen.
Gamache seinerseits verneigte sich leicht.
Die Welt war in Ordnung.
Außer …
Er drehte sich zu der zerzausten Frau neben ihm.
Warum war Clara hier?
Clara schaute weg. Sie brachte es nicht über sich, ihm in die Augen zu sehen. Denn sie wusste, was sie gleich tun würde.
Sie überlegte, ob sie erst mit Myrna reden sollte. Sie um Rat bitten. Aber sie entschied sich dagegen, denn damit hätte sie die Verantwortung für diese Entscheidung von sich abgewälzt.
Vielleicht fürchtete sie auch, Myrna würde es ihr ausreden. Ihr sagen, sie solle es nicht tun. Ihr sagen, es sei unfair und sogar grausam.
Denn das war es. Deshalb hatte Clara auch so lang gebraucht, um sich dazu durchzuringen.
Jeden Tag, an dem sie hier heraufgekommen war, war sie fest entschlossen gewesen, Armand etwas zu sagen. Und jeden Tag hatte sie einen Rückzieher gemacht. Oder vielleicht hatte auch der Engel auf ihrer Schulter an den Zügeln gezogen und sie zurückgerissen. Sie aufzuhalten versucht.
Und es hatte funktioniert. Bisher.
Jeden Tag hatte sie Smalltalk mit ihm gemacht, um dann wieder zu gehen, fest entschlossen, am nächsten Tag nicht zu kommen. Sie versprach sich und allen Heiligen und allen Engeln und Göttern und Göttinnen, am nächsten Tag nicht mehr zu der Bank hinaufzugehen.
Doch am nächsten Morgen, wie durch Zauberei, wie durch ein Wunder, einen Fluch, spürte sie erneut das harte Ahornholz unter ihrem Hintern. Und ertappte sich dabei, wie sie Armand Gamache ansah. Sich über das schmale Bändchen in seiner Tasche den Kopf zerbrach. In seine tiefbraunen nachdenklichen Augen schaute.
Er hatte zugenommen, was gut war. Es zeigte, dass Three Pines seine Aufgabe erfüllte. Es ging aufwärts mit ihm. Er war groß, und eine fülligere Figur stand ihm gut. Nicht dick, aber kräftig. Er hinkte nicht mehr so stark von seinen Verletzungen, und sein Gang war energischer. Aus seinem Gesicht war das Grau verschwunden, aber nicht von seinem Kopf. Sein gewelltes Haar war jetzt mehr grau als braun. Wenn er in ein paar Jahren sechzig wurde, wäre er vollständig ergraut, vermutete Clara.
Sein Gesicht verriet sein Alter. Es war von Sorgen und Bedenken und Problemen gezeichnet. Von Schmerzen. Doch die tiefsten Falten kamen vom Lachen. Um seine Augen und seinen Mund. Tief eingekerbte Heiterkeit.
Chief Inspector Gamache. Der ehemalige Leiter der Mordkommission der Sûreté du Québec.
Aber er war auch Armand. Ihr Freund. Der hierhergekommen war, um sich nach diesem Leben und all dem Sterben zur Ruhe zu setzen. Nicht, um sich vor dem Leid zu verstecken, aber um zu vermeiden, noch mehr anzuhäufen. Und um sich an diesem friedlichen Ort mit seiner eigenen Last zu befassen. Und sie allmählich von seinen Schultern zu nehmen.
Wie sie das alle getan hatten.
Clara stand auf.
Sie brachte es nicht über sich. Sie konnte diesem Mann nicht ihr Herz ausschütten. Er hatte seine eigene Bürde zu tragen. Und sie ihre.
»Dann also heute Abend bei euch?«, fragte sie. »Reine-Marie hat uns zum Essen eingeladen. Vielleicht kommen wir sogar dazu, ein bisschen Bridge zu spielen.«
Das nahmen sie sich immer vor, schafften es aber nur selten. Stattdessen unterhielten sie sich oder saßen still im Garten der Gamaches, während Myrna zwischen den Pflanzen herumging und ihnen erklärte, welche Unkraut waren und welche winterhart und Jahr für Jahr wiederkommen würden. Langlebig. Und welche Blumen einjährig waren. Geschaffen, um nach einem prächtigen kurzen Leben zu sterben.
Gamache stand auf, und wieder einmal konnte Clara sehen, was in die Rückenlehne der Bank geritzt war. Es war noch nicht dort gewesen, als Gilles Sandon die Bank aufgestellt hatte. Und Gilles behauptete steif und fest, es nicht gewesen zu sein. Plötzlich war die Inschrift einfach da gewesen, wie ein Graffiti, und niemand hatte sich dazu bekannt.
Armand streckte die Hand aus. Zuerst dachte Clara, er wolle sie ihr zum Abschied schütteln. Eine seltsam förmliche und endgültige Geste. Dann merkte sie, dass seine Handfläche nach oben gedreht war.
Er lud sie dazu ein, ihre Hand in seine zu legen.
Das tat sie. Und spürte, wie er seine Hand behutsam schloss. Endlich schaute sie ihm in die Augen.
»Warum bist du hier, Clara?«
Sie setzte sich abrupt und spürte wieder das harte Holz der Bank, das sie weniger stützte, als am Fallen hinderte.
2
»Worüber, glaubst du, reden sie?« Olivier servierte Reine-Marie einen Teller mit French Toast, frischen Beeren und Ahornsirup.
»Über Astrophysik vielleicht«, sagte sie und schaute in sein attraktives Gesicht hinauf. »Oder über Nietzsche.«
Olivier folgte ihrem Blick aus dem Sprossenfenster.
»Du weißt schon, dass ich Ruth und die Ente gemeint habe«, sagte er.
»Ich doch auch, mon beau.«
Olivier lachte und entfernte sich, um die anderen Bistrogäste zu bedienen.
Reine-Marie saß auf ihrem Stammplatz. Sie hatte nicht vorgehabt, ihn zu ihrem Stammplatz zu machen, es war einfach passiert. In den ersten paar Wochen, nachdem sie und Armand nach Three Pines gezogen waren, hatten sie sich jedes Mal an einen anderen Tisch gesetzt. Und die Tische und Stühle waren wirklich alle anders. Nicht nur von der Platzierung in dem alten Bistro, sondern auch vom Stil her. Lauter Antiquitäten, alle zu verkaufen, alle mit Preisschildern versehen. Einige waren alte Québecer Kiefernholzmöbel, andere dick gepolsterte edwardianische Armlehnstühle oder Ohrensessel. Nicht einmal moderne Stücke aus den fünfziger Jahren fehlten. Aus schlankem Teak und überraschend bequem. Alle von Olivier gesammelt und von seinem Partner Gabri toleriert. Solange Olivier seine Funde nur ins Bistro stellte und es Gabri überließ, die Pension zu führen und einzurichten.
Olivier war schlank, diszipliniert und sich seines lässig legeren Erscheinungsbildes bewusst. Jedes Stück seiner Garderobe zielte darauf ab, den erwünschten Eindruck zu erwecken. Eines lockeren, stilvollen und dezent wohlhabenden Gastgebers. Alles an Olivier war dezent. Bis auf Gabri.
Eigentlich seltsam, fand Reine-Marie. Während Olivier persönlich einen zurückhaltenden, eleganten Stil pflegte, herrschte im Bistro ein irrer Mix aus Stilen und Farben. Das Bistro war weit davon entfernt, beklemmend oder überladen zu wirken, dennoch kam man sich darin vor wie zu Besuch bei einer weit gereisten exzentrischen Tante. Oder einem Onkel. Jedenfalls bei jemandem, der die Konventionen kannte, aber beschlossen hatte, sich nicht an sie zu halten.
An beiden Enden des langen Raums mit der Balkendecke standen riesige gemauerte Kamine. In der Wärme des Hochsommers wurden die darin aufgeschichteten Scheite nicht angezündet. Doch im Winter trotzten die züngelnden, knisternden Flammen dem Dunkel und der eisigen Kälte. Selbst jetzt entging Reine-Marie der leichte Geruch nach Holzrauch nicht. Wie ein Geist oder Wächter.
Erkerfenster blickten auf die Häuser von Three Pines, ihre Gärten voller Rosen, Taglilien, Waldreben und anderer Pflanzen, deren Namen sie erst kennenlernte. Die Häuser bildeten einen Kreis, in dessen Mitte der Dorfanger lag. Und in dessen Mitte standen die drei Kiefern, die über der Gemeinde aufragten. Drei große Türme, die dem Dorf seinen Namen gegeben hatten. Three Pines. Es waren keine gewöhnlichen Bäume. Schon vor Jahrhunderten gepflanzt, waren sie vielmehr ein Symbol. Ein Zeichen für die Kriegsmüden.
Dass sie in Sicherheit waren. Geborgen.
Es war schwer zu sagen, ob die Häuser die Bäume beschützten oder die Bäume die Häuser.
Reine-Marie Gamache griff nach ihrer Tasse Café au Lait und nahm einen Schluck. Dabei beobachtete sie Ruth und Rosa, die auf der Bank im Schatten der Kiefern allem Anschein nach miteinander plapperten. Sie sprachen die gleiche Sprache, die verrückte alte Dichterin und die watschelnde Ente. Und beide schienen nur ein Wort zu kennen.
»Fuck, fuck, fuck.«
Wir lieben das Leben, dachte Reine-Marie, als sie Ruth und Rosa nebeneinandersitzen sah, nicht weil wir ans Leben, sondern weil wir ans Lieben gewöhnt sind.
Nietzsche. Wie Armand sie aufziehen würde, wenn er wüsste, dass sie Nietzsche zitierte, und sei es nur für sich selbst.
»Wie oft hast du dich über mich lustig gemacht, weil ich mit einem Zitat angekommen bin«, würde er ihr schmunzelnd vorhalten.
»Nie, mein Schatz. Was hat Emily Dickinson gleich wieder übers Sich-lustig-Machen gesagt?«
Er würde sie ernst ansehen und sich dann irgendeinen Unsinn aus den Fingern saugen, den er Dickinson oder Proust oder Fred Feuerstein zuschreiben würde.
Weil wir ans Lieben gewöhnt sind.
Endlich waren sie zusammen und in Sicherheit. Im Schutz der Kiefern.
Ihr Blick wanderte unweigerlich den Hügel hinauf zu der Bank, auf der Armand und Clara saßen. Ohne miteinander zu sprechen.
»Worüber, glaubst du, reden sie nicht?«, fragte Myrna.
Die große schwarze Frau setzte sich in den bequemen Polstersessel gegenüber von Reine-Marie. Sie hatte aus dem Buchladen nebenan ihre eigene Teetasse mitgebracht und bestellte sich einen frisch gepressten Orangensaft.
»Armand und Clara? Oder Ruth und Rosa?«, fragte Reine-Marie.
»Was Ruth und Rosa reden, wissen wir«, sagte Myrna.
»Fuck, fuck, fuck«, sagten die zwei Frauen einstimmig und lachten.
Reine-Marie schob sich eine Gabel French Toast in den Mund und schaute wieder zu der Bank auf dem Hügel hinauf. »Sie sitzt jeden Morgen mit ihm dort oben«, sagte sie. »Selbst Armand weiß nicht, was er davon halten soll.«
»Du glaubst doch nicht etwa, dass sie ihn verführen will?«, fragte Myrna.
Reine-Marie schüttelte den Kopf. »Dann hätte sie ein Baguette mitgenommen.«
»Und Käse. Einen schön reifen Tentation de Laurier. Der richtig zerläuft …«
»Hast du schon Monsieur Béliveaus neuesten Käse probiert?«, fragte Reine-Marie, die darüber ihren Mann völlig vergaß. »Den Chèvre des Neiges?«
»O Gott«, stöhnte Myrna. »Er schmeckt wie Blumen und Brioche. Hör bloß auf. Oder willst du mich verführen?«
»Ich? Du hast damit angefangen.«
Olivier stellte das Glas Saft für Myrna und Toast für beide auf den Tisch.
»Muss ich euch zwei schon wieder mit dem Schlauch abspritzen?«, fragte er.
»Désolé, Olivier«, sagte Reine-Marie. »Es war meine Schuld. Wir haben über Käse gesprochen.«
»In der Öffentlichkeit? Ekelhaft«, sagte Olivier. »Ich bin ziemlich sicher, dass Robert Mapplethorpe wegen eines Fotos von einem Baguette mit Brie auf den Index gekommen ist.«
»Einem Baguette?«, fragte Myrna.
»Das würde Gabris Vorliebe für Kohlehydrate erklären«, sagte Reine-Marie.
»Und meine«, sagte Myrna.
»Ich komme gleich wieder«, sagte Olivier und ging. »Mit dem Schlauch. Und glaubt bloß nicht, das ist euphemistisch gemeint.«
Myrna bestrich eine dicke Scheibe Toast mit schmelzender Butter und Marmelade und biss hinein, während Reine-Marie einen Schluck Kaffee nahm.
»Wo waren wir gerade?«, fragte Myrna.
»Bei Käse.«
»Davor.«
»Bei ihnen.« Reine-Marie deutete mit dem Kopf in Richtung ihres Mannes und Clara, die stumm auf der Bank über dem Dorf saßen. Worüber redeten sie nicht, hatte Myrna gefragt. Und dieselbe Frage stellte sich Reine-Marie jeden Tag.
Die Bank war ihre Idee gewesen. Ein kleines Geschenk an Three Pines. Sie hatte Gilles Sandon gebeten, sie zu bauen und dort oben aufzustellen. Ein paar Wochen später war eine Inschrift darauf erschienen. Tief eingeritzt, gekonnt, sorgfältig.
»Warst du das, mon coeur?«, hatte sie Armand auf ihrem Morgenspaziergang gefragt, als sie davor stehen geblieben waren, um sie zu betrachten.
»Nein«, hatte er verdutzt gesagt. »Ich dachte, du hättest Gilles gebeten, es einzugravieren.«
Sie hatten herumgefragt. Clara, Myrna, Olivier, Gabri. Billy Williams, Gilles. Sogar Ruth. Niemand wusste, wer die Wörter in das Holz geritzt hatte. Auf ihren Spaziergängen mit Armand kam sie jeden Tag an diesem Rätsel vorbei. Sie passierten das alten Schulhaus, wo Armand fast getötet worden wäre. Sie gingen durch den Wald, wo Armand getötet hatte. Und beide waren sich dieser Ereignisse sehr deutlich bewusst. Jeden Tag drehten sie um und kehrten in das stille Dorf und zu der Bank darüber zurück. Und zu den von einer unbekannten Hand eingeritzten Wörtern …
Von Freude überrascht
Clara Morrow erzählte Armand Gamache, warum sie da war. Und was sie von ihm wollte. Und als sie geendet hatte, sah sie in seinen nachdenklichen Augen, was sie am meisten fürchtete.
Angst.
Sie hatte sie hervorgerufen. Sie hatte ihm ihre eigene Furcht eingepflanzt.
Am liebsten hätte Clara die Worte zurückgenommen. Gelöscht.
»Ich wollte einfach, dass du es weißt.« Sie spürte, wie sie rot wurde. »Ich musste es jemandem erzählen. Mehr nicht …«
Sie geriet ins Faseln, was ihre Verzweiflung nur steigerte.
»Ich erwarte nicht, dass du irgendetwas unternimmst. Das will ich auf keinen Fall. Es ist eigentlich gar nichts. Damit werde ich allein fertig. Vergiss bitte, dass ich überhaupt was gesagt habe.«
Aber es war zu spät. Sie konnte nicht mehr aufhören.
»Ist auch egal«, sagte sie bestimmt.
Armands Lächeln erreichte die tiefen Falten um seine Augen, und Clara stellte erleichtert fest, dass keine Angst mehr in ihnen war.
»Mir ist es aber nicht egal, Clara.«
Als sie den Hügel wieder hinunterging, schien die Sonne in ihr Gesicht, und in der warmen Luft lag der zarte Duft von Rosen und Lavendel. Am Dorfanger blieb sie stehen und drehte sich um. Armand hatte sich wieder gesetzt. Sie fragte sich, ob er das Buch wieder herausholen würde, nachdem sie gegangen war, aber er tat es nicht. Er saß nur da, mit übereinandergeschlagenen Beinen, eine große Hand in der anderen, gefasst und anscheinend völlig entspannt. Er schaute über das Tal. Zu den Bergen dahinter. Zur Welt draußen.
Es wird alles gut, dachte sie, als sie sich auf den Heimweg machte.
Aber tief drinnen wusste Clara Morrow, dass sie etwas angestoßen hatte. Dass sie in diesen Augen etwas gesehen hatte. Tief drinnen. Vielleicht hatte sie es weniger dort eingepflanzt als vielmehr geweckt.
Armand Gamache war nach Three Pines gekommen, um sich auszuruhen. Sich zu erholen. Sie hatten ihm Frieden versprochen. Und dieses Versprechen hatte sie gerade gebrochen.
3
»Annie hat angerufen«, sagte Reine-Marie und nahm einen Gin Tonic von ihrem Mann entgegen. »Sie werden etwas später kommen. Der Freitagabendverkehr in Montréal.«
»Bleiben sie übers Wochenende?«, fragte Armand. Er hatte den Grill angeworfen und rangelte mit Monsieur Béliveau um den Vorrang. Aber er stand auf verlorenem Posten, weil er nicht die Absicht hatte zu gewinnen, sondern nur den Anschein erwecken wollte, dass er nicht von vorneherein die Waffen streckte. In einer förmlichen Geste der Kapitulation reichte er dem Gemischtwarenhändler schließlich die Zange.
»Soviel ich weiß, schon«, sagte Reine-Marie.
»Gut.«
Etwas an der Art, wie er das sagte, ließ sie aufhorchen, aber dann war es auch schon weg, von einer Lachsalve davongetragen.
»Ich schwöre euch«, sagte Gabri und hob eine mollige Hand zum Schwur, »das sind Designersachen.«
Damit sie ihn in voller Pracht bewundern konnten, drehte er sich einmal um seine Achse. Er trug eine Schlabberhose und ein weites limettengrünes Hemd, das sich leicht bauschte, als er sich drehte.
»Ich habe die Sachen in einem Factory Outlet gekauft, als wir das letzte Mal in Maine waren.«
Gabri war Ende dreißig, etwas über eins achtzig groß und hatte dank etlicher Mille-feuilles eine ordentliche Wampe angesetzt.
»Ich wusste gar nicht, dass Benjamin Moore jetzt auch Klamotten macht«, sagte Ruth.
»Ha, ha, ha«, sagte Gabri. »Diese Sachen sind extrem teuer. Oder sehen sie etwa billig aus?« Er sah Clara flehentlich an.
»Sie?«, fragte Ruth.
»Alte Hexe«, sagte Gabri.
»Alte Schwuchtel«, sagte Ruth. In einer Hand hielt die alte Frau Rosa, in der anderen ein Gefäß, in dem Reine-Marie eine ihrer Vasen erkannte. Gefüllt mit Scotch.
Gabri half Ruth zu ihrem Stuhl zurück. »Kann ich dir was zu essen bringen?«, fragte er. »Einen Welpen oder vielleicht einen Fötus?«
»Gern, mein Bester«, sagte Ruth. »Das wäre nett.«
Reine-Marie ging zwischen ihren Freunden im Garten herum und schnappte französische und englische Gesprächsfetzen auf, meistens eine Melange aus beidem.
Armand hörte aufmerksam Vincent Gilbert zu, der eine Geschichte zum Besten gab. Offensichtlich war sie witzig, höchstwahrscheinlich selbstironisch, denn Armand grinste. Dann sagte er etwas und gestikulierte beim Sprechen mit seinem Bier.
Als er endete, lachten die Gilberts und er. Dann fing er ihren Blick auf, und sein Lächeln wurde breiter.
Der Abend war noch warm, aber wenn sie später die Lampen im Garten anmachten, würden sie die leichten Pullover und Jacketts brauchen, die jetzt noch über den Stuhllehnen hingen.
Leute gingen im Haus der Gamaches aus und ein, als wäre es ihr eigenes, und stellten Essen auf den langen Tisch auf der Terrasse. Sie waren eine feste Einrichtung geworden, die zwanglosen Grillabende jeden Freitag bei den Gamaches.
Allerdings war es nur für wenige das Gamache-Haus. Nach der Frau, die dort gelebt hatte und aus deren Nachlass die Gamaches es gekauft hatten, hieß es im Dorf weiterhin Emilies Haus und würde vermutlich auch weiter so heißen. Auch wenn es auf Armand und Reine-Marie neu wirkte, war es in Wirklichkeit eins der ältesten Häuser von Three Pines. Es hatte eine weiße Holzverkleidung und auf der Vorderseite eine breite Veranda, von der man auf den Dorfanger schaute. Auf der Rückseite waren eine Terrasse und der große vernachlässigte Garten.
»Ich habe dir eine Tüte mit Büchern ins Wohnzimmer gelegt«, sagte Myrna zu Reine-Marie.
»Merci.«
Als sich Myrna ein Glas Weißwein einschenkte, fiel ihr Blick auf den Blumenstrauß in der Mitte des Tischs. Hoch, überschwänglich, voller Blüten und Grün.
Myrna war nicht sicher, ob sie Reine-Marie sagen sollte, dass er hauptsächlich aus Unkraut bestand. Es fehlte keiner der üblichen Verdächtigen. Blutweiderich, Giersch. Sogar Winden.
Sie hatte die Blumenbeete schon mehrmals mit Armand und Reine-Marie durchgesehen und geholfen, Ordnung in das verhedderte Chaos zu bringen. Und sie glaubte, ihnen den Unterschied zwischen Blumen und Unkraut unmissverständlich klargemacht zu haben.
Eine weitere Lektion war angesagt.
»Schön, nicht?«, sagte Reine-Marie und bot Myrna ein Häppchen Räucherforelle auf Roggenbrot an.
Myrna lächelte. Städter.
Armand entfernte sich von den Gilberts und schaute sich um, ob auch alle Gäste versorgt waren. Dabei fiel ihm ein ungewöhnliches Gespann auf. Clara hatte sich zu Ruth gesellt und saß jetzt so weit wie nur irgend möglich vom Haus entfernt und mit dem Rücken zur Party.
Sie hatte seit ihrer Ankunft kein Wort mit ihm gesprochen.
Das überraschte ihn nicht. Was ihn allerdings überraschte, war, dass sie sich zu Ruth und ihrer Ente gesetzt hatte. Obwohl es Gamache oft zutreffender fand, das Gespann als Rosa und ihren Menschen zu bezeichnen.
Für Clara oder irgendjemanden sonst konnte es nur einen einzigen Grund geben, Ruth’ Nähe zu suchen. Das starke morbide Bedürfnis, in Ruhe gelassen zu werden. Ruth war eine soziale Stinkbombe.
Aber sie waren nicht ganz unter sich. Henri hatte sich zu ihnen gesellt und starrte die Ente an.
Es war Hundeliebe im Extrem. Eine Liebe, die Rosa nicht erwiderte. Gamache hörte ein Knurren. Es kam von Rosa. Henri quakte.
Gamache machte einen Schritt zurück.
Wenn Henri dieses Geräusch machte, verhieß das nichts Gutes.
Clara stand auf, um von ihm wegzukommen. Sie ging auf Gamache zu, bevor sie die Richtung änderte.
Ruth rümpfte die Nase, als sich der Geruch von faulen Eiern breitmachte. Henri blickte sich unschuldig um, als versuchte er die Quelle des Gestanks auszumachen.
Jetzt sahen Ruth und Rosa den Schäferhund fast ehrfürchtig an. Die alte Dichterin holte tief Luft, dann atmete sie aus und verwandelte das stinkende Gas in Poesie.
»Du zwangst mich, dir tödliche Gifte zu geben«, zitierte sie aus ihrem berühmten Werk.
»Ich kann es nicht anders sagen.
Gab bloß alles, um dich loszuwerden.
Wie einen Bettler: Da. Hau ab.«
Aber Henri, der tapfere und gashaltige Schäferhund, haute nicht ab. Ruth sah ihn angewidert an, hielt ihm aber eine schrumpelige Hand zum Ablecken hin.
Was er auch tat.
Dann machte sich Armand Gamache auf die Suche nach Clara. Sie war zu den zwei Adirondack-Stühlen gegangen, die nebeneinander auf dem Rasen standen. Ihre breiten Armstützen waren mit eingetrockneten Feuchtigkeitsringen überzogen, Relikte der über Jahre, Jahrzehnte hinweg im stillen Garten genossenen Drinks. Zu Emilies Ringen hatten sich die der Morgentassen und Nachmittagsaperitifs der Gamaches gesellt. Beschauliche Leben, ineinander verschlungen.
Zwei fast identische Stühle standen auch in Claras Garten. Einander leicht zugekehrt, schauten sie über die immerwährende Grenze, den Fluss, zu den Wäldern dahinter. Mit Ringen auf den hölzernen Armstützen.
Er beobachte, wie Clara die Rückenlehne eines Stuhls umklammerte und sich gegen die hölzernen Latten drückte.
Er war nahe genug, um zu sehen, wie ihre Schultern sich hoben und ihre Knöchel weiß hervortraten.
»Clara?«, sprach er sie an.
»Mir geht’s gut.«
Aber das stimmte nicht. Er wusste es. Und sie wusste es. Sie hatte geglaubt, gehofft, dass das Problem sich lösen würde, nachdem sie am Morgen mit Armand gesprochen hatte. Ein geteiltes Problem …
Doch das Problem war zwar geteilt, aber nicht halbiert. Es hatte sich verdoppelt. Und dann noch einmal verdoppelt, als der Tag sich dahinzog. Indem Clara darüber gesprochen hatte, hatte sie es real gemacht. Sie hatte ihrer Angst Gestalt verliehen. Und jetzt war sie heraus. Und wuchs.
Alles nährte sie. Die Aromen des Barbecues, die vernachlässigten Blumen, die abgenutzten, fleckigen alten Stühle. Die Feuchtigkeitsringe, die verfluchten Feuchtigkeitsringe. Wie zu Hause.
Alles, was trivial, was tröstlich und vertraut und sicher gewesen war, schien jetzt mit Sprengstoff umwickelt.
»Das Essen ist fertig, Clara.« Er sagte das mit seiner ruhigen, tiefen Stimme. Dann hörte sie, wie sich seine Schritte auf dem Gras von ihr entfernten, und sie war allein.
Alle ihre Freunde waren auf der Veranda und holten sich Essen. Sie stand abseits, mit dem Rücken zu ihnen, und schaute in den dunkel werdenden Wald.
Dann spürte sie jemanden neben sich. Gamache reichte ihr einen Teller.
»Sollen wir uns setzen?« Er deutete auf die Stühle.
Und Clara setzte sich. Sie aßen schweigend. Alles, was gesagt werden musste, war gesagt worden.
Die anderen Gäste nahmen sich von den Steaks und dem Chutney auf dem Tisch. Myrna musste immer noch über den Unkrautstrauß in seiner Mitte schmunzeln. Und dann hörte sie auf zu schmunzeln und erkannte etwas: Er war wirklich schön.
Salatschüsseln wurden herumgereicht, und Sarah gab Monsieur Béliveau das größte Brötchen, das sie am Nachmittag gebacken hatte, während er ihr das zarteste Steak besorgte. Sie neigten sich einander zu, berührten sich aber ganz knapp nicht.
Olivier hatte das Bistro einem der Kellner überlassen und sich zu ihnen gesellt. Die Unterhaltungen mäanderten. Die Sonne ging unter, und Pullover und Sommersakkos wurden angezogen. Windlichter wurden angezündet und auf dem Tisch und im Garten aufgestellt, sodass es aussah, als hätten sich für den Rest des Abends riesige Glühwürmchen niedergelassen.
»Als Emilie gestorben ist, dachte ich, wir hätten unser letztes Gartenfest hier gefeiert«, sagte Gabri. »Zum Glück habe ich endlich mal falschgelegen.«
Beim Klang des Namens zuckten Henris Satellitenschüsselohren.
Emilie.
Die alte Frau, die ihn im Tierasyl gefunden hatte, als er noch ganz klein gewesen war. Und ihn zu sich genommen hatte. Ihm einen Namen gegeben und ihn geliebt und großgezogen hatte, bis sie eines Tages nicht mehr dagewesen war und die Gamaches gekommen waren und ihn zu sich genommen hatten. Er hatte monatelang nach ihr gesucht. Nach ihrem Geruch geschnuppert, jedes Mal die Ohren gespitzt, wenn er ein Auto hörte. Oder eine Tür. Er hatte beharrlich gewartet, dass Emilie ihn wiederfand. Ihn wieder rettete und zu sich nahm. Bis er eines Tag nicht mehr Ausschau hielt. Nicht mehr wartete. Nicht mehr gerettet werden wollte.
Er richtete den Blick wieder auf Rosa. Die ebenfalls eine alte Frau anbetete und fürchtete, ihre Ruth könnte eines Tages verschwinden, wie Emilie verschwunden war. Und dass sie dann ganz allein wäre. Henri schaute und schaute. Und hoffte, Rosa möge ihn ansehen und erkennen, dass auch dann das verwundete Herz heilen würde. Der Balsam war nicht Wut oder Angst oder Rückzug, wollte er ihr sagen. Das hatte er alles ausprobiert. Und nichts hatte geholfen.
Schließlich hatte Henri dieses schreckliche Loch mit dem Einzigen gefüllt, was noch blieb. Was Emilie ihm gegeben hatte. Auf seinen endlos langen Spaziergängen mit Armand und Reine-Marie erinnerte er sich, wie gern er es mochte, Schneebällen und Stöckchen hinterherzujagen und sich in Stinktierkacke zu wälzen. Wie gern er den Wechsel der Jahreszeiten und ihre verschiedenen Gerüche mochte. Wie gern er Schlamm und frische Bettwäsche mochte. Wie gern er schwamm und sich ausgiebig schüttelte, während seine Beine unter ihm tanzten. Wie gern er sich selbst ableckte. Und dann andere.
Bis eines Tages der Schmerz und die Einsamkeit und der Kummer nicht mehr das Größte in seinem Herzen waren.
Er liebte Emilie immer noch, aber jetzt liebte er auch Armand und Reine-Marie.
Und sie liebten ihn.
Das war Zuhause. Er hatte es wiedergefunden.
»Ah, bon. Enfin«, sagte Reine-Marie und begrüßte ihre Tochter Annie und ihren Schwiegersohn Jean-Guy auf der Veranda.
Es war ein bisschen eng, weil Leute herumwuselten, um sich zu verabschieden.
Jean-Guy Beauvoir sagte Hallo und Auf Wiedersehen zu den Dorfbewohnern und verabredete sich mit Olivier für den nächsten Morgen zum Joggen. Gabri bot an, sich ums Bistro zu kümmern, statt mit ihnen zu kommen, als ob für ihn Joggen jemals infrage gekommen wäre.
Als Beauvoir vor Ruth stand, beäugten sie einander.
»Salut, versoffene alte Vettel.«
»Bonjour, Vollpfosten.«
Ruth hielt Rosa und beugte sich zu Beauvoir vor, damit sie sich auf die Wangen küssen konnten. »Im Kühlschrank ist Pink Lemonade für Sie«, sagte sie. »Hab ich selbst gemacht.«
Er schaute auf ihre knorrigen Hände und wusste, dass es nicht einfach gewesen sein konnte, die Dose zu öffnen.
»Wenn einem das Leben Zitronen gibt …«, sagte er.
»Zitronen gibt es nur Ihnen. Mir hat es zum Glück Scotch gegeben.«
Beauvoir lachte. »Jedenfalls wird mir die Limonade bestimmt schmecken.«
»Rosa hat sie auch gemocht, als sie den Schnabel in den Krug gesteckt hat.«
Ruth stieg die breite Holztreppe der Veranda hinunter und ging, den gepflasterten Weg ignorierend, auf dem Trampelpfad quer über den Rasen zu ihrem Haus.
Jean-Guy wartete, bis Ruth die Haustür zuwarf, dann trug er die Reisetaschen ins Haus.
Es war schon zehn Uhr vorbei, und alle Gäste waren gegangen. Gamache machte seiner Tochter und seinem Schwiegersohn aus den Resten ein Essen.
»Was macht die Arbeit?«, fragte er Jean-Guy.
»Ganz okay, patron.«
Er brachte es noch nicht über sich, seinen neuen Schwiegervater Armand zu nennen. Oder Dad. Ebenso wenig konnte er ihn Chief Inspector nennen, weil Gamache im Ruhestand war, und außerdem wäre das doch zu förmlich gewesen. Deshalb hatte sich Jean-Guy mit patron beholfen. Chef. Es war gleichzeitig respektvoll und zwanglos. Und seltsam zutreffend.
Mochte Armand Gamache auch Annies Vater sein, würde er immer Beauvoirs patron bleiben.
Sie unterhielten sich über einen speziellen Fall, an dem Beauvoir gerade arbeitete. Jean-Guy achtete sehr genau auf Anzeichen, die verraten hätten, dass der Chef mehr als bloß interessiert war. Dass er in Wirklichkeit unbedingt zurückkehren wollte zur Abteilung der Sûreté du Québec, die er aufgebaut hatte. Doch obwohl Gamache höfliches Interesse zeigte, deutete nichts darauf hin, dass es mehr war als das.
Jean-Guy schenkte Annie und sich Pink Lemonade ein und suchte das Fruchtmark nach Entenflaum ab.
Sie saßen zu viert auf der Terrasse hinter dem Haus, der Garten voller flackernder Windlichter, über ihnen die Sterne. Als sie schließlich gegessen und das Geschirr abgeräumt hatten und es sich bei einer Tasse Kaffee gemütlich machten, wandte sich Gamache an Jean-Guy.
»Könnte ich dich kurz sprechen?«
»Klar.« Er folgte seinem Schwiegervater ins Haus.
Unter Reine-Maries Blick ging die Tür zum Arbeitszimmer langsam zu. Und schloss sich dann mit einem Klicken.
»Was hast du denn, maman?«
Annies Blick folgte dem ihrer Mutter zu der geschlossenen Tür, dann richtete er sich wieder auf das gefrorene Lächeln im Gesicht ihrer Mutter.
Das war also der Grund, dachte Reine-Marie. Armands spezieller Tonfall, als sie ihm am Nachmittag gesagt hatte, dass Annie und Jean-Guy zu Besuch kamen. Es war mehr als die Freude darüber gewesen, seine Tochter und ihren Mann zu sehen.
Sie hatte zu Hause schon auf zu viele geschlossene Türen gestarrt, um ihre Bedeutung nicht zu erkennen. Sie selbst auf einer Seite. Armand und Jean-Guy auf der anderen.
Reine-Marie hatte immer gewusst, dass dieser Moment kommen würde. Seit dem ersten Umzugskarton, den sie ausgepackt, seit der ersten Nacht, die sie hier verbracht hatten. Seit dem ersten Morgen, an dem sie neben Armand aufgewacht war und sich nicht vor dem gefürchtet hatte, was der Tag bringen könnte.
Sie hatte gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Aber sie hatte geglaubt, gehofft, gebetet, dass ihnen mehr Zeit bliebe.
»Mom?«
4
Myrna drehte den Türgriff und stellte fest, dass Claras Haustür abgeschlossen war.
Sie rief »Clara?« und klopfte.
Es kam selten vor, dass einer von ihnen seine Haustür abschloss, obwohl sie aus Erfahrung wussten, dass es nicht schaden konnte. Aber die Dorfbewohner wussten auch, dass es nicht an den Türschlössern lag, dass sie nachts sicher schlafen konnten. Und dass es keine offenen Tür waren, von denen ihnen Gefahr drohte.
Aber an diesem Abend hatte Clara ihre Tür abgeschlossen. Gegen welche Gefahr?, fragte sich Myrna.
»Clara?« Myrna klopfte noch einmal.
Wovor hatte Clara Angst? Was versuchte sie auszusperren?
Die Tür wurde aufgerissen, und als Myrna das Gesicht ihrer Freundin sah, wusste sie die Antwort.
Sie. Clara versuchte, sie auszusperren.
Funktioniert hatte es allerdings nicht. Myrna rauschte in die Küche, als wäre es ihre eigene.
Sie setzte den Wasserkessel auf und griff nach zwei Tassen. Hängte in jede einen Beutel Tee. Für Clara Kamille, für sich selbst Pfefferminze. Dann schaute sie in das verärgerte Gesicht.
»Was ist passiert? Was ist los?«
Jean-Guy ließ sich in den bequemen Lehnsessel sinken und sah den Chef an. Die Gamaches hatten eins der Schlafzimmer im Erdgeschoss in ein Arbeitszimmer umgewandelt, und Gilles Sandon hatte an allen Wänden und sogar um Fenster und Tür herum Bücherregale gebaut, sodass es wie in einer Hütte aus Büchern aussah.
Hinter dem Chef konnte Beauvoir Biographien, Geschichtswerke und wissenschaftliche Bücher sehen. Romane und Sachbücher. Aus Gamaches Kopf schien ein dicker Wälzer über die Franklin-Expedition zu wachsen.
Sie unterhielten sich ein paar Minuten, nicht wie Schwiegervater und Schwiegersohn, sondern wie Kollegen. Wie Überlebende desselben Schiffsunglücks.
»Jean-Guy sieht von Mal zu Mal besser aus«, sagte Reine-Marie.
Sie konnte den Pfefferminztee ihrer Tochter riechen und Motten gegen die Verandalampe flattern hören.
Die zwei Frauen waren auf die Vorderseite des Hauses umgezogen, und Annie hatte es sich in der Hollywoodschaukel bequem gemacht, Reine-Marie auf einem der Stühle. Vor ihnen lag das Dorf Three Pines. In einigen Häusern brannte noch warmes Licht, doch die meisten waren dunkel.
Die Frauen unterhielten sich nicht wie Mutter und Tochter, sondern wie Frauen, die sich ein Rettungsfloß geteilt hatten und jetzt endlich an Land waren.
»Er geht zum Therapeuten«, sagte Annie. »Und zu den AA-Treffen. Lässt keines aus. Ich glaube, inzwischen freut er sich sogar darauf, obwohl er es nie zugeben würde. Und Dad?«
»Er macht brav seine Physiotherapie. Wir unternehmen lange Spaziergänge. Er schafft jeden Tag eine längere Strecke. Er will sogar mit Yoga anfangen.«
Annie lachte. Sie hatte nicht das Gesicht und den Körper für die Laufstege in Paris, sehr wohl aber für gutes Essen und Bücher am Feuer und Lachen. Sie war aus und für Freude gemacht. Doch Annie Gamache hatte einige Zeit gebraucht, um sie zu finden. Und ihr zu trauen.
Und selbst jetzt, in dieser friedlichen Sommernacht, fürchtete ein Teil von ihr, sie könnte ihr genommen werden. Wieder. Von einer Kugel, einer Nadel. Einer winzigen Schmerztablette. Die so viel Schmerz verursachte.
Sie veränderte ihre Haltung und schob den Gedanken beiseite. Nachdem sie so viel Zeit ihres Lebens damit zugebracht hatte, den Horizont nach Bedrohungen und Gefahren abzusuchen, nach echten und eingebildeten, wusste sie inzwischen, dass die wahre Gefahr für ihr Glück nicht von einem Punkt in der Ferne ausging, sondern davon, dass sie nach ihm Ausschau hielt. Mit ihm rechnete. Auf ihn wartete. Und ihn in manchen Fällen selbst schuf.
Ihr Vater hatte ihr im Spaß vorgeworfen, in den Trümmern ihrer Zukunft zu leben. Bis sie ihm eines Tages tief in die Augen gesehen und gemerkt hatte, dass er es gar nicht spaßig meinte.
Er warnte sie.
Aber es war schwer, diese Gewohnheit abzulegen, ganz besonders jetzt, wo sie so viel zu verlieren hatte. Und schon einmal fast alles verloren hatte. An eine Kugel. Eine Nadel. Eine winzige Schmerztablette.
Wie auch ihre Mutter fast alles verloren hatte.
Beide hatten mitten in der Nacht diesen Anruf erhalten. »Kommen Sie schnell. Kommen Sie sofort. Bevor es zu spät ist.«
Aber es war nicht zu spät gewesen. Nicht ganz.
Und selbst wenn ihr Vater und Jean-Guy wieder auf die Beine kamen, war Annie nicht sicher, ob das auch sie und ihre Mutter schaffen würden. Ob sie dieses Klingeln jemals vergessen könnten, dieses Klingeln in der Nacht.
Aber vorerst waren sie in Sicherheit. Auf der Veranda. Annie sah das Rechteck aus Licht hinter dem Wohnzimmerfenster. Wo ihr Vater und Jean-Guy saßen. Ebenfalls in Sicherheit.
Vorerst.
Nein, warnte sie sich. Nein. Es droht keine Gefahr.
Sie fragte sich, wann sie das jemals glauben würde. Und sie fragte sich, ob es ihre Mutter glaubte.
»Kannst du dir Dad vorstellen, wie er jeden Morgen auf dem Dorfanger den Sonnengruß macht?«
Reine-Marie lachte. Das Komische war, dass sie es sich vorstellen konnte. Es wäre kein schöner Anblick, aber sie konnte sich Armand dabei vorstellen.
»Ist wirklich alles okay bei ihm?«, fragte Annie.
Reine-Marie drehte sich auf ihrem Stuhl, um zur Verandalampe über der Haustür hinaufzuschauen. Was als ein zartes Klopfen von Mottenflügeln begonnen hatte, war inzwischen zu einem immer hektischeren Flattern geworden, je öfter die Motte aus der Kühle der Nacht gegen das heiße Licht flog. Es ging ihr auf die Nerven.
Sie wandte sich wieder Annie zu. Sie wusste, was ihre Tochter meinte. Dass es mit ihrem Vater körperlich aufwärts ging, konnte Annie sehen – ihr bereitete das Sorgen, was nicht zu sehen war.
»Er geht einmal die Woche zu Myrna«, sagte Reine-Marie. »Das hilft.«
»Zu Myrna?«, fragte Annie. Und deutete auf das »Finanzviertel« von Three Pines, das sich aus der Gemischtwarenhandlung, der Bäckerei, dem Bistro und Myrnas Buchladen zusammensetzte.
Reine-Marie wurde klar, dass ihre Tochter Myrna nur aus dem Laden kannte, wie sie überhaupt nur das gegenwärtige Leben der Dorfbewohner kannte, nicht deren früheres. Annie hatte keine Ahnung, dass die große schwarze Frau, die gebrauchte Bücher verkaufte und ihnen im Garten half, die pensionierte Psychologin Dr. Landers war.
Das brachte Reine-Marie zu der Frage, wie Neuankömmlinge wohl sie und Armand betrachteten. Das nicht mehr ganz junge Paar in dem holzverschalten weißen Haus.
Waren sie die etwas absonderlichen Dorfbewohner, die Blumensträuße aus Unkraut machten? Die mit der La Presse vom Vortag auf der Veranda saßen? Vielleicht kannte man sie auch nur als Henris Eltern.
Würden Neuankömmlinge jemals erfahren, dass sie bei der Bibliothèque nationale du Québec eine hohe Stellung als Bibliothekarin gehabt hatte?
Spielte das eine Rolle?
Und Armand?
Was für ein Leben hatte nach Auffassung eines neu Zugezogenen wohl er hinter sich gelassen? Das eines Journalisten vielleicht, der für die intellektuelle und fast unverständliche Tageszeitung Le Devoir geschrieben hatte. Würden sie annehmen, dass er in seinem früheren Leben eine fusselige Strickjacke getragen und lange Kommentare über politische Themen verfasst hatte?
Die Scharfsinnigeren mutmaßten vielleicht, dass er Professor an der Université de Montréal gewesen war. Einer von der netten Sorte, der sich leidenschaftlich für Geographie und Geschichte interessierte und dafür, was passierte, wenn die beiden kollidierten.
Würde jemand, der neu in Three Pines war, jemals auf die Idee kommen, dass der Mann, der seinen Schäferhund unermüdlich den Ball apportieren ließ oder im Bistro einen Scotch trank, einmal der renommierteste Polizist von ganz Québec gewesen war? Von ganz Kanada? Würden sie ahnen, konnten sie ahnen, dass der stattliche Mann, der jeden Morgen den Sonnengruß machte, früher von Berufs wegen Mörder gejagt hatte?
Reine-Marie hoffte, nicht.
Sie wagte zu hoffen, dass damit jetzt endgültig Schluss war. Dieses Leben nur noch in der Erinnerung gelebt wurde. Es durchstreifte die Berge, die das Dorf umgaben, hatte hier aber keinen Platz. Hatte jetzt keinen Platz. Chief Inspector Gamache, der Leiter der Mordkommission der Sûreté du Québec, hatte seine Schuldigkeit getan. Jetzt war jemand anders dran.
Aber wenn sie nur an das leise Klicken dachte, mit dem die Tür zum Arbeitszimmer zugegangen war, krampfte sich ihr Herz zusammen.
Die Motte flatterte noch immer gegen das heiße Glas der Lampe, stieß unermüdlich dagegen. Suchte sie die Wärme, fragte sich Reine-Marie, oder das Licht?
Tut es weh? Die versengten Flügel, die Beinchen, fein wie Fäden, die auf dem glühend heißen Glas landeten und sich sofort wieder abstießen. Tut es weh, dass das Licht der Motte nicht gibt, wonach sie sich so sehr sehnt?
Sie stand auf und machte die Verandabeleuchtung aus, und wenige Augenblicke später hörte das Flattern und Schlagen der Flügel auf, woraufhin Reine-Marie zu ihrem friedlichen Sitz zurückkehrte.
Jetzt war es still und dunkel. Bis auf das warme gelbe Licht hinter dem Fenster des Arbeitszimmers. Während sich die Stille vertiefte, fragte sich Reine-Marie, ob sie der Motte einen Gefallen getan hatte. Ihr zwar das Leben gerettet, sie aber ihrer Bestimmung beraubt hatte.
Und dann ging das Flattern wieder los. Hektisch, verzweifelt. Winzig, zart, beharrlich. Die Motte war ein Stück weiter die Veranda hinuntergezogen. Jetzt schlugen ihre Flügel gegen das Fenster des Zimmers, in dem Armand und Jean-Guy saßen.
Sie hatte ihr Licht gefunden. Sie würde niemals aufgeben. Konnte es einfach nicht.
Reine-Marie stand auf und schaltete unter den Blicken ihrer Tochter die Verandabeleuchtung wieder ein. Es lag in der Natur der Motte zu tun, was sie tat. Und Reine-Marie konnte sie nicht davon abbringen, wie sehr sie es sich auch wünschen mochte.
»Wie geht’s Annie?«, fragte Gamache. »Sie macht einen glücklichen Eindruck.«
Armand musste lächeln, als er an seine Tochter dachte, und erinnerte sich, wie er bei ihrer Hochzeit mit Jean-Guy auf dem Dorfanger mit ihr getanzt hatte.
»Willst du wissen, ob sie schwanger ist?«
»Natürlich nicht«, erwiderte der ehemalige Chief Inspector scharf. »Wie kannst du so was auch nur von mir denken?« Er griff nach dem Briefbeschwerer auf dem Couchtisch, legte ihn zurück, griff dann nach einem Buch und fummelte daran herum, als hätte er noch nie eins in der Hand gehabt. »Das geht mich nichts an.« Er stemmte sich im Sessel hoch. »Glaubst du, nur eine Schwangerschaft würde sie glücklich machen? Für was für eine Sorte Mann hältst du mich eigentlich? Für was für eine Sorte Vater?« Er starrte den jüngeren Mann finster an.
Jean-Guy starrte einfach zurück und nahm das untypische Aufbrausen zur Kenntnis.
»Es wäre völlig in Ordnung zu fragen.«
»Ist sie’s denn?« Gamache beugte sich vor.
»Nein. Sie hat beim Abendessen ein Glas Wein getrunken. Hast du das nicht bemerkt? Du bist mir vielleicht ein Ermittler.«
»Ich bin tatsächlich keiner mehr.« Er fing Jean-Guys Blick auf, und beide grinsten. »Aber ich wollte wirklich nicht fragen«, fügte Gamache wahrheitsgemäß hinzu. »Ich möchte nur, dass sie glücklich ist. Und du auch.«
»Das bin ich, patron.«
Die beiden Männer musterten einander. Auf der Suche nach Wunden, die nur sie sehen konnten. Auf der Suche nach Anzeichen von Heilung, von denen nur sie sagen konnten, ob sie echt waren.
»Und du? Bist du glücklich?«
»Ja.«
Beauvoir musste nicht weiter nachhaken. Nachdem er sich sein ganzes Berufsleben lang Lügen angehört hatte, erkannte er die Wahrheit, wenn er sie hörte.
»Und wie geht’s Isabelle?«, fragte Gamache.
»Du meinst Chief Inspector Lacoste?«, fragte Beauvoir mit einem Grinsen. Sein Schützling hatte die Leitung der Mordkommission der Sûreté übernommen, eine Stelle, von der alle angenommen hatten, dass er sie nach der Pensionierung Gamaches bekäme. Obwohl das eigentlich nicht das richtige Wort für den Rücktritt seines Schwiegervaters war. Pensionierung klang vorhersehbar. Doch niemand hätte die Ereignisse vorhersehen können, die dazu führten, dass der Leiter der Mordkommission der Sûreté den Dienst quittierte und sich ein Haus in einem Dorf kaufte, so klein und unbedeutend, dass es auf keiner Landkarte zu finden war.
»Isabelle geht’s gut.«
»Meinst du gut im Ruth-Zardo-Sinn.«
»Mehr oder weniger. Aber sie kriegt es schon hin. Nicht umsonst warst du ihr großes Vorbild.«
Der letzte Gedichtband von Ruth hieß Mir geht’s GUT. Nur Leute, die ihn gelesen hatten, wussten, dass GUT für gallig, unsicher, todtraurig stand.
Isabelle Lacoste telefonierte mindestens einmal pro Woche mit Gamache, und ein paarmal im Monat trafen sie sich in Montréal zum Mittagessen. Immer weit weg vom Sûreté-Hauptquartier. Darauf bestand er. Um die Autorität des neuen Chief Inspectors nicht zu untergraben.
Lacoste hatte Fragen, die nur der frühere Chief Inspector beantworten konnte. Manchmal waren es Verfahrensfragen, aber häufiger handelte es sich um komplexere, menschliche Probleme. Unsicherheiten, Ungewissheiten. Ihre Ängste.
Gamache hörte sich alles an, und manchmal erzählte er von seinen Erfahrungen. Versicherte ihr, dass ganz natürlich und normal war, wie es ihr ging. Und gesund. Ihm war es im Dienst fast jeden Tag so gegangen. Nicht dass er ein Schwindler gewesen war, aber dass er Angst gehabt hatte. Bei jedem Telefonläuten oder Türklopfen hatte er gefürchtet, dass es um Leben und Tod ging und er nicht in der Lage war, das Problem zu lösen.
»Ich habe einen neuen Trainee, patron«, hatte ihm Isabelle Anfang der Woche bei ihrem Mittagessen im Le Paris erzählt.
»Ja?«
»Ein junger Agent, frisch von der Akademie. Adam Cohen. Ich glaube, Sie kennen ihn.«
Der Chef hatte gelächelt. »Merci, Isabelle.«
Der junge Monsieur Cohen hatte die Aufnahme in die Akademie beim ersten Anlauf nicht geschafft und deshalb eine Stelle als Gefängniswärter angenommen. Die beiden hatten sich vor einigen Monaten kennengelernt, als fast jeder den Chief Inspector angriff. Beruflich. Persönlich. Und schließlich sogar körperlich. Doch Adam Cohen hatte ihm beigestanden und sich nicht weggeduckt, obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte. Nicht zuletzt, um seine eigene Haut zu retten.
Das hatte der Chief Inspector nicht vergessen. Und als die Krise ausgestanden war, war Gamache an den Leiter der Polizeiakademie herangetreten und hatte ihn um eine rare zweite Chance für den jungen Mann gebeten. Und dann hatte er den jungen Mann betreut und gecoacht. Ermutigt. Und bei seiner Abschlussfeier hinten im Saal gestanden und ihm applaudiert.
Gamache hatte Isabelle gebeten, Cohen einzustellen. Ihn unter ihre Fittiche zu nehmen. Er konnte sich keine bessere Mentorin für den jungen Polizisten vorstellen.
»Agent Cohen hat heute Morgen angefangen«, sagte Lacoste und nahm einen Bissen von ihrem Salat mit Quinoa, Feta und Granatapfel. »Ich habe ihn in mein Büro bestellt und ihm gesagt, dass es vier Punkte gibt, die zur Weisheit führen. Ich habe ihm erklärt, dass ich sie ihm nur einmal sage und dass ich es ihm überlasse, was er damit anfängt.«
Armand Gamache ließ die Gabel auf seinen Teller sinken und hörte zu.
»Ich weiß nicht. Ich hatte unrecht. Es tut mir leid.« Ganz langsam zählte Lacoste die ersten drei Punkte auf und hakte sie an ihren Fingern ab.
»Ich brauche Hilfe«, ergänzte Gamache den letzten. Es waren dieselben Punkte, die er der jungen Isabelle Lacoste bei ihrem Dienstantritt aufgezählt hatte. Dieselben, die er allen seinen neuen Agents aufgezählt hatte.
Und jetzt saß er in seinem Haus in Three Pines und sagte: »Ich brauche deine Hilfe, Jean-Guy.«
Beauvoir war sofort hellwach. Und nickte kurz.
»Heute Morgen ist Clara zu mir gekommen. Mit einem …« Gamache suchte nach dem richtigen Wort. »Rätsel.«
Beauvoir beugte sich vor.
Clara und Myrna saßen nebeneinander auf den großen hölzernen Adirondack-Stühlen in Claras Garten. Grillen zirpten und Frösche quakten, und hin und wieder hörten es die Frauen im dunklen Wald rascheln.
Unter diesen Geräuschen, hinter diesen Geräuschen plätscherte der Fluss Bella Bella aus den Bergen herab, durchs Dorf hindurch und auf der anderen Seite wieder hinaus. Auf dem Weg nach Hause, aber ohne Hast.
»Ich habe lange Geduld mit dir gehabt«, sagte Myrna. »Aber jetzt musst du mir endlich sagen, was los ist.«
Selbst im Dunkeln wusste Myrna, was für ein Gesicht ihre Freundin machte, als sie sich ihr zuwandte.
»Geduld?«, fragte Clara. »Das Grillfest ist gerade mal eine Stunde zu Ende.«
»Na schön, Geduld ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und nicht erst seit dem Barbecue. Warum setzt du dich jeden Morgen zu Armand? Und was war heute da oben los? Du bist mehr oder weniger von ihm weggelaufen.«
»Das hast du mitbekommen?«
»Jetzt hör mal, Clara. Diese Bank steht auf dem Hügel, direkt über Three Pines. Genauso gut hättest du auf einer Leuchtreklame sitzen können.«
»Ich habe nicht versucht, mich zu verstecken.«
»Das ist dir auch gelungen.« Myrnas Ton wurde sanfter. »Kannst du es mir nicht sagen?«
»Kannst du es dir nicht denken?«
Myrna drehte sich mit dem ganzen Körper zu ihrer Freundin.
Clara hatte immer noch Farbe in ihrem wilden Haar, nicht die Flecken, die man abbekommt, wenn man ein Zimmer streicht. Es waren vielmehr Kadmiumgelb- und Ockersträhnen. Und ein Fingerabdruck aus gebrannter Siena auf ihrem Nacken, wie eine Schramme.
Clara Morrow malte Porträts. Und oft bemalte sie sich dabei selbst.
Auf dem Weg in den Garten hatte Myrna einen kurzen Blick in Claras Atelier geworfen und ihr jüngstes Werk auf der Staffelei gesehen. Auf der Leinwand erschien gerade ein gespenstisches Gesicht, oder verschwand darin.
Myrna fand die Porträts ihrer Freundin außergewöhnlich. Oberflächlich betrachtet waren sie einfach Abbildungen einer Person. Schön. Erkennbar. Konventionell. Aber … wenn sie lang genug davor stand, wenn sie ihre eigenen Vorstellungen ausblendete, ihre Abwehrmechanismen ausschaltete und nicht mehr urteilte, kam ein anderes Porträt zum Vorschein.
Clara Morrow malte eigentlich keine Gesichter, sie malte Emotionen, Gefühle, verborgen hinter einer schönen Fassade, getarnt, eingeschlossen und geschützt.
Die Bilder raubten Myrna den Atem. Aber das war das erste Mal, dass ihr ein Porträt richtiggehend Angst machte.
»Es geht um Peter«, sagte Myrna in die kühle Nachtluft hinein.
Sie wusste, dass das sowohl für dieses Gespräch als auch für das gespenstische Porträt galt. Peter Morrow. Claras Mann.
Clara nickte. »Er ist nicht nach Hause gekommen.«
»Na und?«, sagte Jean-Guy. »Wo soll da das Problem sein? Haben sich Clara und Peter nicht getrennt?«
»Ja, vor einem Jahr«, sagte Gamache. »Clara hat ihn gebeten auszuziehen.«
»Ich erinnere mich. Warum erwartet sie dann, dass er nach Hause kommt?«
»Sie haben sich gegenseitig ein Versprechen gegeben. Ein Jahr keinen Kontakt, aber am ersten Jahrestag seines Auszugs sollte Peter zurückkommen, um zu sehen, wie es um ihre Beziehung steht.«
Beauvoir ließ sich in den Sessel zurücksinken und schlug die Beine übereinander. Und spiegelte damit unbewusst sein Gegenüber.
Er ließ sich eine Weile durch den Kopf gehen, was Gamache gerade gesagt hatte. »Aber Peter ist nicht gekommen.«
»Ich habe gewartet.«
Clara hielt mit beiden Händen die Tasse, nicht mehr heiß, aber warm genug, um tröstlich zu sein. Der Abend war kühl und ruhig, und sie nahm das aufsteigende Kamillenaroma wahr. Sie konnte Myrna neben sich zwar nicht sehen, dafür aber spüren. Und die warme Minze riechen.
Und Myrna war so vernünftig, still zu bleiben.
»Der Jahrestag liegt schon ein paar Wochen zurück«, fuhr Clara fort. »Ich habe bei Monsieur Béliveau eine Flasche Wein und zwei Steaks gekauft und diesen Salat mit Orange, Rucola und Ziegenkäse gemacht, den Peter so gern mag. Ich habe die Kohle im Grill angezündet. Und gewartet.«
Sie erwähnte nicht, dass sie in Sarahs Bäckerei auch Croissants gekauft hatte. Für den nächsten Morgen. Für den Fall.
Jetzt kam sie sich deswegen richtig albern vor. Sie hatte sich vorgestellt, dass er kommen, sie sehen und in die Arme nehmen würde. In besonders melodramatischen Momenten sah sie ihn sogar in Tränen ausbrechen und sie um Verzeihung bitten, dass er so ein Ekel gewesen war.
Sie bliebe selbstverständlich cool und gefasst. Herzlich, mehr aber auch nicht.
In Wirklichkeit fühlte sie sich jedoch in Peters vertrauter Umarmung immer wie ein Geschöpf von Beatrix Potter. Frau Tiggy-Wiggel in ihrem komischen kleinen Häuschen. Sie hatte Zuflucht gefunden in seinen Armen. Dorthin gehörte sie.
Aber dieses Leben hatte sich als Märchen entpuppt, als Illusion. Trotzdem hatte sie in einem Augenblick von Schwäche, Wunschdenken oder falschen Hoffnungen diese Croissants gekauft. Für den Fall, dass das Abendessen in ein Frühstück mündete. Für den Fall, dass sich nichts geändert hatte. Oder dass Peter sich geändert hatte und nicht mehr so ein Stück merde war.
Sie hatte sich vorgestellt, dass sie in diesen Stühlen sitzen und ihre Kaffeetassen in die Ringe auf den Armlehnen stellen, die luftigen Croissants essen und sich ganz entspannt unterhalten würden. Als ob nichts passiert wäre.
Aber in diesem Jahr war viel passiert. Mit Clara. Mit dem Dorf. Mit ihren Freunden.
Doch jetzt beschäftigte sie vor allem, was mit Peter passiert war. Diese Frage hatte zuerst ihren Kopf besetzt, dann ihr Herz eingenommen, und inzwischen hatte sie sie vollständig in ihrer Gewalt.
»Warum hast du das nicht früher gesagt?«, fragte Myrna. Die Frage sollte kein Vorwurf sein, wusste Clara. Kein Tadel und keine Kritik. Myrna wollte nur ihre Beweggründe verstehen.
»Zuerst dachte ich, ich hätte mich im Datum geirrt. Dann bin ich sauer geworden und fand, der kann mich mal. Das hat etwa zwei Wochen lang angehalten. Aber dann …«
Sie hob die Hände, fast resignierend.
Myrna wartete, nahm einen Schluck Tee. Sie kannte ihre Freundin. Clara mochte innehalten, zögern, stolpern. Aber sie resignierte nicht.
»Dann habe ich Angst bekommen.«
»Wovor?« Myrnas Stimme war gefasst.
»Das weiß ich nicht.«
»Das weißt du sehr wohl.«
Darauf trat eine lange Pause ein. »Angst«, sagte Clara schließlich, »dass er tot ist.«
Und Myrna wartete weiter. Und wartete. Stellte ihre Tasse in einen der Ringe. Wartete.
»Und«, fuhr Clara fort, »ich hatte Angst, dass er es nicht ist. Dass er nicht zurückgekommen ist, weil er nicht wollte.«
»Salut«, sagte Annie, als ihr Mann wieder zu ihnen auf die Veranda kam. Sie tätschelte den Platz neben sich auf der Hollywoodschaukel.
»Geht leider gerade nicht«, sagte Jean-Guy. »Aber halt mir den Platz frei. Bin in ein paar Minuten wieder zurück.«
»Bis dahin bin ich schon im Bett.«
Beauvoir wollte schon etwas erwidern, doch dann fiel ihm ein, wo sie waren und wer bei ihnen war.
»Musst du weg?«, fragte Reine-Marie ihren Mann, als sie aufstand und er den Arm um ihre Taille legte.
»Nur kurz.«
»Ich stelle eine Kerze ins Fenster«, sagte sie und sah ihn grinsen.
Sie schaute Armand hinterher, als er sich mit ihrem Schwiegersohn über den Dorfanger entfernte. Zuerst dachte sie, sie würden auf einen Absacker ins Bistro gehen, doch dann bogen sie rechts ab. Zum Licht von Claras Cottage.
Und Reine-Marie hörte sie an ihre Tür klopfen. Ein leises, beharrliches Klopfen.
»Hast du es ihm erzählt?«
Clara schaute von Gamache zu Jean-Guy.
Sie war wütend. Ihr Gesicht war wütend. Als wäre sie mit dem Gesicht voran in eine ihrer Paletten gefallen. Purpurrot mit einem Fleck Dioxazinviolett, das von ihrem Hals hochstieg.
»Es war vertraulich. Was ich dir erzählt habe, war vertraulich.«
»Du hast mich um Hilfe gebeten, Clara«, sagte Gamache.
»Habe ich nicht. Ich habe dir sogar ausdrücklich gesagt, dass du mir nicht helfen sollst. Dass ich mich allein darum kümmern werde. Das ist mein Leben, mein Problem, nicht deines. Glaubst du etwa, jede Unschuld ist in Nöten? Bin ich plötzlich nur noch ein Problem, das gelöst werden muss? Ein Weichei, das gerettet werden muss? Ist es das? Zeit, dass sich der große Armand Gamache einschaltet und die Sache selbst in die Hand nimmt. Bist du gekommen, um mir zu sagen, ich soll mir mein hübsches kleines Köpfchen nicht zerbrechen?«
Bei dieser Beschreibung von Claras Kopf machte sogar Myrna große Augen.
»Augenblick mal …«, schaltete sich Beauvoir ein, dessen Gesicht langsam einen Alizarin-Krapplack-Farbton annahm. Doch Gamache legte seine große Hand auf den Arm des jüngeren Manns.
»Nein, nicht Augenblick mal!«, konterte Clara und fuhr zu Beauvoir herum. Myrna legte ihr fest, aber begütigend die Hand auf den Arm.
»Tut mir leid, wenn ich dich falsch verstanden habe«, sagte Gamache und wirkte aufrichtig geknickt. »Ich dachte, du wolltest mich um Hilfe bitten, als wir uns heute Morgen unterhalten haben. Warum wärst du sonst zu mir gekommen?«
Jetzt war es heraus. Die schlichte Wahrheit.
Armand Gamache war ein Freund von ihr. Aber Reine-Marie war eine engere Freundin. Andere im Dorf waren ältere Freunde. Myrna war ihre beste Freundin.
Warum war sie dann jeden Morgen zu der Bank hinaufgegangen, um sich neben diesen Mann zu setzen? Und ihm schließlich ihr Herz auszuschütten?
»Dann hast du dich eben getäuscht.« Das Violett hatte inzwischen ihre Kopfhaut erreicht. »Wenn dir langweilig ist, Chief Inspector, dann schnüffel bitte in einem anderen Privatleben rum.«
Kurz verschlug es sogar Beauvoir die Sprache. Ihm fehlten die Worte. Doch dann fand er welche.
»Langweilig? Langweilig? Haben Sie eigentlich eine Ahnung, was er Ihnen anbietet? Was er aufgibt? Was für eine selbstsüchtige …«
»Jean-Guy! Das reicht.«
Die vier starrten einander in betretenem Schweigen an.
»Entschuldigung«, sagte Gamache und machte eine knappe Verbeugung vor Clara. »Ich habe mich getäuscht. Jean-Guy.«