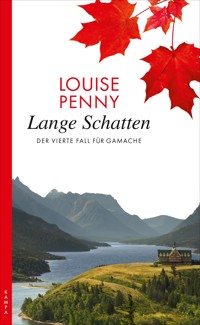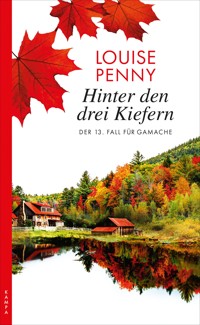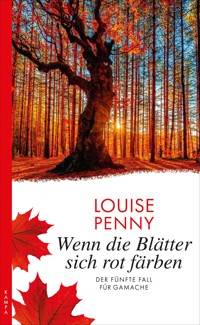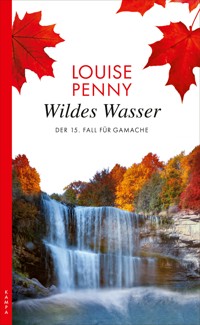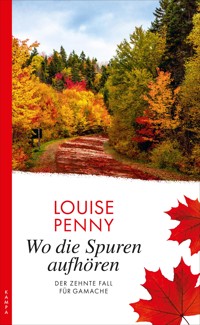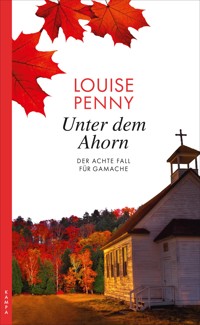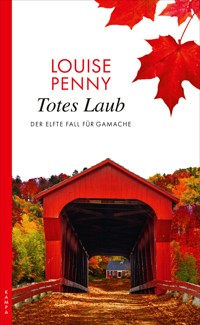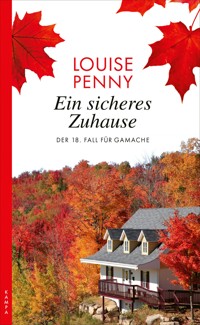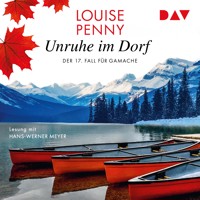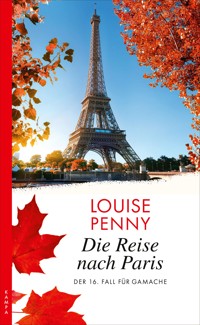
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Armand Gamache, Leiter der Mordkommission der Sûreté du Québec, reist mit seiner Frau Reine-Marie nach Paris, um ihre hochschwangere Tochter zu besuchen. Die Gamaches genießen ihren Urlaub - bis Armands Patenonkel Stephen Horowitz nach einem gemeinsamen Abendessen angefahren und schwer verletzt wird. Alle anderen haben gerade den Lichterglanz des Eiffelturms bewundert, nur Gamache hat gesehen: Das war kein Unfall. Hilfesuchend wendet er sich an Claude Dussault, den Polizeipräfekten von Paris. Kurz darauf machen Gamache und Reine-Marie eine grausame Entdeckung in Stephens Wohnung. Welche Geheimnisse hütet der alte Herr? Und welchen Gefahren ist er tatsächlich ausgesetzt? Gamache kommen immer mehr Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Pariser Polizei, und er beschließt, mit der Hilfe von Beauvoir auf eigene Faust zu ermitteln. Schnell geraten sie in ein Netz aus Lügen. Um die Wahrheit herauszufinden, muss Gamache entscheiden, wem er trauen kann: seinen Freunden, seinen Kollegen, seinem Instinkt oder seiner eigenen Vergangenheit?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Die Reise nach Paris
Der 16. Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck
Kampa
Für Hope Dellon,
eine hervorragende Lektorin und eine noch bessere Freundin.
Das Gute gibt es.
1
»Die Hölle ist leer«, sagte Stephen Horowitz.
»Das hast du schon mal gesagt. Und alle Teufel sind hier?«, fragte Armand Gamache.
»Nun ja, das nicht unbedingt«, Stephen breitete die Arme aus, »also nicht genau hier.«
»Hier«, das war der Garten des Musée Rodin in Paris, wo Armand und sein Patenonkel ein paar ruhige Minuten verbrachten. Von jenseits der Mauern war Verkehrslärm zu hören, das Getöse der großen Stadt.
Hier jedoch herrschte Frieden. Der tiefe Frieden, der sich nicht nur mit Stille, sondern auch mit Vertrautheit einstellt.
Mit dem Bewusstsein, in Sicherheit zu sein. In diesem Garten. In der Gesellschaft des anderen.
Armand reichte seinem Begleiter ein tartelette au citron, dann ließ er den Blick über den Garten schweifen. Es war ein angenehm warmer Nachmittag Ende September. Die Schatten streckten sich, wurden länger. Strebten davon.
Das Licht obsiegte.
Kinder rannten herum und jagten lachend über die lange Rasenfläche vor dem Château. Junge Eltern sahen von den Holzbänken aus zu, die im Laufe der Jahre ergraut waren. Wie die Eltern es schließlich auch tun würden. Aber jetzt saßen sie entspannt da, glücklich über ihre Kinder und noch glücklicher, dass sie an diesem geschützten Ort einige Minuten für sich hatten.
An einem solchen Ort ließ sich der Teufel nur schwer vorstellen.
Andererseits, dachte Armand Gamache, wo sonst fand man Finsternis, wenn nicht im Licht? Gab es einen größeren Triumph für das Böse, als sich eines Gartens zu bemächtigen?
Es wäre nicht das erste Mal.
»Erinnerst du dich?«, begann Stephen, und Armand sah wieder zu dem alten Mann neben sich. Er wusste, was jetzt kam. »Als du beschlossen hast, um Reine-Maries Hand anzuhalten?« Stephen klopfte auf die Bank. »Hier. Ausgerechnet hier.«
Armand verstand die Anspielung und lächelte.
Die Geschichte war hinlänglich bekannt. Stephen erzählte sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit, auf jeden Fall immer, wenn Patenonkel und Patensohn hierherpilgerten.
Es war ihr Lieblingsort in Paris.
Der Garten des Musée Rodin.
Gab es einen schöneren Ort, um Reine-Marie einen Heiratsantrag zu machen?, hatte sich der junge Armand vor vielen Jahren gedacht. Er hatte den Ring. Er hatte sich die Worte zurechtgelegt. Er hatte die Reise sechs Monate lang von seinem lausigen Gehalt als Polizist bei der Sûreté du Québec zusammengespart.
Er wollte mit der Frau, die er liebte, an den Ort, den er liebte. Und sie bitten, den Rest ihres Lebens mit ihm zu verbringen.
Sein Reisebudget gab kein Hotelzimmer her, also würden sie in einem Hostel übernachten müssen. Aber er wusste, dass Reine-Marie so etwas nichts ausmachte.
Sie waren verliebt, und sie waren in Paris. Und schon bald würden sie verlobt sein.
Aber wieder einmal eilte Stephen zu seiner Rettung herbei und überließ dem jungen Paar seine herrliche Wohnung im 7. Arrondissement.
Nicht zum ersten Mal kam Armand dort unter.
Er war in diesem wunderschönen Haussmann-Gebäude praktisch groß geworden. Die Zimmer der riesigen Wohnung hatten bodentiefe Fenster, die zum Hotel Lutetia hinaussahen, Fischgrätparkett und Marmorkamine, und die Decken waren so hoch, dass jeder Raum hell und luftig wirkte.
Mit ihren vielen Winkeln und Nischen war sie ein wahres Paradies für ein neugieriges Kind, und er war davon überzeugt, dass der Schrank mit den Scheinschubladen einzig und allein dem Zweck diente, dass sich ein kleiner Junge darin verstecken konnte. Außerdem gab es überall Schätze, mit denen man spielen konnte, wenn Stephen nicht hinsah.
Und Möbel, auf denen man herumhüpfen konnte.
Bis sie kaputtgingen.
Stephen sammelte Kunst, und jeden Tag wählte er aus seiner Sammlung ein Werk aus und erzählte seinem Patensohn etwas über den Künstler. Cézanne. Riopelle und Lemieux. Kenojuak Ashevak.
Mit einer Ausnahme.
Das winzige Aquarell, das auf Augenhöhe eines Neunjährigen hing. Stephen sprach nie darüber, vor allem weil es darüber nicht viel zu sagen gab, wie er Armand einmal erklärte. Verglichen mit den anderen war es nicht gerade ein Meisterwerk. Dennoch war etwas Besonderes daran.
Wenn sie müde von einem Tag in der großen Stadt zurückkehrten, verschwand Stephen in der engen Küche und bereitete chocolat chaud zu, während der kleine Armand zu den Bildern ging.
Unweigerlich fand Stephen den Jungen jedes Mal vor dem kleinen Aquarell vor, als stünde er vor einem Fenster, hinter dem ein kleines Dorf in einem stillen Tal lag.
»Das ist wertlos«, hatte Stephen gesagt.
Ob wertlos oder nicht, es war das Lieblingsbild des jungen Armand. Bei jedem Besuch kehrte er dorthin zurück. Instinktiv wusste er, dass etwas, das einem einen solchen Frieden schenkte, großen Wert besaß.
Und er vermutete, dass auch sein Patenonkel es so empfand. Sonst hätte er das Bild nicht zu all den Meisterwerken gehängt.
Wenige Monate nachdem Armands Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, hatte Stephen den Neunjährigen das erste Mal mit nach Paris genommen. Gemeinsam waren sie durch die Stadt spaziert. Schweigend, damit der stille kleine Junge seinen Gedanken nachhängen konnte.
Irgendwann hatte Armand den Kopf gehoben und angefangen, seine Umgebung zu erfassen. Die breiten Boulevards, die Brücken. Notre-Dame, den Eiffelturm, die Seine. Die Brasserien, vor denen die Pariser an runden Marmortischen saßen und Espresso, Bier oder Wein tranken.
An jeder Straßenkreuzung nahm Stephen seine Hand und hielt sie fest, bis sie sicher auf der anderen Seite waren.
Langsam begriff der junge Armand, dass er in Sicherheit war, dass er bei diesem Mann immer in Sicherheit sein würde. Dass er es auf die andere Seite schaffen würde.
Und langsam, ganz langsam kehrte er ins Leben zurück.
Hier. In Paris.
Eines Morgens hatte sein Patenonkel dann gesagt: »Heute, garçon, gehen wir an meinen Lieblingsort in ganz Paris. Und danach essen wir ein Eis im Lutetia.«
Sie waren den Boulevard Raspail entlangspaziert und links in die Rue de Varenne eingebogen. An den Läden und Patisserien vorbei. Armand blieb vor den Schaufenstern stehen und betrachtete die Mille-feuilles, Madeleines und pains aux raisins.
In eine der Patisserien gingen sie hinein, und Stephen kaufte zwei tartelettes au citron und gab Armand die kleine Papiertüte zum Tragen.
Und dann waren sie schließlich am Ziel und standen vor einem in eine Mauer eingelassenen Tor.
Nachdem sie den Eintritt bezahlt hatten, gingen sie durch.
Armand dachte nur an die Leckerei in der Tüte und hatte kaum einen Blick für seine Umgebung. Es kam ihm vor, als müsste er eine Aufgabe erfüllen, bevor es die Belohnung gab.
Er öffnete die Tüte und sah hinein.
Stephen legte dem Jungen die Hand auf den Arm. »Geduld. Geduld. Mit der Geduld kommen die Entscheidungsmöglichkeiten, und damit kommt die Macht.«
Die Worte sagten dem hungrigen kleinen Jungen nichts, außer dass er das Törtchen noch nicht essen durfte.
Zögernd schloss Armand die Tüte wieder, dann sah er sich um.
»Was sagst du?«, fragte Stephen, als sein Patensohn erstaunt die Augen aufriss.
Er konnte die Gedanken des Jungen lesen. Wobei das, zugegeben, nicht sehr schwer war.
Wer hätte gedacht, dass es irgendwo auf der Welt einen solchen Ort gab, noch dazu mitten in der Stadt, versteckt hinter hohen Mauern? Es war eine eigene Welt. Ein verzauberter Garten.
Allein wäre Armand bestimmt daran vorbeigegangen, seine Gedanken von dem unangetasteten Törtchen gefesselt, und hätte nie entdeckt, was hinter den Mauern lag, nie das wunderschöne Château mit den hohen Fenstern und der breiten Terrasse erblickt.
Nicht, dass er schon abgestumpft gewesen wäre, aber inzwischen war er an die prachtvollen Gebäude in Paris gewöhnt. Die Stadt war voll davon. Was ihn jedoch in Erstaunen versetzte, waren die Gärten.
Die gepflegten Rasenflächen, die zu Kegeln getrimmten Bäume. Die Springbrunnen.
Aber anders als der Jardin du Luxembourg, der beeindrucken sollte, wirkte dieser Garten beinahe intim.
Und dann waren da auch noch die Statuen, die zwischen dem Grün standen. Als hätten sie geduldig gewartet. Auf sie.
Hin und wieder drang das Heulen einer Sirene über die Mauern. Hupen. Rufe.
Das alles verstärkte den Eindruck des tiefen Friedens, den Armand in diesem Garten spürte. Eines Friedens, den er seit dem leisen Klopfen an der Haustür nicht mehr empfunden hatte.
Langsam spazierten die beiden herum, und zum ersten Mal führte Stephen Armand nicht, sondern folgte ihm zu jeder der Statuen von Rodin, vor denen der Junge stehen blieb.
»Die Bürger von Calais«, hatte Stephen mit leiser, beruhigender Stimme gesagt. »Im Hundertjährigen Krieg belagerte der englische König Edward die französische Hafenstadt Calais.«
Er blickte zu Armand, ob er auch zuhörte, aber es ließ sich nicht erkennen.
»Die Bürger befanden sich in großer Not. Durch die englische Belagerung war die Versorgung unterbrochen, und sie hatten nichts mehr zu essen. Der französische König Philip hätte Verhandlungen aufnehmen können, um die Stadt aus ihrer Notlage zu befreien. Aber er griff nicht ein. Er ließ sie verhungern. Immer mehr Männer, Frauen und Kinder starben.«
Jetzt drehte Armand sich um und sah zu Stephen hoch. Der Junge wusste vielleicht nicht, was Krieg bedeutete. Aber er wusste, was Sterben bedeutete.
»Wirklich? Der König hätte etwas tun können, aber er hat sie sterben lassen?«
»Das gilt für beide Könige. Ja. Weil beide siegen wollten. So ist der Krieg.« Stephen sah die Verwirrung und Erschütterung in den dunkelbraunen Augen des Jungen. »Soll ich weitererzählen?«, fragte er.
»Oui, s’il te plaît.« Damit drehte sich Armand wieder zu der Statue und den in der Zeit erstarrten Menschen.
»Gerade als die völlige Katastrophe drohte, tat König Edward etwas, womit niemand mehr gerechnet hatte. Er beschloss, sich der Einwohner von Calais zu erbarmen. Allerdings verlangte er dafür eine Gegenleistung. Er würde die Einwohnerschaft verschonen, wenn sich ihm sechs angesehene Bürger auslieferten. Ohne dass er es ausdrücklich sagte, wussten alle, dass er sie hinrichten lassen würde. Als Warnung für alle, die sich ihm widersetzen wollten. Sie würden sterben, damit alle anderen leben konnten.«
Stephen sah, wie sich Armands Schultern hoben und wieder senkten.
»Eustache de Saint-Pierre, der das höchste Ansehen genoss, meldete sich als Erster. Das hier ist er.« Stephen deutete auf eine der Statuen. Ein dünner, grimmiger Mann. »Fünf weitere folgten ihm. Man befahl ihnen, sich bis auf das Unterzeug auszuziehen, sich eine Schlinge um den Hals zu legen und die Schlüssel der Stadt und des Schlosses zu den großen Toren zu bringen. Und das taten sie. Die Bürger von Calais.«
Armand hob den Kopf und sah Eustache in die Augen. Anders als bei den anderen Statuen, die er überall in Paris gesehen hatte, erblickte er hier keinen Triumph. Da waren keine Engel, die bereit waren, diese Männer ins Paradies zu tragen. Das war kein furchtloses Opfer. Sie schritten nicht hoch- erhobenen Hauptes in ein glanzvolles Martyrium.
Der Junge sah Angst. Verzweiflung. Resignation.
Die Bürger dieser Stadt am Meer fürchteten sich.
Aber sie taten es dennoch.
Armands Unterlippe fing an zu zittern, und sein Kinn kräuselte sich. Stephen fragte sich, ob er zu weit gegangen war, als er dem Jungen die Geschichte erzählt hatte.
Er berührte die Schulter seines Patensohnes, und der drehte sich rasch herum und vergrub sein Gesicht in seinem Pullover, schlang die Arme um ihn. Aber es war keine Umarmung, er umklammerte ihn. Wie man einen Pfeiler umklammert, um nicht fortgerissen zu werden.
»Sie wurden gerettet, Armand«, sagte Stephen schnell, ging in die Knie und hielt den schluchzenden Jungen fest. »Sie wurden nicht hingerichtet. Der König schenkte ihnen ihr Leben.«
Es dauerte einen Moment, bis diese Worte zu Armand vorgedrungen waren. Dann löste er sich aus Stephens Armen, wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht und sah ihn an.
»Wirklich?«
»Ja.«
»Ganz ehrlich?« Armand rang schluchzend nach Atem.
»Ja, ganz ehrlich, garçon. Sie haben alle überlebt.«
Der kleine Junge dachte nach, den Blick auf seine Turnschuhe gerichtet, dann sah er Stephen in die klaren blauen Augen. »Würdest du das auch tun?«
Stephen wusste, was er fragte, und hätte beinahe »Ja, natürlich« geantwortet. Aber er hielt inne. Der Junge verdiente die Wahrheit.
»Mein Leben geben? Ja, für Menschen, die ich liebe, würde ich das tun.« Er drückte die schmalen Schultern und lächelte.
»Und für Fremde?«
Stephen, der seinen Patensohn erst noch richtig kennenlernen musste, wurde klar, dass er sich nicht mit einer oberflächlichen Antwort zufriedengeben würde. Dieses Kind hatte bei aller Zurückhaltung etwas Unbarmherziges an sich.
»Das hoffe ich, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht.«
Armand nickte, sah erneut die Statue an und straffte die Schultern.
»Es war gemein.« Er sprach mit den Bürgern. »Was der König gemacht hat. Dass er sie denken ließ, sie müssten sterben.«
Sein Patenonkel nickte. »Aber es zeugt von seinem Mitgefühl, dass er sie begnadigt hat. Das Leben kann grausam sein. Aber es kann es auch gut mit einem meinen. Es ist voller Wunder. Das darfst du nie vergessen. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen, Armand. Worauf willst du dich konzentrieren? Auf das, was ungerecht ist, oder auf all die Wunder? Beides gibt es, beides ist wahr. Beides muss man akzeptieren. Was hat für dich mehr Bedeutung?« Stephen tippte dem Jungen auf die Brust. »Das Schreckliche oder das Wundervolle? Das Gute oder das Grausame? Dein Leben wird davon abhängen, welche Entscheidung du triffst.«
»Und Geduld?«, fragte Armand, und Stephen sah etwas, das er bislang noch nicht bemerkt hatte. Etwas leicht Verschmitztes.
Der Junge hörte also doch zu. Nahm alles auf. Und Stephen Horowitz wurde bewusst, dass er vorsichtig sein musste.
Vor den Bürgern von Calais stand keine Bank, und deshalb führte Stephen Armand zu seinem Lieblingswerk von Rodin.
Sie öffneten die braune Papiertüte und aßen ihre tartelettes au citron vor dem Höllentor. Stephen erzählte Armand von diesem bemerkenswerten Werk und klopfte hin und wieder den Puderzucker von seinem Pulli.
»Ich kann es immer noch nicht glauben«, sagte Stephen fünfzig Jahre später, als sie vor ebendieser Skulptur saßen und wieder tartelettes au citron aßen, »dass du vorhattest, Reine-Marie vor dem Höllentor einen Antrag zu machen. Wobei diese Idee demselben Hirn entsprang, das es für eine gute Idee hielt, Reine-Maries Mutter beim Antrittsbesuch eine Badematte als Gastgeschenk mitzubringen.«
»Daran erinnerst du dich?«
Aber natürlich tat er das. Stephen Horowitz vergaß nichts.
»Zum Glück hast du mich um Rat gefragt, bevor du um Reine-Maries Hand angehalten hast, garçon.«
Armand lächelte. Eigentlich war er an diesem Frühlingstag vor fünfunddreißig Jahren nicht in Stephens Büro oberhalb von Montréal gekommen, um seinen Rat einzuholen. Er wollte ihm einfach nur sagen, dass er beschlossen hatte, seiner Freundin, mit der er seit zwei Jahren zusammen war, einen Heiratsantrag zu machen.
Als Stephen das hörte, war er um seinen Schreibtisch herumgegangen und hatte den jungen Mann fest umarmt. Dann hatte er knapp genickt und sich abgewandt. Während er ein Taschentuch zückte, hatte er einen kurzen Moment aus dem Fenster geblickt. Über den Mont Royal hinweg, der über der Stadt thronte. In den wolkenlosen Himmel.
Dann hatte er sich wieder umgedreht und den Mann gemustert, den er seit seiner Geburt kannte.
Der inzwischen größer war als er. Kräftig. Glatt rasiert mit welligen dunklen Haaren und dunkelbraunen Augen, die ernst und zugleich freundlich dreinblickten, und ja, nach wie vor etwas verschmitzt.
Armand war in Cambridge gewesen, um dort Englisch zu lernen, aber statt Jura oder Wirtschaft zu studieren, wozu ihm sein Patenonkel geraten hatte, hatte sich der junge Armand nach seiner Rückkehr nach Québec an der Akademie der Sûreté eingeschrieben.
Er hatte eine Entscheidung getroffen.
Und er hatte ein Wunder entdeckt. Und zwar in Gestalt einer jungen Bibliothekarin in der Bibliothèque et Archives nationales in Montréal, die Reine-Marie Cloutier hieß.
Stephen hatte seinen Patensohn zur Feier des Tages ins nahe gelegene Ritz zum Mittagessen eingeladen.
»Wo willst du ihr den Antrag machen?«, hatte Stephen gefragt.
»Rate mal.«
»In Paris.«
»Ja. Sie war noch nie dort.«
Armand und sein Patenonkel waren jedes Jahr nach Paris gereist. Sie hatten die Stadt erkundet, neue Plätze entdeckt. Spätnachmittags hatten sie gegenüber von Stephens Wohnung im Hotel Lutetia Eis gegessen. Die Kellner waren immer um den Jungen herumgeschwirrt und taten es auch noch, als er längst erwachsen war.
Zora, die für Armand wie eine Großmutter gewesen war und ihn aufgezogen hatte, mochte es nicht, dass er in das Hotel ging, allerdings verstand Armand erst Jahre später den Grund dafür.
»Das ist unser kleines Geheimnis«, hatte Stephen deshalb gesagt.
Genauso wenig mochte Zora Stephen. Auch den Grund dafür erfuhr Armand erst Jahre später. Und ihm wurde klar, dass crème glacée im Lutetia das geringste der Geheimnisse seines Patenonkels war.
Bei einem Glas Champagner im Ritz in Montréal hatte Armand Stephen von seinen Plänen berichtet.
Als er fertig war, hatte sein Patenonkel ihn angestarrt.
»Herrje, garçon«, hatte Stephen gesagt. »Das Höllentor? Und dir haben sie eine Waffe in die Hand gedrückt?«
Stephen war damals Ende fünfzig gewesen und auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Finanzmagnat schüchterte jeden ein, der ihm begegnete. Armand vermutete, dass sich sogar die Möbel wegduckten, wenn Stephen Horowitz einen Raum betrat.
Das lag nicht nur an seiner Ausstrahlung und dem ungeheuren Reichtum, den er angehäuft hatte und immer weiter vergrößerte, sondern auch an seiner Bereitschaft, Macht und Geld dafür einzusetzen, all jene zu vernichten, die er für Gauner hielt.
Manchmal brauchte er Jahre dafür, aber letztlich brachte er sie zu Fall. Macht und Geduld. Stephen Horowitz verfügte über beides.
Er war ein überaus freundlicher Mann und absolut gnadenlos. Wenn er seine leuchtend blauen Augen auf jemanden richtete, dann begann derjenige zu zittern.
Außer Armand.
Nicht etwa, weil er nie im Fadenkreuz gewesen wäre, sondern weil er keine Angst davor hatte, von Stephen verletzt zu werden. Vielmehr fürchtete er sich davor, ihn zu verletzen. Ihn zu enttäuschen.
Er hatte mit Stephen diskutiert. Er hatte ihm erklärt, dass er Reine-Marie liebte und dass er den stillen Garten inmitten von Paris liebte.
»Gibt es einen schöneren Ort für einen Heiratsantrag?«
»Keine Ahnung«, hatte Stephen gesagt und Armand herausfordernd angesehen. »Die Metro vielleicht? Die Katakomben? Das Leichenschauhaus? Verdammt noch mal, garçon, alles ist schöner als vor dem Höllentor.«
Nach kurzem Schweigen hatte Armand leise gelacht. Weil er wusste, was Stephen meinte.
Die Bank, die er im Kopf hatte, war für ihn nicht die, die vor dem Höllentor stand. Es war die, auf der er sich in einem gewissen Maß von der vernichtenden Trauer hatte befreien können. Auf der er gemerkt hatte, dass es möglich war, Frieden zu finden. Glück empfunden hatte, mit Zitronencreme am Kinn und Puderzucker auf dem Pullover.
Neben seinem Patenonkel sitzend, hatte er vor dem Höllentor eine Zufluchtsstätte gefunden.
»Ich sage dir, wo du es tun solltest«, erklärte Stephen. Und sagte es.
Das war vor fünfunddreißig Jahren gewesen.
Mittlerweile hatten Armand und Reine-Marie zwei erwachsene Kinder. Daniel und Annie. Drei Enkelkinder. Die bevorstehende Geburt von Annies zweitem Kind hatte sie nach Paris geführt.
Armand war jetzt in demselben Alter, in dem Stephen gewesen war, als sie sich über den Heiratsantrag unterhalten hatten. Armand, über eins achtzig und kräftig gebaut, war mittlerweile fast vollständig ergraut, und die Zeit und das Gewicht schwieriger Entscheidungen hatten Falten in seinem Gesicht hinterlassen.
Eine tiefe Narbe an seiner Schläfe zeugte von dem Tribut, den sein Job gefordert hatte. Dem Lohn dafür, ein hochrangiger Beamter der Sûreté du Québec zu sein.
Aber es gab auch andere Falten. Tiefere. Die von seinen Augen und seinem Mund wegführten. Lachfalten.
Auch sie zeugten von den Entscheidungen, die Armand getroffen hatte. Und dem Gewicht, das er ihnen beimaß.
Stephen war jetzt dreiundneunzig, und auch wenn er gebrechlicher wurde, war er immer noch eine beeindruckende Erscheinung. Nach wie vor ging er jeden Tag arbeiten und versetzte jene in Angst und Schrecken, die es nicht besser verdienten.
Seine Konkurrenten würde es nicht überraschen, dass die Skulptur, die Stephen Horowitz am meisten schätzte, Rodins Höllentor war. Über dem der berühmte Denker thronte. Darunter die in den Abgrund taumelnden Seelen.
Wieder einmal saßen Patenonkel und Patensohn nebeneinander auf der Bank und aßen im Sonnenschein ein Törtchen.
»Zum Glück konnte ich dich überzeugen, deinen Antrag im Jardin du Luxembourg zu machen«, sagte Stephen.
Armand wollte ihn schon korrigieren. Es war nämlich woanders gewesen.
Stattdessen schwieg er und betrachtete seinen Patenonkel.
Ließ sein Gedächtnis doch langsam nach? Das wäre in seinem Alter nur natürlich, und trotzdem war es für Armand unvorstellbar. Er streckte die Hand aus und wischte Puderzucker von Stephens Jackett.
»Wie geht es Daniel?«, fragte Stephen und schob Armands Hand weg.
»Dem geht’s gut. Seit die Mädchen in der Schule sind, arbeitet Roslyn wieder für das Designlabel.«
»Macht Daniel die Arbeit Spaß? Will er hierbleiben?«
»Ja. Er ist sogar befördert worden.«
»Ja, das weiß ich.«
»Woher weißt du das denn schon wieder?«
»Ich habe geschäftlich mit der Bank zu tun. Ich glaube, Daniel ist jetzt für Risikokapital zuständig.«
»Ja. Hast du etwa …«
»Für seine Beförderung gesorgt? Nein. Aber wir beide treffen uns hin und wieder, wenn ich in Paris bin. Dann unterhalten wir uns. Er ist ein guter Junge.«
»Ja, ich weiß.« Armand fand es seltsam, dass Stephen glaubte, ihm das sagen zu müssen. Als würde er seinen eigenen Sohn nicht kennen.
Das Nächste, was Stephen sagte, war noch seltsamer. »Sprich mit Daniel. Versöhn dich mit ihm.«
Konsterniert sah Armand Stephen an. »Pardon?«
»Daniel. Ihr müsst Frieden miteinander schließen.«
»Das haben wir doch. Schon vor Jahren. Es ist wieder alles in Ordnung.«
Die scharfen blauen Augen erwiderten Armands Blick. »Bist du dir da so sicher?«
»Was weißt du, Stephen?«
»Nur das, was du auch weißt. Dass alte Wunden tief sitzen. Sie können sich entzünden. Bei anderen ist dir das bewusst, aber bei deinem eigenen Sohn übersiehst du es.«
Armand verspürte einen kurzen Anflug von Ärger, wusste aber genau, was dahintersteckte. Schmerz. Und dahinter Angst. Er hatte den Konflikt mit seinem Sohn doch bereinigt. Schon vor Jahren. Ganz sicher. Oder nicht? »Was genau meinst du?«
»Was glaubst du, warum Daniel nach Paris gegangen ist?«
»Aus demselben Grund, aus dem Jean-Guy und Annie hierhergezogen sind. Man hat ihnen hervorragende Stellen angeboten.«
»Und seither ist zwischen euch alles gut?«
»Bis auf die eine oder andere Unstimmigkeit, ja.«
»Das freut mich.«
Allerdings wirkte Stephen weder erfreut noch überzeugt. Bevor Armand nachhaken konnte, sprach Stephen weiter. »So viel zu Daniel. Und wie steht es mit deiner Tochter und Jean-Guy? Haben sie sich in Paris schon eingelebt?«
»Ja. Es dauert natürlich seine Zeit. Annie ist in Mutterschaftsurlaub, und Jean-Guy gewöhnt sich langsam an die Arbeit in der freien Wirtschaft. Einfach war es am Anfang nicht.«
»Das kann ich mir vorstellen. Jetzt, wo er nicht mehr bei der Sûreté ist, darf er niemanden mehr verhaften«, sagte Stephen, der Jean-Guy Beauvoir gut kannte, mit einem Lächeln. »Das muss ihn hart ankommen.«
»Ja, er hat versucht, eine Kollegin, die sich bei der Essensausgabe vorgedrängelt hat, in Gewahrsam zu nehmen, aber er lernt schnell. Es hatte keine Konsequenzen. Zum Glück hat er behauptet, er heiße Stephen Horowitz.«
Stephen lachte.
Es wäre schlichtweg eine Untertreibung gewesen zu behaupten, es sei bloß eine Frage der Gewohnheit, wenn man vom Posten eines Chief Inspector bei der Sûreté du Québec auf den Leitungsposten einer Abteilung in einem multinationalen Technologiekonzern in Paris wechselte.
Noch schwieriger war es, dabei ohne Waffe auszukommen.
»Dass Daniel und Roslyn in Paris sind, hat sehr geholfen.« Während Armand sprach, beobachtete er die Reaktion seines Patenonkels.
In den vielen Jahren als leitender Beamter bei der Sûreté und Jean-Guys Chef hatte er gelernt, Gesichter zu lesen.
Er war eher Forscher als Jäger und erkundete als solcher die Gedankenwelt anderer, vor allem aber ihre Gefühlswelt. Denn dort hatte ihr Tun seinen Ursprung.
Großmütige Taten und solche von größter Grausamkeit.
Aber sosehr er sich auch bemühte, hatte Armand Schwierigkeiten, seinen Patenonkel zu durchschauen.
Eine Zeit lang hatte er gedacht, er befände sich in einer privilegierten Position und hätte einen besonders intimen Blick auf diesen bemerkenswerten Mann. Aber im Laufe der Jahre fing er an, sich zu fragen, ob nicht eher das Gegenteil der Fall war. Vielleicht war er ihm zu nahe. Vielleicht sahen andere Stephen klarer, umfassender.
Für ihn war er immer noch der Mann, der seine Hand genommen und ihn beschützt hatte.
Andere, wie seine Großmutter Zora, sahen etwas anderes in ihm.
»Wie geht’s Annie?«, fragte Stephen. »Sind sie auf ihre Tochter vorbereitet?«
»So gut man das sein kann, denke ich.«
»Es war eine gewichtige Entscheidung.«
»Ja.« Das war nicht zu leugnen. »Das Baby kann jetzt jeden Tag kommen. Du wirst sie heute Abend beim Essen sehen. Ich habe für uns alle im Juveniles reserviert. Um acht.«
»Wunderbar.« Stephen öffnete den Reißverschluss seiner Innentasche und zeigte Armand die Notiz in seinem schmalen Kalender. »Davon ging ich aus.«
Dort stand bereits Familie und darunter Juveniles.
»Reine-Marie und ich werden dich abholen.«
»Nein, nein. Ich bin vorher zu einem Drink verabredet. Wir treffen uns dort.« Stephen blickte geradeaus. Sah den Denker an.
»Was geht dir durch den Kopf?«, fragte Armand.
»Dass ich keine Angst habe zu sterben. Ich habe nur ein wenig Angst, in der Hölle zu landen.«
»Wie kommst du darauf?«, fragte Armand, erschüttert von den Worten.
»Das ist die natürliche Sorge eines Dreiundneunzigjährigen, der auf sein Leben zurückblickt.«
»Und was siehst du da?«
»Ich sehe viel zu viel Eiscreme.«
»Das kann nicht sein.« Armand hielt einen Moment inne, bevor er weitersprach. »Ich sehe einen guten Menschen. Einen mutigen Menschen. Du hast die Welt besser gemacht.«
Stephen lächelte. »Nett, dass du das sagst, aber du weißt nicht alles.«
»Kommt jetzt ein Geständnis?«
»Nein, bestimmt nicht.« Stephen streckte die Hand aus und fasste Armand am Handgelenk. Sah ihm fest in die Augen. »Ich habe immer die Wahrheit gesagt.«
»Das weiß ich.« Armand legte seine warme Hand über Stephens kalte und drückte sie sanft. »Vorhin, als wir uns gesetzt haben, hast du gesagt, die Hölle ist leer und alle Teufel sind hier. Was hast du damit gemeint?«
»Es ist eins von meinen Lieblingszitaten, das weißt du doch«, sagte Stephen.
Das stimmte. Stephen zitierte gerne diese Zeilen aus Shakespeares Sturm, um Konkurrenten und Kollegen aus der Fassung zu bringen. Und Freunde und Zufallsbekanntschaften im Flugzeug.
Aber dieses Mal hatte er es verändert. Dieses Mal hatte Stephen etwas hinzugefügt. Zum ersten Mal, soweit Armand sich erinnerte.
Er hatte es präzisiert.
»Du hast gesagt, die Teufel sind nicht genau hier.« Armand hob die Hände und ahmte Stephens Geste nach. »Warum hast du das gesagt?«
»Wer weiß das schon? Ich bin ein alter Mann. Hör auf, mich zu piesacken.«
»Wenn die Teufel nicht hier sind, wo sind sie dann?«
Mittlerweile hatten die Schatten sie erreicht, und es wurde kühl.
»Das solltest doch gerade du wissen.« Stephen wandte sich zu ihm. Aber nicht gegen ihn. Es war eine langsame, bedachte Bewegung. »Du bist den Teufeln oft genug begegnet. Du verdienst damit deinen Lebensunterhalt.« Er sah ihm in die Augen. »Ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohn.«
Mein Sohn.
So hatte Stephen ihn noch nie genannt. Nicht ein einziges Mal in fünfzig Jahren.
Garçon, Junge, das schon. Mit großer Zuneigung. Aber es war nicht dasselbe wie mein Sohn.
Armand wusste, dass Stephen dieses Wort bewusst niemals benutzt hatte. Um nicht das Andenken an seinen verstorbenen Vater zu stören und dessen Platz in seinem Leben einzunehmen.
Aber jetzt hatte er es getan. War es ihm versehentlich passiert? Ein Hinweis auf Alter und Schwäche? Darauf, dass seine Selbstbeherrschung nachließ und seine wahren Gefühle zum Vorschein kamen? Mit diesem einen kleinen Wort.
»Mach dir wegen der Teufel keine Sorgen, Armand. Es ist ein schöner Septembernachmittag, wir sind in Paris, und deine Enkelin kommt bald zur Welt. Das Leben ist schön.« Stephen tätschelte Armands Knie, dann stützte er sich darauf ab, um sich auf die Füße zu stemmen. »Nun komm, garçon. Bring mich nach Hause.«
Wie immer blieben sie vor den Bürgern von Calais stehen. Um in die grimmigen, entschlossenen Gesichter zu blicken.
»Nur zur Erinnerung.« Stephen sah seinen Patensohn an.
Armand erwiderte seinen Blick und nickte.
Dann gingen die beiden Männer langsam die Rue de Varenne entlang. Beim Überqueren der Straße nahm Armand Stephens Arm. Sie spazierten an Antiquitätenläden vorbei und machten halt bei einer Patisserie, wo Armand für Reine-Marie ein pain aux raisins escargot kaufte, das sie besonders mochte. Und ein Croissant für Stephen zum Frühstück.
Vor der rot lackierten hohen Doppeltür zu dem Haus, in dem Stephen wohnte, sagte der alte Mann: »Geh nur. Ich mache vielleicht noch einen Abstecher ins Lutetia auf einen Aperitif.«
»Mit Aperitif meinst du Eiscreme, oder?«
Erst als Armand auf dem Weg zu seiner Wohnung im Marais den Pont d’Arcole überquerte, dämmerte ihm, dass er keine Antwort auf seine Frage erhalten hatte. Vielleicht hatte Stephen ihn auch bewusst abgelenkt.
Weg von den Teufeln. Die irgendwo hier waren. Genau hier. In Paris.
2
Jean-Guy Beauvoir glaubte zu spüren, wie sich Kälte in seinem sonnendurchfluteten Büro ausbreitete.
Wohl wissend, wen er sehen würde, hob er den Blick vom Bildschirm. Abgesehen von dem kühlen Luftzug, umgab die stellvertretende Abteilungsleiterin stets ein zarter Duft. Die Kälte, das wusste Beauvoir, war Einbildung, der Geruch nicht.
Es war tatsächlich Séverine Arbour, die in seiner Tür stand. Sie lächelte ihr leicht herablassendes Lächeln. Sie trug es wie einen Seidenschal zu ihrer Designerkleidung. Beauvoir kannte sich mit Mode nicht aus und konnte nicht sagen, ob Arbour Chanel, Yves Saint Laurent oder auch Givenchy trug. Aber zumindest kannte er die Namen, seit er in Paris war. Und er erkannte Haute Couture, wenn er sie sah.
Und gerade sah er sie.
Madame Arbour war Mitte vierzig und eine elegante Erscheinung, der Inbegriff von soignée. Eine Pariserin durch und durch.
Das Einzige, was er von dem, das sie trug, benennen konnte, war ihr Duft.
Sauvage von Dior. Ein Eau de Cologne für Männer.
Er fragte sich, ob eine Botschaft dahintersteckte und ob er mit seinem Eau de Cologne von Brut zu Boss wechseln sollte. Aber er entschied sich dagegen. Ihr Verhältnis war angespannt genug, da musste er nicht auch noch einen Parfümkrieg mit seiner Nummer zwei vom Zaun brechen.
»Viele Frauen tragen Männerdüfte«, hatte Annie gesagt, als er ihr davon erzählte. »Und Männer tragen Frauendüfte. Die Unterscheidung ist reines Marketing. Wenn dir der Duft gefällt, ist doch nichts dagegen einzuwenden, oder?«
Dann hatte sie ihm zehn Euro geboten, wenn er ihr Eau de Toilette am nächsten Tag im Büro tragen würde. Er hatte eingeschlagen. Wie es der Teufel wollte, lud ihn seine Chefin Carole Gossette genau an diesem Tag zum Mittagessen ein. Das erste Mal.
Er ging in ihren Club, den Cercle de l’Union Interalliée, und roch nach Aromatics Elixier von Clinique. Es war genau der Duft, den auch die Vizepräsidentin des riesigen Technologiekonzerns trug.
Es schien sie für ihn einzunehmen.
Um es ihm gleichzutun, ging Annie an diesem Tag nach Brut duftend in die Kanzlei. Bisher waren ihre männlichen Kollegen höflich, aber distanziert gewesen. Erst mal sollte sich die avocate aus Québec beweisen. An diesem Tag wurden sie nahbarer. Sie begegneten ihr sogar mit mehr Respekt. Sie und ihr Duft wurden in die Herde aufgenommen.
Genau wie ihr Vater gehörte Annie Gamache nicht zu den Menschen, die sich einem unverhofften Vorteil verschlossen. Fortan trug sie das Eau de Cologne bis zu dem Tag, an dem sie in Mutterschaftsurlaub ging.
Jean-Guy dagegen legte ihr Parfüm nicht wieder auf, auch wenn er den weichen Geruch eigentlich lieber mochte als den von Brut. Das Parfüm roch nach Annie, und das beruhigte ihn und machte ihn froh.
Séverine Arbour stand in der Tür und trug ein freundliches Lächeln mit einer Kopfnote nebulöser Feindseligkeit und einer Basisnote Hochnäsigkeit.
Spielte sie auf Zeit? Wartete sie auf die Gelegenheit, ihm ein Messer in den Rücken zu rammen? Beauvoir vermutete es, wusste aber zugleich, dass die Unternehmenspolitik dieses multinationalen Players im Vergleich zu der Brutalität in der Sûreté du Québec nichts war.
Dieses Messer würde wenigstens nur symbolisch sein.
Beauvoir hatte gehofft, dass Madame Arbour ihn im Laufe der Zeit als Abteilungsleiter akzeptieren würde. Aber in den knapp fünf Monaten, die er nun hier war, hatten sie nicht mehr als gegenseitiges Misstrauen entwickelt.
Er hatte den Verdacht, dass sie ihn absägen wollte.
Sie hatte den Verdacht, dass er inkompetent war.
Eine leise Stimme sagte Jean-Guy Beauvoir, dass sie beide recht haben könnten.
Madame Arbour setzte sich auf den Stuhl ihm gegenüber und sah ihn geduldig an.
Beauvoir wusste sehr wohl, dass ihn das aus der Fassung bringen sollte. Aber es würde nicht funktionieren. An diesem Tag konnte ihn nichts aus der Fassung bringen.
Sein zweites Kind würde bald auf die Welt kommen.
Annie war gesund, genau wie ihr kleiner Sohn Honoré.
Er mochte seine Arbeit, wenn er auch noch keinen richtigen Durchblick hatte.
Sie waren in Paris. Paris, unglaublich!
Wenn er ehrlich war, war es ihm immer noch ein Rätsel, wie ein kleiner Rotzlöffel, der in den Gassen des East End von Montréal Hockey gespielt hatte, zu einem Managerposten in Paris kam.
Dass Freitagnachmittag war, war seiner Laune weiter zuträglich. Armand und Reine-Marie Gamache waren aus Montréal eingetroffen, und heute Abend würden sie alle in einem ihrer Lieblingsbistros zu Abend essen.
»Ja?«, sagte er.
»Sie wollten mich sprechen?«, sagte Madame Arbour.
»Nein. Wie kommen Sie darauf, Séverine?«
Sie deutete auf seinen Laptop. »Ich habe Ihnen ein Dokument geschickt. Zu dem Seilbahnprojekt in Luxemburg.«
»Ja. Das lese ich gerade.« Er sagte nicht, dass er es bereits zum zweiten Mal las und immer noch nicht verstand, worum es ging. Außer dass es ein Aufzug einen Felsen hoch war. In Luxemburg.
»Wollen Sie mir etwas dazu sagen?« Er nahm seine Brille ab.
Er hatte bald Feierabend, und seine Augen waren müde, aber er würde den Teufel tun und sie sich reiben.
Instinktiv wusste Jean-Guy Beauvoir, dass es ein Fehler wäre, vor dieser Frau Schwäche zu zeigen. Sei es körperliche, seelische oder intellektuelle.
»Ich dachte nur, dass Sie vielleicht Fragen haben«, sagte sie. Und schwieg dann erwartungsvoll.
Beauvoir musste zugeben, dass sich ein Schatten auf seine gute Stimmung legte.
Mit Verbrechern konnte er umgehen. Und damit meinte er nicht Taschendiebe oder minderbemittelte Schlägertypen, sondern die Schlimmsten der Schlimmen. Mörder. Nicht zu vergessen: eine verrückte Dichterin mit Ente.
Er hatte gelernt, sie von sich fernzuhalten. Abgesehen von der Ente, natürlich.
Und doch schaffte es Séverine Arbour irgendwie, ihm auf die Pelle zu rücken. Wenn sie es bislang auch noch nicht geschafft hatte, bis in seinen Kopf vorzudringen.
Was aber nicht daran lag, dass sie es nicht versucht hätte.
Er wusste auch, warum. Das hätte selbst ein minderbemittelter Schlägertyp kapiert.
Sie wollte seine Stelle. Glaubte, dass sie ein Recht darauf hatte.
Fast hatte er Mitleid mit ihr. Schließlich war es eine tolle Stelle.
Wie jeden Freitag hatte Beauvoir mit seiner Chefin Carole Gossette in einer nahe gelegenen Brasserie zu Mittag gegessen. Der vorige Lunch hatte in zehntausend Meter Höhe stattgefunden, als sie im Firmenjet nach Singapur geflogen waren.
Zwei Wochen davor war er in Dubai gewesen.
Seine erste Geschäftsreise hatte ihn auf die Malediven geführt. Dort sollte er sich das Riffschutzsystem ansehen, das sie bei dem winzigen Archipel im Indischen Ozean bauten. Es hatte eine Weile gedauert, bis er im Atlas die Inselgruppe entdeckt hatte, die an der Südspitze von Indien hing.
Einen Monat zuvor war er in Québec im vereisten Matsch herumgerutscht, hatte einen Mörder zu verhaften versucht und um sein Leben gekämpft, und jetzt aß er Langusten von feinstem Porzellan und näherte sich in einem Privatjet einer tropischen Insel.
Auf dem Flug hatte Madame Gossette, Anfang fünfzig, klein, rundlich, gut gelaunt, ihm die Unternehmensphilosophie erläutert. Warum sie sich für bestimmte Projekte entschieden und für andere nicht.
Sie war Ingenieurin und hatte an der École polytechnique in Lausanne promoviert. In einfachen Worten erklärte sie ihm die Technik, ohne in den belehrenden Ton zu verfallen, in dem Madame Arbour mit ihm sprach.
Beauvoir stellte fest, dass er sich immer öfter an Madame Gossette wandte, wenn er Unterstützung und Informationen brauchte und sich bestimmte Projekte erklären lassen wollte. Eigentlich sollte man erwarten, dass er sich an seine Stellvertreterin wandte, aber er mied Séverine Arbour zunehmend und ging gleich zu Madame Gossette. Ihr wiederum schien es zu gefallen, die Mentorin des Mannes zu sein, den sie selbst rekrutiert hatte.
Allerdings legte sie ihm höflich nahe, sich mehr auf seine Stellvertreterin zu verlassen.
»Lassen Sie sich nicht von ihrer Schroffheit abschrecken«, sagte Madame Gossette. »Séverine Arbour ist sehr gut. Wir sind froh, sie zu haben.«
»Ist ihr vorheriger Arbeitgeber nicht pleitegegangen?«
»Ja, er hat Insolvenz angemeldet. Zu schnell gewachsen.«
»Dann kann sie froh sein, eine neue Stelle gefunden zu haben«, sagte Beauvoir.
Madame Gossette hatte nur auf diese vielsagende französische Art mit den Achseln gezuckt. Was alles bedeuten konnte. Und nichts.
Beauvoir verfiel in Schweigen und las weiter in den Unterlagen, die ihm Madame Gossette gegeben hatte, als sie an Bord gegangen waren. Über Korallen, Strömungen und Schifffahrtswege. Und etwas, das anthropogene Störung hieß.
In der neunten Stunde des zehnstündigen Flugs zu den Malediven stellte er schließlich die Frage, die ihm schon die ganze Zeit auf den Nägeln brannte, obwohl er ein wenig Angst vor der Antwort hatte.
»Warum haben Sie mich eingestellt? Ich bin kein Ingenieur. Sie müssen doch gewusst haben, dass ich so was wie das hier kaum entziffern kann.«
Er hielt das Bündel Papiere in die Höhe. Manchmal hatte er den Verdacht, dass sie den falschen Jean-Guy Beauvoir eingestellt hatten. Dass es irgendwo in Québec einen phantastisch ausgebildeten Ingenieur gab, der sich wunderte, warum er den Job bei GHS Engineering nicht gekriegt hatte.
»Auf die Frage habe ich schon länger gewartet«, sagte Madame Gossette mit einem gutturalen Lachen. Dann sah sie ihn forschend, aber immer noch lächelnd mit ihren klugen Augen an. »Was glauben Sie denn?«
»Ich glaube, Sie glauben, dass in dem Unternehmen etwas nicht stimmt.«
Diese Möglichkeit bestand natürlich auch. Dass sie den richtigen Jean-Guy Beauvoir eingestellt hatte. Den erfahrenen Ermittler bei der Sûreté du Québec. Fähig und hervorragend ausgebildet. Nicht in Ingenieurswissenschaften, sondern in Verbrechensbekämpfung.
Madame Gossette lehnte sich zurück. Musterte ihn. »Warum sagen Sie das? Haben Sie etwas entdeckt?«
»Nein«, sagte er vorsichtig. »Das ist nur ein Gedanke.«
Wenn er ehrlich war, war ihm dieser Gedanke erst in dem Moment gekommen, als er ihn ausgesprochen hatte. Aber kaum war es heraus, wurde ihm klar, dass es eine gewisse Plausibilität hatte.
»Warum sonst sollten Sie einen Cop einstellen, um einen Managementposten zu besetzen, wenn es dafür eindeutig einen Ingenieur braucht?«
»Sie unterschätzen sich, Monsieur Beauvoir. Wir haben Ingenieure wie Sand am Meer. Eh bien, noch ein Ingenieur wäre das Letzte, was wir brauchen.«
»Und was brauchen Sie?«
»Eine Kombination von Fähigkeiten. Eine bestimmte Haltung. Jemanden mit Autorität. Sie haben Frauen und Männer dazu gebracht, Ihnen in lebensgefährlichen Situationen zu folgen. Ich habe die Berichte gelesen. Ich habe die Onlinevideos gesehen.«
Beauvoir schnaubte. Diese geklauten Videos hätten nie ins Netz gestellt werden dürfen. Doch es war passiert, und der Schaden ließ sich nun nicht mehr rückgängig machen.
»Sie erwarten hoffentlich nicht, dass ich dasselbe für GHS tue«, sagte er mit gezwungenem Lächeln.
»Uns in eine solche Schlacht führen? Hoffentlich nicht. Ich würde ein ziemlich großes Ziel abgeben.« Sie lachte und legte ihre Hände auf ihren beeindruckenden Bauch. »Nein. Sie leiten eine neue Abteilung, die eingerichtet wurde, um unsere Kontrollverfahren zu verbessern. Bevor wir uns entschließen, ein Angebot für ein Projekt abzugeben, muss es umfassend geprüft werden. Es muss profitabel sein und gleichzeitig einen Nutzen für die Bevölkerung haben.«
So viel war ihm klar. Es war einer der Gründe, warum er das Angebot von GHS angenommen hatte. Für ihn als Vater von bald zwei Kindern rückten einige beängstigende Wahrheiten über den Zustand der Welt stärker in den Blick.
GHS entwarf Dämme und Straßen, Brücken und Flugzeuge.
Aber mindestens die Hälfte der Projekte betraf Wasseraufbereitungsanlagen, Erosionsbekämpfungsmaßnahmen, Wiederaufforstung. Alternativen zu fossilen Brennstoffen. Katastrophenhilfe.
»Dabei«, unterbrach Madame Gossette seinen Gedankengang und beugte sich vor, »ist es immer empfehlenswert, einen neutralen Beobachter mit im Boot zu haben, um sicherzugehen, dass alles nach Plan läuft. Und das ist Ihr Bereich.«
»Dann liegt also nichts im Argen?«, fragte er.
»Das habe ich nicht gesagt.« Sie wählte ihre nächsten Worte sorgfältig. »Es ist nicht damit getan, eine bestimmte Unternehmensphilosophie zu haben. Man muss sie auch durchsetzen. Und das erwarten wir von Ihnen. Sie sollen keine Pläne entwickeln, das machen andere, vielmehr sollen Sie dafür sorgen, dass sie nicht … wie sagt man? Korrumpiert werden.«
»Haben Sie den Verdacht, dass es im Unternehmen Korruption gibt?«
»Nein, nicht, was Sie denken. Wir haben Sorge, dass einige der Projektmanager in ihrem gut gemeinten Übereifer Abkürzungen nehmen. Das passiert leicht. Lassen Sie sich von der gelackten Oberfläche nicht blenden.« Sie sah sich in der Flugzeugkabine um. »Ein solcher Erfolg ist mit enormem Druck verbunden. Es gibt Deadlines, Vertragsstrafen, Kredite, gewaltsame Umstürze. Und unsere Leute stecken mittendrin. Da können die Prioritäten aus dem Blick geraten. Es wäre normal, dass jemand, der unter großem Druck steht, auf Geschwindigkeit statt Qualität setzt. Und das dann zu verbergen versucht, wenn etwas schiefgeht. Nicht weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie eben Menschen sind. So etwas kann tragisch enden.«
»Was wiederum schlecht fürs Geschäft ist«, sagte er.
Sie breitete die Hände aus. So war es. Sie nahm ihre Teetasse. Nachdem sie einen Schluck getrunken hatte, sagte sie: »Kennen Sie die Gedichte von Auden?«
Ach du Scheiße, dachte Beauvoir. Nicht schon wieder Gedichte. Noch dazu war er in zehntausend Meter Höhe gefangen. Was war nur mit den Chefs los?
»Ich hab von ihm gehört.« Oder von ihr?
»Bis die Straße ins Land der Toten / Aus dem Sprung in der Teetasse wächst.«
»Hat Ihre einen Sprung?«
Sie lächelte und stellte sie ab. »Nicht dass ich wüsste. Aber wenn einer auftaucht, ist es Ihr Job, ihn zu finden.«
Da verstand er, was sie meinte. Und verstand wie durch ein Wunder, was Auden meinte.
»Aber woher soll ich wissen, ob etwas nicht stimmt, wenn ich nicht mal weiß, wie es sich gehört?«
»Deshalb haben Sie ja eine ganze Abteilung Ingenieure an der Hand, inklusive Séverine Arbour. Sie ist eine erstklassige Ingenieurin. Nutzen Sie das.« Madame Gossette sah ihm in die Augen. »Vertrauen Sie ihr.«
Beauvoir nickte, fragte sich aber insgeheim, warum Arbour, wenn sie so eine tolle Ingenieurin war, in seiner Abteilung arbeitete und nicht in ein richtiges Projekt eingebunden war.
»Qualitätskontrolle ist also ein bisschen irreführend. Es geht tatsächlich um Überwachung. Bin ich ein Vollstrecker?«, fragte Beauvoir und schnitt in seine Profiterole.
»Das müssen Sie doch geahnt haben, als Sie in dem Geschenkkorb zur Begrüßung den Schlagring gefunden haben.«
Da lachte er.
»Nein, Sie sind kein Vollstrecker«, sagte sie. »Sie sind unser Sicherheitsnetz. Unsere letzte Hoffnung, dass nichts Schreckliches passiert, wenn etwas schiefgeht.« Todernst sah sie ihm in die Augen. »Ich erwarte nicht, dass es so weit kommt, vermute es auch nicht. Aber ich will sichergehen.«
Interessant, dachte Beauvoir, dass sie »ich« und nicht »wir« sagte.
»Ich habe Ihnen gesagt, warum ich Sie für die Stelle wollte, jetzt müssen Sie mir sagen, warum Sie sie schließlich doch angenommen haben. Sie haben sie mehrmals abgelehnt.«
Das stimmte. Er hatte zweimal abgelehnt, bevor er schließlich einwilligte. Aus welchem Grund?
Er war müde, seine Arbeit in der Sûreté du Québec hatte ihn mürbe gemacht. Nachdem sein Mentor, Chef und Schwiegervater Armand Gamache suspendiert worden war, hatte er die Leitung der Mordkommission übernommen.
Beauvoir hatte miterlebt, welche Demütigungen Gamache über sich ergehen lassen musste. Wie man ihn des Fehlverhaltens beschuldigte. Wie Politiker dabei tatenlos zusahen. Obwohl sie wussten, dass er nur seine Pflicht getan und im Interesse der Bürger gehandelt hatte.
Chief Inspector Beauvoir war nach einer Reihe beinahe ebenso demütigender Untersuchungen zurückgeholt worden.
Jeden Tag hatten sie Mörder gejagt. Jeden Tag hatten sie ihr Leben riskiert.
Und zum Dank waren sie an den Pranger gestellt worden. Man hatte sie den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, weil bestimmte Politiker wiedergewählt werden wollten.
Im Vergleich zu den Gehältern in der freien Wirtschaft war das Salär bescheiden, die Risiken waren unkalkulierbar und Belobigungen selten. Jean-Guy hatte eine junge Familie. Bald würde seine Tochter zur Welt kommen, die beide Eltern brauchte.
So kam es, dass er mit Annie darüber gesprochen hatte, als GHS Engineering ihm zum dritten Mal ein Angebot unterbreitet und hinzugefügt hatte, die Stelle sei in Paris. Und sie hatten es angenommen.
Jean-Guy Beauvoir hatte die Sûreté verlassen, und zwar zur selben Zeit, als Chief Inspector Gamache dorthin zurückgekehrt war. Beauvoir hatte seinen Posten dem ehemaligen und zukünftigen Leiter der Mordkommission übergeben.
Aber das erzählte er Madame Gossette nicht alles.
»Es war Zeit für eine Veränderung«, erwiderte er nur knapp, als die Stewardess ihre Tabletts abräumte.
Und eine Veränderung stellte sich ein. Wenn auch nicht in dem erwarteten Maß.
»Was passiert, wenn ich feststelle, dass etwas nicht richtig läuft?«
»Dann kommen Sie zu mir.«
»Woher soll ich wissen, dass – wie haben Sie es genannt? – der Sprung in der Tasse nicht von weiter oben kommt? Das ist oft so. Dass es oben anfängt.«
»Stimmt. Nun, ich schätze mal, dass dann Ihr Spürsinn gefragt ist.« Wieder beugte sie sich vor, während das Flugzeug eine Kurve zog und zur Landung auf der winzigen Insel in einem riesigen und unfassbar blauen Meer ansetzte. »Voyons, ich habe keinerlei Grund anzunehmen, dass etwas nicht stimmt. Sonst würde ich mich sofort an Sie wenden. Sie sind bei uns, um sicherzustellen, dass wir nicht, sei es absichtlich oder unabsichtlich, eine Straße ins Land der Toten wachsen lassen.« Jetzt war ihr Blick hart. Beinahe grimmig. »Wir entwickeln Dinge, die die Lebensqualität verbessern. Aber wenn sie nicht funktionieren, Leben kosten. Wir müssen absolut sicher sein. Verstehen Sie?«
Sie sah ihn so durchdringend an, dass er zusammenzuckte. Bis zu diesem Moment hatte er den Job nur aus seiner Perspektive gesehen.
Eine sanfte Landung nach dem heftigen Gegenwind in der Sûreté. Ein Gehalt, das bei Weitem alles überstieg, was er sich jemals erträumt hatte. Sie würden in Sicherheit sein. Sie würden ein komfortables Leben führen. Sie würden in Paris sein.
Jetzt sah er ihn aus Madame Gossettes Perspektive.
Leben standen auf dem Spiel. Und seine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass keines verloren ging.
»Ich kann unmöglich alle Projekte im Blick behalten«, sagte er. »Es gibt Hunderte davon.«
»Deshalb haben Sie ja auch Ihre Mitarbeiter. Keine Sorge, nach einer Weile werden Sie ein Gespür dafür entwickeln, wenn etwas nicht stimmt. Sie werden es riechen.«
Riechen?, hätte er beinahe gesagt. Was glaubte sie eigentlich, wie eine Ermittlung funktionierte? Wenngleich er zugeben musste, dass es einen bestimmten Geruch hatte, wenn etwas faul war.
In den folgenden Wochen und Monaten hatte Jean-Guy Beauvoir oft über dieses Gespräch nachgedacht. Und jetzt fiel es ihm erneut ein, als er seine Stellvertreterin ansah, die Dior und Ressentiment verströmte.
»Ich denke, ich kann mich durch die Luxemburg-Pläne ackern, Séverine. Merci. Was macht das Patagonien-Projekt?«
Halb hatte er Mitleid mit Madame Arbour. Aber wenn sie ihn und seine Führung noch immer nicht akzeptiert hatte, würde einer von ihnen beiden wohl gehen müssen.
Und das werde nicht ich sein, dachte Beauvoir.
»Patagonien? Ich weiß nichts von Patagonien.« Sie stand auf. »Tut mir leid, ich hatte geglaubt, dass Sie über das Luxemburg-Projekt reden wollen.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Na ja, wegen der abschließenden Sicherheitsprüfungen nächste Woche. Vielleicht wollen Sie ja dabei sein.«
»Ich wüsste nicht, warum. Wollen Sie dabei sein? Sind Sie deswegen hier?«
»Nein, nein. Ist schon in Ordnung.«
Das war selbst für Séverine Arbours Verhältnisse ein seltsamer und nerviger Wortwechsel.
»Wollen Sie mir wegen Luxemburg etwas mitteilen, Séverine?«
»Nein.«
Nachdem sie sein Büro verlassen hatte, überlegte Jean-Guy, ob er sich den Bericht über Luxemburg ansehen sollte. Noch mal. Aber es war nach fünf. Er wollte heim und Honoré füttern, damit Annie sich noch kurz hinlegen konnte, bevor sie abends ausgingen.
Luxemburg musste warten.
Er schnappte sich sein Jackett von der Stuhllehne und ging eine Tür weiter zu Arbours Büro. »Ich gehe nach Hause. Schönes Wochenende.«
Sie hob kurz den Kopf und blickte dann sofort wieder auf ihren Bildschirm. Wortlos.
Als Arbour allein war, sah sie sich um. Sie hatte den Point of no Return erreicht, wie man so sagte. Noch ein Mausklick, und es gab kein Zurück mehr.
Durch das Fenster sah sie in der Ferne den Eiffelturm.
Ein Wunderwerk französischer Ingenieurskunst. Ein Monument des Erfindergeistes und der Kühnheit. Etwas, worauf man stolz sein konnte.
Dann wandte sie sich wieder ihrem Computer zu und klickte auf Senden.
Sie nahm ihre Chanel-Handtasche und ging. Nur zum Ausstempeln blieb sie noch einmal kurz stehen.
»Bon weekend«, sagte der Wachmann, nachdem er ihre Handtasche durchsucht hatte.
Sie lächelte und wünschte ihm ebenfalls ein schönes Wochenende. Dann lief sie zur Metro.
Jetzt gab es keine Umkehr mehr.
3
Reine-Marie Gamache hakte sich bei ihrem Mann unter, während sie die Rue des Archives zur Bushaltestelle in der Rue des Quatre-Fils entlanggingen.
Armand hatte vorgeschlagen, mit dem Taxi von ihrer Wohnung im Marais zu dem Restaurant zu fahren, aber Reine-Marie nahm lieber den Bus. Die Route war sie schon oft gefahren. Sie fühlte sich dann immer richtig in Paris angekommen.
»Erinnerst du dich an das erste Mal, als wir diesen Bus genommen haben?«, fragte sie.
Er hörte sie, dachte aber an das erste Mal, als Reine-Marie sich bei ihm untergehakt hatte. Wie jetzt.
Es war ihre dritte Verabredung, und sie gingen nach dem Essen in einem Restaurant einen vereisten Montréaler Bürgersteig entlang.
Er hatte im gleichen Moment die Hand nach ihr ausgestreckt, um sie zu halten, als sie die Hand nach ihm ausstreckte.
Um ihn zu halten.
Sie hatte sich bei ihm untergehakt. Um ihr Schicksal miteinander zu teilen. Wenn einer von ihnen das Gleichgewicht verlor, würde der andere ihn stützen. Oder sie würden zusammen fallen.
»Du hattest das blaue Cape an, das du dir von deiner Mutter geborgt hattest«, sagte er in Erinnerung an den kalten Abend.
»Ich hatte das gepunktete Kleid von meiner Schwester an«, sagte sie in Erinnerung an den warmen Tag.
»Es war Winter«, sagte er.
»Es war Hochsommer.«
»Ah, yes«, sang er in der Abendluft. »I remember it well.«
»Dummkopf«, sagte sie lachend. »Überlass das lieber Maurice Chevalier.«
Er lächelte. Und drückte ihren Arm, als sie an Männern und Frauen, jungen und alten, Liebespaaren und Fremden vorbeigingen, die wie sie die Rue des Quatre-Fils entlangschlenderten.
»Fertig?«, rief Daniel nach oben.
»Können wir nicht mitkommen?«, fragte Florence.
Sie und ihre Schwester steckten schon in den Flanellschlafanzügen, die ihnen ihre Großeltern aus Québec mitgebracht hatten.
Über Florence’ Schlafanzug trabten Elche, während auf Zoras Schlafanzug kleine Schwarzbären herumtollten.
Die Schwestern standen nebeneinander im Wohnzimmer und sahen zu ihrem Vater hoch.
»Non, mes petits singes«, sagte Daniel und kniete sich vor sie. »Meine kleinen Äffchen. Ihr bleibt schön hier und spielt mit eurem Cousin.«
Sie sahen zu Honoré, der auf einer auf dem Boden ausgebreiteten Decke lag und schlief.
»Er ist langweilig«, sagte Zora zögernd.
Tante Annie lachte aus den Tiefen des Sessels, in den sie gesunken war. Der Babysitter war auch gekommen. Jetzt fehlte nur noch Roslyn.
»Nach den Tritten zu urteilen«, sagte Annie und legte eine Hand auf den Bauch, »wird die Kleine nie schlafen. Wollt ihr mal fühlen?«
Die Mädchen rannten zu ihr und legten ihre winzigen Hände auf den mächtigen Bauch. Jean-Guy gesellte sich zu Daniel.
»Ich erinnere mich daran«, sagte Daniel. Seine tiefe Stimme klang sehnsüchtig. »Als Roslyn schwanger war. Es kam mir unglaublich vor.«
Jean-Guy sah zu Annie, die den beiden Mädchen lächelnd und nickend zuhörte. Florence, die Ältere, kam nach ihrer Mutter. Schlank, athletisch, extrovertiert.
Zora dagegen kam nach ihrem Vater. Grobknochig, etwas unbeholfen, schüchterner. Während Florence ungestüm sein konnte, Bällen nachjagte, Laternenpfähle rammte und sich die Knie aufschlug, wenn sie von einer Schaukel sprang, war Zora ruhiger, sanftmütiger. Nachdenklicher.
Wenn Florence im Park beschloss, Angst vor Vögeln zu haben, und kreischend davonlief, stand Zora mit einer Handvoll Brot da und fütterte sie.
Als Jean-Guy sie jetzt betrachtete, war er froh, dass ihre ungeborene Tochter die beiden zum Spielen haben würde und den ungeheuer treuen Honoré als Bruder. Sie würde es brauchen. Ihn. Sie.
Und was würde Honoré mit seiner Schwester bekommen?
Eine das ganze Leben währende Liebe, hoffte er. Und Verantwortung, das wusste er.
Er betrachtete seinen schlafenden Sohn und bekam ein schlechtes Gewissen. Dass sie ihn, ohne zu fragen, damit belasteten.
»Da bin ich«, rief Roslyn, die aus dem Schlafzimmer die Treppe herunter kam. »Tut mir leid, dass ich so lang gebraucht habe. Komm, ich helf dir.«
Sie streckte die Hand aus, und zusammen mit Jean-Guy und Daniel hievte sie Annie aus dem Sessel.
»Habt ihr auch gerade das Polster stöhnen hören?«, fragte Jean-Guy.
»Pass bloß auf, sonst stöhnst du gleich«, sagte Annie.
Sie hakte sich bei ihm unter, und er drückte sie an sich, als sie in den kühlen Septemberabend hinaustraten.
Armand und Reine-Marie stiegen an der vertrauten Haltestelle aus. Der Bibliothèque nationale.
Armand sah sich um. Die anderen Fahrgäste, die mit ihnen ausstiegen, mussten den Eindruck haben, er würde sich orientieren.
Tatsächlich musterte der Leiter der Mordkommission der Sûreté du Québec die Umgebung. Warf instinktiv einen prüfenden Blick auf die Brasserien und Läden. Die Türeingänge und Gassen. Die anderen Fußgänger. Die Autos und Laster.
Paris blieb nicht verschont von Gewalt, und in jüngerer Zeit hatte es einige fürchterliche Terroranschläge gegeben.
So wohl er sich in der Stadt fühlte, ließ seine Wachsamkeit doch nie nach. Das tat sie allerdings auch nicht, wenn er zu Hause mit den Hunden durch den Wald spazierte.
Sie bummelten die Rue de Richelieu hinunter, und nach weniger als einer Minute erreichten sie die bar à vins, deren Fenster mit Weinflaschen vollgestellt war.
Die Tochter des Wirts begrüßte sie mit Küsschen und Umarmungen.
Margaux war mittlerweile erwachsen und verheiratet. Als die Gamaches sich vor fünfunddreißig Jahren vor einem Regenguss ins Juveniles gerettet und tropfnass beschlossen hatten, gleich zum Abendessen zu bleiben, war sie auch da gewesen.
Margaux war gerade mal fünf Jahre alt gewesen und hatte Getränke ausgeschenkt.
Ihr Vater hatte sich zu ihr hinuntergebeugt und etwas in ihr Ohr geflüstert, wobei er auf die Gamaches deutete. Sie war zu den frisch eingetroffenen Gästen getreten, ein weißes Leinentuch über den angewinkelten Arm gelegt, und hatte ihnen mit ernster Miene einen schönen andalusischen Rotwein empfohlen.
Sorgfältig hatte sie den Namen ausgesprochen. Und dann zu ihrem Vater gesehen, der beifällig nickte und das junge Paar anlächelte.
Mittlerweile hatte Margaux das Restaurant übernommen, und ihr Mann Romain war der Küchenchef. Tim war jedoch nach wie vor der Wirt und wurde immer noch Big Boss genannt.
Sie waren die Ersten aus ihrer Runde und erhielten den üblichen langen Tisch neben der Holztheke. Die Karaffe stand schon da und wartete auf sie.
Armand und Reine-Marie plauderten mit dem Big Boss, während im Hintergrund leise Jazzmusik spielte. Innerhalb weniger Minuten trafen Daniel und Roslyn mit Annie und Jean-Guy im Schlepptau ein.
Es gab ein großes Hallo, Margaux legte ihre Hand auf Annies Bauch, und die beiden Frauen sprachen über die unmittelbar bevorstehende Geburt, während die anderen sich begrüßten.
Der kleine Tumult legte sich schließlich, und alle nahmen Platz. Daniel schenkte Wein ein. Margaux brachte Annie ein Glas frisch gepressten Saft und Jean-Guy eine Cola. Holzbretter mit ofenwarmen Baguettes wurden auf den Tisch gestellt, dazu eine terrine de campagne, geschlagene Butter und kleine Schälchen mit Oliven.
»Wollte Stephen nicht auch kommen?«, fragte Annie und sah zu dem verwaisten Stuhl.
»Ja«, sagte ihr Vater. »Wir haben uns vorhin noch gesehen.«
»Darf ich raten?«, sagte Daniel. »Im Musée Rodin, oder?« Er drehte sich zu Roslyn. »Hast du jemals die Geschichte gehört, wie er beschlossen hat, Mama einen Heiratsantrag zu machen?«
»Nein, nie«, sagte Roslyn mit übertriebenem Interesse. Wie die anderen hatte sie die Geschichte bereits x-mal gehört. »Was ist passiert?«
Armand warf seiner Schwiegertochter einen gespielt strengen Blick zu, und sie lachte.
»Die Mädchen sind begeistert von ihren Schlafanzügen«, sagte Roslyn zu Reine-Marie. »Ich fürchte, dass sie sie gar nicht mehr ausziehen wollen.«
»Lass sie doch«, sagte Daniel. »Apropos, Mama, danke, dass du nicht Dad das Geschenk hast aussuchen lassen.«
»Er hatte die Farbrollen schon eingepackt, bevor ich ihn aufhalten konnte.«
Traurig schüttelte Armand den Kopf. »Die werden sie dann wohl erst an Weihnachten kriegen.«
Während die anderen lachten, betrachtete Armand Daniel.
Er amüsierte sich.
Offenbar hatte er Frieden mit Jean-Guy geschlossen. Daniel war lange eifersüchtig auf die enge Beziehung gewesen, die seinen Vater mit seinem Stellvertreter verband, aber inzwischen hatte er sich mit Jean-Guy angefreundet.
Dennoch hatte Daniel dafür gesorgt, dass Jean-Guy einen Stuhl bekam, der so weit wie möglich von Armands Stuhl entfernt war. Wobei das auch Zufall sein konnte.
Er selbst hoffte, sich an einem der nächsten Tage mit Daniel zu einem ruhigen Essen oder einem Spaziergang treffen zu können. Nur sie beide. Nach dem, was Stephen gesagt hatte, wollte er sichergehen, dass alles in Ordnung war.
Armand sah zu dem leeren Stuhl. Es war zwanzig nach acht, und Stephen, ein großer Freund von Pünktlichkeit, war noch nicht da.
»Excusez-moi«, sagte er und wollte gerade aufstehen, als die Tür des Bistros aufging und der alte Mann eintrat.
»Stephen«, rief Annie und kämpfte sich hoch, bevor Jean-Guy ihr helfen konnte.
Armand und Reine-Marie blieben abwartend stehen, während die Jüngeren Stephen begrüßten, dann scheuchte Margaux sie auf ihre Plätze zurück, um den engen Gang in dem kleinen Lokal frei zu machen.
Daniel gab ihr ein Zeichen, neuen Wein zu bringen, und Stephen legte sein Handy vor sich auf den Tisch und nickte dem Mann hinter der Theke zu. Das Übliche.
Zusammen mit einem weiteren Liter Rotem kam der Martini.
»Ein Toast«, sagte Armand, nachdem alle bestellt hatten. »Auf die Familie. Neue Mitglieder«, er warf einen Blick auf Annies Bauch, »und sehr, sehr …«
»Sehr«, fielen alle mit ein und drehten sich zu Stephen, »alte.«
Stephen hob sein Glas und sagte: »Ihr mich auch.«
»Mein Vater ist eben ein Mann klarer Worte«, sagte Daniel, als das Gelächter verebbte.
»Da kennst du ihn aber schlecht«, sagte Jean-Guy. »Warte nur ab, bis er anfängt, Der Schiffbruch des Hesperus zu rezitieren.«
»Kannst du haben«, sagte Armand. Er räusperte sich und sah ernst drein. »Es fuhr der Schoner Hesperus …«
Alle lachten. Mit einer Ausnahme. Aus dem Augenwinkel nahm Armand den finsteren Ausdruck auf Daniels Gesicht wahr. Es passte ihm nicht, dass man ihm, selbst im Spaß, sagte, dass Beauvoir seinen Vater besser kannte als er.
Auch Stephen hatte Daniels Gesichtsausdruck bemerkt und nickte Armand kaum merklich zu, bevor er auf sein Handy blickte.
Dann wandte er sich Annie und Jean-Guy zu und fragte: »Wie geht es euch?«
Ein paar Minuten sprachen sie leise miteinander.
»Wenn ihr etwas braucht«, sagte Stephen und beließ es dabei.
»Vielleicht ein Eis im Lutetia?«, sagte Annie.
»Das ist zu machen«, sagte Stephen. »Nach Montag. Dann können wir alle feiern.«
»Was ist denn am Montag?«, fragte Jean-Guy.
»Nur einige Meetings, zu denen ich muss. Apropos: Wie geht es dir mit deiner neuen Stelle?«
Am anderen Ende des Tischs sagte Armand zu Daniel: »Es freut mich sehr, dass du befördert wurdest. Auch weil es eine ganz neue Abteilung ist.«
»Das stimmt«, sagte Daniel. »Risikokapital. Ich habe auch schon ein Investment getätigt.«
»Was denn?«
»Das kann ich nicht sagen.«
Kann er nicht, fragte sich Armand, oder will er nicht?
»Dann machst du also vor allem Risikobewertungen?«, fragte er.
»Genau.«
Armand hörte aufmerksam zu und stellte zwischendurch Fragen. Vorsichtig brachte er seinen Sohn zum Reden, bis er sich entspannte und anfing, freier, ja sogar angeregt zu erzählen.
Reine-Marie beobachtete, wie Daniel sich zu seinem Vater beugte.
Sie waren sich in so vieler Hinsicht ähnlich. Sie sahen sich sogar ähnlich.
Mit seinen eins fünfundachtzig war Daniel größer als sein Vater. Und kräftiger. Nicht dick, aber er hatte Fleisch auf den Knochen.
Das hatte Armand auch. Allerdings etwas weniger.
Daniel hatte sich einen rötlichen Bart stehen lassen, der grau gesprenkelt war, wie Reine-Marie überrascht feststellte. Die Zeit verging.
Seine dichten braunen Haare trug er sehr kurz.
Die leicht welligen Haare seines Vaters waren inzwischen fast ganz grau. Und sie wurden dünner. Natürlich hatte Armands glatt rasiertes Gesicht im Vergleich mehr Falten. Und die tiefe Narbe an der Schläfe.
Daniel war wie sein Vater freundlich und liebenswürdig.
Anders als sein Vater war der junge Daniel jedoch nie von großer Wissbegier gewesen, was er durch Disziplin ausglich. Dank seines Fleißes übertraf er seine von Natur aus begabteren Freunde oft.
Er war ein glückliches Kind gewesen. Bis …
Als er acht war, änderte sich etwas. Eine Mauer ging zwischen ihm und seinem Vater hoch. Zuerst kaum merklich zog er sich zurück. Daniel war schon als kleines Kind höflich gewesen, aber jetzt bekam sein Verhalten etwas Distanziertes. Kaltes. Eine Vorsicht, die zu Zurückweisung wurde.
Und zu einer Kluft führte.
Reine-Marie hatte beobachtet, wie Armand versuchte, die Kluft zu überbrücken, aber sie schien sich mit jeder Umarmung nur noch zu vergrößern.