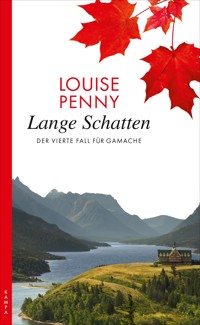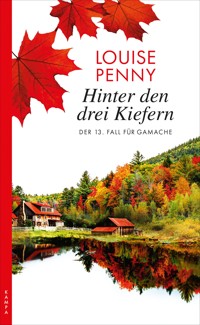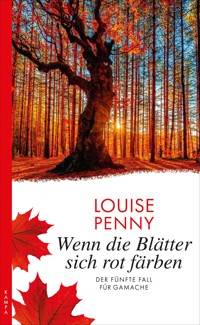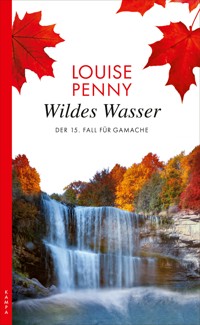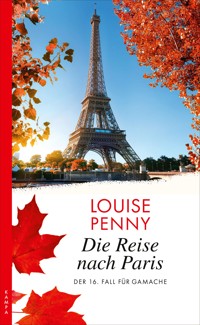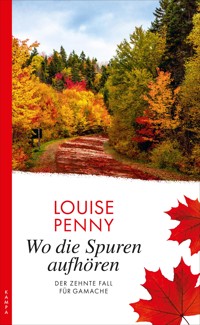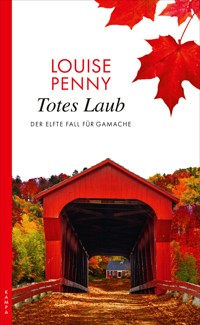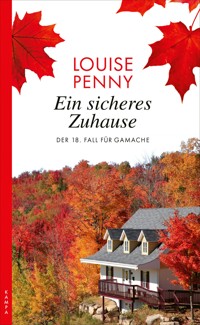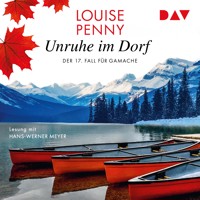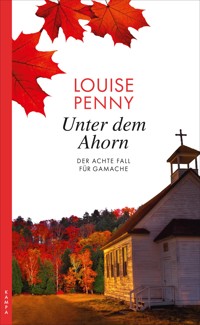
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Das Dorf Three Pines liegt so versteckt in den kanadischen Wäldern, dass es auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Nur ein Ort ist noch schwieriger zu finden: das Gilbertinerkloster Entre-les-Lupes. Hoch im Norden Québecs, an einem einsamen See, leben die Mönche von selbst angebautem Gemüse und sind vor allem eins: schweigsam und friedfertig. Da ist das Entsetzen groß, als Frère Mathieu, der allseits beliebte Chorleiter, hinterrücks erschlagen unter dem Ahorn im Klostergarten aufgefunden wird. Armand Gamache, Leiter der Mordkommission der Sûreté du Québec, und sein Stellvertreter Inspector Jean-Guy Beauvoir nehmen die Ermittlungen auf. Und die erweisen sich als mühsam, denn die Mönche haben ein Schweigegelübde abgelegt, und nicht alle im Orden freuen sich über das Interesse von außen. Als dann plötzlich Sylvain Françoeur, ein langjähriger Rivale Gamaches, auf der Bildfläche erscheint, ahnt der Chief Inspector, dass sein ranghö- herer Kollege nichts Gutes im Schilde führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Unter dem Ahorn
Der achte Fall für Gamache
Aus dem kanadischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Dieses Buch ist denen gewidmet, die niederknien,
und denen, die aufstehen.
Prolog
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts merkte die katholische Kirche, dass sie ein Problem hatte. Zugegebenermaßen nicht nur eins. Doch das Problem, das ihr zu diesem Zeitpunkt zu schaffen machte, hatte mit dem Stundengebet zu tun, mit den acht Andachten im täglichen Leben einer Ordensgemeinschaft, bei denen geistliche Gesänge angestimmt werden. Gregorianische Choräle. Schlichte Lieder, gesungen von demütigen Mönchen.
Um es kurz zu machen, die katholische Kirche hatte das Stundengebet verloren.
Die einzelnen Andachten im Lauf eines geistlichen Tages wurden weiterhin abgehalten, und in manchen Klöstern wurden auch noch gelegentlich sogenannte gregorianische Choräle gesungen, aber selbst in Rom musste man zugeben, dass sich diese Gesänge so weit von den Originalen entfernt hatten, dass sie als korrumpiert, sogar barbarisch angesehen wurden. Zumindest verglichen mit den anmutigen Gesängen früherer Jahrhunderte.
Doch ein Mann hatte eine Lösung parat.
1833 machte es sich Dom Prosper, der spätere Abt von Saint-Pierre de Solesmes, als junger Mönch zur Aufgabe, das alte französische Kloster und mit ihm auch die ursprünglichen gregorianischen Choräle zu neuem Leben zu erwecken.
Das zog jedoch ein anderes Problem nach sich. Wie sich nach umfangreichen Nachforschungen des Abtes herausstellte, wusste niemand mehr, wie diese mehr als tausend Jahre alten Choräle geklungen hatten. Da es zur Zeit ihrer Entstehung noch kein Notierungssystem gegeben hatte, existierten auch keine schriftlichen Aufzeichnungen von ihnen. Sie waren auswendig gelernt und nach jahrelangem Studium von Mönch zu Mönch mündlich weitergegeben worden. Die Choräle waren einfach, aber gerade in ihrer Einfachheit lag enorme Kraft. Die ursprünglichen Gesänge waren tröstlich, beruhigend, hypnotisch.
Ihre Wirkung auf diejenigen, die sie sangen und hörten, war so intensiv, dass die alten Choräle unter dem Namen »Das schöne Mysterium« bekannt wurden. Die Mönche glaubten, das Wort Gottes zu singen. Mit der betörend ruhigen, Zuversicht spendenden Stimme Gottes.
Was Dom Prosper jedoch wusste, war, dass sich schon im 9. Jahrhundert, tausend Jahre vor seinen Lebzeiten, ein anderer Mönch mit dem Mysterium der Choräle beschäftigt hatte. Der Legende nach hatte dieser unbekannte Mönch eine geniale Idee. Er beschloss, die Gesänge schriftlich aufzuzeichnen. Damit sie erhalten blieben. Seine unbedarften Novizen machten zu viele Fehler beim Lernen der Choräle. Falls die Worte und die Musik tatsächlich göttlichen Ursprungs waren, wovon er felsenfest überzeugt war, mussten sie sicherer aufbewahrt werden als in derart unzulänglichen menschlichen Köpfen.
Dom Prosper konnte sich bildlich vorstellen, wie dieser Mönch damals in einer kargen Zelle wie seiner eigenen ein Stück Vellum, besonders hochwertiges Pergament, vor sich liegen hatte und seinen geschärften Federkiel in das Tintenfass tauchte. Natürlich schrieb er den Text, Passagen aus den Psalmen, auf Latein. Und als er damit fertig war, kehrte er an den Anfang zurück. Zum ersten Wort.
Sein Federkiel verharrte darüber.
Und jetzt?
Wie Musik aufschreiben? Wie etwas so Erhabenes festhalten? Zunächst versuchte er es mit schriftlichen Anweisungen, doch das war viel zu mühsam. Mit Worten ließ sich unmöglich beschreiben, wie diese Musik den normalen menschlichen Zustand transzendierte und den Menschen zum Göttlichen erhob.
Der Mönch wusste nicht weiter. Tage und Wochen ging er seinem klösterlichen Alltag nach. Betete und arbeitete mit den anderen. Sang das Stundengebet. Unterrichtete die jungen und leicht abzulenkenden Novizen.
Bis ihm eines Tages auffiel, dass sie sich auf seine rechte Hand konzentrierten, wenn er sie beim Singen anleitete. Rauf, runter. Schneller, langsamer. Ruhig, ruhig. Den Text hatten sie sich eingeprägt, aber für die Musik waren sie auf seine Handzeichen angewiesen.
Am Abend, nach der Vesper, saß der namenlose Mönch bei kostbarem Kerzenlicht an seinem Tisch und betrachtete die sorgsam auf das Pergament geschriebenen Psalmen. Dann tauchte er seinen Federkiel in die Tinte und schrieb die erste Musiknote.
Es war eine Welle über einem Wort. Ein kurzer verschnörkelter Strich. Dann noch einer. Und noch einer. Er zeichnete die Bewegungen seiner Hand. Stilisiert. Wie sie einen unsichtbaren Mönch anleitete, einen höheren Ton zu singen. Noch höher. Ihn dann zu halten. Dann noch höher. Ganz kurz auf ihm zu verharren, um schließlich in einem schwindelerregenden musikalischen Absturz nach unten zu taumeln.
Er summte beim Schreiben mit. Seine einfachen, über die Seite flatternden Handzeichen erweckten die Wörter zum Leben. Ließen sie emporsteigen. Davonfliegen. Voller Freude. Er konnte hören, wie die Stimmen noch gar nicht geborener Mönche in seinen Gesang einstimmten. Exakt die Choräle sangen, die ihn befreiten und sein Herz zum Himmel hoben.
In seinem Bestreben, das schöne Mysterium festzuhalten, hatte der Mönch die Notenschrift erfunden. Aber noch nicht die Noten, wie wir sie heute kennen. Seine Zeichen wurden unter dem Begriff Neumen bekannt.
Im Lauf der Jahrhunderte nahm der schlichte Gesang immer komplexere Formen an. Instrumente und Harmonien wurden hinzugefügt, was wiederum zu Akkorden und Notenlinien und schließlich zu unserem heutigen Notensystem führte. Do-re-mi. Die moderne Musik war geboren. Die Beatles, Mozart, Rap. Disco, Annie Get Your Gun, Lady Gaga. Alle aus demselben uralten Samen hervorgegangen. Ein Mönch, der seine Handbewegungen zeichnete. Summend und dirigierend und nach dem Göttlichen strebend.
Die gregorianischen Choräle waren der Ursprung der westlichen Musik. Aber irgendwann wurden sie von ihren undankbaren Kindern getötet. Begraben. Verloren und vergessen.
Bis im frühen 19. Jahrhundert Dom Prosper, abgestoßen von der, wie er es sah, Vulgarität der Kirche und vom Verlust von Reinheit und Schlichtheit, zu der Überzeugung gelangte, dass es Zeit war, die ursprünglichen gregorianischen Choräle neu erstehen zu lassen. Die Stimme Gottes wiederzufinden.
Seine Mönche schwärmten über ganz Europa aus. Durchforsteten Klöster, Bibliotheken, Sammlungen. Mit einem einzigen Ziel. Das uralte Originalmanuskript zu finden.
Die Mönche kehrten mit zahlreichen in fernen Bibliotheken und Sammlungen verschollenen Schätzen zurück. Und schließlich gelangte Dom Prosper zu der Überzeugung, dass eine in verblassten Neumen verfasste Choralniederschrift das Original sein musste. Die erste und vielleicht einzige Aufzeichnung, wie gregorianische Choräle geklungen hatten. Es war ein fast tausend Jahre altes Pergament aus Kalbshaut.
In Rom war man anderer Meinung. Der Papst hatte eine eigene Suche veranlasst und ein anderes Notendokument aufgespürt. Er bestand darauf, dass auf dieser ramponierten Kalbshaut aufgezeichnet war, wie das Stundengebet zu singen war.
Und wie so oft, wenn sich Kirchenmänner uneins sind, kam es zum Krieg. Zwischen der Benediktinerabtei Solesmes und dem Vatikan schossen Gesangssalven hin und her. Beide Seiten bestanden darauf, dass ihre Version dem Original und somit dem Göttlichen am nächsten kam. Akademiker, Musikwissenschaftler, berühmte Komponisten und einfache Mönche äußerten sich zu dem Thema und ergriffen Partei in dem eskalierenden Streit, bei dem es bald mehr um Macht und Einfluss ging als um menschliche Stimmen, erhoben zur Ehre Gottes.
Wer hatte die ursprünglichen gregorianischen Choräle gefunden? Wie sollten sie gesungen werden? Wer befand sich im Besitz der wahren Stimme Gottes?
Wer hatte recht?
Nach Jahren des Streits gelangten die Gelehrten endlich zu einer stillen Übereinkunft. Die in der Folge noch stiller unter den Teppich gekehrt wurde.
Niemand hatte recht. Obwohl die Mönche von Solesmes mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wahrheit näher gekommen waren als der Vatikan, hatten sie ihr Ziel dennoch nicht erreicht. Was sie entdeckt hatten, war authentisch und unbezahlbar – aber es war unvollständig.
Denn etwas fehlte.
Die Niederschriften der Choräle enthielten Wörter und Neumen sowie Hinweise, wann die mönchischen Stimmen lauter, wann leiser werden sollten. Wann ein Ton höher, wann tiefer war.
Was sie jedoch nicht enthielten, war ein Ausgangspunkt. Höher, aber im Vergleich wozu? Lauter, aber im Vergleich wozu? Es war wie bei einer Schatzkarte, auf der mit einem Kreuz das Ziel eingezeichnet ist, an das man gelangen soll. Aber nicht, wo man mit der Suche beginnen soll.
Im Anfang …
Die Benediktinermönche von Solesmes konnten sich bald als die neuen Hüter der alten Choräle behaupten. Der Vatikan gab schließlich nach, und binnen weniger Jahrzehnte hatte sich das Stundengebet von Solesmes durchgesetzt. Die wiederauferstandenen gregorianischen Choräle fanden in Klöstern der ganzen Welt Verbreitung. Die schlichten Gesänge spendeten echten Trost. Archaische Musik in einer zunehmend lärmenden Welt.
Und so hatte der Abt von Solesmes hinsichtlich zweier Dinge Gewissheit, als er in aller Stille verschied. Dass er etwas Wichtiges und Kraftvolles und Bedeutsames bewirkt hatte. Er hatte eine ebenso schöne wie schlichte Tradition neu belebt. Er hatte den korrumpierten Gesängen ihre Reinheit zurückgegeben und den Kampf gegen das effekthascherische Rom gewonnen.
Aber in seinem tiefsten Innern wusste er auch, dass er zwar gewonnen, aber nicht sein Ziel erreicht hatte. Was mittlerweile alle für authentische gregorianische Choräle hielten, kam der Sache sehr nahe, das ja. Fast göttlich. Aber nicht ganz.
Denn noch fehlte der Ausgangspunkt.
Dom Prosper, selbst ein begabter Musiker, konnte nicht glauben, dass der Mönch, der die ersten Choräle niedergeschrieben hatte, späteren Generationen keinen Hinweis gegeben hatte, wo sie beginnen sollten. Sie konnten diesbezüglich nur raten. Was sie auch taten. Aber es war nicht dasselbe wie Gewissheit zu haben.
Der Abt von Solesmes hatte vehement die Ansicht vertreten, dass das Gesangbuch, das seine Mönche gefunden hatten, das Original war. Doch auf seinem Totenbett kamen ihm Bedenken. Er stellte sich den anderen Mönch vor, wie er sich, genauso gekleidet wie er, vor Hunderten von Jahren über das Kerzenlicht beugte.
Vermutlich schrieb dieser Mönch zuerst den Text des Chorals, dann die Neumen. Und dann? Bereits im Schwebezustand zwischen dieser Welt und der nächsten, wurde dem im Sterben liegenden Dom Prosper endlich klar, was dieser namenlose Mönch damals getan haben musste. Genau das, was auch er getan hätte.
Wesentlich deutlicher als seine Mitbrüder, die an seinem Sterbebett leise Gesänge anstimmten, sah Dom Prosper, wie der schon lange tote Mönch über seinen Schreibtisch gebeugt saß. Und zum Anfang zurückkehrte. Zum ersten Wort. Und ein weiteres Zeichen machte.
Am Ende seines Lebens wurde Dom Prosper klar, dass es sehr wohl einen Anfang gab. Aber finden musste ihn jemand anders. Um das schöne Mysterium zu lösen.
1
Als der letzte Ton des Chorals aus der Gebenedeiten Kapelle entwich, legte sich tiefe Stille über den Kirchenraum und mit ihr eine noch tiefere Unruhe.
Die Stille zog sich hin. Immer länger.
Diese Männer waren Stille gewöhnt, aber diesmal schien sie extrem, sogar für sie.
Dennoch standen sie in ihren langen schwarzen Kutten und den weißen Skapulieren weiter reglos da.
Und warteten.
Auch das waren die Männer gewöhnt. Doch selbst das Warten schien diesmal extrem.
Die weniger disziplinierten unter ihnen warfen verstohlene Blicke zu dem großen, schlanken alten Mann, der als Erster hereingekommen war und als Erster wieder gehen würde.
Dom Philippe hielt die Augen geschlossen. Einst war dies für ihn ein Moment tiefen Friedens gewesen, ein intimer Moment mit seinem privaten Gott zwischen dem Ende der Matutin und dem Moment, in dem er das Zeichen zum Angelus geben würde. Doch jetzt empfand er es schlicht als Flucht.
Er hielt die Augen geschlossen, weil er nicht sehen wollte.
Außerdem wusste er, was da war. Was immer da war.
Was schon Hunderte von Jahren da gewesen war, bevor er auf die Welt gekommen war, und was, so Gott wollte, noch Hunderte von Jahren da sein würde, wenn er längst auf dem Friedhof begraben lag. Ihm gegenüber zwei Reihen von Männern, in schwarzen Kutten mit weißen Skapulieren, ein schlichtes Seil um den Bauch gebunden.
Und rechts neben ihm zwei weitere Reihen von Männern.
Sie standen einander auf dem Steinboden der Kapelle gegenüber wie mittelalterliche Schlachtreihen.
Nein, sagte sein müder Geist. Nein. Ich darf es nicht als eine Schlacht oder einen Krieg betrachten. Nur als gegensätzliche Ansichten. Vertreten in einer intakten Gemeinschaft.
Warum sträubte er sich dann so dagegen, die Augen zu öffnen? Den Tag auf den Weg zu bringen?
Das Zeichen für die großen Glocken zu geben, damit sie den Wäldern und Vögeln und Seen und Fischen den Angelus läuteten. Und den Mönchen. Den Engeln und allen Heiligen. Und Gott.
Ein Räuspern.
In der tiefen Stille klang es wie eine Bombe. Und in den Ohren des Abts klang es wie das, was es war.
Eine Kampfansage.
Es kostete ihn Mühe, die Augen weiter geschlossen zu halten. Er blieb reglos und still. Aber der Frieden war dahin. Jetzt herrschte nur noch Aufruhr, innen und außen. Er konnte spüren, wie er zwischen den beiden Doppelreihen wartender Männer hin und her brandete.
Er konnte ihn auch in sich selbst spüren.
Dom Philippe zählte bis hundert. Langsam. Dann öffnete er seine blauen Augen und schaute durch die Kapelle direkt auf den kleinen, rundlichen Mann, der mit offenen Augen dastand, die Hände über dem Bauch verschränkt, ein verhaltenes Lächeln in seinem unendlich geduldigen Gesicht.
Die Augen des Abts verengten sich kaum merklich zu einem finsteren Starren, dann fing er sich, hob seine schlanke rechte Hand und gab das Zeichen. Und die Glocken setzten ein.
Das perfekte, volltönende, harmonische Läuten verließ den Glockenturm und schwebte in das frühmorgendliche Dunkel davon. Es streifte über den klaren See, die Wälder, die sanft gewellten Hügel. Um von allen erdenklichen Geschöpfen gehört zu werden.
Und von vierundzwanzig Männern in einem fernen Kloster in Québec.
Ein Weckruf. Ihr Tag hatte begonnen.
»Das meinst du jetzt aber nicht ernst«, sagte Jean-Guy Beauvoir lachend.
»Und ob.« Annie nickte. »Bei allem was mir heilig ist, es ist die Wahrheit.«
»Willst du damit sagen«, er nahm ein weiteres Stück in Ahornsirup marinierten Speck von der Platte, »dein Vater hat deiner Mutter einen Badvorleger geschenkt, als sie sich gerade kennenlernten?«
»Nein, nein. Das wäre echt lächerlich gewesen.«
»Finde ich allerdings auch«, sagte er und verspeiste den Speck mit zwei kräftigen Bissen. Im Hintergrund lief ein Lied von einem alten Beau-Dommage-Album. »La complainte du phoque en Alaska«. Über einen einsamen Seehund, dessen Liebe verschwunden war. Beauvoir summte die vertraute Melodie leise mit.
»Er hat ihn meiner Großmutter mitgebracht, als sie ihn zum ersten Mal zum Essen eingeladen hat.«
Beauvoir lachte. »Das hat er mir nie erzählt«, brachte er schließlich hervor.
»In einem zivilisierten Gespräch erwähnt Dad es normalerweise auch nicht. Arme Mom. Sie hat sich verpflichtet gefühlt, ihn zu heiraten. Er hätte sonst keine abbekommen.«
Beauvoir lachte wieder. »Die Messlatte ist also nicht gerade hoch. Ich könnte dir kaum was Popligeres schenken.«
Er griff neben dem Tisch in der sonnendurchfluteten Küche nach unten. Es war Samstagmorgen, ein schöner Frühherbsttag, und sie saßen beim gemeinsamen Frühstück. Auf dem kleinen Kiefernholztisch stand eine Platte mit gebratenem Speck und Rühreiern mit geschmolzenem Brie. Er war in einen Sweater geschlüpft und in die Bäckerei um die Ecke von Annies Wohnung in der Rue Saint-Denis gegangen, um Croissants und pain au chocolat zu holen. Dann hatte er die Runde durch die lokalen Geschäfte gemacht und zwei Café au Lait, die Montrealer Wochenendzeitungen und noch etwas besorgt.
»Was hast du da?«, fragte Annie Gamache und beugte sich über den Tisch. Die Katze sprang zu Boden und suchte sich eine sonnenbeschienene Stelle.
»Nichts.« Er grinste. »Nur ein kleines je ne sais quoi. Ich hab es gesehen und sofort an dich gedacht.«
Beauvoir hob es hoch, damit es zu sehen war.
»Das sieht dir Idiot ähnlich«, sagte Annie lachend. »Einen Klostampfer.«
»Aber mit einer Schleife dran«, sagte Beauvoir. »Nur für dich, ma chère. Wir sind jetzt drei Monate zusammen. So ein Jubiläum muss gefeiert werden.«
»Klar, das Klostampferjubiläum. Und ich habe nichts für dich.«
»Ich werde dir gerade noch mal verzeihen«, sagte er.
Annie nahm den Stampfer. »Ich werde jedes Mal, wenn ich ihn verwende, an dich denken. Obwohl wahrscheinlich du derjenige bist, der ihn am meisten brauchen wird. So voll, wie du davon bist.«
»Zu freundlich.« Beauvoir machte eine leichte Verbeugung.
Wie eine Schwertkämpferin mit einem Rapier stieß sie mit dem Stampfer nach ihm und stupste ihn mit der roten Gummisaugglocke.
Beauvoir grinste und nahm einen Schluck von seinem starken, aromatischen Kaffee. Typisch Annie. Während andere Frauen wahrscheinlich so getan hätten, als wäre der blöde Stampfer ein Zauberstab, tat sie so, als wäre er ein Schwert.
Andererseits, wurde Jean-Guy bewusst, hätte er einer anderen Frau nie einen Klostampfer geschenkt. Nur Annie.
»Du hast mich angeschwindelt«, sagte sie und setzte sich wieder. »Offensichtlich hat dir Dad doch von der Badematte erzählt.«
»Ja, hat er«, gab Beauvoir zu. »Wir waren in Gaspé, in der Hütte eines Wilderers, und haben nach Beweisen gesucht, als dein Vater in einem Schrank nicht nur eine, sondern zwei nagelneue Badematten gefunden hat. Originalverpackt.«
Er sah beim Sprechen Annie an. Ihr Blick wich keinen Moment von ihm. Sie blinzelte kaum und achtete auf jedes Wort, jede Geste, jede Nuance. Auch Enid, seine Ex-Frau, hatte zugehört. Aber immer mit einer Spur von Verzweiflung, einer unterschwelligen Forderung. Als wäre er ihr etwas schuldig. Als ob sie sterben müsste und er die Medizin dagegen wäre.
Enid hatte an ihm gezehrt und ihm zugleich das Gefühl vermittelt, nicht zu genügen.
Annie war sanfter. Großzügiger.
Wie ihr Vater hörte sie aufmerksam und ruhig zu.
Mit Enid hatte er nie über seine Arbeit gesprochen, und sie hatte ihn nie danach gefragt. Annie erzählte er alles.
Als er jetzt das warme Croissant mit Erdbeermarmelade bestrich, erzählte er ihr von der Wildererhütte, von dem Fall, von der brutalen Ermordung einer Familie. Er erzählte ihr, was sie gefunden, wie sie sich gefühlt, wen sie festgenommen hatten.
»Wie sich herausstellte, waren die Badvorleger die Schlüsselbeweise«, sagte Beauvoir und hob das Croissant zum Mund. »Obwohl wir lange gebraucht haben, um darauf zu kommen.«
»Hat Dad dir damals seine eigene traurige Bademattenstory erzählt?«
Beauvoir nickte kauend und sah den Chief Inspector in der dunklen Hütte vor sich. Wie er flüsternd die Geschichte erzählte. Sie waren nicht sicher gewesen, wann der Wilderer zurückkommen würde und hatten nicht in der Hütte entdeckt werden wollen. Sie hatten zwar einen Durchsuchungsbeschluss, wollten aber nicht, dass er das erfuhr. Während also die zwei Ermittler die Hütte rasch durchsuchten, erzählte Chief Inspector Gamache Jean-Guy Beauvoir von der Badematte. Wie er bei den Eltern der Frau, in die er hoffnungslos verliebt war, zum ersten Mal zum Essen eingeladen worden war und unbedingt einen guten Eindruck hatte machen wollen. Und irgendwie auf die Idee gekommen war, ein Badvorleger sei das ideale Gastgeschenk.
»Wie sind Sie denn darauf gekommen, Sir?«, hatte Beauvoir geflüstert, den Blick unablässig auf die gesprungene, von Spinnweben überzogene Fensterscheibe gerichtet, in ständiger Sorge, der Wilderer könnte jeden Moment mit einem erlegten Tier zurückkommen.
»Na ja.« Gamache hatte innegehalten und versucht, seine damaligen Gedankengänge nachzuvollziehen. »Diese Frage stellt mir meine Frau auch noch hin und wieder. Ihre Mutter hat sogar ständig gefragt. Ihr Vater dagegen hat einfach den Schluss gezogen, dass ich ein Schwachkopf bin, und es nie mehr zur Sprache gebracht. Das war schlimmer. Nach ihrem Tod haben wir die Badematte in ihrem Wäscheschrank gefunden, immer noch plastikverpackt und mit der Karte dran.«
Beauvoir hörte auf zu erzählen und schaute Annie an. Ihr Haar war noch feucht von ihrer gemeinsamen Dusche. Sie roch frisch und sauber. Wie ein Zitronenhain in warmem Sonnenschein. Kein Makeup. Sie trug warme Pantoffeln und weite, bequeme Kleidung. Annie war durchaus modebewusst und kleidete sich gern modisch. Aber noch lieber hatte sie es bequem.
Sie war nicht schlank. Sie war keine atemberaubende Schönheit. Annie Gamache hatte nichts von den Dingen, die er an Frauen immer attraktiv gefunden hatte. Aber Annie wusste etwas, was die meisten Menschen nie lernen. Sie wusste, was für ein Geschenk es war zu leben.
Um das zu lernen, hatte Jean-Guy Beauvoir fast vierzig Jahre gebraucht, aber dann war auch bei ihm der Groschen gefallen. Und jetzt wusste er, dass es nichts Schöneres gab.
Annie ging auf die Dreißig zu. Als sie sich zum ersten Mal begegnet waren, war sie ein linkischer Teenager gewesen. Als der Chief Inspector Beauvoir in seine Mordkommission in der Sûreté du Québec geholt hatte. Aus den Hunderten von Agents und Inspectors unter seinem Kommando hatte er diesen jungen, nassforschen Agent ausgesucht, den sonst niemand als Stellvertreter haben wollte.
Hatte ihn in sein Team integriert und schließlich, im Lauf der Jahre, sogar in die Familie.
Obwohl nicht einmal der Chief Inspector eine Ahnung hatte, wie sehr Beauvoir Teil der Familie geworden war.
»Jetzt haben wir also auch so eine Geschichte«, sagte Annie mit einem verschmitzten Lächeln, »mit der wir unsere Kinder vor ein Rätsel stellen können. Wenn wir sterben und sie dieses Ding hier finden, werden sie sich bestimmt wundern.«
Sie hielt den Stampfer mit seiner knallroten Schleife hoch.
Beauvoir wagte nicht, etwas zu sagen. Ahnte Annie, was sie da gerade gesagt hatte? Die Selbstverständlichkeit, mit der sie davon ausgegangen war, dass sie einmal Kinder bekommen würden. Enkelkinder. Miteinander sterben würden. In einem Zuhause, das nach frischen Zitronen und Kaffee roch. Und in dem es eine Katze gab, die sich in der Sonne zusammenrollte.
Sie waren jetzt drei Monate zusammen und hatten nie über die Zukunft gesprochen. Doch als er es jetzt hörte, erschien es ihm ganz natürlich. Als wäre das immer schon der Plan gewesen. Kinder zu haben. Gemeinsam alt zu werden.
Beauvoir rechnete nach. Er war zehn Jahre älter als sie und würde mit hoher Wahrscheinlichkeit als Erster sterben. Er war erleichtert.
Doch etwas bereitete ihm Sorgen.
»Wir müssen es deinen Eltern erzählen«, sagte er.
Annie wurde still und zupfte an ihrem Croissant herum. »Ich weiß. Und es ist nicht so, dass ich nicht will. Aber«, sie hielt inne und blickte sich in der Küche um, bevor sie in ihr Wohnzimmer mit den Bücherregalen schaute, »so ist es auch schön. Nur wir zwei.«
»Machst du dir deswegen Gedanken?«
»Wie sie es aufnehmen werden?«
Annie zögerte, und Jean-Guys Herz begann plötzlich zu klopfen. Er hatte erwartet, dass sie es leugnen, ihm versichern würde, dass sie sich keinerlei Gedanken machte, wie ihre Eltern es aufnehmen würden.
Stattdessen zögerte sie.
»Ein bisschen vielleicht«, gab Annie zu. »Ich bin sicher, sie finden es klasse. Aber dadurch wird sich auch einiges ändern.«
Das war ihm durchaus klar, aber er hatte nicht gewagt, es sich selbst einzugestehen. Angenommen, der Chef war nicht mit ihrer Verbindung einverstanden? Ändern könnte er zwar nichts daran, aber eine Katastrophe wäre es trotzdem.
Nein, sagte sich Jean-Guy zum hundertsten Mal, es wird alles gut. Der Chief und Madame Gamache werden sich freuen. Sehr sogar.
Aber er wollte sicher sein. Er wollte Gewissheit. Das lag in seiner Natur. Es war sein Beruf, Fakten zu sammeln, und diese Ungewissheit forderte ihren Tribut. Sie war der einzige Schatten in einem plötzlich und unerwarteterweise so strahlenden Leben.
Er konnte den Cief Inspector nicht weiter belügen. Er hatte sich einzureden versucht, es wäre keine Lüge, er täte nichts weiter, als sein Privatleben für sich zu behalten. Aber wenn er ehrlich war, kam er sich wie ein Betrüger vor.
»Glaubst du wirklich, sie werden sich freuen?«, fragte er Annie und hasste die Unsicherheit, die sich in seine Stimme geschlichen hatte. Aber entweder bemerkte Annie sie nicht, oder sie störte sich nicht daran.
Sie beugte sich vor, stützte Ellbogen und Unterarme auf die Croissantbrösel auf dem Kieferntisch und ergriff seine Hand. Sie hielt sie warm in ihren.
»Wenn sie erfahren, dass wir zusammen sind? Mein Vater freut sich garantiert. Nur meine Mutter kann dich auf den Tod nicht ausstehen …«
Als sie sein Gesicht sah, lachte sie und drückte seine Hand. »Ich mache doch nur Witze. Sie ist total hin und weg von dir. Von Anfang an. Sie sieht dich als Teil der Familie. Als einen weiteren Sohn.«
Er spürte seine Wangen brennen, als er diese Worte hörte, und schämte sich deswegen, merkte aber zugleich, dass sich Annie auch daran nicht störte und es nicht kommentierte. Sie hielt nur seine Hand und sah ihm in die Augen.
»Das hört sich ja gefährlich nach Inzucht an«, brachte er schließlich hervor.
»Ja«, pflichtete sie ihm bei und ließ seine Hand los, um einen Schluck Café au Lait zu nehmen. »Der Traum meiner Eltern ist wahr geworden.« Sie lachte und stellte die Tasse wieder ab. »Du weißt doch, dass er begeistert sein wird.«
»Überrascht auch?«
Annie dachte kurz nach. »Ich glaube, er wird baff sein. Komisch, nicht? Dad tut sein ganzes Leben lang nichts anderes, als nach Anhaltspunkten zu suchen, Details zusammenzufügen. Beweise zu sammeln. Aber wenn etwas direkt unter seiner Nase passiert, übersieht er es. Zu nahe wahrscheinlich.«
»Matthäus 10,36«, murmelte Beauvoir.
»Wie bitte?«
»Das ist etwas, was uns dein Vater in der Mordkommission immer vorbetet. Eine der ersten Lektionen, die er den Neuen mitgibt.«
»Eine Bibelstelle?« Annie sah ihn ungläubig an. »Mom und Dad gehen nie in die Kirche.«
»Anscheinend hat er sie von seinem Mentor, als er selbst zur Sûreté gekommen ist.«
Das Telefon klingelte. Nicht das robuste Läuten des Festnetzanschlusses, sondern das gut gelaunte, penetrante Trällern eines Handys. Es war das von Beauvoir. Er stürzte ins Schlafzimmer, um es vom Nachttisch zu holen.
Nummer wurde keine angezeigt, nur ein Wort.
»Chief.«
Fast hätte Beauvoir auf das kleine grüne Telefon-Icon gedrückt, besann sich aber eines Besseren. Er ging aus dem Schlafzimmer in Annies lichtdurchflutetes, mit Büchern gefülltes Wohnzimmer. Er wollte nicht mit dem Chef sprechen, wenn er vor dem Bett stand, in dem er sich an diesem Morgen mit dessen Tochter geliebt hatte.
»Oui, allô«, sagte er so beiläufig wie möglich.
»Entschuldigen Sie die Störung«, meldete sich die vertraute Stimme. Sie schaffte es, gleichzeitig entspannt und respekteinflößend zu klingen.
»Überhaupt kein Problem, Sir. Was gibt’s?« Beauvoir warf einen kurzen Blick auf die Uhr auf dem Kaminsims. Es war 10:23 Uhr an einem Samstagmorgen.
»Ein Mord.«
Dann war es kein privater Anruf. Keine Einladung zum Abendessen. Keine Frage zu einer Personalentscheidung oder einem Fall, der vor Gericht kam. Es war ein Ruf zu den Waffen. Ein Ruf zur Tat. Ein Ruf, der besagte, dass etwas Schreckliches passiert war. Und dennoch machte sein Herz schon seit mehr als zehn Jahren jedes Mal einen Sprung, wenn er diese Worte hörte. Es begann schneller zu schlagen. Und sogar ein bisschen zu tanzen. Nicht vor Freude über einen schrecklichen und frühzeitigen Tod, sondern weil er und der Cief Inspector und andere wieder einmal einer Spur folgen würden.
Jean-Guy Beauvoir liebte seinen Job. Doch jetzt schaute er zum ersten Mal in die Küche und sah Annie in der Tür stehen. Und ihn beobachten.
Überrascht stellte er fest, dass es jetzt etwas gab, was er noch mehr liebte.
Er schnappte sich sein Notizbuch, setzte sich auf Annies Sofa und notierte sich die Einzelheiten. Als er fertig war, schaute er auf das, was er geschrieben hatte, und hauchte:
»O Mann.«
»Das kann man wohl sagen«, bestätigte ihm Chief Inspector Gamache. »Können Sie bitte alles Nötige veranlassen? Und vorerst nur wir beide. Wenn wir da sind, nehmen wir einen Sûreté-Agent von dort mit.«
»Was ist mit Inspector Lacoste? Sollte sie vielleicht mitkommen? Nur um das Tatort-Team zusammenzustellen? Dann könnte sie ja wieder zurück.«
Chief Inspector Gamache zögerte nicht. »Nein.« Er lachte knapp. »Das Tatort-Team sind leider wir. Hoffentlich wissen Sie noch, wie so was geht.«
»Ich bringe den Staubsauger mit.«
»Bon. Meine Lupe habe ich schon eingepackt.« Nach einem kurzen Moment der Stille kam eine ernstere Stimme aus dem Hörer. »Wir dürfen keine Zeit verlieren, Jean-Guy.«
»D’accord. Ich muss nur noch kurz telefonieren und hole Sie in fünfzehn Minuten ab.«
»In fünfzehn Minuten? Wie wollen Sie das von Downtown schaffen?«
Beauvoir hatte ein Gefühl, als bliebe die Welt stehen. Seine kleine Wohnung war in der Innenstadt von Montréal, aber die von Annie war im Viertel Plateau Mont Royal, nur wenige Straßen vom Haus ihrer Eltern in Outremont entfernt. »Heute ist Samstag. Da ist kaum Verkehr.«
Gamache lachte. »Seit wann sind Sie Optimist? Ich warte auf Sie, egal, wann Sie aufkreuzen.«
»Ich werde mich beeilen.«
Und das tat er. Rief an, erteilte Anweisungen, organisierte. Dann stopfte er ein paar Sachen in eine Reisetasche.
»Das ist aber viel Unterwäsche«, sagte Annie, die auf dem Bett saß. »Hast du vor, länger wegzubleiben?« Ihr Ton war leicht, was sie ausstrahlte aber nicht.
»Du kennst mich doch«, sagte er und drehte sich von ihr weg, um seine Dienstwaffe ins Holster zu stecken. Sie wusste, dass er sie hatte, sah sie aber nicht gern. Selbst für eine Frau, die sich nichts vormachte, hatte die Pistole etwas zu Reales. »Ohne den Stampfer brauche ich wahrscheinlich mehr Furzfänger.«
Sie lachte, und er war froh.
An der Tür blieb er stehen und stellte die Tasche ab.
»Je t’aime«, flüsterte er ihr ins Ohr, als er sie in den Armen hielt.
»Je t’aime«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Und als sie sich voneinander lösten, fügte sie hinzu: »Pass auf dich auf.« Und dann, als er schon halb die Treppe hinunter war, rief sie: »Und pass bitte auf meinen Vater auf.«
»Werde ich. Versprochen.«
Sobald er weg war und sie sein Auto nicht mehr sehen konnte, schloss Annie Gamache die Tür und hielt die Hand an ihre Brust.
Sie fragte sich, ob es ihrer Mutter all die Jahre genauso gegangen war.
Und wie es ihrer Mutter jetzt wohl ging? Ließ auch sie sich gegen den Türstock sinken, nachdem sie ihr Herz hatte gehen sehen? Nachdem sie es hatte gehen lassen.
Schließlich ging Annie zu den Bücherregalen in ihrem Wohnzimmer. Nach wenigen Minuten fand sie, was sie suchte. Die Bibel, die ihre Eltern ihr zur Taufe geschenkt hatten. Obwohl sie nicht in die Kirche gingen, hielten sie sich an die Rituale.
Und sie wusste, dass auch sie ihre Kinder taufen lassen würde, wenn sie welche bekäme. Sie und Jean-Guy würden ihnen ihre eigenen weißen Bibeln schenken, mit ihren Namen und den Taufdaten darin.
Sie schaute auf die dicke erste Seite. Und natürlich stand dort ihr Name. Anne Daphné Gamache. Und ein Datum. In der Handschrift ihrer Mutter. Aber statt eines Kreuzes hatten ihre Eltern zwei kleine Herzen unter ihren Namen gezeichnet.
Dann setzte sich Annie aufs Sofa und trank ihren inzwischen abgekühlten Café au Lait, während sie die Stelle in dem ungewohnten Buch nachschlug.
Matthäus 10,36.
»Und des Menschen Feinde«, las sie laut, »werden seine eigenen Hausgenossen sein.«
2
Das offene Aluminiumboot pflügte hopsend durch die Wellen und spritzte Tropfen frischen, kalten Wassers in Beauvoirs Gesicht. Er hätte weiter nach hinten rücken können, ins Heck. Aber er saß gern auf dem schmalen dreieckigen Sitz vorn im Bug. Er beugte sich vor und vermutete, dass er aussah wie ein Retriever, der kaum erwarten konnte, dass es losging. Dass die Jagd begann.
Aber es war ihm egal. Dann sah er eben so aus. Er war nur froh, dass er keinen Schwanz hatte, der seine einsilbige Fassade Lügen gestraft hätte. Ja, dachte er, ein Schwanz wäre ein großer Nachteil für einen Mordermittler.
Das Röhren des Boots, das Auf und Ab, die gelegentlichen Stöße waren belebend. Sogar die erfrischende Gischt und den Geruch von frischem Wasser und Wald mochte er. Und den Hauch von Fisch und Würmern.
Wenn es keine Mordermittler beförderte, wurde das kleine Boot offensichtlich zum Fischen verwendet. Nicht auf kommerzieller Basis. Dafür war es viel zu klein. Außerdem eignete sich der kleine See nicht für Fischfang im großen Stil. Nur zum Hobbyangeln. Der Bootsführer warf die Rute im klaren Wasser der felsigen Buchten aus. Saß den ganzen Tag nur da, warf hin und wieder aus. Und holte ein.
Auswerfen. Und einholen. Allein mit seinen Gedanken.
Beauvoir schaute zum Heck. Eine seiner großen verwitterten Hände hatte der Bootsführer am Griff des Außenbordmotors. Die andere lag auf seinem Knie. Auch er war vornübergebeugt, eine Haltung, die er wahrscheinlich seit seiner Kindheit kannte. Die scharfen blauen Augen auf das Wasser vor ihm gerichtet. Auf Buchten und Inseln, die er ebenfalls seit seiner Kindheit kannte.
Konnte es Spaß machen, immer wieder das Gleiche zu tun, fragte sich Beauvoir. Früher war ihm schon der bloße Gedanke unerträglich gewesen. Routine, Wiederholung. Für ihn war es gleichbedeutend mit Tod, oder zumindest todlangweilig, ein vorhersehbares Leben zu führen.
Inzwischen war er sich da nicht mehr so sicher. Im Moment rauschte er in einem offenen Boot einem neuen Fall entgegen. Mit dem Wind und der Gischt in seinem Gesicht. Doch er sehnte sich einzig und allein danach, zusammen mit Annie auf dem Sofa zu sitzen und die Sonntagszeitung zu lesen. Das zu tun, was sie jedes Wochenende taten. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Bis er starb.
Trotzdem, wenn er nicht bei ihr sein konnte, war das hier seine zweite Wahl. Er blickte sich um, betrachtete die Wälder. Die Felsbuchten. Den verlassenen See.
Es gab schlechtere Büros als dieses.
Er musste ein bisschen grinsen über den grimmigen Bootsführer. Das hier war auch sein Büro. Würde er sich, wenn er sie abgesetzt hatte, eine stille Bucht suchen, seine Angel auspacken und sie auswerfen?
Auswerfen. Und einholen.
Bei diesem Gedanken wurde Beauvoir bewusst, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach auch sie gleich tun würden. Ihre Angel nach Anhaltspunkten, Beweisen, Zeugen auswerfen. Und einholen.
Und früher oder später, mit dem richtigen Köder, würden sie einen Mörder fangen.
Nur dass sie ihn, wenn die Sache nicht völlig aus dem Ruder lief, wahrscheinlich nicht verspeisen würden.
Direkt vor dem Bootsführer saß Captain Charbonneau, Leiter der Außenstelle der Sûreté in La Mauricie. Er war Mitte vierzig, etwas älter als Beauvoir, sportlich und dynamisch und hatte den wachen Blick von jemandem, der sehr genau registrierte, was um ihn herum passierte.
Das tat er auch jetzt.
Captain Charbonneau hatte sie am Flugzeug abgeholt und den halben Kilometer zum Hafen gefahren, wo der Bootsführer wartete.
»Das ist Etienne Legault«, stellte er den Bootsführer vor, der nickte, aber eine ausführlichere Begrüßung nicht für nötig hielt. Legault roch nach Benzin und rauchte eine Zigarette, und Beauvoir wich einen Schritt zurück.
»Leider müssen wir etwa zwanzig Minuten mit dem Boot fahren«, erklärte ihnen Captain Charbonneau. »Anders kommt man da nicht hin.«
»Waren Sie schon mal dort?«, fragte Beauvoir.
Der Captain grinste. »Nein, nie. Jedenfalls nicht drinnen. Aber ein paarmal war ich nicht weit von dort fischen. Wie alle bin ich natürlich neugierig. Außerdem ist es eine gute Stelle zum Angeln. Riesige Barsche und Seeforellen. Ich hab sie aus der Ferne gesehen, sie haben auch geangelt. Aber ich hab sie in Ruhe gelassen. Ich glaube, sie sind lieber allein.«
Sie waren alle in das offene Boot geklettert, und inzwischen hatten sie etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Captain Charbonneau schaute nach vorn oder erweckte zumindest den Anschein. Aber Beauvoir entging nicht, dass sich der höherrangige Sûreté-Beamte nicht ausschließlich auf die dichten Wälder oder die kleinen Einschnitte und Buchten konzentrierte.
Er warf immer wieder verstohlene Blicke auf etwas, das er wesentlich interessanter fand.
Den Mann vor ihm.
Beauvoirs Blick wanderte zum vierten Mann im Boot.
Zum Chief Inspector. Beauvoirs Chef und Annies Vater.
Armand Gamache war ein stattlicher, aber kein behäbiger Mann. Wie der Bootsführer hatte auch Chief Inspector Gamache die Augen zusammengekniffen, sodass sich um Mund und Augen Falten bildeten. Doch im Gegensatz zum Gesichtsausdruck des Bootsführers war seiner nicht verdrießlich. Stattdessen blickten seine dunkelbraunen Augen nachdenklich und nahmen alles auf. Die von Gletschern geformten Hügel, den Wald in seinen leuchtenden Herbstfarben. Das felsige Ufer, frei von Stegen, Behausungen oder sonstigen Anlegestellen.
Echte Wildnis. Vögel, die vielleicht nie ein menschliches Wesen gesehen hatten, flogen über sie hinweg.
Beauvoir war ein Jäger, Armand Gamache hingegen ein Forscher. Blieben andere stehen, ging Gamache voran. Spähte in Risse und Spalten und Höhlen. In denen finstere Dinge hausten.
Der Chief Inspector war Mitte fünfzig. Das ergrauende Haar an seinen Schläfen wellte sich leicht über seine Ohren. Die Narbe an seiner linken Schläfe wurde von einer Mütze fast verdeckt. Er trug eine khakifarbene gewachste Feldjacke, darunter ein Sakko mit Hemd und graugrüner Seidenkrawatte. Die große Hand, die er auf den Rand des Boots gelegt hatte, war bei der Fahrt über den See nassgespritzt worden. Die andere ließ er abwesend auf einer orangen Rettungsweste ruhen, die neben ihm auf dem Alusitz lag. Als sie am Anleger gestanden und das offene Boot mit der Angelrute, dem Netz, der Schale sich windender Würmer und dem wie eine Kloschüssel aussehenden Außenbordmotor gesehen hatten, hatte der Chief Inspector Beauvoir eine Rettungsweste in die Hand gedrückt, die neueste. Und als Jean-Guy sich darüber lustig gemacht hatte, hatte er darauf bestanden. Nicht, dass Beauvoir sie tragen musste, aber haben musste er sie.
Für alle Fälle.
Und deshalb hatte Inspector Beauvoir seine Rettungsweste in seinem Schoß liegen. Und war bei jedem Wellenstoß insgeheim froh, dass er sie hatte.
Er hatte den Chef noch vor elf zu Hause abgeholt. An der Tür war der Chief Inspector noch einmal kurz stehen geblieben, um Madame Gamache zu küssen. Sie verharrten eine Weile in ihrer Umarmung, bevor sie sich voneinander lösten. Dann wandte sich der Chef von ihr ab und kam mit einer Reisetasche über der Schulter die Treppe herunter.
Überwältigt von dem Gedanken, dass dieser Mann vielleicht bald sein Schwiegervater würde, roch Jean-Guy den dezenten Sandelholz- und Rosenwasserduft seines Eau de Cologne, als er zu ihm ins Auto stieg. Möglicherweise würden diesen tröstlichen Duft eines Tages Beauvoirs Kinder riechen, wenn dieser Mann sie in den Armen hielt.
Bald wäre Jean-Guy mehr als ein Ehrenmitglied dieser Familie.
Noch während er das dachte, hörte er ein leises Flüstern. Angenommen, sie sind nicht begeistert? Was dann?
Aber das war unvorstellbar, und er schlug sich den unwürdigen Gedanken aus dem Kopf.
Außerdem wurde ihm nach mehr als zehnjähriger Zusammenarbeit mit dem Chief Inspector zum ersten Mal klar, warum er nach Sandelholz und Rosenwasser roch. Das Sandelholz war sein eigenes Cologne. Das Rosenwasser kam von Madame Gamache, als sie sich umarmt hatten. Der Chef trug ihren Duft wie eine Aura. Vermischt mit seinem eigenen.
Dann holte Beauvoir lang und tief Atem. Und lächelte. Da war auch ein ganz schwacher Hauch von Zitrone. Annie. Kurz fürchtete er, ihr Vater könnte es ebenfalls riechen, merkte aber schnell, dass es ein privater Duft war. Er fragte sich, ob Annie jetzt ein bisschen nach Old Spice roch.
Sie waren noch vor Mittag am Flughafen eingetroffen und sofort zum Hangar der Sûreté du Québec gegangen. Dort hatte ihre Pilotin gerade ihren Kurs geplant. Sie war es gewöhnt, an entlegene Orte zu fliegen. Und auf Schotterstraßen oder Eispisten oder gar keinen Straßen zu landen.
»Wie ich sehe, haben wir heute sogar eine Landebahn«, sagte sie und kletterte auf den Pilotensitz.
»Tut mir leid«, sagte Gamache. »Wenn Sie möchten, können Sie auch gern auf dem See landen.«
Die Pilotin lachte. »Wäre nicht das erste Mal.«
Gamache und Beauvoir mussten gegen das Dröhnen der Motoren der kleinen Cessna anschreien, als sie über den Fall sprachen. Irgendwann verfiel der Chef in Schweigen und schaute aus dem Fenster. Allerdings entging Beauvoir nicht, dass er kleine Ohrstöpsel trug und Musik hörte. Beauvoir konnte sich gut vorstellen, welche Musik das war. Auf Chief Inspector Gamaches Gesicht lag der Anflug eines Lächelns.
Beauvoir wandte sich ab und schaute aus dem kleinen Fenster auf seiner Seite. Es war ein strahlend klarer Septembertag, und er konnte die Städte und Dörfer unter ihnen sehen. Dann wurden die Dörfer kleiner und spärlicher. Die Cessna neigte sich nach links und folgte einem gewundenen Fluss. Nach Norden.
Immer weiter nach Norden flogen sie. Jeder in seine eigenen Gedanken versunken. Den Blick auf die Erde unter ihnen gerichtet, wo die letzten Anzeichen von Zivilisation verschwanden, bis da nur noch Wald war. Und Wasser. Im hellen Sonnenschein war das Wasser nicht blau, sondern setzte sich aus Streifen und Flecken von Gold und blendendem Weiß zusammen. Sie folgten einem der goldenen Bänder. Immer tiefer in den Wald hinein. Ins Innerste von Québec. Zu einer Leiche.
Je weiter sie nach Norden flogen, desto stärker veränderte sich der dunkle Wald. Zuerst waren es nur vereinzelte Bäume. Doch bald wurden es immer mehr. Bis irgendwann der ganze Wald aus Gelb- und Rot- und Orangetönen und dem tiefdunklen Grün der Nadelbäume bestand.
Hier kam der Herbst früher. Je weiter nördlich, desto früher färbten sich die Blätter. Und je länger der Herbst dauerte, umso intensiver war er.
Und dann setzte das Flugzeug zum Sinkflug an. Immer weiter nach unten. Es sah aus, als würde es gleich ins Wasser eintauchen. Aber stattdessen beendete es seinen Sinkflug und segelte über den Boden, um auf einer unbefestigten Landepiste niederzugehen.
Und jetzt hopsten Chief Inspector Gamache, Inspector Beauvoir, Captain Charbonneau und der Bootsführer über den See. Das Boot drehte leicht nach rechts ab, und Beauvoir sah, wie sich der Gesichtsausdruck des Chefs veränderte. Von Nachdenklichkeit zu Staunen.
Gamache beugte sich vor. Mit leuchtenden Augen.
Beauvoir drehte sich auf seinem Sitz und schaute ebenfalls.
Sie waren in eine weite Bucht gebogen. Und an deren Ende lag ihr Ziel.
Und sogar Beauvoir durchlief ein Schauder. Auf der ganzen Welt hatten Millionen nach diesem Ort gesucht. Nach den zurückgezogenen Männern Ausschau gehalten, die hier lebten. Und als sie endlich entdeckt wurden, im hintersten Québec, waren Tausende hierher gereist, um die Männer, die sich hierher zurückgezogen hatten, kennenzulernen. Ihr Bootsführer könnte unzählige Touristen über diesen See geschippert haben.
Wenn Beauvoir ein Jäger und Gamache ein Forscher war, so waren die Männer und Frauen, die hierherkamen, Pilger. Die Zeugen der einzigartigen Gabe werden wollten, die diese Männer angeblich besaßen.
Aber vergeblich.
An der Pforte wurden alle abgewiesen.
Beauvoir merkte, dass er den Anblick, der sich ihm jetzt bot, bereits kannte. Von Fotos. Was sie in diesem Moment vor sich sahen, war ein beliebtes Poster geworden, mit dem Tourisme Québec Werbung für die Provinz machte. Was eigentlich nicht ganz korrekt war.
Ein Ort, zu dem niemand Zutritt erhielt, wurde dazu benutzt, Besucher anzulocken.
Auch Beauvoir beugte sich vor. Am Ende der Bucht erhob sich eine Festung, wie aus dem Fels gehauen. Ihr Turm ragte in die Höhe, als wäre er infolge eines seismischen Ereignisses aus der Erde herausgepresst worden. An den Seiten erstreckten sich Flügel. Oder Arme. Segnend, oder einladend, ausgebreitet. Ein Hafen. Eine sichere Umarmung in der Wildnis.
Alles Trug.
Das war das legendäre Kloster Saint-Gilbert-Entre-les-Loups. Das Zuhause von zwei Dutzend abgeschieden lebenden Mönchen. Die ihre Abtei so fernab jeder Zivilisation erbaut hatten wie nur irgend möglich.
Es hatte Hunderte Jahre gedauert, bis die Zivilisation sie fand, aber die stummen Mönche behielten das letzte Wort.
Vierundzwanzig Männer waren durch die Tür des Klosters getreten. Dann hatte sie sich hinter ihnen geschlossen. Und kein lebendes Wesen hatte mehr Zugang dazu erhalten.
Bis heute.
Chief Inspector Gamache, Jean-Guy Beauvoir und Captain Charbonneau standen kurz davor, Einlass zu finden. Ihre Eintrittskarte war ein Toter.
3
»Soll ich auf Sie warten?«, fragte der Bootsführer und rieb sich mit einem amüsierten Blitzen in den Augen die stoppligen Wangen.
Sie hatten ihm nicht gesagt, warum sie hergekommen waren. Und er dachte, sie seien Journalisten oder Touristen. Weitere irregeführte Pilger.
»Ja, bitte«, sagte Gamache und gab dem Mann seine Bezahlung, einschließlich eines großzügigen Trinkgelds.
Der Bootsführer steckte das Geld ein und beobachtete sie beim Entladen ihrer Sachen. Dann kletterte er auf den Anleger.
»Wie lang können Sie warten?«, fragte der Chief Inspector.
»Ungefähr drei Minuten.« Der Mann lachte. »Das sind zwei Minuten mehr, als Sie brauchen werden.«
»Könnten Sie bis …«, Gamache schaute auf die Uhr. Es war kurz nach eins. »… fünf Uhr warten?«
»Sie möchten, dass ich bis fünf hier warte? Hören Sie, ich weiß, Sie sind von weit her gekommen, trotzdem muss Ihnen doch klar sein, dass Sie nicht vier Stunden brauchen werden, um zu dieser Tür zu gehen, zu klopfen, umzudrehen und wieder zurückzukommen.«
»Sie werden uns reinlassen«, sagte Beauvoir.
»Sind Sie Mönche?«
»Nein.«
»Sind Sie der Papst?«
»Nein«, sagte Beauvoir.
»Dann gebe ich Ihnen drei Minuten. Nutzen Sie sie gut.«
Als sie vom Anleger den unbefestigten Weg hinaufgingen, fluchte Beauvoir leise vor sich hin. Als sie die massive Holztür erreichten, sagte der Chef mahnend:
»Reißen Sie sich zusammen, Jean-Guy. Ab jetzt wird nicht mehr geflucht.«
»Ja, patron.«
Gamache nickte, und Jean-Guy hob die Hand und klopfte gegen die Tür. Es entstand fast kein Geräusch, tat aber gemein weh.
»Maudit tabarnac«, zischte er.
»Das ist, glaube ich, die Türglocke.« Charbonneau deutete auf einen langen Eisenstab in einer in den Stein gehauenen Vertiefung.
Beauvoir griff danach und drosch damit gegen die Tür. Diesmal entstand ein lauteres Geräusch. Er schlug noch einmal dagegen, und jetzt sah er die Schrammen, wo andere gegen die Tür geschlagen hatten. Immer und immer wieder.
Jean-Guy blickte hinter sich. Der Bootsführer hob sein Handgelenk und tippte auf seine Uhr. Beauvoir drehte sich wieder zur Tür und erschrak.
Das Holz hatte Augen bekommen. Die Tür schaute ihn an. Erst dann merkte er, dass sich ein Schlitz in ihr aufgetan hatte und zwei blutunterlaufene Augen nach draußen schauten.
War schon Beauvoir überrascht, die Augen zu sehen, schienen die Augen noch überraschter, ihn zu sehen.
»Ja?« Das Wort wurde vom Holz gedämmt.
»Bonjour, mon frère«, sagte Gamache. »Mein Name ist Armand Gamache. Ich bin der Chief Inspector der Mordkommission der Sûreté. Das sind Inspector Beauvoir und Captain Charbonneau. Ich glaube, wir werden erwartet.«
Das hölzerne Fenster wurde zugedrückt, und sie hörten ein unmissverständliches Klicken, als es verriegelt wurde. Dann tat sich eine Weile nichts, sodass sich Beauvoir schon fragte, ob sie wirklich nach drinnen gelassen würden. Und wenn nicht? Was würden sie dann tun? Die Tür aufbrechen? Vom Bootsführer war eindeutig keine Hilfe zu erwarten. Vom Anleger wehte ein leises Lachen herauf, das sich mit dem Plätschern der Wellen mischte.
Er schaute in den Wald. Er war dicht und dunkel. Und man hatte versucht, ihn in Schach zu halten. Beauvoir konnte sehen, wo Bäume gefällt worden waren. Entlang der Klostermauern sprenkelten ihre Stümpfe den Boden, als wäre es nach einer Schlacht zu einem prekären Waffenstillstand gekommen. Im dunklen Schatten des Klosters sahen die Baumstümpfe aus wie Grabsteine.
Beauvoir holte tief Luft und riss sich zusammen. Es sah ihm nicht ähnlich, so phantasievoll zu sein. Ihn interessierten nur Fakten. Er sammelte sie. Derjenige, der Gefühle sammelte, war der Chief Inspector. Bei jedem Mordfall ließ sich Gamache von diesen Gefühlen leiten, den tief sitzenden, verfaulenden und verwesenden. Und am Ende dieser Schleimspur fand Gamache den Mörder.
Während der Chef sich von Gefühlen leiten ließ, folgte Beauvoir den Fakten. Kalt und hart. Aber mit vereinten Kräften gelangten die zwei Männer ans Ziel.
Sie waren ein gutes Team. Ein hervorragendes Team.
Und wenn er sich nicht darüber freut? Die Frage hatte sich aus dem Wald an Beauvoir herangeschlichen. Und wenn er nicht will, dass Annie mit mir zusammen ist?
Aber auch das war nur Einbildung. Keine Tatsache. Keine Tatsache. Keine Tatsache.
Er starrte auf die Tür und sah wieder die Narben, wo gegen sie geschlagen worden war. Von jemandem oder etwas, das unbedingt nach drinnen hatte kommen wollen.
Neben ihm stand Chief Inspector Gamache seelenruhig da. Wie ein Fels. Und schaute auf die Tür, als wäre sie das Interessanteste, was er jemals gesehen hatte.
Und Captain Charbonneau? Aus dem Augenwinkel konnte Beauvoir sehen, dass der Kommandant des Außenpostens ebenfalls auf die Tür schaute. Er fühlte sich sichtlich unwohl, schien es kaum erwarten zu können, entweder einzutreten oder sich zurückzuziehen. Zu kommen oder zu gehen. Etwas anderes zu tun, als auf der Schwelle zu stehen und zu warten wie ein sehr höflicher Eroberer, egal was.
Dann ertönte ein Geräusch, und Beauvoir sah Charbonneau überrascht zusammenzucken.
Sie hörten ein langes Schaben von Eisen auf Holz. Dann Stille.
Gamache hatte sich nicht bewegt, war nicht überrascht, und wenn doch, ließ er es sich nicht anmerken. Die Hände am Rücken verschränkt, schaute er weiter auf die Tür. Als hätte er alle Zeit der Welt.
Ein Spalt tat sich auf. Wurde breiter. Noch breiter.
Beauvoir rechnete mit einem Quietschen von rostigen alten Türangeln, die endlich benutzt wurden. Stattdessen war absolut nichts zu hören. Was noch beunruhigender war.
Die Tür ging ganz auf, und vor ihnen stand eine Gestalt in einer langen schwarzen Kutte. Aber sie war nicht vollkommen schwarz. Auf ihren Schultern waren weiße Epauletten, und ein Teil ihrer Brust war von einer schmalen, ebenfalls weißen Schürze bedeckt. Als ob der Mönch sich eine Leinenserviette in den Kragen gesteckt und sie abzunehmen vergessen hätte.
Um seinen Bauch war ein Seil gebunden, und daran hing ein Ring mit einem einzigen riesigen Schlüssel.
Der Mönch nickte und trat zur Seite.
»Merci«, sagte Gamache.
Beauvoir drehte sich zum Bootsführer um und konnte es sich nur mit Mühe verkneifen, ihm den Finger zu zeigen.
Wären seine Passagiere über dem Boden geschwebt, hätte der Bootsführer nicht verdutzter gucken können.
In der Tür drehte sich Chief Inspector Gamache noch einmal um und rief ihm zu: »Dann also um fünf?«
Der Bootsführer nickte und brachte ein »Oui, patron« hervor.
Gamache drehte sich wieder zu der offenen Tür und zögerte. Einen Herzschlag lang. Nur für jemanden erkennbar, der ihn gut kannte. Beauvoir sah seinen Chef an und wusste, warum.
Er wollte diesen einzigartigen Moment genießen. Nur noch ein Schritt und er wäre der erste Nichtgeistliche überhaupt, der seinen Fuß in das Kloster Saint-Gilbert-Entre-les-Loups setzte.
Dann machte Gamache diesen Schritt, und die anderen folgten ihm.
Mit einem leisen, dumpfen Schmatzen schloss sich die Tür hinter ihnen. Der Mönch hob seinen großen Schlüssel, steckte ihn in das große Schloss und drehte ihn.
Sie waren eingeschlossen.
Armand Gamache hatte damit gerechnet, eine Weile zu brauchen, um sich an das Dunkel zu gewöhnen. Er hatte nicht damit gerechnet, sich an das Licht gewöhnen zu müssen.
Weit davon entfernt, düster zu sein, war das Innere der Abtei von Licht durchflutet.
Vor ihnen lag ein langer, breiter Flur aus grauen Steinen, der zu einer geschlossenen Tür führte. Was jedoch den Chef am meisten erstaunte, was jeden Mann, jeden Mönch, der im Lauf der Jahrhunderte durch diese Türen getreten war, erstaunt haben musste, war das Licht.
Der Gang war voller Regenbögen, schwindelerregender Prismen. Sie wurden von den harten Steinwänden zurückgeworfen. Bildeten Pfützen auf den Schieferböden. Veränderten ihre Form, mischten sich und trennten sich wieder, als wären sie lebendig.
Der Chief Inspector wusste, dass er mit offenem Mund dastand, aber es war ihm egal. Etwas Derartiges hatte er noch nie gesehen, obwohl er in seinem Leben schon viele erstaunliche Dinge zu Gesicht bekommen hatte. Es war, als träte man in pure Freude.
Er drehte sich zur Seite und fing den Blick des Mönchs auf. Hielt ihn kurz.
In seinen Augen war keine Freude. Nur Leid. Das Dunkel, das Gamache im Innern des Klosters vorzufinden erwartet hatte, war nicht in den Mauern, sondern in den Männern. Zumindest in diesem Mann.
Dann drehte sich der Mönch ohne ein Wort um und ging den Flur hinunter. Trotz seiner raschen Schritte machten seine Füße kaum ein Geräusch. Nur seine Kutte streifte leise über die Steine. An den Regenbogen vorbei.
Die Sûreté-Beamten warfen sich ihre Taschen über die Schultern und traten in die Spektren aus warmem Licht.
Gamache blickte sich um, während er dem Mönch folgte. Das Licht kam durch Fenster hoch oben in den Wänden. In Kopfhöhe gab es keine Fenster. Die niedrigsten waren drei Meter über dem Boden. Und darüber befand sich eine weitere Fensterreihe. Durch sie konnte Gamache tiefblauen Himmel sehen, ein paar Wolken und Baumspitzen, die sich vorzubeugen schienen, um von draußen hereinzuschauen. Genauso wie er nach draußen schaute.
Das Glas war alt. Bleigefasst. Unvollkommen. Und es waren die Unvollkommenheiten, die das Lichtspiel hervorbrachten.
An den Wänden gab es keinerlei Verzierungen. Nicht nötig.
Der Mönch öffnete die Tür. Sie führte in einen größeren, kühleren Raum. Hier waren die Regenbögen auf einen einzigen Punkt gerichtet. Den Altar.
Das war die Kirche.
Der Mönch eilte hindurch, machte eine rasche Kniebeuge. Seine Schritte wurden schneller, als ob das Kloster leicht kippen würde und sie ihrem Ziel entgegenpurzelten.
Der Leiche.
Gamache blickte sich um und nahm rasch alles auf. Von Männern, die diesen Ort wieder verlassen durften, waren diese Anblicke und Geräusche noch nie wahrgenommen worden.
In der Kapelle roch es nach Weihrauch. Es war jedoch nicht der beißende, abgestandene Geruch vieler Québecer Kirchen, in denen man den Eindruck hatte, dass dort etwas Verdorbenes versteckt wurde. Hier war der Geruch natürlicher. Wie Blumen oder frische Kräuter.
In einer Aufeinanderfolge flüchtiger Eindrücke nahm Gamache alles wahr.
Hier gab es kein trübes, belehrendes Buntglas. Da die Fenster hoch oben in den Wänden leicht angewinkelt waren, fiel das Licht zuerst auf den schlichten, nüchternen Altar. Er war nicht verziert. Bis auf das heitere Licht, das über seine Oberflächen spielte, an die Wände geworfen wurde und die hintersten Ecken des Kirchenraums erhellte.
Und noch etwas sah Gamache in diesem Licht. Sie waren nicht allein.
Auf beiden Seiten des Altars saßen einander zwei Reihen Mönche gegenüber. Die Köpfe gesenkt, die Hände im Schoß gefaltet. Alle in der genau gleichen Haltung. Wie leicht vornüber geneigte Skulpturen.
Sie waren vollkommen still, beteten in dem bunten Spektrum aus Licht.
Gamache und seine Begleiter verließen die Kirche und betraten einen weiteren langen Gang. Einen weiteren langen Regenbogen. Immer dem Mönch hinterher.
Der Chief Inspector fragte sich, ob ihr Führer, der rasch ausschreitende Mönch, die Regenbögen überhaupt noch wahrnahm, durch die er watete. Waren sie für ihn alltäglich geworden? War an diesem einzigartigen Ort das Außergewöhnliche Normalität geworden? Dem Mann vor ihm schien seine Umgebung gleichgültig zu sein. Aber der Chief Inspector wusste, dass ein gewaltsamer Tod diese Wirkung haben konnte.
Er war wie eine Eklipse, die alles ausblendete, was schön, erhebend, reizvoll war. So groß war das Verhängnis.
Der Mönch, der ihnen voranging, war jung. Viel jünger, als Gamache erwartet hatte. Insgeheim machte er sich Vorwürfe wegen seiner Erwartungen. Das war eine der ersten Lektionen, die er den Neuen in der Mordkommission beibrachte.
Habt keine Erwartungen. Betretet jeden Raum, begegnet jedem Mann, jeder Frau, jedem Kind, betrachtet jede Leiche unvoreingenommen und offen. Nicht so offen, dass gleich das ganze Hirn rausfällt, aber offen genug, um das Unerwartete sehen und hören zu können.
Habt keine vorgefassten Meinungen. Mord ist unerwartet. Und oft ist das auch der Mörder.
Gamache hatte gegen seine eigene Regel verstoßen. Er hatte erwartet, dass die Mönche alt wären. Die meisten Mönche und Geistlichen und Nonnen in Québec waren das. Nicht viele junge Menschen fühlten sich noch zu einem geistlichen Leben hingezogen.
Wenn auch viele weiterhin nach Gott suchten, taten sie das nicht mehr in der Kirche.
Dieser junge Mann, dieser junge Mönch war die Ausnahme.
In dem flüchtigen Moment, in dem Chief Inspector Gamache und der Mönch einander angesehen hatten, in dem ihre Blicke sich getroffen hatten, waren Gamache zwei Dinge klar geworden. Der Mönch war fast noch ein Junge. Und er war extrem aufgeregt und versuchte, es zu verbergen. Wie ein Kind, das sich den Zeh an einem Stein gestoßen hat und sich die Schmerzen nicht anmerken lassen will.
Intensive Gefühle waren am Tatort eines Mordes an der Tagesordnung. Sie waren natürlich. Warum versuchte dieser junge Mönch, seine Gefühle zu verbergen? Besonders gut gelang es ihm zumindest nicht.
»O Mann«, stieß Beauvoir hervor, als er an Gamaches Seite kam. »Was wetten Sie, dass dahinter Montréal ist?«
Er deutete mit dem Kopf auf die nächste geschlossene Tür am Ende des Gangs. Beauvoir war stärker außer Atem als Gamache oder Captain Charbonneau, aber er trug auch mehr Gepäck.
Der Mönch nahm eine schmiedeeiserne Stange, ähnlich der am Eingang, von der Wand neben der Tür und schlug damit gegen das Holz. Ein lautes Dröhnen ertönte. Er wartete kurz, dann schlug er ein weiteres Mal gegen die Tür. Sie warteten. Schließlich nahm Beauvoir den Stab und drosch mit aller Kraft gegen die Tür.
Ihr Warten endete mit einem vertrauten Scharren, als wieder ein Riegel zurückgezogen wurde. Und die Tür ging auf.
4
»Ich bin Dom Philippe«, sagte der alte Mönch. »Der Abt von Saint-Gilbert. Danke, dass Sie gekommen sind.«
Er hatte die Hände in seine Ärmel geschoben und die Arme über dem Bauch verschränkt. Er wirkte erschöpft. Ein höflicher Mann, der sich angesichts eines barbarischen Akts an diese Höflichkeit zu klammern versuchte. Im Gegensatz zu dem jungen Mönch versuchte der Abt nicht, seine Gefühle zu verbergen.
»Es tut mir leid, aber es lässt sich nicht umgehen«, sagte Gamache und stellte sich und seine Männer vor.
»Bitte folgen Sie mir«, sagte der Abt.
Als Gamache sich umdrehte, um dem jungen Mönch, der ihnen den Weg gezeigt hatte, zu danken, war dieser bereits verschwunden.
»Wer war der Bruder, der uns hierhergebracht hat?«, fragte er.
»Frère Luc«, sagte der Abt.
»Er ist jung«, sagte Gamache, als er dem Abt durch den kleinen Raum folgte.
»Ja.«
Gamache glaubte nicht, dass Dom Philippe kurz angebunden war. Wenn jemand ein Schweigegelübde abgelegt hat, ist jedes Wort ein großes Opfer. Dom Philippe war sogar sehr großzügig.
Obwohl die Regenbögen und das heitere Licht des Gangs nicht bis hierher vordrangen, war der Raum alles andere als trist. Er wirkte sogar regelrecht heimelig und gemütlich. Die Decke war niedrig, und die Fenster waren kaum mehr als Schlitze in der Wand. Durch die rautenförmigen Scharten konnte Gamache den Wald sehen. Ein tröstlicher Kontrapunkt zum ausgelassenen Licht des Gangs.
In einer der von Bücherregalen gesäumten Steinwände befand sich ein großer offener Kamin. Sein Feuer wurde von zwei Stühlen mit einem Schemel dazwischen flankiert. Eine Lampe spendete zusätzliches Licht.
Elektrizität haben sie also, dachte Gamache. Er war sich nicht sicher gewesen.
Von dem kleinen Zimmer gingen sie in ein noch kleineres.
»Das war mein Arbeitszimmer.« Der Abt deutete mit dem Kopf auf den Raum, den sie gerade verlassen hatten. »Das hier ist meine Zelle.«
»Ihre Zelle?«, fragte Beauvoir, der die inzwischen fast unerträglich schweren Taschen über seinen hängenden Schultern zurechtrückte.
»Mein Schlafzimmer«, sagte Dom Philippe.
Die drei Sûreté-Beamten blickten sich um. Der Raum war kaum zwei auf drei Meter groß. Mit einem schmalen Einzelbett und einer kleinen Kommode, die zugleich als Privataltar zu dienen schien. Auf ihr stand eine Holzfigur der Gottesmutter mit dem Jesuskind. An einer Wand war ein hohes schmales Bücherregal, neben dem Bett stand ein winziger Holztisch mit Büchern darauf. Fenster gab es keins.
Die Männer drehten sich um die eigene Achse.
»Verzeihen Sie, mon père«, sagte Gamache. »Aber wo ist die Leiche?«
Ohne ein Wort zog der Abt am Bücherregal. Alle drei Männer streckten erschrocken die Arme aus, um das Regal aufzufangen, wenn es umstürzte, aber statt zu kippen, schwang es auf.
Strahlender Sonnenschein fiel durch das unerwartete Loch in der Steinwand. Dahinter konnte der Chief Inspector von buntem Herbstlaub gesprenkeltes grünes Gras sehen, umringt von Büschen in den unterschiedlichsten Stadien der Herbstfärbung. Und einen einzigen großen Baum. Einen Ahorn. In der Mitte des Gartens.
Gamaches Blick wanderte jedoch sofort zum hinteren Teil des Gartens, zu der Gestalt, die dort zusammengekrümmt lag. Und zu den zwei Mönchen, die in ihren Kutten reglos etwa einen Meter von der Leiche entfernt standen.
Die Sûreté-Beamten gingen durch die letzte Tür. In den unerwarteten Garten.
»Heilige Maria, Mutter Gottes«, stimmten die Mönche mit tiefen, melodischen Stimmen an. »Bitte für uns Sünder …«
»Wann haben Sie ihn gefunden?«, fragte Gamache, als er sich der Leiche vorsichtig näherte.
»Mein Sekretär hat ihn nach den Laudes gefunden.« Als er Gamaches Gesicht sah, fügte der Abt hinzu: »Die Laudes enden um acht Uhr fünfzehn. Bruder Mathieu wurde etwa zwanzig vor neun gefunden. Mein Sekretär hat sofort den Arzt geholt, aber es war schon zu spät.«
Gamache nickte. Hinter ihm waren Beauvoir und Charbonneau bereits dabei, das Tatort-Equipment auszupacken. Der Chief Inspector inspizierte das Gras, dann streckte er die Hand aus und winkte den Abt behutsam ein paar Schritte zurück.
»Désolé, Dom Philippe, aber wir müssen vorsichtig sein.«
»Entschuldigung.« Der Abt wich zurück. Er wirkte hilflos, bestürzt. Nicht nur wegen der Leiche, auch wegen des plötzlichen Erscheinens von Männern, die er nicht kannte.
Gamache suchte Beauvoirs Blick und deutete unauffällig auf den Boden. Beauvoir nickte. Ihm war der leichte Unterschied zwischen dem Gras an dieser Stelle und im Rest des Gartens bereits aufgefallen. Hier waren die Halme geknickt. Und zeigten in Richtung Leiche.
Gamache wandte sich wieder dem Abt zu. Dom Philippe war groß und schlank und wie die anderen Mönche glatt rasiert. Auf dem Kopf hatte er kurze graue Stoppeln.
Die Augen des Abts waren tiefblau, und er erwiderte Gamaches nachdenklichen Blick, als suchte er einen Weg in ihn hinein. Der Chief Inspector schaute nicht weg, fühlte sich aber behutsam durchwühlt.
Der Abt schob seine Hände wieder in die Ärmel seiner Kutte. Die gleiche Haltung hatten auch die zwei anderen Mönche eingenommen, die mit geschlossenen Augen betend bei der Leiche standen.
»Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade …«
Der Rosenkranz. Gamache erkannte ihn. Konnte ihn noch im Schlaf heruntersagen.
» … der Herr ist mit dir …«
»Wer ist der Tote, Père Abbé?«
Gamache hatte sich so vor die Leiche gestellt, dass er dem Abt die Sicht auf sie verstellte. In manchen Fällen wollte er, dass die Verdächtigen nicht umhin konnten, die tote Person anzusehen. Die ermordete Person. Er wollte, dass ihr Anblick verstörte und zermürbte und verschliss.
Aber in diesem Fall nicht. Er vermutete, dass dieser in sich gekehrte Mönch diesen Anblick nie vergessen würde. Und dass Freundlichkeit vielleicht schneller zur Wahrheit führte.
»Mathieu. Bruder Mathieu«, antwortete der Abt.
»Der Chorleiter?«, fragte Gamache. »Oh.«