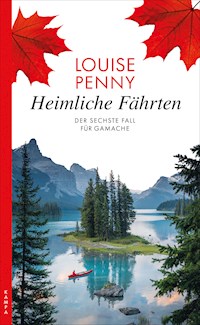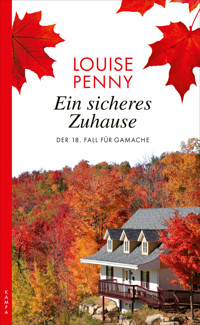Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Inspector Gamaches allererster Fall in Three Pines Rückblende: Wie ist Gamache eigentlich zu seinem Wochenendhaus in Three Pines gekommen? Als er noch nicht Polizeichef von Québec war, sondern nur Chef der Mordkommission in Montréal, führte ihn ein Fall in das charmante Dorf mitten in den kanadischen Wäldern, wo jeder jeden kennt und man auf seine Nachbarn zählen kann. Die Idylle wird jäh zerstört, als am Erntedankfest, einem leuchtend klaren Herbsttag, die Leiche von Jane Neal gefunden wird - getötet durch den Pfeil einer Armbrust. Es kann sich nur um einen Jagdunfall handeln, denn wer hätte einen Grund gehabt, die pensionierte Lehrerin umzubringen? Inspector Gamache muss die Sache aufklären, damit der Dorffrieden wiederhergestellt wird. Dabei wird er nicht nur den Mörder finden, sondern auch Freunde, wie die Buchhändlerin Myrna, die schrullige alte Dichterin Ruth oder Gabri und Olivier, das schwule Paar, das die Pension im Dorf führt. Und Gamache schließt Three Pines bei seinen Ermittlungen so sehr ins Herz, dass aus dem Tatort ein Sehnsuchtsort für ihn wird. Die erfolgreichste Krimiserie Kanadas geht weiter - und kehrt gleichzeitig zu ihren Anfängen zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Das Dorf in den roten Wäldern
Ein Fall für Gamache
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck
Kampa
Dieses Buch ist in Liebe Michael gewidmet
1
Jane Neal segnete im Frühnebel des Sonntags vor Thanksgiving das Zeitliche. Ihr Ableben kam für alle überraschend. Niemand würde behaupten wollen, Miss Neal wäre eines natürlichen Todes gestorben, es sei denn, man vertrat die Ansicht, dass alles im Leben vorherbestimmt war. Dann hatte Jane Neal sechsundsiebzig Jahre lang auf diesen Moment hingelebt, in dem sie zwischen den bunten Ahornbäumen am Rande von Three Pines ihren letzten Atemzug tat. Mit ausgestreckten Armen und Beinen lag sie in dem farbenprächtigen, raschelnden Laub, so als hätte sie gerade Engelchen flieg gespielt.
Chief Inspector Armand Gamache von der Sûreté du Québec kniete sich neben sie, und dabei knackten seine Knie so laut wie ein Gewehrschuss. Seine großen, kräftigen Hände schwebten über dem kleinen Blutfleck, der ihre flauschige Strickjacke verunzierte, als könne er wie durch Zauberei die Wunde zum Verschwinden bringen und die Frau zum Leben erwecken. Aber das konnte er nicht. Magie gehörte nicht zu seinen Gaben. Dafür besaß er andere. Der Geruch von Mottenkugeln, der ihn an seine Großmutter erinnerte, stieg ihm in die Nase. Janes sanfte und freundliche Augen starrten ihn an, als sei sie erstaunt, ihn zu sehen.
Er jedenfalls war überrascht, sie zu sehen. Das war sein kleines Geheimnis. Nicht dass er sie vorher schon einmal zu Gesicht bekommen hätte. Nein, sein kleines Geheimnis bestand darin, dass ihn mit Mitte fünfzig, auf dem Höhepunkt einer langen und inzwischen offenbar zum Stillstand gekommenen Laufbahn, ein gewaltsamer Tod noch immer überraschte. Was ungewöhnlich war für den Leiter der Mordkommission und vielleicht einer der Gründe, warum er in der von Zynismus geprägten Welt der Sûreté nicht weiter nach oben gelangte. Gamache hoffte stets, dass jemand vielleicht etwas missverstanden hatte und es gar keine Leiche gab. Aber bei der schon starren Miss Neal war ein Irrtum ausgeschlossen. Gestützt von Inspector Beauvoir erhob er sich, knöpfte zum Schutz gegen die Oktoberkälte seinen gefütterten Burberry zu und wunderte sich.
Einige Tage zuvor hatte sich schon jemand über Jane Neal gewundert, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Sie hatte sich mit ihrer Freundin und unmittelbaren Nachbarin Clara Morrow zum Kaffee im Bistro des Dorfes verabredet. Clara saß am Fenster und wartete. Geduld gehörte nicht gerade zu ihren Stärken, und ihre Ungeduld, zusammen mit dem Café au lait, machte sie nervös. Leise mit den Fingern auf die Tischplatte trommelnd sah Clara aus dem zweiflügeligen Fenster auf den Dorfanger und die alten Häuser und Ahornbäume, die ihn säumten. Die Bäume, deren Laub atemberaubende Rot- und Goldtöne angenommen hatte, waren im Grunde das Einzige, was sich in diesem ehrwürdigen Dorf jemals veränderte.
Sie beobachtete einen Pick-up, der mit einer wunderschön gesprenkelten Dammhirschkuh auf der Motorhaube auf der Rue du Moulin ins Dorf fuhr. Langsam umkreiste er den Dorfanger und zwang die Fußgänger innezuhalten. Es war Jagdsaison, und sie befanden sich in einem Jagdgebiet, wobei Jäger wie dieser zumeist aus Montréal oder einer anderen großen Stadt kamen. Sie mieteten einen Pick-up und polterten in der Morgen- und Abenddämmerung auf der Suche nach Wild wie Nilpferde zur Fressenszeit über die Feldwege. Wenn sie dann einen Hirschen erblickten, stiegen sie auf die Bremse, sprangen aus dem Wagen und ballerten los. Nicht alle Jäger waren so, das wusste Clara, aber es waren genug. Und genau diese Jäger banden ihre Beute dann auf der Motorhaube des Trucks fest und fuhren in der Gegend herum, überzeugt, dass das tote Tier auf dem Wagen Kunde davon gab, was für Helden sie waren.
Jedes Jahr erlegten diese Jäger Kühe und Pferde und Haustiere und andere Jäger. Und manchmal, man mochte es kaum glauben, erschossen sie sich auch selbst, möglicherweise in einem Anfall von Wahnsinn, in dem sie sich mit dem Sonntagsbraten verwechselten. Ein kluger Mensch hatte einmal gesagt, manchen Jägern – nicht allen, aber doch einigen – falle es schwer, eine Kiefer von einem Kitz oder einem Kind zu unterscheiden.
Clara fragte sich, wo Jane blieb. Da ihre Freundin meistens pünktlich war, konnte sie ihr die heutige Verspätung nachsehen. Clara fiel es ohnehin leicht, den meisten Leuten die meisten Dinge zu verzeihen. Allzu leicht, wie ihr Mann Peter meinte. Aber auch Clara hatte ihr kleines Geheimnis. Denn sie ließ es nicht immer auf sich beruhen. In den meisten Fällen schon. Aber manchmal merkte sie sich ein Vergehen und erinnerte sich seiner in Momenten, wenn sie durch die Unfreundlichkeit der Welt getröstet werden wollte.
Auf der Montreal Gazette, die jemand auf ihrem Tisch hatte liegen lassen, hatten sich die Krümel eines Croissants angesammelt. Dazwischen konnte Clara die Schlagzeilen lesen: Parti Québécois will Souveränitätsreferendum abhalten – Drogenkrieg in Townships – Wanderer verirren sich im Tremblant Park.
Clara riss ihren Blick von den trostlosen Schlagzeilen los. Sie und Peter hatten schon vor geraumer Zeit ihr Abonnement der Montreal Gazette gekündigt. Unwissenheit war wirklich ein Segen. Sie zogen das Lokalblättchen aus dem nahen Williamsburg vor, das sie über nichts Aufregenderes als Waynes Kuh, den Besuch der Enkel der Guylaines oder eine Quilt-Versteigerung zugunsten des Altenheims informierte. Ab und an fragte sich Clara, ob sie damit vor der Realität und der Verantwortung davonliefen, und dann stellte sie fest, dass es ihr egal war. Außerdem erfuhr sie alles zum Überleben Notwendige genau hier, in Oliviers Bistro, im Herzen von Three Pines.
»Du träumst mal wieder«, ertönte eine vertraute und geschätzte Stimme. Es war Jane, außer Atem und lächelnd, ihr von Lachfalten durchzogenes Gesicht gerötet von der kühlen Herbstluft und dem rasch zurückgelegten Weg von ihrem Cottage auf der anderen Seite des Dorfangers.
»Entschuldige bitte meine Verspätung«, sagte sie leise in Claras Ohr, als sie sich umarmten, die eine klein, mollig und atemlos, die andere dreißig Jahre jünger, schlank und noch immer etwas nervös von dem Kaffee. »Du zitterst ja«, bemerkte Jane, setzte sich an den Tisch und bestellte sich ebenfalls einen Café au lait. »Dass du dir solche Sorgen machst, hätte ich nicht gedacht.«
»Blöde Kuh«, sagte Clara und lachte.
»Das war ich heute Morgen, und wie. Hast du schon gehört?«
»Nein, was denn?« Neugierig beugte Clara sich vor. Sie war mit Peter in Montréal gewesen, um Leinwand und Acrylfarben zu kaufen. Sie waren beide Künstler. Peter ein erfolgreicher. Clara war noch nicht entdeckt worden, und wie die meisten ihrer Freunde insgeheim dachten, würde sie das auch nicht werden, wenn sie weiterhin darauf beharrte, solche unergründlichen Werke zu schaffen. Clara musste zugeben, dass ihre Serie von Kriegerinnen und deren Uteri auf kein besonders lebhaftes Käuferinteresse stieß, wohingegen sich ihre Haushaltsgegenstände mit toupierten Haaren und riesigen Füßen eines gewissen Erfolgs erfreuten. Sie hatte immerhin eine der Arbeiten verkauft. Die anderen fünfzig lagen im Keller, in dem es ein bisschen wie in Frankensteins Werkstatt aussah.
»Nein«, flüsterte Clara ein paar Minuten später schockiert. In den fünfundzwanzig Jahren, die sie nun in Three Pines lebte, hatte es ihres Wissens nie ein Verbrechen im Dorf gegeben. Wenn hier die Türen abgesperrt wurden, dann nur, um zu verhindern, dass einem die Nachbarn zur Erntezeit Körbe mit Zucchini in den Hausflur stellten. Gut, wie die Schlagzeile der Gazette zeigte, gab es noch etwas anderes, das in ähnlichen Mengen wie Zucchini geerntet wurde: Marihuana. Aber das wurde beharrlich ignoriert.
Davon abgesehen gab es keine Verbrechen. Keine Einbrüche, keinen Vandalismus, keine Überfälle. In Three Pines gab es nicht einmal eine Polizei. Ab und an fuhr Robert Lemieux von der lokalen Sûreté durch das Dorf, um deren Präsenz zu zeigen, aber im Grunde bestand kein Anlass dazu.
Bis zu diesem Morgen.
»Vielleicht war es ja nur ein schlechter Scherz?« Clara versuchte, das hässliche Bild zu verdrängen, das Janes Bericht vor ihrem geistigen Auge hatte entstehen lassen.
»Nein, das war kein Scherz«, sagte Jane und erzählte weiter. »Einer der Jungen lachte. Wenn ich jetzt so daran denke, kam es mir irgendwie bekannt vor. Es war kein heiteres Lachen.« Jane sah Clara mit ihren klaren blauen Augen an. Augen, in die Verwunderung geschrieben stand. »Es war ein Lachen, wie ich es manchmal in der Schule gehört habe. Glücklicherweise nicht oft. Ein Lachen, wie es Jungen von sich geben, wenn sie sich einen Spaß daraus machen, ein Tier oder einen Menschen zu quälen.« Der Gedanke ließ Jane erschauern, und sie zog ihre Strickjacke enger um sich. »Ein hässlicher Klang. Ich bin froh, dass du nicht dabei warst.«
Bei ihren letzten Worten streckte Clara den Arm über den runden Holztisch und nahm Janes kalte, kleine Hand. Sie wünschte, sie wäre statt Jane dort gewesen.
»Es waren Jugendliche, sagst du?«
»Sie trugen Skimasken, daher ist es schwer zu sagen, aber ich glaube, ich habe sie erkannt.«
»Wer war es?«
»Philippe Croft, Gus Hennessey und Claude LaPierre.« Jane flüsterte die Namen und sah sich vorsichtig um, als wolle sie sich vergewissern, dass niemand mithörte.
»Bist du sicher?« Clara kannte die drei. Sie waren nicht gerade Engel, aber genauso wenig würde man ihnen ein solches Vergehen zutrauen.
»Nein«, räumte Jane ein.
»Dann solltest du die Namen besser für dich behalten.«
»Zu spät.«
»Was meinst du damit, zu spät?«
»Ich habe ihre Namen schon genannt, heute Morgen, als es passierte.«
»Aber doch hoffentlich nur leise?« Clara spürte, wie ihr das Blut aus den Fingern und Zehen wich und zu ihrem Herzen strömte. Bitte, bitte, betete sie still.
»Ich habe sie laut gerufen.«
Als sie Claras Gesichtsausdruck sah, fügte Jane zu ihrer Rechtfertigung hinzu: »Ich wollte, dass sie aufhören. Und es hat geklappt. Sie haben aufgehört.«
Jane sah die Jungen immer noch vor sich, wie sie davonliefen, die Rue du Moulin entlang, aus dem Dorf hinaus. Der eine mit der leuchtend grünen Maske hatte sich umgedreht und sie angesehen. Seine Hände waren noch voller Entendreck gewesen. Entendreck, mit dem im Herbst die Blumenbeete auf dem Dorfanger gedüngt wurden und der dieses Jahr noch nicht verteilt worden war. Sie wünschte, sie hätte den Gesichtsausdruck des Jungen gesehen. War er wütend? Verängstigt? Belustigt?
»Dann hattest du also recht. Mit den Namen, meine ich.«
»Wahrscheinlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal den Tag erleben muss, an dem bei uns so etwas passiert.«
»Und deswegen hast du dich verspätet? Weil du dich sauber machen musstest?«
»Ja. Oder besser gesagt, nein.«
»Könntest du dich vielleicht noch ein wenig unklarer ausdrücken?«
»Vielleicht. Du bist doch in der Jury für die nächste Ausstellung der Arts Williamsburg, oder?«
»Ja. Wir treffen uns heute Nachmittag. Peter gehört auch dazu. Warum?« Clara wagte kaum, Luft zu holen. Konnte es wahr sein? Nachdem sie Jane so lange beschwatzt und liebevoll aufgezogen und manchmal auch nicht ganz so liebevoll gedrängt hatte, würde sie es endlich tun?
»Ich bin bereit.«
Noch nie hatte Clara jemanden so tief ausatmen hören wie jetzt Jane. Dabei wehten sogar ein paar Croissantkrümel von der Titelseite der Gazette auf Claras Schoß.
»Ich bin zu spät gekommen, weil ich eine Entscheidung treffen musste«, erklärte Jane und ihre Hände zitterten. »Ich möchte ein Bild für die Ausstellung einreichen.«
Kaum hatte sie das ausgesprochen, fing sie an zu weinen.
Janes Malerei war seit Urzeiten ein offenes Geheimnis in Three Pines. Immer wieder stolperte man beim Spazierengehen in den Wäldern oder auf einem Feld über sie, wie sie konzentriert vor einer Leinwand stand. Aber sie nahm jedem das Versprechen ab, nicht näher zu kommen, nicht zu gucken, die Augen abzuwenden und natürlich niemals irgendjemandem davon zu erzählen, geradeso, als sei er Zeuge eines obszönen Aktes geworden. Ein einziges Mal hatte Clara Jane wütend erlebt; damals hatte sich Gabri von hinten an sie herangeschlichen, als sie gerade am Malen war. Er hatte es für einen Witz gehalten, dass sie alle immer davor warnte zu gucken.
Er hatte sich geirrt. Es war ihr todernst damit gewesen. Erst nach Monaten hatten Jane und Gabri zu einem normalen Umgang miteinander zurückgefunden, denn beide hatten sich vom anderen betrogen gefühlt. Aber da sowohl Jane als auch Gabri von Natur aus gutmütig waren und sich mochten, hatten sie einander schließlich verziehen. Jedenfalls war dieser Vorfall allen eine Lehre gewesen.
Keiner durfte Janes Malerei sehen.
Bis jetzt jedenfalls. Und in diesem Moment wurde die Künstlerin von einem so übermächtigen Gefühl übermannt, dass sie mitten im Bistro in Tränen ausbrach. Clara war ebenso erschrocken wie verunsichert. Sie sah sich verstohlen um, einesteils hoffte sie, dass niemand Notiz von ihnen nahm, anderenteils wünschte sie sich nichts sehnlicher, als dass jemand sie sah und wusste, was zu tun war. Dann stellte sie sich die einfache Frage, die sie wie einen Talisman stets mit sich herumtrug, um in allen Lebenslagen darauf zurückzugreifen: Was würde Jane in einem solchen Fall tun? Und schon hatte sie ihre Antwort. Jane würde sie weinen und schluchzen lassen. Würde sie einen Teller gegen die Wand werfen lassen, wenn sie das brauchte. Und Jane würde nicht weglaufen, sie würde nicht einmal mitten in einem Unwetter von ihrer Seite weichen. Sobald die erste Aufregung überwunden war, würde sie Clara in den Arm nehmen und sie trösten und wissen lassen, dass sie nicht allein war. Dass sie niemals allein war. Also saß Clara da und sah Jane an und wartete. Und machte die Erfahrung, wie schwer es war, nichts zu tun. Endlich versiegten die Tränen.
Clara erhob sich betont ruhig. Sie nahm Jane in den Arm und spürte, wie deren gebrechlicher Körper mit knirschenden Knochen wieder seine gewohnte Form annahm. Dann schickte sie ein kleines Dankgebet an die Götter. Für die Gnade zu weinen, aber auch für die Gnade zuzusehen.
»Jane, wenn ich gewusst hätte, dass es so schmerzhaft für dich ist, hätte ich dich niemals gedrängt, deine Bilder zu zeigen. Es tut mir leid.«
»Aber nein, Liebes.« Jane ergriff Claras Hand, nachdem diese wieder Platz genommen hatte. »Das hast du falsch verstanden. Das waren keine Tränen des Schmerzes. Nein. Es waren Freudentränen.« Jane blickte in die Ferne und nickte, so als antworte sie einer Stimme in ihrem Inneren. »Endlich.«
»Wie heißt es, dein Bild?«
»Fair Day. Es zeigt den Umzug am letzten Tag des Jahrmarkts.«
Und so kam es, dass am Freitag vor Thanksgiving Janes Bild auf einer Staffelei in den Ausstellungsräumen der Arts Williamsburg stand. Es war in Packpapier gewickelt und mit einem Bindfaden verschnürt wie ein zum Schutz gegen die kalten, grausamen Elemente warm eingepacktes Kind. Langsam und akribisch machte sich Peter Morrow über den Knoten her und nestelte daran herum, bis er sich löste, dann wickelte er den alten Faden in aller Ruhe um die Hand, als handelte es sich um einen Strang Wolle. Clara hätte ihn erdolchen können. Am liebsten wäre sie mit einem lauten Schrei aufgesprungen und hätte ihn zur Seite geschubst. Um das lächerliche Bindfadenknäuel auf den Boden zu werfen und Peter vielleicht gleich mit und das Packpapier von der Leinwand zu reißen. Stattdessen nahm ihr Gesicht einen noch ruhigeren Ausdruck an, nur ihre Augen traten ein wenig vor.
Sorgfältig schlug Peter zuerst eine Ecke des Papiers zurück, dann eine andere und glättete die Falten mit der Hand. Clara war nie bewusst gewesen, dass ein Rechteck so viele Ecken hatte. Sie spürte, wie sich die Stuhlkante in ihr Hinterteil bohrte. Die übrigen Mitglieder der Jury, die sich zur Auswahl der eingereichten Werke versammelt hatten, sahen gelangweilt aus. Claras Unruhe reichte für sie alle.
Endlich war jede Ecke geglättet, und das Papier konnte entfernt werden. Peter wandte sich um und sah die vier anderen Jurymitglieder an. Gerne wollte er eine kleine Rede halten, bevor er das Werk enthüllte. Ein paar wohlgesetzte Worte waren seiner Meinung nach jetzt genau das Richtige. Ein bisschen Kontext, ein bisschen – er erhaschte einen Blick aus den hervorquellenden Augen seiner Frau, die mit puterrotem Kopf dasaß, und wusste, wenn Clara sich in diesem Zustand befand, war es der falsche Zeitpunkt, um Reden zu schwingen.
Rasch drehte er sich wieder zu dem Bild und riss das braune Papier weg. Voilà, Fair Day.
Clara klappte der Unterkiefer herunter, und ihr Kopf kippte nach vorne, als hätten plötzlich ihre Halsmuskeln versagt. Ihre Augen weiteten sich, und sie vergaß, Luft zu holen. Sie fühlte sich wie vom Blitz getroffen. Das also war Fair Day. Es raubte ihr schier den Atem. Und den anderen Juroren offenbar auch. Auf den Gesichtern in der Runde zeichneten sich verschiedene Grade von Fassungslosigkeit ab. Selbst die Vorsitzende Elise Jacob war still. Sie sah aus, als habe sie soeben einen Schlaganfall erlitten.
Clara hasste es, die Arbeit anderer zu beurteilen, und erst recht diese. Sie hätte sich ohrfeigen können, dass sie Jane überredet hatte, ihre Arbeit das allererste Mal in einer Ausstellung zu präsentieren, für die sie in der Jury saß. War es Eitelkeit gewesen? Oder reine Dummheit?
»Dieses Bild trägt den Titel Fair Day«, las Elise aus ihren Notizen vor. »Es stammt von Jane Neal aus Three Pines, die seit vielen Jahren die Arts Williamsburg unterstützt. Mit Fair Day reicht sie zum ersten Mal ein eigenes Werk ein.« Elise sah sich in der Runde um. »Irgendwelche Kommentare?«
»Es ist wunderbar«, log Clara. Die anderen sahen sie überrascht an. Von der Staffelei blickte sie eine ungerahmte Leinwand an. Das Motiv war unverkennbar. Die Pferde sahen wie Pferde aus, die Kühe wie Kühe und auch die Menschen darauf waren identifizierbar, und zwar nicht nur als Menschen, sondern als ganz bestimmte Bewohner des Dorfes. Nur waren es alles Strichmännchen. Gut, vielleicht einen evolutionären Schritt weiter als Strichmännchen. In einem Krieg zwischen Strichmännchen und den Figuren auf Fair Day würden die Fair Day-Leute gewinnen, einfach weil sie ein paar Muskeln mehr hatten. Und Finger. Aber auch sie lebten nur in zwei Dimensionen. Während Clara versuchte, den Schock zu verdauen und keine naheliegenden Vergleiche zu ziehen, konnte sie sich doch nicht des Eindrucks erwehren, dass hier jemand eine Höhlenmalerei auf Leinwand übertragen hatte. Falls Neandertaler Jahrmärkte veranstaltet hatten, dann mussten sie genauso ausgesehen haben.
»Mon Dieu. Das kann ja meine Vierjährige besser«, sagte Henri LaRiviere und zog damit einen der naheliegenden Vergleiche, vor denen Clara sich gescheut hatte. Henri hatte in einem Steinbruch gearbeitet, bis er eines Tages gemerkt hatte, dass der Stein zu ihm sprach. Und er hatte zugehört. Danach konnte er natürlich nicht mehr wie bisher weiterleben, auch wenn sich seine Familie nach der Zeit zurücksehnte, als er noch keine riesigen Steinskulpturen nach Hause gebracht hatte, sondern den Mindestlohn. Sein grob geschnittenes Gesicht war unergründlich wie immer, dagegen sprachen seine Hände Bände. Er hielt sie nach oben, eine schlichte, aber viel sagende Geste des Flehens, der Unterwerfung. Er kämpfte um die angemessene Wortwahl, wohl wissend, dass Jane mit vielen der Juroren befreundet war. »Es ist furchtbar.« Offensichtlich hatte er den Kampf aufgegeben und beschlossen, sich zur Wahrheit zu bekennen. Entweder das, oder sein Urteilsspruch war gemessen an seinen tatsächlichen Gedanken noch milde ausgefallen.
Janes Werk stellte in verwegenen, leuchtenden Farben den Umzug am letzten Tag des Jahrmarkts dar. Die Schweine waren von den Ziegen nur deshalb zu unterscheiden, weil sie knallrot waren. Die Kinder sahen aus wie kleine Erwachsene. Im Grunde, dachte Clara und beugte sich vorsichtig vor, als könnte ihr die Leinwand einen weiteren Schlag versetzen, im Grunde sind es gar keine Kinder. Es sind zu kurz geratene Erwachsene. Sie erkannte Olivier und Gabri, die die Gruppe der blauen Hasen anführten. Die Menge hatte sich auf der Tribüne hinter dem Umzug niedergelassen, die meisten von ihnen waren im Profil zu sehen und blickten einander an oder voneinander weg. Einige, nicht viele, schauten den Betrachter an. Sämtliche Wangen zierten kreisrunde rote Punkte, was, wie Clara vermutete, ihnen ein gesundes Aussehen verleihen sollte. Es war schrecklich.
»Nun, wenigstens macht es uns die Entscheidung leicht«, sagte Irenée Calfat. »Wir lehnen es ab.«
Clara spürte, wie ihre Hände und Füße kalt und taub wurden.
Irenée Calfat war Töpferin. Sie verwandelte Lehmklumpen in erlesene Kunstwerke. Sie hatte eine völlig neue Methode des Glasierens entwickelt, und inzwischen wurde ihre Werkstatt in Saint-Rémy von Töpfern aus der ganzen Welt aufgesucht. Fünf Minuten in der Gesellschaft der Hohepriesterin des Lehms genügten allerdings vollauf, um ihren Bewunderern vor Augen zu führen, dass sie einen riesigen Fehler gemacht hatten. Sie sahen sich einem der egozentrischsten und kleinlichsten Menschen auf Gottes weitem Erdenrund gegenüber.
Clara fragte sich, wie jemand, dem es so sehr an normalem menschlichem Empfindungsvermögen mangelte, Werke von solcher Schönheit hervorbringen konnte. Während du selbst so sehr darum ringst, sagte die boshafte kleine Stimme, ihre treue Begleiterin.
Sie warf Peter über den Rand ihres Bechers einen verstohlenen Blick zu. Ein kleines Stück Schokoladenkuchen klebte ihm im Gesicht. Instinktiv wischte sich Clara über die Wange und schmierte sich dabei versehentlich eine Walnuss ins Haar. Selbst mit einem Stückchen Schokoladenkuchen im Gesicht war Peter eine beeindruckende Erscheinung. Ein wirklich gut aussehender Mann. Er war groß und breitschultrig wie ein Holzfäller und sah ganz und gar nicht aus wie der feinsinnige Künstler, der er war. Sein welliges Haar war mittlerweile ergraut, und er trug ständig eine Brille. Um seine Augen hatten sich Krähenfüße gebildet, und auch sonst durchzogen einige Falten sein glatt rasiertes Gesicht. Mit Anfang fünfzig sah er wie ein Geschäftsmann auf Abenteuerurlaub aus. Wenn Clara morgens neben ihm aufwachte, beobachtete sie ihn oft eine Weile beim Schlafen. In diesen Minuten würde sie am liebsten unter seine Haut schlüpfen und sich schützend um sein Herz legen.
Claras Kopf wirkte eine geradezu magnetische Anziehungskraft auf alles Essbare aus. Wo andere Frauen Schmuck trugen, trug sie Krümel. Peter war dagegen immer wie aus dem Ei gepellt. Selbst wenn es Schlamm regnen würde, käme er sauberer nach Hause zurück, als er losgegangen war. Nur manchmal versagte zu ihrer allergrößten Genugtuung sein natürlicher Schutzschild, und irgendetwas hing ihm im Gesicht. Clara wusste, dass sie ihn darauf aufmerksam machen sollte. Aber sie tat es nicht.
»Wisst ihr«, sagte Peter und selbst Irenée sah ihn an. »Ich finde es toll.«
Irenée schnaubte und warf Henri einen vielsagenden Blick zu, den dieser allerdings ignorierte. Peter suchte für einen Moment Claras Aufmerksamkeit, als sei sie eine Art Prüfstein. Wenn Peter einen Raum betrat, sah er sich immer als Erstes nach Clara um. Und erst wenn er sie entdeckt hatte, entspannte er sich. Außenstehende sahen einen großen, eleganten Mann mit einer schlampigen Frau und fragten sich, wie dieses ungleiche Paar zustande gekommen war. Es gab sogar Menschen, insbesondere Peters Mutter, die das Ganze für eine abartige Spielart der Natur hielten. Clara war der Mittelpunkt seines Lebens und alles, was darin gut und gesund war und ihn glücklich machte. Wenn er sie anblickte, dann sah er nicht die wilden, unbezähmbaren Haare, die weiten Kutten, das Kassengestell aus Kunststoff. Nein. Er sah seinen sicheren Hafen. Wobei er in diesem Moment natürlich auch eine Walnuss in ihren Haaren sah, aber das war im Grunde ihr Erkennungszeichen. Automatisch strich er sich durchs eigene Haar und wischte dabei das Kuchenstückchen von seiner Wange.
»Was siehst du darin?«, fragte Elise Peter.
»Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir es unbedingt annehmen sollten.«
Die Kürze seiner Antwort verlieh ihr aus irgendeinem Grund nur noch mehr Glaubwürdigkeit.
»Es ist ein Risiko«, sagte Elise.
»Ja, sicher«, räumte Clara ein. »Aber was soll schon Schlimmes passieren? Dass die Besucher der Ausstellung denken, wir hätten einen Fehler gemacht? Das denken sie immer.«
Elise nickte zustimmend.
»Ich will euch sagen, worin das Risiko besteht.« Der Zusatz »ihr Idioten« schwebte im Raum, als Irenée fortfuhr: »Das hier ist eine Initiative der Gemeinde, und wir haben kaum Geld für das Nötigste. Das einzige Pfund, mit dem wir wuchern können, ist unsere Glaubwürdigkeit. Wenn die Leute zu der Überzeugung gelangen, dass wir bestimmte Werke nicht wegen ihres künstlerischen Werts zeigen, sondern weil wir den Künstler mögen oder mit ihm befreundet sind, dann können wir es gleich sein lassen. Und genau das wird passieren. Niemand wird uns mehr ernst nehmen. Künstler werden ihre Werke nicht mehr bei uns ausstellen wollen, weil sie Angst haben müssen, in Verruf zu geraten. Das Publikum wird nicht mehr kommen, weil es denkt, dass es hier nur solchen Mist zu sehen bekommt wie –« An diesem Punkt gingen ihr die Worte aus, und sie deutete mit einer Grimasse auf die Leinwand.
Dann sah Clara es. Es war wie ein Aufblitzen, etwas, das sich am äußersten Rand ihres Bewusstseins bewegte. Einen kurzen Moment lang ging ein Strahlen von Fair Day aus. Die einzelnen Teile vereinigten sich zu einem Ganzen, dann war der Moment schon wieder vorbei. Clara wurde bewusst, dass sie erneut die Luft angehalten hatte, aber sie musste anerkennen, dass sie ein bedeutendes Werk betrachtete. Genau wie Peter konnte sie nicht sagen, warum oder inwiefern, aber in diesem Augenblick kam die Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten zu sein schien, wieder ins Lot. Sie wusste, dass Fair Day große Kunst war.
»Ich glaube, es ist mehr als gut, ich glaube, es ist brillant«, sagte sie.
»Oh, bitte! Merkt ihr nicht, dass sie das nur sagt, um ihren Mann zu unterstützen?«
»Irenée, wir haben deine Meinung gehört. Fahr fort, Clara«, ermutigte Elise sie. Henri lehnte sich vor, sein Stuhl knarrte.
Clara stand auf und ging langsam zu der Staffelei. Das Bild berührte sie im tiefsten Inneren, an einer Stelle, an der Trauer und Verlust saßen, und sie konnte nur mit Mühe die Tränen unterdrücken. Wie konnte das sein, fragte sie sich. Die Figuren darauf waren so kindlich, so einfach. Mit all den tanzenden Gänsen und lachenden Menschen hatte es etwas fast Albernes. Aber da war auch noch etwas anderes. Etwas Ungreifbares.
»Tut mir leid. Es ist mir wirklich peinlich.« Sie lächelte und spürte, wie ihre Wangen brannten. »Aber ich kann es nicht erklären.«
»Warum stellen wir Fair Day vorerst nicht zurück und sehen uns die anderen Arbeiten an? Wir werden am Schluss noch einmal darauf zurückkommen.«
Der Rest der Sitzung verlief reibungslos. Die Sonne hatte schon lange ihren Zenit überschritten, und es war merklich kälter im Raum geworden, als sie sich Fair Day noch einmal vornahmen. Alle waren müde und wollten die Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich bringen. Peter schaltete die Deckenbeleuchtung ein und stellte Janes Werk erneut auf die Staffelei.
»D’accord. Hat jemand seine Meinung zu Fair Day geändert?«, fragte Elise.
Schweigen.
»Dann sind also zwei dafür und zwei dagegen.«
Elise starrte schweigend auf das Bild. Sie kannte Jane Neal vom Sehen und mochte sie, soweit sie das sagen konnte. Sie war ihr immer als eine zurückhaltende, freundliche und intelligente Frau erschienen. Jemand, mit dem man gerne seine Zeit verbrachte. Wie kam es, dass diese Frau ein solch krudes, kindliches Bild gemalt hatte? Aber … Ein neuer Gedanke ging ihr durch den Kopf. Kein wirklich origineller Gedanke, nicht einmal einer, der Elise neu gewesen wäre, aber zumindest ein neuer an diesem Tag.
»Fair Day ist akzeptiert. Es wird mit den anderen Kunstwerken gezeigt.«
Clara sprang vor Freude auf und warf dabei ihren Stuhl um.
»Das darf doch nicht wahr sein!«, schnaubte Irenée.
»Eben! Genau das habe ich erwartet. Ihr beide bestätigt meine Ansicht vollkommen.« Elise lächelte.
»Welche Ansicht?«
»Aus welchen Gründen auch immer, Fair Day stellt eine Provokation für uns dar. Es bewegt uns. Macht uns wütend«, hier nickte Elise Irenée zu, »es verwirrt uns«, ein kurzer, aber bedeutungsvoller Blick zu Henri, der leicht den ergrauten Kopf neigte, »oder es macht uns …«
»Glücklich«, sagte Peter in genau dem Moment, in dem Clara »traurig« sagte. Sie schauten sich an und lachten.
»Nun, mich verwirrt es, so wie Henri. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich Fair Day für ein herausragendes Beispiel naiver Malerei halten soll oder für die lächerliche Pinselei einer schrulligen alten Frau, der jegliches Talent abgeht. Darin liegt die Spannung. Und deshalb müssen wir es in die Ausstellung aufnehmen. Ich garantiere euch, es wird dasjenige Bild sein, über das sich die Leute nach der Vernissage in den Cafés die Köpfe heißreden.«
»Grässlich«, sagte Ruth Zardo später am selben Abend. Sie stützte sich auf ihren Stock und hielt ein Glas Scotch in der Hand. Die Freunde von Peter und Clara hatten sich anlässlich eines vorgezogenen Thanksgiving-Dinners um das knisternde Kaminfeuer im Wohnzimmer der Morrows versammelt.
Es war die Ruhe vor dem Sturm. Am nächsten Tag würden Verwandte und Freunde, seien sie nun eingeladen oder nicht, in Three Pines einfallen und sich über das lange Thanksgiving-Wochenende einnisten. Die Wälder würden dann von Wanderern und Jägern wimmeln – eine unselige Mischung. Am Samstagvormittag würde auf dem Dorfanger das alljährliche Football-Spiel stattfinden, gefolgt vom großen Markt am Nachmittag, einem allerletzten Versuch, die übrig gebliebenen Tomaten und Zucchini loszuwerden. Dort würde am Abend auch ein riesiges Feuer entzündet werden, das ganz Three Pines in den Duft von brennendem Herbstlaub, Holz und einer verdächtigen Beimischung von Gemüse hüllte.
Three Pines war in keinem Reiseführer zu finden, dafür lag es viel zu weitab von jeder größeren oder auch weniger großen Straße. Wie Narnia, das geheimnisvolle Zauberland, wurde es meist unverhofft entdeckt, und es rief stets Erstaunen hervor, dass sich ein so altes Dorf in diesem Tal versteckte. Die meisten, die das Glück hatten, es gefunden zu haben, kehrten zurück. Und Thanksgiving, Anfang Oktober, war die beste Zeit. Das Wetter war meist klar und kühl, und die Gerüche des Sommers nach Gartenrosen und Phlox wurden von den erdigeren des Herbstes nach Laub, Holzfeuer und gebratenem Truthahn verdrängt.
Olivier und Gabri berichteten von den Ereignissen an diesem Morgen. Ihre Erzählung war so lebendig, dass jeder in dem behaglichen Wohnzimmer vor sich sah, wie die drei maskierten Jungen den Entendreck am Rand des Dorfangers aufsammelten; wie sie die Hände hoben und der Dünger durch ihre Finger quoll, und wie sie ihn mit einer weit ausholenden Bewegung gegen das alte Backsteinhaus schleuderten. Schon bald tropfte das Zeug überall von den blau-weißen Campari-Markisen, rann an den Mauern herunter und ließ kaum noch etwas von dem »Bistro«-Schild erkennen. Innerhalb kürzester Zeit war die Fassade des Cafés im Herzen von Three Pines von oben bis unten besudelt und das nicht nur mit Entenscheiße. Das ganze Dorf wurde von den Worten, die die Stille durchbrachen, in den Dreck gezogen: »Schwule! Tunten! Dégueulasse!«, brüllten die Jungen.
Während Jane dem Bericht von Olivier und Gabri lauschte, erinnerte sie sich daran, wie sie aus ihrem kleinen Cottage auf der anderen Seite des Dorfangers getreten war und Olivier und Gabri aus dem Bistro hatte kommen sehen. Die Jungen hatten beim Anblick der beiden jubiliert und mit dem Entendreck auf sie gezielt.
Ihre kurzen Stummelbeine verfluchend, war Jane losgerannt. Dann hatte Olivier etwas ganz Außerordentliches getan. Während die Jungen johlten und weiter mit Entendreck warfen, hatte er langsam und bedächtig Gabris Hand genommen und sie mit einer eleganten Bewegung an seine Lippen geführt. Überrascht hatten die Jungen innegehalten und zugesehen, wie Olivier Gabris verschmierte Hand mit seinem verschmierten Mund küsste. Die Jungen schienen angesichts dieses Liebesbeweises und des Widerstands förmlich zu versteinern. Aber nur einen Moment lang. Dann gewann ihr Hass die Oberhand, und sie nahmen ihren Angriff mit doppelter Energie wieder auf.
»Hört sofort auf!«, hatte Jane mit fester Stimme gerufen.
Die Jungen hatten mitten in der Bewegung innegehalten, hatten instinktiv auf diese Stimme der Autorität reagiert. Alle drei hatten sich wie auf Kommando umgedreht und Jane Neal angesehen, wie sie in ihrem geblümten Kleid und ihrer gelben Strickjacke auf sie zustürzte. Einer der Jungen, der eine orangefarbene Maske trug, hatte zum Wurf ausgeholt.
»Wage es nicht, junger Mann!«
Er zögerte lange genug, dass Jane ihnen allen in die Augen sehen konnte.
»Philippe Croft, Gus Hennessey, Claude LaPierre«, hatte sie langsam und deutlich gesagt. Das hatte gereicht. Die Jungen ließen den Dreck, den sie noch in den Händen hielten, fallen und rannten los, an Jane vorbei und den Hügel hoch, und derjenige mit der orangefarbenen Maske lachte. Der Klang dieses Lachens war so widerwärtig, dass er darin sogar den Entendreck übertraf. Einer der Jungen drehte sich um und sah zurück, wurde von den anderen jedoch sofort weitergeschubst, die Rue du Moulin hoch.
Das alles war erst am selben Morgen geschehen. Es kam ihnen inzwischen schon wie ein Traum vor.
»Es war grässlich«, stimmte Gabri Ruth zu, als er sich in einen der alten Sessel fallen ließ, dessen verblichener Bezug ganz warm vom Feuer war. »Auch wenn sie natürlich recht haben: Ich bin schwul.«
»Und eine ziemliche Tunte«, sagte Olivier und lümmelte sich auf die Lehne von Gabris Sessel.
»Ich bin eine der imposantesten Homo-Erscheinungen von Québec«, wandelte Gabri ein Zitat von Quentin Crisp ab. »Mein Aussehen ist atemberaubend.«
Olivier lachte, und Ruth legte ein weiteres Scheit aufs Feuer.
»Heute Morgen hast du wirklich imposant ausgesehen«, sagte Ben Hadley, Peters bester Freund.
»Meinst du nicht vielleicht importun?«
»Nun, für einen Bistrobesitzer jedenfalls nicht opportun, das ist wahr.«
In der Küche begrüßte Clara Myrna Landers.
»Der Tisch sieht wunderbar aus«, sagte Myrna und schlüpfte aus ihrem Mantel, unter dem ein knalllila Kaftan zum Vorschein kam. Clara fragte sich, wie ihr Gast es durch den Türrahmen geschafft hatte. Dann holte Myrna ihren Beitrag zu diesem Abend – einen Blumenstrauß. »Wo soll ich ihn hinstellen, Kindchen?«
Clara staunte. Wie Myrna selbst waren ihre Sträuße überdimensional, überbordend, überraschend. Dieser bestand unter anderem aus Eichen- und Ahornzweigen, Binsen vom Ufer des Flüsschens Bella Bella, das hinter Myrnas Buchladen vorbeifloss, Apfelzweigen, an denen noch ein paar McIntosh-Äpfel hingen, und büschelweise Kräutern.
»Was ist das?«
»Was?«
»Das da, in der Mitte.«
»Eine Krakauer.«
»Eine Wurst?«
»Hmhm, schau mal da.« Myrna deutete in das Gebinde.
»Die Gesammelten Werke von W.H. Auden«, las Clara. »Du machst wohl Witze.«
»Ist für die Jungs.«
»Ist noch was drin?« Clara untersuchte den riesigen Strauß.
»Denzel Washington. Aber verrat’s bloß nicht Gabri.«
Im Wohnzimmer fuhr Jane gerade mit ihrer Geschichte fort: » … dann sagte Gabri zu mir: ›Ich hab deinen Dünger. Findest du nicht, dass er mich gut kleidet?‹«
Olivier flüsterte Gabri ins Ohr: »Du bist ganz einfach eine Tunte.«
»Bist du nicht froh, dass wenigstens einer von uns beiden eine ist?« Ein alter Witz zwischen den beiden.
»Hallo, wie geht’s euch?« Myrna kam mit Clara aus der Küche und umarmte Gabri und Olivier, während Peter ein Glas Scotch für sie einschenkte.
»Ich glaube, ganz gut.« Olivier küsste Myrna auf beide Wangen. »Das Erstaunliche ist wohl eher, dass es nicht schon früher passiert ist. Wie lange leben wir jetzt schon hier? Zwölf Jahre?« Gabri nickte mit dem Mund voll Camembert. »Und das ist der erste Übergriff dieser Art. In Montréal wurde ich als Jugendlicher von einer Gruppe erwachsener Männer verprügelt, weil ich schwul war. Damals hatte ich wirklich Angst.« Die anderen waren still geworden, und man hörte nur das Knistern und Knacken des Kaminfeuers, als Olivier weitersprach.
»Sie haben mich mit Stöcken geschlagen. Es ist seltsam, aber wenn ich zurückdenke, dann erscheint mir das als das Schmerzhafteste. Nicht die Kratzer und die blauen Flecken, sondern dass sie mich mit den Stöcken stupsten, bevor sie zuschlugen.« Er stieß mit einem Arm in die Luft, um die Bewegung nachzuahmen. »So als wäre ich kein Mensch.«
»Das ist der entscheidende erste Schritt«, sagte Myrna. »Das Opfer zu entmenschlichen. Das hast du vollkommen richtig erkannt.«
Sie sprach aus Erfahrung. Bevor sie nach Three Pines gezogen war, hatte sie in Montréal eine psychotherapeutische Praxis geführt. Und da sie schwarz war, kannte sie auch diesen ganz bestimmten Blick, wenn die Leute einen wie ein Möbelstück betrachteten.
Ruth wandte sich, das Thema wechselnd, an Olivier. »Ich war neulich in meinem Keller und bin über ein paar Sachen gestolpert, die du vielleicht für mich verkaufen könntest.« Ruth’ Keller war ihre Bank.
»Gerne. Was denn?«
»Da wären ein paar Vasen aus Böhmischem Glas –«
»Wunderbar.« Olivier liebte Böhmisches Glas. »Geschliffen?«
»Hältst du mich vielleicht für doof? Natürlich sind sie geschliffen.«
»Bist du dir sicher, dass du sie nicht lieber behalten willst?« Das fragte er seine Freunde jedes Mal.
»Hör auf, mir diese Frage zu stellen. Glaubst du, ich würde sie dir anbieten, wenn ich mir nicht sicher wäre?«
»Miststück.«
»Schlampe.«
»Okay, und der Rest?«, fragte Olivier. Der Kram, den Ruth aus ihrem Keller holte, war unglaublich. Es war, als verfüge sie über ein Schlupfloch in die Vergangenheit. Manche Stücke waren Müll, wie die alten, kaputten Kaffeemaschinen etwa und die angekokelten Toaster. Aber das meiste jagte ihm Wonneschauer über den Rücken. Der habgierige Antiquitätenhändler in ihm, der einen bedeutenderen Teil von ihm ausmachte, als er jemals sich selbst oder seinen Freunden eingestehen würde, war hingerissen davon, einen exklusiven Zugang zu Ruth’ Schätzen zu haben. Manchmal erschien ihm dieser Keller sogar in seinen Tagträumen.
Wenn ihn Ruth’ Besitztümer in Begeisterung versetzten, geriet er bei Janes Haus geradezu in Ekstase. Er würde einen Mord begehen, um weiter als bis zu ihrer Küche zu kommen. Ihre Küche allein war eine wahre Fundgrube an Antiquitäten. Als er nach Three Pines gezogen war, weil seine Diva darauf bestand, hatte ihn fast der Schlag getroffen, als er das Linoleum im Windfang von Janes Haus sah. Wenn bereits der Windfang ein Museum war und die Küche ein Schrein, was war dann erst der Rest des Hauses? Olivier schüttelte den Gedanken ab, wohl wissend, dass er womöglich enttäuscht wäre. IKEA. Und Plüschteppiche. Er hatte schon vor langer Zeit aufgehört, es seltsam zu finden, dass Jane niemals jemanden durch die Tür in ihr Wohnzimmer und darüber hinaus gebeten hatte.
»Um auf den Dünger zurückzukommen, Jane«, sagte Gabri, während er seinen massigen Körper über eines von Peters Puzzles beugte, »ich kann dir morgen welchen vorbeibringen. Brauchst du Hilfe beim Zurückschneiden der Büsche im Garten?«
»Nein, damit bin ich schon fast fertig. Aber dieses Jahr ist vielleicht das letzte Mal gewesen. Ich schaffe es nicht mehr.« Gabri war froh, dass er nicht helfen musste. Sein eigener Garten war Arbeit genug.
»Ich habe eine Menge Stockrosenableger«, sagte Jane und fügte ein Stück Himmel in das Puzzle ein. »Wie haben sich die einfachen gelben bei dir gemacht? Ich habe keine gesehen.«
»Ich habe sie im letzten Herbst gepflanzt, aber sie sind nichts geworden. Kann ich noch einmal welche haben? Ich tausche sie gegen ein paar Indianernesseln.«
»Gott, bloß nicht.« Indianernesseln waren die Zucchini unter den Blütenstauden. Auch sie erfreuten sich großer Beliebtheit auf dem Herbstmarkt und gleich danach beim Thanksgiving-Feuer, zu dem sie einen Hauch von Bergamotte beisteuerten, so als würde jeder in Three Pines gerade Earl-Grey-Tee kochen.
»Haben wir schon erzählt, was heute Nachmittag geschehen ist, nachdem ihr alle gegangen wart?«, fragte Gabri mit seiner Bühnenstimme, sodass jeder im Zimmer ihm bereitwillig sein Ohr lieh. »Wir waren gerade dabei, die Erbsen für heute Abend vorzubereiten …« Clara verdrehte die Augen gen Himmel und flüsterte Jane zu: »Wahrscheinlich haben sie den Dosenöffner gesucht!«, » … als es an der Tür klingelte, und da standen Matthew Croft und Philippe.«
»Nein! Und dann?«
»Philippe murmelte: ›Es tut mir leid wegen heute Morgen.‹«
»Und was hast du gesagt?«, fragte Myrna.
»Beweis es mir«, sagte Olivier.
»Nein, hast du nicht«, johlte Clara, zugleich amüsiert und beeindruckt.
»Aber selbstverständlich. Seine Entschuldigung schien mir nicht wirklich von Herzen zu kommen. Es tat ihm leid, dass er erwischt worden war und dass er nun die Folgen zu spüren bekam. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ihm das, was er getan hatte, leid tat.«
»Gewissen und Feigheit«, sagte Clara.
»Was meinst du damit?«, fragte Ben.
»Oscar Wilde sagt, dass Gewissen und Feigheit dasselbe sind. Was uns davon abhält, schreckliche Dinge zu tun, ist nicht unser Gewissen, sondern die Angst, erwischt zu werden.«
»Ich frage mich, ob das stimmt«, sinnierte Jane.
»Würdest du so etwas tun?«, fragte Myrna Clara.
»Irgendetwas Schreckliches, wenn ich damit durchkäme?«
»Peter betrügen«, schlug Olivier vor. »Die Bank beklauen. Oder noch besser, das Werk eines anderen Künstlers klauen.«
»Ach, das ist doch Kinderkram«, fuhr Ruth dazwischen.
»Nein, wie wäre es mit Mord. Würdest du jemanden mit deinem Auto über den Haufen fahren? Oder ihm meinetwegen auch Gift verabreichen oder ihn während des Hochwassers im Frühling in den Bella Bella werfen? Oder …« Sie sah sich in der Runde um, der Feuerschein tauchte die leicht beunruhigten Gesichter in ein warmes Licht. »Oder wir könnten ein Haus anzünden und die Eingeschlossenen nicht retten.«
»Wen meinst du mit ›wir‹ – wir weißen Frauen?«, fragte Myrna bemüht, dem Gespräch die Schärfe zu nehmen.
»Willst du die Wahrheit wissen? Alles, nur keinen Mord.« Clara sah zu Ruth hinüber, die ihr konspirativ zuzwinkerte.
»Stell dir eine Welt vor, in der du alles tun kannst. Alles. Und damit durchkommst«, sagte Myrna, die sich wieder für das Thema zu erwärmen begann. »Welche Macht. Wer in diesem Zimmer geriete da nicht in Versuchung?«
»Jane«, sagte Ruth mit absoluter Überzeugung. »Aber ihr anderen?« Sie zuckte die Achseln.
»Und was ist mit dir?«, fragte Olivier Ruth, mehr als nur ein wenig verärgert, in einen Topf mit den anderen geworfen zu werden, auch wenn er insgeheim zugeben musste, dass er hineingehörte.
»Ich? Du müsstest mich mittlerweile doch gut genug kennen, Olivier. Ich wäre natürlich die Schlimmste von allen. Ich würde betrügen und stehlen und euch allen das Leben zur Hölle machen.«
»Schlimmer als jetzt?«, fragte Olivier, noch immer etwas beleidigt.
»So, damit stehst du ganz oben auf meiner Liste der Todeskandidaten«, sagte Ruth. Und Olivier fiel ein, dass das, was hier am Ort der Polizei am nächsten kam, die freiwillige Feuerwehr war, der er selbst angehörte – und die Ruth leitete. Wenn Ruth befahl, dass man ein brennendes Haus stürmte, dann tat man das. Sie war furchteinflößender als jedes Feuer.
»Gabri, was ist mit dir?«, fragte Clara.
»Es gab Zeiten, da war ich wütend genug, um jemanden umzubringen, und vielleicht hätte ich es auch gemacht, wenn ich hätte sicher sein können, damit durchzukommen.«
»Was hat dich denn so wütend gemacht?« Clara war erstaunt.
»Betrogen zu werden, es war immer und ausschließlich das eine – betrogen zu werden.«
»Und was hast du dagegen unternommen?«, fragte Myrna.
»Eine Therapie. Und dabei habe ich diesen Herrn hier kennengelernt.« Gabri tätschelte Oliviers Hand. »Ich glaube, wir sind beide ein Jahr länger als nötig hingegangen, nur um uns im Wartezimmer sehen zu können.«
»Ist das nicht krank?«, fragte Olivier und strich sich eine Strähne seines allmählich dünner werdenden blonden Haars aus dem Gesicht. Es war so glatt wie Seide und fiel ihm ständig über die Augen, egal welche Mittelchen er hineinschmierte.
»Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ich glaube, dass nichts ohne einen ganz bestimmten Grund geschieht«, sagte Gabri. »Kein Betrug, keine Wut. Keine Wut, keine Therapie. Keine Therapie, kein Olivier. Kein Olivier, kein –«
»Es reicht.« Olivier hob beschwichtigend die Hände.
»Ich habe Matthew Croft immer gemocht«, sagte Jane.
»Hast du ihn unterrichtet?«, fragte Clara.
»Vor langer Zeit. Er besuchte die vorletzte Klasse der alten Dorfschule, bevor sie dichtgemacht wurde.«
»Ich finde es nach wie vor schade, dass sie geschlossen wurde«, sagte Ben.
»Um Himmels willen, Ben, das ist zwanzig Jahre her. Schau endlich mal nach vorn.« So etwas wagte nur Ruth zu sagen.
Als sie nach Three Pines gezogen war, hatte sich Myrna gefragt, ob Ruth vielleicht einmal einen Schlaganfall erlitten hatte. Manche Schlaganfallpatienten, das wusste Myrna aus ihrer Praxis, verfügten nur über eine sehr schwach ausgeprägte Impulskontrolle. Auf ihre Frage hin hatte Clara erklärt, falls Ruth jemals einen Schlaganfall erlitten habe, müsse das schon im Bauch ihrer Mutter passiert sein. Soweit sie wusste, war Ruth nie anders gewesen.
»Warum mag sie dann jeder?«, hatte Myrna gefragt.
Clara hatte gelacht und mit den Achseln gezuckt. »Es gibt Tage, da frage ich mich das auch. Die Frau kann ganz schön anstrengend sein. Aber sie ist es wert. Glaube ich.«
»Wie auch immer«, sagte Gabri jetzt schmollend, weil er kurze Zeit nicht im Rampenlicht gestanden hatte. »Philippe hat sich einverstanden erklärt, fünfzehn Stunden im Bistro zu arbeiten, unentgeltlich.«
»Aber er war bestimmt nicht glücklich darüber.« Peter erhob sich.
»Nein, das kann man nicht behaupten«, erwiderte Olivier mit einem Grinsen.
»Ich möchte einen Toast ausbringen«, sagte Gabri. »Auf unsere Freunde, die heute zu uns gestanden haben. Auf unsere Freunde, die den ganzen Vormittag damit verbracht haben, das Bistro sauber zu machen.« Diesem Phänomen war Myrna schon früher begegnet, die Fähigkeit mancher Leute, aus einem schrecklichen Ereignis einen Triumph zu machen. Sie hatte an diesem Morgen daran denken müssen, während sie mit Entendreck unter den Fingernägeln eine kurze Pause machte und die Leute beobachtete, junge und alte, die sich im Bistro eingefunden hatten, um zu helfen. Sie war eine von ihnen gewesen. Und sie hatte erneut den Tag gepriesen, an dem sie sich dazu entschlossen hatte, Montréal zu verlassen und hier eine Buchhandlung zu eröffnen. Sie war endlich zu Hause angekommen. Dann stieg ein anderes Bild in ihr auf, eines, das verloren gegangen war in der Geschäftigkeit des Vormittags. Von Ruth, die sich auf ihren Stock stützte und von den anderen abwandte, sodass nur Myrna sehen konnte, wie die alte Frau vor Schmerz zusammenzuckte, als sie sich auf die Knie niederließ, um schweigend den Boden zu schrubben. Den ganzen Vormittag.
»Das Essen ist fertig«, rief Peter.
»Wunderbar. Genau wie bei Mama. Le Sieur?«, fragte Jane einige Minuten später und führte eine Gabel voll Erbsenbrei und Bratensoße zu ihrem Mund.
»Bien sûr. Von Monsieur Béliveau«, bestätigte Olivier.
»Nein!«, rief Clara vom anderen Ende des reich gedeckten Tisches. »Dosenerbsen! Und du schimpfst dich Koch!«
»Le Sieur ist der Kaviar unter den Dosenerbsen. Sag noch ein Wort, Missy, und du kriegst nächstes Jahr No-name-Erbsen vorgesetzt. Undank ist der Welt Lohn«, flüsterte Olivier Jane für alle hörbar zu, »sie sollte sich was schämen.«
Sie aßen beim Schein zahlreicher Kerzen in allen erdenklichen Größen und Farben, die überall in der Küche verteilt waren. Auf den Tellern häuften sich Truthahn und Maronifüllung, glasierte Yams und Kartoffeln, Erbsen und Bratensoße. Bis auf Ben, der nicht kochen konnte, hatten alle etwas zum Essen beigesteuert. Als Ausgleich hatte Ben für den Wein gesorgt, was ohnehin besser war. Sie trafen sich regelmäßig, aber nur, wenn alle etwas mitbrachten, konnten sich Peter und Clara eine solche Einladung leisten.
Olivier beugte sich zu Myrna. »Das ist wieder einmal ein ganz wunderbares Blumenarrangement.«
»Danke. Es ist sogar etwas für euch beide darin versteckt.«
»Nein, wirklich!« Gabri sprang sofort auf. Seine langen Beine trugen ihn in Windeseile durch die Küche zu dem Strauß. Anders als Olivier, der katzengleich zurückhaltend und eher etwas eigenbrötlerisch war, hatte Gabri etwas von einem Bernhardiner an sich, wenn auch meistens ohne das Geschlabber. Sorgfältig untersuchte er den Blätterwald, dann kreischte er: »Oh Gott! Genau das habe ich mir schon immer gewünscht!« Er zog die Krakauer heraus.
»Nein, die ist nicht für dich, die ist für Clara.« Alle sahen Clara alarmiert an, besonders Peter. Olivier machte dagegen einen erleichterten Eindruck. Gabri griff noch einmal zwischen die Blätter und zog vorsichtig das dicke Buch heraus.
»Die Gesammelten Werke von W.H. Auden.« Gabri versuchte, die Enttäuschung in seiner Stimme zu verbergen. Aber nicht allzu sehr. »Kenn ich nicht.«
»Oh Gabri, es wird dir gefallen«, tröstete Jane.
»So, jetzt rückt endlich mit der Sprache heraus«, sagte Ruth unvermittelt und beugte sich über den Tisch zu Jane. »Hat die Arts Williamsburg dein Bild akzeptiert?«
»Ja.«
Dieses kleine Wort schien Katapulte unter den Stühlen auszulösen. Alle sprangen auf und liefen zu Jane, die ebenfalls aufstand und sich erfreut umarmen ließ. Sie strahlte heller als alle Kerzen im Zimmer zusammen. Clara stand daneben und beobachtete die Szene, und sie spürte, wie ihr ganz leicht ums Herz wurde. Wie glücklich sie war, diesen Moment miterleben zu dürfen.
»Große Künstler legen viel von sich selbst in ihr Werk«, begann Clara das Gespräch, nachdem alle wieder Platz genommen hatten.
»Was ist die Bedeutung von Fair Day?«, fragte Ben.
»Das verrate ich nicht. Du musst es selbst herausfinden. Aber es steckt tatsächlich etwas Bestimmtes darin.« Jane wandte sich lächelnd an Ben. »Ich bin sicher, du wirst es erkennen.«
»Warum hast du es Fair Day genannt?«, wollte er wissen.
»Weil es den Umzug am letzten Tag des Jahrmarkts zeigt.« Jane warf Ben einen bedeutungsschweren Blick zu. Seine Mutter, ihre Freundin Timmer, war am Nachmittag desselben Tages gestorben. War das wirklich erst einen Monat her? Das ganze Dorf war auf dem Umzug gewesen, bis auf Timmer, die allein in ihrem Bett lag und an Krebs starb, während sich ihr Sohn Ben auf einer Antiquitätenauktion in Ottawa befand. Es waren Clara und Peter gewesen, die ihm die Nachricht überbracht hatten. Clara würde nie den Ausdruck auf seinem Gesicht vergessen, als Peter ihm sagte, dass seine Mutter gestorben war. Keine Traurigkeit, nicht einmal Schmerz. Sondern vollkommene Ungläubigkeit. Er war nicht der Einzige gewesen.
»Das Böse ist gar nichts Besonderes, sondern menschlich, und teilt mit uns das Bett und sitzt an unserem Tisch«, sagte Jane fast unhörbar. »Auden«, erklärte sie, deutete mit dem Kopf auf das Buch in Gabris Hand und ließ ein Lächeln aufblitzen, das die unerwartete und unerklärliche Spannung auflöste.
»Ich bin fast versucht, mir Fair Day noch vor der Ausstellung heimlich anzusehen«, bekannte Ben.
Jane holte tief Luft. »Ich möchte euch nach der Vernissage alle auf ein Glas Wein einladen. Im Wohnzimmer.« Hätte sie »nackt« gesagt, hätte sie kein größeres Erstaunen hervorrufen können. »Es wartet eine kleine Überraschung auf euch.«
»Das kann man wohl sagen«, erwiderte Ruth.
Die Bäuche voller Truthahn und Kürbiskuchen, Portwein und Espresso gingen die Gäste nach Hause, und die Lichtkegel ihrer Taschenlampen tanzten in der Nacht wie riesige Glühwürmchen. Jane küsste Peter und Clara zum Abschied. Es war ein angenehmes, wenig aufsehenerregendes verfrühtes Thanksgiving-Fest unter Freunden gewesen. Clara sah Jane nach, als sie den gewundenen Pfad durch das Wäldchen, das ihre beiden Grundstücke voneinander trennte, einschlug. Noch lange, nachdem Jane aus ihrem Blickfeld verschwunden war, konnte sie den Strahl ihrer Taschenlampe sehen, ein helles, weißes Licht, wie das des Diogenes. Erst als Clara das erfreute Bellen von Janes Hund Lucy vernahm, schloss sie leise die Tür. Jane war zu Hause. In Sicherheit.
2
Der Anruf erreichte Armand Gamache, als er gerade seine Wohnung in Montréal verlassen wollte. Seine Frau Reine-Marie saß schon im Auto, und nur weil er noch einmal auf die Toilette gemusst hatte, waren sie noch nicht auf dem Weg zur Taufe seiner Großnichte.
»Oui, allô?«
»Monsieur L’Inspecteur?«, fragte eine höfliche junge Stimme am anderen Ende. »Hier spricht Agent Nichol. Der Superintendent hat mich gebeten, Sie anzurufen. Es gab einen Mord.«
Selbst nach den vielen Jahren in der Sûreté du Québec, die meisten davon in der Mordkommission, jagten ihm diese Worte noch einen Schauer über den Rücken. »Wo?« Er hatte bereits Papier und Bleistift in der Hand, die neben jedem Telefon in der Wohnung lagen.
»Ein Dorf in den Eastern Townships. Three Pines. Ich könnte in einer Viertelstunde bei Ihnen sein und Sie abholen.«
»Hast du diesen Menschen umgebracht?«, fragte Reine-Marie, als er ihr erklärte, dass er nicht während des Zwei-Uhr-Gottesdienstes neben ihr auf einer der harten Bänke in einer fremden Kirche sitzen würde.
»Wenn ich es getan habe, werde ich es herausfinden. Möchtest du mitkommen?«
»Was würdest du eigentlich machen, wenn ich jemals ja sage?«
»Ich würde mich freuen«, antwortete er wahrheitsgemäß. Nach zweiunddreißig Ehejahren konnte er immer noch nicht genug von Reine-Marie kriegen. Sollte sie ihn jemals bei einer Morduntersuchung begleiten, würde sie genau das Richtige tun, davon war er fest überzeugt. Sie schien immer genau zu wissen, was notwendig war. Es gab nie irgendwelche Dramen mit ihr, irgendein Durcheinander. Er vertraute ihr.
Und wieder einmal tat sie das Richtige und lehnte seine Einladung ab.
»Ich sage ihnen einfach, dass du wieder einmal betrunken bist«, erwiderte sie auf seine Frage, ob ihre Familie wegen seines Ausbleibens nicht enttäuscht wäre.
»Hast du ihnen beim letzten Mal, als ich einem Familientreffen fernblieb, nicht erzählt, ich wäre auf Entzug?«
»Dann bist du eben wieder rückfällig geworden.«
»Traurig für dich.«
»Ich opfere mich eben für meinen Ehemann auf«, sagte Reine-Marie und rutschte auf den Fahrersitz. »Pass auf dich auf, Schatz.«
»Das werde ich, mon cœur.« Er ging zurück in sein Arbeitszimmer in ihrer Wohnung im ersten Stock und stellte sich vor die große Karte von Québec, die an die Wand gepinnt war. Sein Finger glitt von Montréal über die Eastern Townships nach Süden und blieb an der Grenze zu den Vereinigten Staaten hängen.
»Three Pines … Three Pines«, murmelte er vor sich hin. »Könnte es auch anders heißen?«, fragte er sich, da er das erste Mal auf seiner detaillierten Karte einen Ort nicht finden konnte. »Trois Pins, vielleicht?« Nein, auch das war nicht verzeichnet. Aber das war nicht weiter schlimm, da es Nichols Aufgabe war, den Ort ausfindig zu machen. Er lief durch die große Wohnung, die sie damals in Outremont gekauft hatten, als die Kinder auf die Welt gekommen waren. Inzwischen waren sie längst ausgezogen und hatten selbst Kinder, aber trotzdem vermittelte die Wohnung nie einen verlassenen Eindruck. Er fühlte sich auch allein mit Reine-Marie wohl darin. Auf dem Klavier standen Fotos und die Regalbretter bogen sich unter den Büchern. Zeugnisse eines glücklichen Lebens. Reine-Marie hätte auch seine Auszeichnungen aufgehängt, aber das hatte er nicht gewollt. Jedes Mal, wenn sein Blick auf die gerahmten Urkunden in dem Schrank in seinem Arbeitszimmer fiel, erinnerte er sich nicht an deren feierliche Überreichung, sondern an die Gesichter der Toten und Lebenden, die mit den einzelnen Fällen verbunden waren. Nein. Sie hatten keinen Platz an den Wänden seines Zuhauses. Und seit dem Fall Arnot gab es sowieso keine Belobigungen mehr. Aber seine Familie war Belohnung genug.
Agent Yvette Nichol rannte auf der Suche nach ihrer Brieftasche aufgescheucht in der Wohnung herum.
»Komm schon, Dad, du musst sie gesehen haben«, sagte sie flehentlich mit einem Blick auf die Wanduhr und den unbarmherzig vorrückenden Minutenzeiger.
Ihr Vater erstarrte auf seinem Stuhl. Er hatte ihre Brieftasche gesehen. Vorhin erst hatte er sie in der Hand gehabt und zwanzig Dollar hineingesteckt. Das war ein kleines Spiel zwischen ihnen. Er gab ihr ein bisschen Taschengeld, und sie tat so, als bemerkte sie es nicht; nur dann und wann, wenn er von der Nachtschicht in der Brauerei nach Hause kam, fand er im Kühlschrank ein Eclair mit einem Zettel, auf dem in ihrer klaren, fast kindlichen Schrift sein Name geschrieben stand.
Vor ein paar Minuten hatte er die Brieftasche genommen und das Geld hineingesteckt, aber als der Anruf für seine Tochter kam, mit dem sie zu dem Mordfall abkommandiert wurde, hatte er etwas getan, was er sich nie hätte träumen lassen. Er hatte die Brieftasche versteckt, zusammen mit ihrem Sûreté-Ausweis. Für dieses kleine Dokument hatte sie jahrelang geackert. Er beobachtete sie dabei, wie sie die Sofakissen auf den Boden schleuderte. Sie würde auf der Suche nach ihrer Brieftasche noch die ganze Wohnung auseinandernehmen.
»Hilf mir doch, Dad. Ich muss sie finden.« Sie drehte sich zu ihm um, die Augen vor Verzweiflung weit aufgerissen. Wie konnte er nur so dasitzen und nichts tun? Das war ihre große Chance, der Moment, von dem sie seit Jahren geredet hatten. Wie viele Male hatten sie über ihren Traum gesprochen, dass sie es eines Tages in die Sûreté schaffen wollte? So war es schließlich auch gekommen, und jetzt hatte sie dank einer Menge harter Arbeit und, offen gesagt, ihrer angeborenen Begabung als Ermittlerin die Chance erhalten, mit Gamache an einem Mordfall zu arbeiten. Ihr Dad wusste alles über ihn. Er verfolgte jeden seiner Fälle in der Zeitung.
»Dein Onkel Saul, der hätte die Gelegenheit gehabt, zur Polizei zu gehen, aber er hat es vermasselt«, hatte ihr Vater ihr erzählt und den Kopf geschüttelt. »Was für eine Schande. Und du weißt doch, was mit Versagern geschieht?«
»Sie bezahlen mit ihrem Leben.« Yvette kannte die richtige Antwort. Praktisch seit dem Tag ihrer Geburt war ihr immer wieder die alte Familiengeschichte erzählt worden.
»Wie Onkel Saul, deine Großeltern. Alle. Aber jetzt bist du ja da, mein kluges Mädchen, wir zählen auf dich.«
Yvette hatte jede Erwartung übertroffen, als sie in die Sûreté aufgenommen wurde. Innerhalb einer Generation war ihre Familie von den Opfern der tschechoslowakischen Regierung zu jenen aufgestiegen, die andere herumkommandierten. Jetzt hielten sie das Heft in der Hand.
Das gefiel ihr.
Allein ihre unauffindbare Brieftasche samt Ausweis stand in diesem Moment zwischen der Erfüllung ihrer Träume und kläglichem Scheitern wie bei dem dummen Onkel Saul. Die Uhr tickte. Sie hatte dem Chief Inspector gesagt, sie wäre in fünfzehn Minuten bei ihm. Das war fünf Minuten her. Damit blieben ihr zehn Minuten, um ans andere Ende der Stadt zu gelangen und auf dem Weg noch Kaffee zu besorgen.
»Hilf mir doch«, flehte sie erneut und leerte den Inhalt ihrer Handtasche auf dem Wohnzimmerboden aus.
»Hier ist sie.« Ihre Schwester Angelina kam aus der Küche, die Brieftasche und den Sûreté-Ausweis in der Hand. Yvette stürzte auf Angelina zu und küsste sie, dann eilte sie in den Flur, um ihren Mantel überzustreifen.
Ari Nikulas sah seinem jüngsten Kind zu, versuchte jeden Quadratzentimeter ihres geliebten Gesichtes im Gedächtnis zu bewahren und der erbärmlichen Furcht, die in seinem Herzen lauerte, nicht nachzugeben. Was hatte er nur getan, als er ihr diese lächerliche Idee in den Kopf gesetzt hatte? Er hatte niemanden in der ehemaligen Tschechoslowakei verloren. Die ganze Geschichte war ein Produkt seiner Fantasie und diente einzig dem Zweck, ihm in ihrer neuen Heimat Bedeutung zu verleihen, einen Anstrich von Heldentum. Aber seine Tochter hatte ihm geglaubt, glaubte noch immer, dass es einen dummen Onkel Saul und eine hingeschlachtete Familie gegeben hatte. Und jetzt war es zu spät. Er konnte ihr die Wahrheit nicht mehr sagen.
Sie umarmte ihn, küsste ihn auf die stoppelige Wange. Er hielt sie einen Moment zu lang fest, und sie sah ihm verwundert in die müden, traurigen Augen.
»Mach dir keine Sorgen, Dad. Ich werde dich nicht enttäuschen.« Und mit diesen Worten war sie weg.
Er konnte gerade noch sehen, wie eine kleine Locke ihres dunklen Haars an ihrem Ohr hängen blieb.
Fünfzehn Minuten nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte, klingelte Yvette Nichol an der Tür. Verlegen stand sie da und sah sich um. Das war ein schickes Haus, in dem Gamache wohnte, umgeben von viel Grün und in bequemer Gehweite zu den Läden und Restaurants an der Rue Bernard. In Outremont hatte sich die intellektuelle und politische Elite des französischen Québec niedergelassen. Sie hatte den Chief Inspector im Polizeipräsidium gesehen, hastig durch die Flure eilend, stets eine Gruppe von Leuten in seinem Kielwasser. Er war schon ewig dabei und stand in dem Ruf, die Rolle eines Mentors für die Leute zu übernehmen, die das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sie konnte froh sein.
Er rückte noch schnell seine Tweed-Kappe zurecht, dann öffnete er die Tür und lächelte Nichol freundlich an. Nach kurzem Zögern ergriff sie seine ausgestreckte Hand.
»Ich bin Chief Inspector Gamache.«
»Es ist mir eine Ehre.«
Als sie die Beifahrertür des Zivilfahrzeugs für ihn öffnete, bemerkte Gamache sogleich einen unverkennbaren Geruch: Kaffee in Pappbechern. Und dazu noch einen anderen Duft. Brioche. Die junge Frau hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Er trank diesen Kaffee nur, wenn er mit einem Mordfall betraut war. In seinem Kopf war er so sehr mit der Ermittlungsarbeit verbunden, den langen Stunden, die er und sein Team in der Kälte auf durchweichten Feldern herumstanden, dass sein Herz jedes Mal wild zu klopfen begann, wenn ihm der Geruch von Kaffee und feuchter Pappe in die Nase stieg.
»Ich habe den vorläufigen Bericht vom Tatort heruntergeladen. Der Ausdruck ist in der Akte da hinten.« Nichol deutete auf die Rückbank, während sie den Wagen über den Boulevard St. Denis in Richtung Autobahn steuerte, die sie zur Champlain Bridge und von dort aufs Land bringen würde.
Den Rest der Fahrt schwiegen sie, während er die knappen Informationen las, an seinem Kaffee nippte, das Brioche aß und auf das flache Ackerland vor den Toren Montréals hinaussah, das zunächst sanft geschwungenen Hügeln wich und schließlich höheren Bergen, deren Hänge von leuchtendem Herbstlaub bedeckt waren.
Ungefähr zwanzig Minuten nachdem sie die Autobahn verlassen hatten, kamen sie an eine Abzweigung mit einem kleinen verwitterten Schild, auf dem zu lesen war, dass es noch zwei Kilometer bis Three Pines waren. Ein, zwei Minuten später, die sie auf einer von Schlaglöchern übersäten unbefestigten Straße entlanggeholpert waren, bot sich ihnen ein zwangsläufig widersprüchliches Bild: eine alte steinerne Mühle neben einem Teich, deren Mauern von der warmen Vormittagssonne vergoldet wurden, um die Mühle herum Ahornbäume und Birken und Wildkirschen, deren bunt gefärbte Blätter ihnen bei ihrer Ankunft wie Tausende von Händen fröhlich zuwinkten. Und Polizeiautos. Die Schlangen im Garten Eden. Doch die Polizei war nicht das Böse, wie Gamache wusste. Die Schlange war schon vorher da.