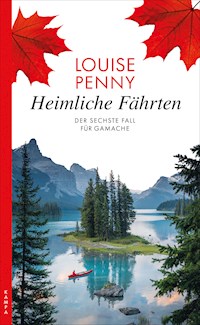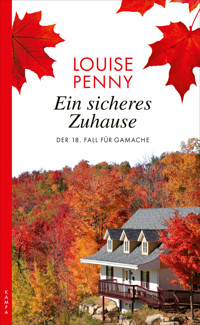Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Gamache
- Sprache: Deutsch
Armand Gamache ist nicht mehr bei der Mordkommission, sondern leitet die Akademie der Sûreté du Québec. Als Chief Superintendent will er die angehenden Agents an der Akademie Moral und Mitgefühl lehren. Denn seit Jahren schon bringt die Polizeischule erschreckend viele brutale und korrupte Beamte hervor. Gleich mit seinen ersten Personalentscheidungen stößt Gamache jedoch auf Unverständnis: Warum lässt er den korrupten ehemaligen Leiter der Akademie, Serge Leduc, weiterhin dort unterrichten? Und was sieht er in der ruppigen, am ganzen Körper tätowierten Bewerberin Amelia Choquet? Unterdessen finden die Bewohner von Three Pines bei Renovierungsarbeiten eine alte Karte in der Wand von Oliviers Bistro. Das beschauliche Dorf in den kanadischen Wäldern ist eigentlich auf keiner Landkarte verzeichnet - auf dieser allerdings schon. Als bald darauf in der Akademie ein Mord geschieht und am Tatort eine Kopie der Karte gefunden wird, gerät Armand Gamache plötzlich selbst ins Visier der Kriminalpolizei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Louise Penny
Auf keiner Landkarte
Der zwölfte Fall für Gamache
Aus dem kanadischen Englisch von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck
Kampa
Für Michael
Das schlägt einen Menschen härter nieder als eine große Rechnung in einem kleinen Zimmer.
Shakespeare
1
Armand Gamache saß in dem kleinen Zimmer und klappte das Dossier bedächtig zu, drückte den Aktendeckel fest zusammen, sperrte die Worte weg.
Es war ein schmales Dossier. Nur ein paar Seiten. Genau wie die anderen, die um ihn herum auf dem alten Holzfußboden seines Arbeitszimmers lagen. Und doch unterschied es sich von den anderen.
Er blickte auf die jungen Leben zu seinen Füßen, die einer Entscheidung über ihr Schicksal harrten.
Das machte er nun schon eine ganze Weile. Dossiers durchsehen. Einen Blick auf den kleinen Punkt oben rechts auf dem Kartenreiter werfen. Rot für abgelehnt. Grün für angenommen.
Nicht er hatte die Punkte dorthin geklebt, sondern sein Vorgänger.
Armand legte das Dossier auf den Boden und beugte sich in seinem bequemen Sessel vor, die Ellbogen auf die Knie gestützt. Die Hände verschränkt. Er fühlte sich wie ein Passagier auf einem Interkontinentalflug, der auf die unter ihm liegenden Felder blickte. Die einen fruchtbar, andere frisch umgepflügt und brachliegend. Wieder andere karg. Der felsige Untergrund von einer dünnen Erdschicht bedeckt.
Aber welche waren welche?
Nachdenklich hatte er die Dossiers gelesen und versucht, hinter die spärlichen Daten zu blicken. Er dachte über diese Leben nach und fragte sich, warum sein Vorgänger welche Entscheidung getroffen hatte.
Jahrelang, jahrzehntelang hatte seine Arbeit bei der Mordkommission der Sûreté du Québec darin bestanden, zu suchen und zu graben. Beweise sicherzustellen. Fakten zu prüfen und Gefühle zu hinterfragen. Verbrecher zu jagen und festzunehmen. Zu beurteilen, aber nie zu verurteilen.
Jetzt aber war er Richter und Geschworener. Er hatte das erste und das letzte Wort.
Er war nicht besonders überrascht, dass ihm diese Rolle zusagte, sogar gefiel. Die Macht. Er war ehrlich genug, sich das einzugestehen. Vor allem aber war er froh, jetzt in einer Position zu sein, in der er nicht einfach nur auf die Gegenwart reagieren musste, sondern die Zukunft mitgestalten konnte.
Und die Zukunft lag zu seinen Füßen.
Gamache lehnte sich wieder zurück und schlug die Beine übereinander. Obwohl es bereits nach Mitternacht war, war er nicht müde. Neben ihm auf dem Schreibtisch stand eine Tasse Tee, dazu Schokoladenkekse, die er nicht angerührt hatte.
Die Vorhänge in seinem Arbeitszimmer bewegten sich, und er spürte den kalten Luftzug durch das einen Spaltbreit geöffnete Fenster. Er wusste, wenn er die Vorhänge aufzog und das Verandalicht einschaltete, würde er den ersten Schnee des Winters durch die Luft schweben sehen. Lautlos würde der Schnee auf die Dächer in dem kleinen Dorf Three Pines sinken.
Er würde die Stauden in den Gärten bedecken und sich als dünne Schicht auf Autos und Veranden und auf die Bank in der Mitte des Dorfangers legen. Sanft würde er auf die Wälder und Hügel fallen, und auf das Flüsschen Bella Bella, das an den Häusern vorbeifloss.
Es war Anfang November und selbst für Québecer Verhältnisse kam der Schnee früh. Ein erster kleiner Fingerzeig. Noch nicht genug, damit die Kinder etwas zum Spielen hatten.
Bald war es jedoch wieder so weit. Schneller, als man dachte. Dann verwandelte sich der graue November in ein hell glitzerndes Wunderland für Skifahrer und Schlittschuhläufer. Es gab Schneeballschlachten, Iglus und Schneemänner. Und Schneeengel.
Im Moment schliefen die Kinder noch und ihre Eltern auch. Jeder in dem kleinen Québecer Dorf schlief, während der Schnee fiel und Armand Gamache über die jungen Leben nachdachte, die zu seinen Füßen lagen.
Durch die offene Tür seines Arbeitszimmers sah er in das Wohnzimmer des Hauses, in dem er mit seiner Frau Reine-Marie lebte.
Auf den breiten Dielen lagen Perserteppiche. Auf der einen Seite des großen gemauerten Kamins stand ein breites Sofa, auf der anderen standen zwei ausgeblichene Sessel. Auf den Beistelltischen stapelten sich Zeitschriften und Bücher. Die Wände waren von Regalen gesäumt, und Lampen tauchten den Raum in ein warmes Licht.
Es war ein einladender Raum, und Gamache stand auf, streckte sich und ging hinüber, gefolgt von dem Schäferhund Henri. Er schürte das Feuer und setzte sich in einen der Sessel. Er war noch nicht fertig mit seiner Arbeit, er musste noch nachdenken.
Über die meisten Dossiers hatte er schon entschieden. Außer diesem einen.
Beim ersten Mal hatte er es gelesen und dann auf den Stapel mit den Ablehnungen gelegt. Einverstanden mit dem roten Punkt seines Vorgängers.
Aber irgendwas an dem Dossier hatte ihn nicht losgelassen. Er hatte es wieder und wieder gelesen und herauszukriegen versucht, warum gerade dieses Dossier, diese junge Frau ihm keine Ruhe ließ.
Jetzt nahm Gamache die Akte mit zum Kamin und öffnete sie ein weiteres Mal.
Ihr Gesicht starrte ihn an. Arrogant, provozierend. Blass. Die Haare pechschwarz, stellenweise wegrasiert, stellenweise wild abstehend. Piercings in der Nase, den Augenbrauen, der Wange.
Sie behauptete, Altgriechisch und Latein lesen zu können, und trotzdem hatte sie die Highschool nur mit Hängen und Würgen geschafft und die letzten Jahre offenbar damit verbracht, nichts zu tun.
Sie hatte den roten Punkt verdient.
Warum nahm er sich dann die Akte erneut vor? Warum sie? An ihrem Äußeren lag es nicht. So etwas durchschaute er.
War es ihr Name? Amelia?
Ja, dachte er, das könnte es sein. Gamaches Mutter hatte so geheißen. Sie war nach der Fliegerin Amelia Earhart benannt worden, die auf einem Flug über den Pazifik verschollen war.
Amelia.
Nur empfand er keine Wärme, als er ihre Akte in der Hand hielt. Im Gegenteil, er verspürte einen gewissen Widerwillen.
Schließlich nahm Gamache die Lesebrille ab und rieb sich die Augen, dann ging er mit Henri eine letzte nächtliche Runde, im ersten Schnee der Saison.
Und dann war es an der Zeit, schlafen zu gehen, für sie beide.
Am nächsten Morgen lud Reine-Marie ihren Mann zum Frühstück ins Bistro ein. Henri kam mit und lag still unter dem Tisch, während sie Café au Lait tranken und auf die Rühreier mit Speck und Brie warteten.
In den Kaminen an beiden Seiten des Raums mit den freigelegten Balken prasselte ein munteres Feuer. Die Gespräche vermischten sich mit dem Geruch des Feuers, und hin und wieder hörte man ein Stampfen, wenn Gäste beim Hereinkommen den Schnee von ihren Stiefeln traten.
Noch in der Nacht hatte es aufgehört zu schneien, sodass das gefallene Herbstlaub kaum bedeckt war. Man fühlte sich wie in einem Niemandsland zwischen Herbst und Winter. Die Hügel, die das Dorf wie ein Schutzwall umgaben, wirkten jetzt selbst feindlich. Zumindest abweisend. Der Wald schien aus Skeletten zu bestehen. Die Bäume streckten ihre nackten grauen Äste in die Luft, als bettelten sie um Gnade und wüssten genau, dass sie ihnen nicht gewährt werden würde.
Auf dem Dorfanger standen die drei hohen Kiefern, denen das Dorf seinen Namen verdankte. Lebensstrotzend, aufrecht und stark. Immergrün. Unsterblich. In den Himmel ragend. Gewappnet gegen das Schlimmste. Denn das Schlimmste würde kommen.
Das Schlimmste. Aber auch das Beste. Die Schneeengel.
»Voilà«, sagte Olivier und stellte einen Korb mit ofenwarmen Mandelcroissants auf den Tisch. »Solange ihr auf das Frühstück wartet.«
An dem Korb hing ein Preisschildchen. Und auch an dem Kronleuchter über ihren Köpfen. Und an den Ohrensesseln, auf denen sie saßen. Alles in Oliviers Bistro stand zum Verkauf. Inklusive seines Lebensgefährten Gabri, wie er ihnen mehr als einmal versichert hatte.
»Eine Tüte Süßigkeiten, und er gehört euch«, hatte man Olivier zu Gästen sagen hören, wenn Gabri in seiner Rüschenschürze auftauchte.
»Dafür hat er mich gekriegt«, bekannte Gabri dann und strich sich über die Schürze, die er, wie alle wussten, nur trug, um Olivier zu ärgern. »Für eine Tüte Weingummi.«
Als sie wieder allein waren, schob Armand einen Aktendeckel über den Tisch.
»Wärst du bitte so nett, das zu lesen?«
»Natürlich«, sagte Reine-Marie und setzte ihre Lesebrille auf. »Gibt es ein Problem?«
»Ich glaube, eigentlich nicht.«
»Warum soll ich dann …?« Sie deutete auf die Akte.
Bevor er vorzeitig aus dem Dienst bei der Sûreté ausgeschieden war, hatte er oft mit ihr über seine Fälle gesprochen. Er war noch nicht ganz sechzig, und im Grunde hatte er sich hierher nach Three Pines geflüchtet. Um sich in diesem Dorf hinter den Hügeln zu erholen.
Er hielt die Schale mit dem aromatisch duftenden heißen Kaffee in den Händen und sah über deren Rand hinweg Reine-Marie an. Seine Hände zitterten nicht mehr, bemerkte sie. Wenigstens nicht mehr oft. Darauf hatte sie stets ein Auge, für den Fall.
Auch die Narbe an seiner Schläfe war nicht mehr so tief. Vielleicht hatte sie jedoch auch durch Gewöhnung und zunehmende Erleichterung an Schrecken verloren.
Noch immer hinkte er manchmal, wenn er müde war. Abgesehen von dem Hinken und der Narbe wies äußerlich nichts mehr auf das Geschehene hin. Aber sie brauchte keine Hinweise. Es war etwas, das sie nie vergessen würde.
Dass sie ihn beinahe verloren hatte.
Stattdessen hatten sie sich hier wiedergefunden. In dem Dorf, das selbst an den trübsten Tagen einladend wirkte.
Schon, als sie das Haus gekauft und die Kisten ausgepackt hatten, hatte Reine-Marie gewusst, dass der Zeitpunkt kommen würde, an dem er wieder arbeiten wollte und musste. Die Frage war nur, was? Was würde Chief Inspector Armand Gamache, der ehemalige Leiter der erfolgreichsten Mordkommission des Landes, tun wollen?
Angebote gab es genug. Im Arbeitszimmer stapelten sich Umschläge mit einem »Vertraulich«-Stempel. Er hatte viele Gespräche geführt. Angefangen bei großen Unternehmen über politische Parteien, für die er kandidieren sollte, bis hin zu nationalen und internationalen Polizeibehörden. Unauffällig gekleidete Männer und Frauen waren in unauffälligen Autos vor ihrem weiß geschindelten Haus vorgefahren, hatten an die Tür geklopft und in ihrem Wohnzimmer gesessen, um mit ihm über seine Zukunft zu sprechen.
Höflich hatte Armand ihnen zugehört und sie oft zum Mittagessen oder Abendessen eingeladen, und wenn es spät wurde, hatte er ihnen auch ein Bett angeboten. Aber nie hatte er etwas zu erkennen gegeben.
Reine-Marie hatte ihren Traumjob gefunden, nachdem sie die Stelle in der Bibliothèque et Archives nationales du Québec aufgegeben hatte, und arbeitete ehrenamtlich für die hiesige Historical Society, für die sie Nachlässe sichtete.
Diese Arbeit würden ihre ehemaligen Kollegen sicher als Abstieg begreifen. Aber Reine-Marie waren solche Dinge wie Abstieg oder Aufstieg egal. Sie war dort angelangt, wo sie sein wollte. Keine Karriereleiter mehr. Wozu? In Three Pines hatte sie eine Heimat gefunden. In Armand. Und jetzt hatte sie auch ihre intellektuelle Heimat gefunden, indem sie die ausufernden und ungeordneten Sammlungen von Dokumenten, Möbeln, Kleidern und Nippes, die der Region testamentarisch vermacht worden waren, sichtete.
Jeder Tag, an dem sie den Inhalt der Kartons sortierte, war für Reine-Marie wie Weihnachten. Und davon gab es sehr, sehr viele.
Sie hatten oft darüber gesprochen, bis Armand endlich entschieden hatte, was er als Nächstes tun wollte.
Während sie über Stapeln von Briefen und alten Dokumenten gebrütet hatte, hatte er wochenlang über Akten gebrütet, hatte vertrauliche Berichte gelesen, Schaubilder und Lebensläufe studiert. Sie hatten einander an ihrem großen Wohnzimmertisch gegenübergesessen und waren ihre jeweiligen Kartons durchgegangen, während das Feuer knisterte, der Kaffee in der Espressokanne blubberte und der Spätherbst langsam in einen frühen Winter überging.
Während sie die Welt um immer neue Details bereicherte, machte er in gewisser Hinsicht das Gegenteil. Armand stutzte, schliff, entfernte und entsorgte Unnützes, Unnötiges, Ungewolltes. Verrottetes. Bis das, was er in Händen hielt, geschärft war. Eine Waffe, die er selbst geschaffen hatte. Denn die würde er brauchen. Es durfte kein Zweifel daran bestehen, wer der Chef war und wer die Macht besaß. Und dass er bereit war, sie einzusetzen.
Er hatte es beinahe geschafft, das wusste sie. Es schien nur noch ein kleines Hindernis zu geben.
Unschuldig lag es vor ihnen auf dem mit Croissantkrümeln übersäten Tisch.
Armand öffnete den Mund, um etwas zu sagen, dann schloss er ihn wieder und stieß laut die Luft aus.
»Irgendetwas irritiert mich an diesem Dossier, und ich weiß nicht, was.«
Reine-Marie nahm es und las es. Es dauerte nicht lange. Nach ein paar Minuten klappte sie es zu und legte sanft die Hand darauf, so wie eine Mutter die Hand auf die Brust ihres kranken Kindes legt. Um sicherzugehen, dass sein Herz ruhig schlägt.
»Sie sticht heraus, das muss man ihr lassen.« Sie sah auf den roten Punkt in der Ecke. »Du lehnst ihre Bewerbung also ab.«
Armand hob die Hände in einer unsicheren Geste.
»Ach, du überlegst, ob du sie nehmen sollst?«, fragte Reine-Marie. »Selbst wenn es stimmt, dass sie Altgriechisch und Latein lesen kann, bringt das für die Stelle nicht viel. Das sind tote Sprachen. Und außerdem lügt sie wahrscheinlich.«
»Das ist wahr«, stimmte er ihr zu. »Aber wenn man schon lügt, warum dann bei so etwas? Merkwürdig, oder?«
»Sie genügt nicht den Anforderungen«, sagte Reine-Marie. »Ihr Highschool-Abschluss ist unterirdisch. Ich weiß, dass die Entscheidung schwierig ist, aber es gibt doch bestimmt Bewerber, die den Platz eher verdienen.«
Ihr Frühstück kam, und Armand legte die Akte neben Henri auf den Dielenboden.
»Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich diesen Punkt ausgetauscht habe«, sagte er mit einem Lächeln. »Von Rot zu Grün. Von Grün zu Rot.«
Reine-Marie spießte etwas von dem schaumigen Rührei auf. Ein langer Brie-Faden hing am Teller fest, und sie hob ihre Gabel in die Höhe, um zu sehen, wie weit er sich dehnen ließ, bevor er riss.
Offenbar weiter, als ihr Arm lang war.
Armand schüttelte den Kopf und zupfte den Faden lächelnd auseinander.
»Bitte sehr, Madame, Sie sind wieder frei.«
»Von der Käsefessel«, sagte sie. »Sehr freundlich, mein Herr. Aber ich fürchte, die Fessel reicht tiefer als das.«
Er lachte.
»Glaubst du, es hängt mit ihrem Namen zusammen?«, fragte Reine-Marie. Ihr Mann war selten so unentschlossen, auch wenn er Entscheidungen nie auf die leichte Schulter nahm. Sie konnten das ganze Leben eines Menschen beeinflussen.
»Amelia?« Er runzelte die Stirn. »Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber es wäre eine krasse Überreaktion, findest du nicht? Meine Mutter ist vor fast fünfzig Jahren gestorben. Und ich habe schon andere Frauen mit diesem Namen kennengelernt …«
»Viele nicht.«
»C’est vrai. Aber doch ein paar. Außerdem nenne ich meine Mutter für mich nicht so, selbst wenn mich der Name an sie erinnert. Für mich ist sie maman.«
Er hatte natürlich recht. Es schien ihm auch kein bisschen peinlich zu sein, als erwachsener Mann noch von seiner maman zu sprechen. Das kam einfach aus der Zeit, als er seine Mutter und seinen Vater das letzte Mal gesehen hatte. Damals war er neun gewesen. Und seine Eltern nicht Amelia und Honoré, sondern maman und papa. Die mit Freunden ausgingen. Und die rechtzeitig zurückkehrten, um ihm einen Gutenachtkuss zu geben.
»Es könnte an ihrem Namen liegen«, sagte Armand.
»Aber du glaubst es nicht. Du glaubst, es ist etwas anderes.«
»O Gott«, sagte Olivier, der an ihren Tisch getreten war, um zu fragen, ob alles in Ordnung war, und zum Fenster hinaussah. »Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon bereit bin.«
»Wir auch nicht«, bekannte Reine-Marie, die seinem Blick auf den verschneiten Dorfanger folgte. »Man glaubt, man wäre es, aber dann ist es doch immer eine unangenehme Überraschung.«
»Die sich jedes Mal früher einstellt«, sagte Armand.
»Genau. Und jedes Mal schlimmer wird«, sagte Olivier.
»Aber trotzdem hübsch«, sagte Armand und erntete dafür einen entgeisterten Blick von Olivier.
»Hübsch? Das ist ein Scherz, oder?«, sagte er.
»Nein, überhaupt nicht. Wobei man immer irgendwann die Nase voll hat«, sagt Armand.
»Wem sagst du das«, erwiderte Olivier.
»Es ist einfach jedes Jahr dasselbe.«
»Jedes Jahr?«
»Jedenfalls hilft es, wenn man gute Ketten hat«, sagte Reine-Marie.
Olivier stellt den leeren Croissantkorb zurück auf den Tisch. »Wovon redet ihr eigentlich?«
»Natürlich vom Winter«, sagte sie. »Vom Schnee.«
»Was hast du denn gemeint?«, fragte Armand.
»Ruth«, sagte Olivier und deutete aus dem Fenster auf die alte Frau mit Stock und Ente, die auf das Bistro zukam. Alt, kalt und bitter.
Sie trat ein und sah sich um.
»Ja«, sagte Olivier. »Gute Ketten würden das Problem lösen.«
»Na, alte Schwuchtel«, sagte Ruth, als sie zu ihnen hinkte.
»Alte Schachtel«, murmelte Olivier, während sie zusahen, wie die Dichterin sich auf ihrem Stammplatz am Kamin niederließ. Sie klappte die Holztruhe auf, die als Beistelltisch diente, und nahm einen Packen Papier heraus.
»Sie hilft mir, das Zeug zu ordnen, das wir beim Umbau in den Mauern gefunden haben und das ewig in der Truhe lag«, sagte Olivier. »Du weißt schon.«
Armand nickte. Olivier und Gabri hatten vor vielen Jahren ein ehemaliges Haushaltswarengeschäft zu dem Bistro umgebaut, und als sie die Mauern aufschlugen, um die Wasser- und Stromleitungen neu zu verlegen, war alles Mögliche zum Vorschein gekommen. Mumifizierte Eichhörnchen, Kleidung. Vor allem aber fanden sie Papier. Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblättchen, Kataloge, all das war zur Isolierung benutzt worden, als könnten Worte die Kälte von draußen in Schach halten.
Der Québecer Winter wurde oft genug mit harschen Worten bedacht, aber keines hatte je verhindert, dass der Schnee weiter fiel.
Im Chaos der Renovierungsarbeiten hatten sie die Papiere einfach in die Holztruhe geworfen und vergessen. Jahrelang stand sie ungeöffnet vor dem Kamin. Unzählige Schalen Café au Lait und Gläser Wein, Teller mit regionalem Käse und pâté und Baguette hatten darauf gestanden und Füße darauf gelegen, bis die Papiere vor ein paar Monaten wiederentdeckt worden waren.
»Ich glaube ja nicht, dass was Wertvolles dabei ist«, sagte Olivier zurück am Tisch der Gamaches, nachdem er Ruth ihr Frühstück aus Irish Coffee und gebratenem Speck gebracht hatte.
»Wie kommt es eigentlich, dass die Frau alles überlebt?«, fragte Reine-Marie.
»Galle«, antwortete Olivier. »Sie besteht aus purer Galle. So was stirbt nicht.« Er sah Reine-Marie an. »Ich vermute mal, dass du keine Lust hast, ihr zu helfen?«
»Also, das wollte ich immer schon mal, mit purer Galle arbeiten«, erwiderte sie.
»Richtig eklig wird sie, wenn sie einen bestimmten Pegel erreicht hat, aber das weißt du ja«, sagte Olivier. »Bitte, bitte, Ruth hat zwei Monate gebraucht, um einen Fingerbreit von dem Stapel abzuarbeiten. Das Problem ist, dass sie die Sachen nicht einfach überfliegt, sondern jede Zeile liest. Gestern hat sie den ganzen Nachmittag mit einer National Geographic von 1920 verbracht.«
»Das würde ich auch, mon beau«, sagte Reine-Marie. »Aber weißt du, was? Wenn Ruth damit einverstanden ist, helfe ich ihr gerne.«
Nach dem Frühstück setzte sie sich neben Ruth auf das Sofa und nahm einen Stoß Papier aus der Holztruhe, während Armand und Henri nach Hause gingen.
»Armand!«, rief Olivier, und als Gamache sich umdrehte, sah er den Bistrobesitzer in der Tür stehen und mit etwas winken.
Es war das Dossier.
Schnell ging Armand zurück.
»Hast du da reingesehen?«, fragte er. Die Schärfe in seiner Stimme ließ Olivier zögern.
»Nein.«
Aber unter dem strengen Blick knickte er ein.
»Vielleicht. Okay, ja. Ich habe einen Blick reingeworfen. Nur auf das Foto. Und den Namen. Und ein bisschen von dem Lebenslauf.«
»Danke«, sagte Armand, nahm die Akte und ging.
Auf dem Heimweg fragte sich Armand, warum er Olivier angefahren hatte. Auf dem Aktendeckel stand zwar »Vertraulich«, aber Reine-Marie hatte er das Dossier auch gezeigt, und es war nicht gerade ein Staatsgeheimnis. Außerdem, wer wäre nicht versucht, sich etwas anzusehen, das als vertraulich gekennzeichnet war?
Wenn sie etwas über Olivier wussten, dann, dass er gegen Versuchungen kein bisschen gefeit war.
Außerdem fragte sich Gamache, warum er das Dossier liegen lassen hatte. Hatte er es tatsächlich vergessen?
War es ein Versehen, oder hatte er es unbewusst gewollt?
Am frühen Nachmittag fing es erneut an zu schneien. Der Schnee wehte über die Hügel und wirbelte wie gefangen durch das Tal. Three Pines verwandelte sich in eine Schneekugel.
Reine-Marie rief an und sagte, sie würde im Bistro zu Mittag essen. Clara und Myrna hatten sich zu ihr und Ruth gesellt, und sie wollten den Nachmittag damit verbringen, den Inhalt der Truhe zu bergen und zu lesen und nebenher etwas zu essen.
Das klang so verführerisch, dass Armand beschloss, das Gleiche zu Hause zu machen.
Er stocherte an dem Birkenscheit, das er gerade nachgelegt hatte, und sah zu, wie die Rinde knackend Feuer fing und sich aufwarf. Dann setzte er sich mit einem Sandwich, einem Buch und Henri, der sich neben ihm zusammenrollte, auf das Sofa.
Immer wieder wanderte sein Blick jedoch zum Arbeitszimmer, in dem sich junge Männer und Frauen drängten und ungeduldig zu ihm herübersahen. Sie warteten darauf, dass der alte Mann entschied, wie es mit ihnen weiterging, so wie seit Jahrtausenden alte Männer über das Schicksal der Jugend entschieden hatten.
Er war nicht alt, auch wenn er wusste, dass er in ihren Augen alt, vielleicht sogar uralt wirkte. Die jungen Männer und Frauen würden einen Mann Ende fünfzig sehen. Gut ein Meter achtzig groß, eher kräftig als dick, zumindest sagte er sich das. Seine Haare waren inzwischen mehr grau als braun, und über den Ohren lockten sie sich leicht. Früher hatte er von Zeit zu Zeit einen Schnauzer oder einen Vollbart getragen, aber heute war er glatt rasiert, sodass man seine Falten sehen konnte. Es war ein gezeichnetes Gesicht. Aber wenn man die Falten zu ihrem Ursprung zurückverfolgte, nahmen die meisten ihren Anfang in etwas Freudvollem. Einem Lachen oder Lächeln, dem Ausdruck eines Menschen, der ruhig dasitzt und den Tag genießt.
Einige der Falten hatten allerdings einen anderen Ursprung. In Chaos und Grauen. In der Finsternis. Einige der Falten in seinem Gesicht führten zu fürchterlichen, unmenschlichen Ereignissen. Zu schrecklichen Bildern. Zu unaussprechlichen Taten.
Von denen manche er begangen hatte.
Die Falten in seinem Gesicht waren die Längen- und Breitengrade seines Lebens.
Die jungen Männer und Frauen würden auch die tiefe Narbe an seiner Schläfe sehen, die verriet, wie nah er dem Tod gekommen war. Aber die Besten unter ihnen würden nicht nur die Wunde sehen, sondern auch die Heilung. Und tief in seinen Augen würden sie jenseits der Narbe, des Schmerzes, selbst jenseits der Freude auf etwas Unerwartetes stoßen.
Auf Freundlichkeit.
Vielleicht würde sich auch in ihren Gesichtern, wenn diese einmal von Gräben und Falten zerfurcht waren, Freundlichkeit verbergen.
Danach suchte er in den Dossiers. Auf den Fotos.
Schlau konnte jeder sein. Geschickt konnte jeder sein. Etwas lernen konnte jeder.
Aber nicht jeder war freundlich.
Armand Gamache sah zu den jungen Männern und Frauen, die in seinem Arbeitszimmer versammelt waren und warteten.
Er kannte ihre Gesichter, wenigstens die Fotos davon. Er kannte ihre Geschichten, wenigstens das, was sie erzählen wollten. Er kannte ihre Schullaufbahn, ihre Abschlüsse, ihre Interessen.
Unter all den anderen entdeckte er sie. Amelia. Die mit ihnen wartete.
Sein Herz setzte einen Schlag aus, und er stand auf.
Amelia Choquet.
Da wusste er, warum er so heftig auf sie reagierte. Warum er das Dossier im Bistro liegen lassen hatte und warum er immer wieder darauf zurückkam.
Was ihn an ihr so sehr bewegte.
Er hatte Reine-Marie das Dossier gezeigt und gehofft, sie würde ihm die Erlaubnis erteilen, das zu tun, wozu ihm sein Verstand riet. Diese junge Frau abzulehnen. Sie auszumustern. Sich von ihr abzuwenden, solange er noch konnte.
Und jetzt wusste er auch, warum.
Henri schnarchte und sabberte auf dem Sofa, das Feuer knisterte und knackte, der Schnee fiel sanft gegen die Scheiben.
Nicht ihr Vorname hatte ihn aufmerken lassen. Es war der Nachname. Ihr Familienname.
Choquet.
Er war zwar ungewöhnlich, aber auch keine Seltenheit. Normalerweise würde man ihn Choquette schreiben.
Gamache ging in sein Arbeitszimmer und nahm ihr Dossier vom Boden, schlug es auf. Er überflog die lächerlich knappen Informationen. Dann schloss er es mit zitternder Hand.
Er sah zum Feuer und überlegte kurz, ob er den Aktendeckel einfach hineinwerfen sollte. Damit sie in Flammen aufging. Eine Hexe auf dem Scheiterhaufen.
Stattdessen ging er in den Keller hinunter.
Er schloss den hintersten Raum auf. Wo er die Akten zu alten Fällen aufbewahrte. Und ganz hinten im hintersten Raum öffnete er einen kleinen Schuhkarton.
Dort fand er es.
Die Bestätigung.
Choquet.
Rein logisch betrachtet konnte er sich irren. Wie groß war denn die Wahrscheinlichkeit? Aber sein Instinkt sagte ihm, dass er recht hatte.
Mit schweren Schritten kehrte er zurück nach oben, stellte sich ans Fenster und sah dem winterlichen Treiben zu.
Kinder, die in hastig herausgekramten und nach Zedernholz riechenden Schneeanzügen steckten, tobten über den Dorfanger, jagten einander und schubsten sich in den weichen Schnee. Bombardierten jeden, der ihnen vor Augen kam, mit Schneebällen. Bauten Schneemänner. Kreischten, schrien und lachten.
Er ging in sein Arbeitszimmer und verbrachte die nächsten Stunden mit Recherchen. Als Reine-Marie nach Hause kam, begrüßte er sie mit einem großen Glas Scotch und den Neuigkeiten.
Er musste nach Gaspé.
»Die Halbinsel?«, fragte sie, um sicherzugehen, dass sie richtig gehört hatte. Das war das Letzte, was sie erwartet hatte. Er musste ins Bad. In den Laden. Vielleicht auch zu einem Meeting nach Montréal. Aber auf die Halbinsel Gaspé? Hunderte von Kilometern entfernt, wo Québec ans Meer stieß?
»Willst du zu ihm?«
Als er nickte, sagte sie: »Dann komme ich mit.«
Er kehrte in sein Arbeitszimmer zurück, stellte sich an das Sprossenfenster und sah zu, wie sich die erschöpften Kinder auf den Rücken fallen ließen, eins nach dem anderen, und Arme und Beine im Schnee hin und her bewegten.
Dann standen sie wieder auf und trotteten nach Hause, verdrehten den Hals, als der Schnee in ihrem Nacken schmolz und ihnen in kleinen Rinnsalen den Rücken hinunterlief. Er hing an ihren Handschuhen und an ihren Mützen. Ihre Wangen waren rot, und ihre Nasen liefen.
Im Schnee ließen sie Engel zurück.
Armand holte tief Luft und klebte mit leicht zitternder Hand einen anderen Punkt auf Amelias Akte. Einen grünen.
2
Bereits aus einiger Entfernung sah Michel Brébeuf das Auto auf der Straße, die an der Klippe entlangführte. Zuerst beobachtete er es durch sein Fernglas, dann mit bloßem Auge. Nichts verstellte ihm die Sicht. Kein Baum, kein Haus.
Der Wind hatte fast alles Beiwerk abgetragen und nur das Wesentliche der Landschaft übrig gelassen. Störrisches Gras und Fels. Im Sommer wurde es von Touristen und Ferienhausbesitzern überschwemmt, die wegen der herben Schönheit der Landschaft kamen und sich vor dem ersten Schnee wieder verzogen. Nur wenige wussten das Majestätische zu schätzen, das Gaspé den Rest des Jahres zu bieten hatte.
Die wenigen, die blieben, taten es, weil sie nicht wegwollten oder nirgends sonst hinkonnten.
Michel Brébeuf gehörte zu Letzteren.
Das Auto wurde langsamer, und dann blieb es zu seiner Überraschung gegenüber seiner Einfahrt auf dem leicht abfallenden Seitenstreifen der Landstraße stehen.
Es stimmte, von hier aus hatte man einen spektakulären Ausblick auf den Percé Rock in der Bucht draußen, aber es gab bessere und sicherere Stellen, um für ein Foto anzuhalten.
Brébeuf nahm wieder das Fernglas vom Fensterbrett und richtete es auf das Auto. Es war ein Mietwagen. Das verriet ihm das Kennzeichen. Drin saßen zwei Leute. Mann und Frau. Weiß. Mittleren Alters, wahrscheinlich zwischen fünfzig und sechzig. Wohlhabend, aber nicht reich.
Die Gesichter konnte er nicht sehen, aber das alles schloss er schnell und instinktiv aus der Wahl des Mietautos und der Kleidung.
Und dann drehte der Mann auf dem Fahrersitz sich zu der Frau neben ihm und sagte etwas.
Und Michel Brébeuf senkte langsam das Fernglas und sah aufs Meer hinaus.
Was über Zentral-Québec als Schnee niedergegangen war, hatte tags zuvor als heftiger Regen die Halbinsel Gaspé erreicht. Solche Regengüsse war man im November am Meer gewohnt. Die Novemberstürme ließen die Landschaft in grauer Tristesse versinken.
Aber auch das verging wieder, und der neue Tag zog unfassbar klar und strahlend herauf, der Himmel von einem vollkommenen Blau. Nur das Meer hatte sich noch nicht wieder beruhigt. Es schäumte und brandete gegen die felsige Küste. Weit draußen in der Bucht erhob sich einsam der majestätische, vom Atlantik umtoste Percé Rock.
Als Brébeuf den Blick wieder vom Meer losriss, war das Auto in die Einfahrt gebogen und hatte beinahe das Haus erreicht. Er sah zu, wie die Insassen ausstiegen. Und verharrten. Der Mann stand mit dem Rücken zum Haus und sah aufs Meer hinaus. Zu dem großen Felsen mit dem großen Loch darin.
Die Frau trat zu ihm und nahm seine Hand. Dann gingen sie zusammen die letzten Meter zum Haus. Langsam. Offenbar zögerten sie ebenso sehr, ihm gegenüberzutreten, wie er zögerte, ihnen gegenüberzutreten.
Inzwischen klopfte sein Herz so heftig, dass er sich fragte, ob er tot umfallen würde, bevor das Paar die Verandastufen erklommen hatte.
Er hoffte es.
Mit jahrelang trainiertem Blick sah er auf Armands Hände. Keine Waffe. Dann wanderte sein Blick zur Jacke. War sie nicht an der Seite leicht ausgebeult? Aber Armand war doch gewiss nicht gekommen, um ihn umzubringen? Wenn er das gewollt hätte, hätte er es schon längst getan. Und sicher nicht vor den Augen von Reine-Marie.
Es wäre eine Hinrichtung ohne Publikum. Eine, die Michel insgeheim seit Jahren erwartete.
Was er nicht erwartet hatte, war ein Höflichkeitsbesuch.
Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass kein Blut fließen würde, war Reine-Marie ins Haus gegangen und hatte die beiden Männer auf der Veranda zurückgelassen, wo sie sich dick in Pullover und Jacken eingepackt auf Zedernholzstühlen niederließen, die durch die Wettereinflüsse im Laufe der Zeit grau geworden waren. Wie die beiden Männer.
»Was willst du hier, Armand?«
»Ich habe die Sûreté verlassen.«
»Das habe ich gehört.«
Brébeuf sah den Mann an, der einmal sein bester Freund gewesen war, sein Trauzeuge, sein Kamerad und Kollege und geschätzter Mitarbeiter. Er hatte Armand vertraut und Armand ihm.
Michel hatte recht damit getan. Armand nicht.
Armand sah zu der Felseninsel in der Ferne, in die das über Äonen hinweg unbarmherzig brandende Meer ein Loch gebohrt und sie zu einem steinernen Ring geformt hatte.
Dann drehte er sich zu Michel Brébeuf. Dem Taufpaten seiner Tochter. So wie er selbst der Taufpate von Michels Erstgeborenem war.
Wie oft hatten sie als junge Inspectors so nebeneinandergesessen und einen Fall diskutiert? Und wie oft hatten sie sich später gegenübergesessen, als Michels Stern aufgegangen und der von Armand gesunken war? Chef und Untergebener in der Sûreté, aber außerhalb nach wie vor beste Freunde.
Bis.
»Ich habe auf dem Weg hierher viel nachgedacht«, sagte Armand.
»Über das, was geschehen ist?«
»Nein. Über die Chinesische Mauer.«
Michel lachte. Es war ein spontanes, aufrichtiges Lachen, und in der kurzen Zeit, die es währte, war alles andere vergessen.
Doch dann erstarb das Lachen, und Michel fragte sich erneut, ob Armand hier war, um ihn umzubringen.
»Die Chinesische Mauer? Tatsächlich?«
Michel versuchte, uninteressiert, sogar etwas genervt zu klingen. Gamache mit seinen schlaumeierischen Anspielungen. Aber wie immer, wenn Armand etwas scheinbar Unwichtiges sagte, war Brébeuf neugierig.
»Hmm«, sagte Armand. Die Falten um seinen Mund wurden tiefer. Ergebnis eines leichten Lächelns. »Gut möglich, dass ich der Einzige auf dem Flug war, der darüber nachgedacht hat.«
Brébeuf hätte sich eher die Zunge abgebissen als gefragt, warum er gerade auf die Chinesische Mauer gekommen war.
»Warum?«
»Es hat Hunderte von Jahren gedauert, bis sie stand«, sagte Armand. »Zweihundert vor Christus wurde mit dem Bau begonnen. Kaum zu glauben, was sie vollbracht haben. Tausende Kilometer über Berge und Schluchten hinweg. Es ist auch nicht nur eine Mauer. Sie haben nicht einfach nur Steine aufeinandergeschichtet, sondern sich enorm angestrengt, um zugleich eine Festung daraus zu machen und etwas Schönes. Sie hat China über Jahrhunderte geschützt. Unüberwindlich für Invasoren. Eine unfassbare Leistung.«
»Hab ich auch gehört.«
»Aber im 16. Jahrhundert überwanden die Mandschuren die Chinesische Mauer. Weißt du, warum?«
»Ich ahne, dass du es mir gleich sagen wirst.«
Der Schleier aus Misstrauen und Langeweile hatte sich gehoben, und selbst Michel konnte die Neugier in seiner Stimme hören. Er wollte nicht nur wissen, was es mit der Chinesischen Mauer auf sich hatte, über die er in seinem ganzen Leben nie auch nur eine Sekunde nachgedacht hatte. Vor allem wollte er wissen, warum Armand an sie gedacht hatte.
»Der Bau und die Verteidigung der Mauer hat Millionen von Menschenleben gekostet. Ganze Dynastien gingen für sie und ihren Erhalt bankrott«, sagte Gamache und sah auf das Meer hinaus, spürte die frische Meeresluft auf seiner Haut.
»Nach mehr als tausend Jahren«, fuhr er fort, »überwand sie schließlich ein Feind. Nicht etwa, weil er überlegene Waffen besessen hätte. Nicht weil die Mandschuren bessere Krieger oder Strategen gewesen wären. Denn das waren sie nicht. Die Mandschuren überwanden die Chinesische Mauer und nahmen Peking ein, weil einer ein Tor öffnete. Von innen. So einfach. Ein verräterischer General ließ sie hinein, und damit fiel das gesamte Reich.«
Trotz all der frischen Luft um sie herum konnte Michel Brébeuf auf einmal nicht mehr atmen. Armands Worte schnürten ihm die Kehle zu.
Geduldig saß Armand da und wartete. Dass Michel sich erholte oder ohnmächtig wurde. Er würde seinen früheren Freund nicht verletzen, zumindest jetzt nicht, aber er würde ihm auch nicht helfen.
Nach einiger Zeit fand Michel seine Stimme wieder. »Und des Menschen Feinde werden seine eignen Hausgenossen sein, oder, Armand?«
»Ich glaube nicht, dass die Mandschuren die Bibel zitiert hätten, aber der Satz scheint universelle Geltung zu besitzen. Verrat.«
»Bist du den ganzen weiten Weg gekommen, um mir das mitzuteilen?«
»Nein.«
»Was willst du dann?«
»Ich will, dass du für mich arbeitest.«
Die Worte waren so abstrus, dass Brébeuf sie nicht begriff. Er starrte Gamache verständnislos an.
»Was? Wo?«, fragte er schließlich.
Die eigentliche Frage lautete jedoch, wie beide wussten, warum.
»Ich habe gerade die Leitung der Akademie der Sûreté übernommen«, sagte Armand. »Nach Weihnachten beginnt das neue Semester. Ich möchte, dass du dort unterrich- test.«
Brébeuf starrte ihn immer noch an. Versuchte, das Gesagte zu erfassen.
Das war nicht einfach ein Stellenangebot. Und vermutlich genauso wenig ein Friedensangebot. Dafür war der Kampf zu lange und zu erbittert ausgefochten worden. Bis zu diesem Tag.
Es ging um etwas anderes.
»Warum?«
Armand antwortete nicht. Er sah Brébeuf unverwandt in die Augen, bis dieser den Blick senkte. Dann sah Gamache wieder aufs Meer hinaus. Auf den riesigen Ozean und den mächtigen Felsblock, den das Wasser ausgehöhlt hatte.
»Woher weißt du, dass du mir trauen kannst?«, fragte Michel an Armands Profil gerichtet.
»Das tu ich nicht.«
»Weißt du es nicht, oder traust du mir nicht?«
Jetzt drehte Armand den Kopf und bedachte Michel mit einem Blick, wie ihn dieser noch nie bei ihm gesehen hatte. Er war nicht verächtlich. Nicht in dem Sinn. Nicht einmal ablehnend. Aber etwas in der Art.
Wissend war er in jedem Fall. Gamache sah in Michel das, was er war.
Ein schwacher Mann. Wie der Percé Rock ausgehöhlt von den Unbilden der Zeit. Mitgenommen und deformiert..
»Du hast das Tor geöffnet, Michel. Du hättest es verhindern können, hast es aber nicht getan. Als die Korruption vor der Tür stand, hast du sie hereingelassen. Du hast alle verraten, die dir vertraut haben. Du hast die Sûreté von einer starken und zuverlässigen Institution in eine Jauchegrube verwandelt, und es hat viele Leben gekostet und viele Jahre gedauert, die Jauche wieder wegzukriegen.«
»Warum willst du mich dann zurückholen?«
Armand stand auf, und Brébeuf tat es ihm nach.
»Der Schwachpunkt bei der Chinesischen Mauer lag nicht im Bau, er war menschlicher Natur. Die Stärke oder Schwäche von etwas ist in erster Linie der Mensch. Auch bei der Sûreté. Und die hat ihr Fundament in der Akademie.«
Brébeuf nickte. »D’accord. Das stimmt. Dann stellt sich aber doch erst recht die Frage, warum ich? Hast du keine Angst, dass ich die Kadetten anstecken könnte?«
Er musterte Gamache. Dann lächelte er.
»Ach, das ist schon passiert, oder, Armand? Das ist der Grund? Bist du hierhergekommen, weil du ein Gegenmittel suchst? Brauchst du mich deshalb? Ich soll der Antivirus sein. Der ansteckendere Virus, der die Krankheit heilt. Das ist ein gefährliches Spiel, Armand.«
Gamache bedachte ihn mit einem durchdringenden, abschätzenden Blick, dann ging er ins Haus, um Reine-Marie zu holen.
Michel begleitete sie zurück zu ihrem Auto und sah zu, wie sie davonfuhren, zurück zum Flughafen und zu dem Flug nach Hause.
Dann ging er ins Haus. Allein. Da waren keine Frau, keine Kinder, keine Enkel. Nur die herrliche Aussicht aufs Meer.
Während des Flugs sah Gamache auf die Felder und Wälder hinab, auf den Schnee und die Seen und dachte über das nach, was er getan hatte.
Michel hatte natürlich recht. Es war gefährlich, auch wenn es kein Spiel war.
Was würde geschehen, wenn er es nicht kontrollieren konnte und das Gegenmittel, der neue Virus, sich ausbreitete?
Was hatte er gerade in die Akademie eingeschleust? Welches Tor hatte er geöffnet?
Statt nach der Landung nach Three Pines zurückzukehren, fuhr Armand ins Hauptquartier der Sûreté. Aber zuvor setzte er Reine-Marie bei ihrer gemeinsamen Tochter ab. Annie war im vierten Monat schwanger.
»Kommst du mit rein, Dad?«, fragte sie ihn an der Tür. »Jean-Guy ist bald zu Hause.«
»Ich muss erst noch was erledigen«, sagte er und küsste sie auf die Wangen.
»Hetz dich nicht«, rief Reine-Marie und schloss die Tür.
Im Hauptquartier drückte Armand auf den obersten Knopf im Aufzug und wurde in das Stockwerk mit dem Büro des Chief Superintendent gebracht.
Thérèse Brunel sah von ihrem Schreibtisch auf. Hinter ihr breiteten sich die Lichter von Montréal aus. Drei Brücken konnte er sehen, dazu die Scheinwerfer der Autos, in denen Leute nach Hause fuhren. Es war eine beeindruckende Aussicht, und hinter dem Schreibtisch saß eine beeindruckende Frau.
»Armand«, sagte sie und stand auf, um ihren alten Freund mit einer Umarmung zu begrüßen. »Danke, dass Sie gekommen sind.«
Sie deutete auf die Sitzecke, und beide nahmen Platz. Chief Superintendent Thérèse Brunel, eine schlanke, elegante Frau Ende sechzig, war erst spät zur Polizei gekommen, hatte sich aber von Anfang an als geborene Ermittlerin erwiesen.
Sie war schnell aufgestiegen und hatte ihren Lehrer und Kollegen Chief Inspector Gamache überrundet, bis sie an der Spitze angelangt war.
Ihr Büro war in sanften Pastellfarben renoviert worden, nachdem man den vormaligen Chief Superintendent abgelöst hatte. Wobei »abgelöst« wohl nicht das richtige Wort war.
Ihre Beförderung in einen höheren Rang als Gamache hatte mit Interna der Sûreté zu tun und nichts mit größerer Kompetenz, wie sie beide wussten. Dennoch bekleidete sie den Rang mit großem Selbstvertrauen und leitete den ganzen Apparat dementsprechend.
Armand reichte ihr die Dossiers und sah ihr eine Weile beim Lesen zu. Dann stand er auf und schenkte ihnen beiden einen Drink ein, gab eines der Gläser Thérèse und ging mit seinem zu der Fensterwand.
Die Aussicht auf sein geliebtes Québec fesselte ihn jedes Mal.
»Das wird Ärger geben, Armand«, sagte sie schließlich.
Er drehte nur den Kopf und sah ihr ernstes Gesicht, finster sogar, wenn auch nicht ablehnend. Sie hatte nur gesagt, was passieren würde.
»Ja«, pflichtete er ihr bei und wandte sich wieder dem Ausblick zu, während sie sich erneut den Dossiers zuwandte.
»Sie haben einige der Bewerber ausgetauscht, sehe ich«, sagte sie. »Das wundert mich nicht. Das Problem wird der Lehrkörper sein. Sie wollen mindestens die Hälfte der Stelleninhaber ersetzen.«
Er ging zurück zu seinem Stuhl und setzte sich, stellte das Glas, von dem er nur einen kleinen Schluck getrunken hatte, auf den Untersetzer und nickte. »Wie sollte es zu entscheidenden Veränderungen kommen, wenn dieselben Leute in der Verantwortung stehen?«
»Ich gebe Ihnen recht, und ich habe auch gar nichts dagegen einzuwenden, aber sind Sie auf den Gegenwind vorbereitet? Diese Leute werden ihre Pensionen und Vergünstigungen verlieren. Und sie werden sich gedemütigt fühlen.«
»Dafür bin ich nicht verantwortlich. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Wenn sie dagegen klagen wollen, dann habe ich entsprechende Beweise.« Er wirkte weder besorgt noch triumphierend. Das waren einfach die letzten Nachwehen einer Tragödie, und sie schmerzten.
»Ich glaube nicht, dass sie vor Gericht ziehen«, sagte sie und legte die zuletzt gelesene Akte auf den Stapel. »Aber sie werden auch nicht kampflos aufgeben. Dieser Kampf wird allerdings nicht in der Öffentlichkeit oder vor den Gerichten ausgetragen werden.«
»Wir werden sehen«, sagte er und lehnte sich zurück. Sein Gesicht war grimmig entschlossen.
Armand sah Thérèse dabei zu, wie sie sich die letzten Dossiers vornahm. Die von den Männern und Frauen, denen er eine Stelle an der Akademie anbieten wollte. Um diejenigen zu ersetzen, die er rauswerfen wollte.
Dass er Thérèse die Dossiers zeigte, geschah aus reiner Höflichkeit. Die Befugnisse von Chief Superintendent Brunel erstreckten sich nicht auf die Akademie. Die Akademie und die Sûreté waren gesonderte Institutionen, die theoretisch der Glaube an die Notwendigkeit von Service, Integrité, Justice verband. Pflichterfüllung, Integrität, Gerechtigkeit. Ihr Motto.
Sein Vorgänger hatte die Akademie nur dem Titel nach geleitet. Denn tatsächlich hatte er sich dem vormaligen Leiter der Sûreté zunächst untergeordnet, dann war er vor ihm in die Knie gegangen, und schließlich hatte er aufgegeben. Der Leiter der Sûreté wiederum hatte die Akademie als sein persönliches Experimentierfeld betrachtet.
Aber Chief Superintendent Françoeur war nicht mehr der Leiter der Sûreté und auch nicht mehr bei der Polizei. Er war nicht einmal mehr am Leben. Dafür hatte Gamache gesorgt.
Und jetzt musste Gamache die merde, die er hinterlassen hatte, beseitigen.
In einem ersten Schritt wurde die Autonomie der Akademie wiederhergestellt und gleichzeitig eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der jetzigen Leiterin der Sûreté aufgenommen.
Commander Gamache sah zu, wie sich Chief Superintendent Brunel durch die Auswahl an möglichen Dozenten ackerte, gelegentlich eine kurze Notiz machte und dabei leise vor sich hin murmelte. Bis sie zum letzten Dossier kam. Sie starrte es an, dann suchte sie, ohne es zu öffnen, Gamaches Blick.
»Soll das ein Witz sein?«
»Nein.«
Sie senkte den Blick, fasste den Aktendeckel aber nicht an. Es reichte, den Namen zu lesen.
Michel Brébeuf.
Als sie erneut den Kopf hob, stand an Wut grenzender Ärger in ihr Gesicht geschrieben.
»Das ist verrückt, Armand.«
3
Serge Leduc wartete.
Er war vorbereitet. Den ganzen Morgen über hatte sein iPhone gebrummt. Kollegen hatten ihm Textnachrichten geschickt, um ihm mitzuteilen, dass der neue Leiter der Akademie vorbeisehen würde.
Morgens um acht dachte noch jeder, dass es ein Höflichkeitsbesuch sei. Armand Gamache würde die Runde durch die Büros machen, um sich vorzustellen und sie womöglich nach ihrer Meinung und nach Vorschlägen zu fragen.
Um neun hatte sich ein Schatten des Zweifels über sie gesenkt, und die Nachrichten wurden zurückhaltender.
Um elf kam der Informationsfluss zum Versiegen, und immer weniger Nachrichten landeten in Professor Leducs Posteingang. Und die wenigen waren knapp gehalten.
Hast du von Roland gehört?
Weiß jemand was?
Ich höre ihn auf dem Korridor.
Um zwölf war Leducs iPhone endgültig verstummt.
Er saß in seinem großen Büro und sah auf die Bücherwände. Bücher über Waffen. Über Bundes- und Provinzgesetze. Über das Richterrecht und den Code Civil. Es gab Fallgeschichten und Ausbildungshandbücher. Das kleine Stück Wand, an dem keine Bücher standen, war seinen Urkunden und einem alten Stich von einer in ihre Bestandteile zerlegten Muskete vorbehalten.
Leduc war Mitte vierzig, von eher kleiner Statur, aber durchtrainiert. Als man ihn dabei ertappt hatte, wie er Drogen aus der Asservatenkammer der Sûreté entwendete, hatte man ihn an die Akademie versetzt.
Leduc hatte den Verdacht, dass Chief Superintendent Françoeur dahintergesteckt hatte. Nicht, dass er unschuldig war. Leduc hatte sich jahrelang an den beschlagnahmten Drogen bedient und sie an Verbrechersyndikate verkauft. Was ihm allerdings seltsam vorkam, war, dass man ihn gerade dann erwischt hatte, als die Stelle des stellvertretenden Leiters der Akademie frei wurde.
Françoeur hatte Leduc vor die Wahl gestellt. Entweder in die Leitung der Akademie zu wechseln oder gefeuert zu werden.
Serge Leduc war Pragmatiker und hatte sich den Regeln innerhalb der Sûreté untergeordnet. Wenn der Chief Superintendent das wollte, dann sollte es so sein. Es brachte nichts und war sogar schädlich, wenn man nachtragend war oder sich dem Unausweichlichen widersetzte. Besonders wenn es von Sylvain Françoeur kam. Leduc war selbst lange genug Françoeurs Handlanger gewesen, um zu wissen, was es bedeutete, wenn er einen feuerte.
Das alles war inzwischen fast zehn Jahre her, und mit seiner Versetzung hatte ein neues Zeitalter begonnen. Wenn auch nicht unbedingt das der Aufklärung.
Serge Leduc hatte die Akademie in Françoeurs Sinn umgekrempelt. Er hatte in seinem Sinn Bewerber ausgewählt und aufgenommen. Er hatte den Lehrplan geändert. Die jungen Leute angeleitet, gefördert und bestraft. Bis sie alle waren wie Serge Leduc.
Jedem Rekruten, der sich auflehnte oder auch nur etwas infrage stellte, wurde eine Sonderbehandlung zuteil. Die sofortige Unterwerfung zur Folge hatte.
Der eigentliche Leiter der Akademie hatte zunächst leise protestiert, sich dann aber gefügt. Er hatte Form ohne Funktion zu seinem Leitprinzip erhoben. Er war das Aushängeschild der Akademie, ein Relikt, das bleiben durfte, um besorgte Mütter und Väter zu beruhigen, die fälschlicherweise annahmen, dass die Hauptgefahr für ihre Kinder körperlicher Natur war.
Mit seinen grauen Haaren und der geraden Haltung war der Commander eine vertrauenerweckende Erscheinung, wenn er die eifrigen Rekruten an ihrem ersten Tag lächelnd in seiner Ausgehuniform begrüßte und sie am letzten lächelnd verabschiedete, während sie ihn verschlagen und wissend angrinsten. In der übrigen Zeit versteckte er sich in seinem Büro und fürchtete, dass sein Telefon klingeln, jemand an seiner Tür klopfen, die Sonne auf- oder untergehen könnte.
Und jetzt war er weg. Und Chief Superintendent Françoeur war auch weg. Genau genommen »gefeuert«, dachte Leduc mit einem ironischen Grinsen.
Jetzt wartete Professor Leduc darauf, dass an seine Tür geklopft wurde.
Sorgen machte er sich keine. Er herrschte über die Akademie. Sie gehörte ihm.
Armand Gamache ging den langen Korridor hinunter. Vor ein paar Jahren hatten sie die alte Akademie, an der er selbst seine Ausbildung erhalten hatte, abgerissen und an der South Shore von Montréal ein neues Gebäude aus Glas, Beton und Stahl errichtet.
Bei aller Wertschätzung für Tradition und Geschichte war Gamache über den Abriss der alten Akademie nicht traurig gewesen. Das waren nur Ziegel und Mörtel. Nicht das Äußere des Gebäudes zählte, sondern was im Inneren vor sich ging.
Zwei Agents der Sûreté, die er persönlich ausgesucht und sich von Thérèse Brunel ausgeliehen hatte, gingen hinter ihm her.
Er blieb vor der Tür stehen. Der letzten auf seiner Liste. Ohne zu zögern klopfte er.
Leduc hörte das Klopfen und zuckte unwillkürlich zusammen. Erst in diesem Moment wurde ihm klar, dass er insgeheim gar nicht damit gerechnet hatte, dass auch an seine Tür geklopft werden würde.
Dennoch machte er sich immer noch keine Sorgen.
Er stand auf und kehrte der Tür den Rücken zu, verschränkte die Arme vor der Brust und sah durch das bodentiefe Fenster auf den Sportplatz hinunter, der von einer makellosen Schneeschicht bedeckt war.
Gamache wartete.
Er hörte, wie die Agents hinter ihm anfingen, von einem Fuß auf den anderen zu treten. Er stellte sich vor, wie sie vielsagende Blicke wechselten und die Augenbrauen hoben.
Aber er wartete weiter, verschränkte die großen Hände hinter dem Rücken. Es war nicht nötig, noch einmal zu klopfen. Der Mann hinter der Tür hatte es gehört und spielte ein Spielchen. Nur war es eine Patience.
Gamache hatte keine Lust, sich auf so etwas einzulassen. Stattdessen nutzte er die Zeit, um sich zu überlegen, wie er seinen Plan am besten umsetzen konnte.
Serge Leduc war kein Problem. Er war nicht mal ein Hindernis. Er war, im Gegenteil, Teil des Plans.
Leduc sah aus dem Fenster und wartete auf ein nochmaliges Klopfen. Lauter dieses Mal. Ein ungeduldiges Hämmern gegen seine Tür. Aber es blieb still.
War Gamache gegangen?
Sylvain Françoeur hatte immer gesagt, Chief Inspector Gamache sei ein Schwächling, der das gut hinter einer Fassade verstecke, die oft genug mit Klugheit verwechselt werde.
»Sein einziges echtes Talent besteht darin, andere davon zu überzeugen, dass er Talent hat«, hatte der Leiter der Sûreté mehr als einmal erklärt. »Der integre, mutige Armand Gamache. Blödsinn. Wissen Sie, warum er mich nicht leiden kann? Weil ich ihn durchschaut habe.«
Zu diesem Zeitpunkt hatte Françoeur für gewöhnlich schon mehrere Gläser Scotch intus und war redselig und noch aggressiver als ohnehin. Die meisten seiner Untergebenen kannten ihn gut genug, um nach dem dritten Drink unter einem Vorwand das Weite zu suchen. Nur Serge Leduc blieb, der damit seinen Mut beweisen wollte, aber auch, weil es ihn sonst nirgends hinzog.
Françoeur saß über seinen Schreibtisch gebeugt da und sah an der Flasche Ballantine’s vorbei sein Restpublikum an. Das Gesicht krebsrot.
»Er ist ein Schlappschwanz. Ein Schwächling, ein erbärmlicher Schwächling. Er versammelt den Ausschuss der Sûreté um sich. Die Agents, die sonst keiner will. Die Nieten, die von besseren Männern als ihm rausgeworfen wurden. Gamache ist ein Müllsammler. Und wissen Sie, warum?«
Leduc wusste es. Er kannte die Geschichte. Und nur weil die immer gleichen Worte in einer widerlichen Wolke aus Scotch und Bosheit aus Françoeurs Mund strömten, waren sie nicht weniger wahr.
»Weil er die Konkurrenz scheut. Er umgibt sich mit Speichelleckern und Nieten, damit er selbst besser dasteht. Er kann Waffen nicht leiden. Weil er Angst vor ihnen hat. Dieser Feigling. Er hat vielen Leuten Sand in die Augen gestreut, aber mit mir macht er das nicht.«
Dann schüttelte Françoeur den Kopf, und seine Hand schob sich zu der Waffe in seinem Gürtelholster. Der Waffe, mit der ihn Armand Gamache eines Tages töten würde.
»Wir sind keine Freunde und Helfer, wir sind die Polizei«, sagte Françoeur gerne auf der Abschlussfeier, wenn die Polizeikadetten zu Agents ernannt wurden und wie Wasser durch ein leckes Abflussrohr in die Sûreté sickerten. »Wir sind nicht nett. Wir sind schlagkräftig. Nicht ohne Grund werden wir Polizeikräfte genannt. Wir nutzen unsere Kraft. Wir sind eine Kraft, mit der man rechnen muss.«
Dafür erntete er stets begeisterten Applaus von den Absolventen und leichtes Unbehagen von den Angehörigen, die im Auditorium saßen.
Das war Chief Superintendent Françoeur egal. Seine Worte richteten sich nicht an Eltern und Großeltern.
Einmal im Monat besuchte Françoeur die Akademie und übernachtete in dem luxuriösen Apartment, das für ihn reserviert war. Nach dem Abendessen lud er ein handverlesenes Grüppchen zu einem Drink in sein großes Wohnzimmer ein, von dem aus man den riesigen Sportplatz überblickte, und ergötzte die eingeschüchterten Kadetten mit Horrormärchen über unglaubliche Gefahren und riskante Ermittlungen und der einen oder anderen geschickt eingeflochtenen Geschichte über dumme Verbrecher und blöde Fehler.
Und wenn Françoeur die Zeit für gekommen hielt, schummelte er die eigentliche Botschaft in seine Geschichten. Dass die Sûreté du Québec nicht dazu da sei, die Bevölkerung zu schützen, sondern sich selbst vor der Bevölkerung. Dass die Bürger der eigentliche Feind seien.
Die Rekruten könnten nur ihren Kameraden in der Sûreté trauen. Und selbst bei denen müssten sie vorsichtig sein. Es gab welche, die es darauf anlegten, die Polizei von innen zu schwächen.
Serge Leduc betrachtete die faltenlosen Gesichter mit den weit aufgerissenen Augen, und im Laufe der Monate und Jahre sah er, wie sie sich veränderten. Und immer wieder bewunderte er das Geschick des Chief Superintendent, der so leicht kleine Ungeheuer erschaffen konnte.
Auch wenn Françoeur inzwischen tot war, sein Vermächtnis blieb, und zwar in Fleisch und Blut und in Glas und Stahl. In den kalten, harten Oberflächen und den scharfen Kanten der Akademie und der Agents, die er erschaffen hatte.
Der neue Bau der Akademie wirkte schlicht, beinahe klassisch. Er stand auf dem Grund, den man der Gemeinde Saint-Alphonse abgeluchst hatte, weil die Bedürfnisse der Sûreté gegenüber denen der Bevölkerung Vorrang hatten.
Der beeindruckende Komplex war um einen riesigen Innenhof mit einem großen Sportplatz angelegt. Hinein kam man nur durch ein einziges Tor.
Er vermittelte den Eindruck von Transparenz und Stärke. Aber im Grunde war es eine Festung. Ein Bunker.
Serge Leduc starrte auf die Fassaden der anderen Gebäude. Das war vermutlich sein letzter Tag in diesem Büro. Das war sein letzter Blick auf den Innenhof.
Das Klopfen an der Tür hatte es bestätigt.
Aber er würde sich nicht mit eingezogenem Schwanz verziehen. Wenn der neue Leiter der Akademie dachte, er könnte hier einfach reinmarschieren und Leduc würde ihm sein Territorium kampflos überlassen, dann war er nicht nur ein Schwächling, sondern auch dumm. Und dumme Leute bekamen, was sie verdienten.
Leduc rückte sein Gürtelholster zurecht, schlüpfte in sein Jackett und ging zur Tür, um sie zu öffnen. Und stand Auge in Auge Armand Gamache gegenüber. Wobei Leduc den Kopf ein wenig in den Nacken legen musste.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Er war dem Mann noch nie persönlich begegnet, auch wenn er ihn oft genug aus der Ferne und in den Nachrichten gesehen hatte. Leduc war überrascht von Gamaches Ausstrahlung, wobei der es im Gegensatz zu Françoeur nicht darauf anlegte, einschüchternd zu wirken.
Aber da war etwas an ihm, etwas Ungewöhnliches. Vielleicht lag es an der Narbe an seiner Schläfe, dachte Leduc. Sie vermittelte den Eindruck von Stärke, aber eigentlich bedeutete sie, dass der Mann so schwerfällig war, dass er sich nicht schnell genug weggeduckt hatte.
»Armand Gamache«, stellte sich der neue Commander vor und streckte ihm mit einem Lächeln die Hand entgegen. »Haben Sie einen Moment Zeit?«
Auf ein unauffälliges Zeichen hin traten die beiden großen Agents einen Schritt zurück, aber der Mann selbst bewegte sich nicht, ging nicht an Leduc vorbei, um sein Büro zu besetzen.
Stattdessen stand er einfach da und wartete höflich darauf, hereingebeten zu werden.
Leduc musste sich ein Lächeln verkneifen. Dann würde doch noch alles in Ordnung kommen.
Der neue Commander war kein bisschen besser als der alte. Ein Relikt durch das andere ersetzt. Wenn man Gamache in eine Ausgehuniform steckte, würde er zweifellos beeindruckend aussehen. Aber der kleinste Windhauch würde ihn umwerfen.
Doch dann sah Leduc Gamache in die Augen, und in dem Moment wurde ihm klar, was hier tatsächlich vor sich ging.
Der neue Leiter könnte sich den Weg in Leducs Büro erzwingen, insbesondere mit der Hilfe der beiden hünenhaften Polizisten. Aber Gamache machte etwas viel Gerisseneres und um einiges Heimtückischeres. Und zum ersten Mal fragte sich Leduc, ob Françoeur nicht falschgelegen hatte.
Gamache hatte den Chief Superintendent mit dessen eigener Waffe getötet. Es war eine endgültige und äußerst symbolische Handlung.
Und jetzt sah Serge Leduc in diese ruhigen, selbstbewussten, intelligenten Augen, und ihm wurde klar, dass Gamache dasselbe mit ihm tat. Nicht ihn töten. Wenigstens nicht physisch. Armand Gamache wartete, dass Leduc ihn eintreten ließ. Dass er ihm von sich aus Platz machte.
Das würde die Niederlage vollkommen machen.
Jeder konnte sich etwas mit Gewalt nehmen, aber nicht viele brachten andere dazu, sich kampflos zu ergeben.
Bislang hatte er die Akademie kampflos übernommen. Das hier war das letzte Widerstandsnest.
Professor Leduc bewegte seinen linken Arm, sodass er den Griff der Waffe unter dem Jackett spürte. Im selben Moment hob er die rechte Hand und schüttelte die von Gamache. Er hielt Gamaches Hand, und er hielt seinen Blick. Beide waren ruhig und verrieten nichts von Ärger oder Gereiztheit.
Es war sehr viel bedrohlicher, als jede Machtdemonstration es jemals sein könnte.
»Kommen Sie rein«, sagte Leduc. »Ich habe Sie erwartet. Ich weiß, warum Sie hier sind.«
»Sind Sie sicher?«, sagte der neue Leiter der Akademie und schloss die Tür hinter sich. Die beiden Agents blieben draußen.
Leduc war verwirrt, blieb aber zuversichtlich. Gamache mochte seine Pläne haben, seinen Charme, in einem gewissen Maß sogar Mut. Aber Serge Leduc hatte eine Waffe. Und eine Kugel ließ sich mit keinem Mut der Welt aufhalten.
Um die Akademie ging es Leduc dabei gar nicht so sehr. Was er nicht ausstehen konnte, war, wenn ihm jemand etwas wegnehmen wollte. Und dieses Büro sowie diese Schule gehörten ihm.
Er machte eine Geste zu dem Besucherstuhl, und Gamache setzte sich, während Leduc hinter seinem Schreibtisch Platz nahm. Er hob an, etwas zu sagen. Seine Hand hatte sich unter dem Schreibtisch zu dem Holster geschoben und die Waffe herausgeholt.
Er würde festgenommen und vor Gericht gestellt werden. Man würde ihn schuldig sprechen, weil er schuldig war. Aber Leduc wusste, dass ihn viele seiner vormaligen Studenten für einen Märtyrer halten würden. Besser so, als im Stillen untergehen wie die anderen. Abgesehen davon wusste er nicht, wohin er gehen sollte, außer hinaus in die Kälte.
Bevor Leduc jedoch etwas sagen konnte, legte Gamache einen großen Umschlag auf den Schreibtisch. Seine Hand blieb einen Moment darauf liegen, als würde er noch einmal kurz überlegen, dann schob er ihn wortlos zu dem Professor.
Leduc konnte seine Neugier nicht bezwingen. Er legte die Waffe in den Schoß, zog den Umschlag zu sich heran und öffnete ihn. Die erste Seite war unmissverständlich. Sie listete fein säuberlich seine Vergehen auf.
Leduc war nicht überrascht, dass die Vergehen aus seiner Zeit bei der Sûreté aufgeführt waren. Françoeur hatte versprochen, die Uraltakten zu vernichten, aber Leduc hatte ihm nicht eine Sekunde geglaubt. Überrascht war er über die anderen. Aus der Akademiezeit. Die fragwürdigen Grundstückserwerbe. Die Bauverträge. Die Verhandlungen, von denen eigentlich niemand etwas wissen sollte.
Kurz und bündig, klar und verständlich. Und Serge Leduc verstand.
Er klappte den Aktendeckel zu und legte erneut die Hand in den Schoß.
»Sie sind leicht zu durchschauen, Monsieur«, sagte er. »Das hier habe ich erwartet.«
Gamache nickte, sagte aber immer noch nichts. Sein Schweigen war beunruhigend, auch wenn Leduc seine Unruhe zu verbergen versuchte.
»Jetzt sind Sie hier, um mich zu entlassen.«
Da tat Gamache etwas völlig Überraschendes. Er lächelte. Es war kein breites Lächeln. Kein Grinsen. Aber doch amüsiert.
»Mir ist klar, dass Sie das erwarten«, sagte er. »Aber ich bin hier, um Sie zu bitten zu bleiben.«
Polternd fiel die Pistole zu Boden.
»Ich glaube, Sie haben da etwas fallen lassen«, sagte Gamache und stand auf. »Sie werden natürlich nicht den Posten meines Stellvertreters bekleiden, aber Sie werden ihre Professorenstelle behalten und weiter Verbrechensprävention und öffentliche Kommunikation unterrichten. Ende der Woche hätte ich gern Ihren Semesterplan.«
Reglos saß Serge Leduc da und brachte kein Wort heraus. Er rührte sich auch dann noch nicht, als Gamaches Schritte im Korridor verhallten.
Und in dieser Stille wurde Leduc klar, was Gamache getan hatte. Er hatte nicht Gewalt ausgeübt, sondern Macht.
4
»Hast du etwas entdeckt?«
»Verpiss dich«, sagte Ruth und drehte sich weg, um das, was sie in ihren knochigen Händen hielt, zu beschützen. Dann warf sie einen vorsichtigen Blick über die Schulter. »Ach, du bist’s. ’tschuldigung.«
»Was dachtest du denn, wer es ist?«, fragte Reine-Marie weniger verärgert als amüsiert.
Seit beinahe zwei Monaten saß sie jetzt jeden Nachmittag mit Ruth zusammen und ging mit ihr auf Oliviers Bitte hin die Dokumente in der Truhe durch. An den meisten Nachmittagen gesellten sich Clara und Myrna zu ihnen, um bei der Arbeit zu helfen, die ihnen allerdings nie wie Arbeit vorkam.
Die vier Frauen saßen um den Kamin, tranken Café au Lait und Scotch, aßen chocolatines und sahen den riesigen Haufen Papier durch, den Olivier und Gabri vor zwanzig Jahren im Zuge des Umbaus aus den Mauern des Bistros geborgen hatten.
Reine-Marie, Ruth und Rosa, ihre Ente, saßen auf dem Sofa, während Clara und Myrna sich auf den beiden einander gegenüberstehenden Sesseln niedergelassen hatten.
Clara machte gerade eine Pause von der Arbeit an ihrem Selbstporträt. Insgeheim fragte sich Reine-Marie, ob Clara, wenn sie sagte, sie male sich, nicht eher meinte, sie bemale sich. Jeden Nachmittag tauchte Clara nämlich mit Essensresten in den Haaren und Farbtupfern im Gesicht auf. Heute waren es ein leuchtendes Orange und Tomatensoße.
Clara gegenüber saß ihre beste Freundin Myrna. Myrna führte die Buchhandlung mit Antiquariat, die neben dem Bistro lag. Sie hatte sich in den großen Sessel gequetscht und genoss jedes Wort, das sie las, und jeden Bissen von ihrer chocolatine.
Vor hundert Jahren, als die Papiere eingemauert worden waren, um das Haus vor dem bitterkalten Winter in Québec zu schützen, hatten die Dorfbewohnerinnen bei einem Nähkränzchen zusammengesessen.
Das hier war das moderne Äquivalent. Ein Lesekränzchen.
Zumindest lasen Clara, Myrna und Reine-Marie. Was Ruth tat, konnte Reine-Marie nicht sagen.
Die alte Dichterin hatte diesen und den gestrigen Nachmittag damit verbracht, auf ein einzelnes Blatt zu starren. Die anderen Papiere hatte sie ignoriert. Ihre Freundinnen hatte sie ignoriert. Selbst den vor ihr stehenden Scotch hatte sie ignoriert, und das war äußerst besorgniserregend.
»Hast du etwas Interessantes gefunden?« Reine-Marie gab nicht auf.
Jetzt ließen auch Clara und Myrna die Blätter sinken, die sie studiert hatten, um Ruth zu mustern. Selbst Rosa sah die alte Frau fragend an. Wobei Reine-Marie zu dem Schluss gekommen war, dass Enten kaum jemals anders dreinschauten.
Reine-Marie hatte sich einen entspannten Tagesablauf angewöhnt: Vormittags ging sie die Archivalien der Township durch, nachmittags wechselte sie ins Bistro.
An den Wochenenden leistete Armand ihr Gesellschaft, machte es sich mit einem Bier in einem der Sessel bequem und studierte seine eigenen Akten.
Wenngleich die Holztruhe einer Schatzkiste ähnelte und viele faszinierende Dinge enthielt, konnte nichts davon als Schatz bezeichnet werden, auch nicht von einer Archivarin, die Gold erblickte, wo andere Dämmung sahen.
Als Ruth mit dem Projekt angefangen hatte, war das Laub leuchtend rot, gelb und braun gewesen. Mittlerweile war Weihnachten gekommen und gegangen, und die Bäume ächzten unter ihrer winterlichen Last. Das Dorf versank beinahe im Schnee, und nur über die Wege, die Billy Williams freigelegt hatte, gelangte man von Haus zu Haus.