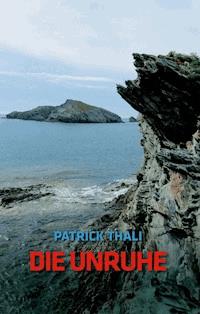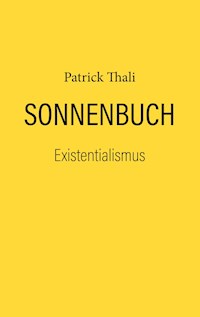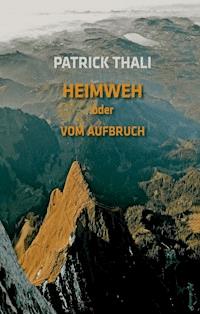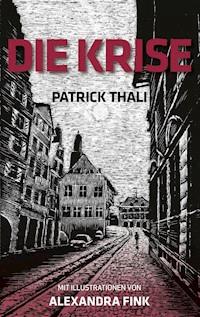Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man muss nicht glänzen, man soll leben und arbeiten; vielleicht glänzt dann ein wenig, was man tut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
EINLEITUNG
BILD / SEHNSUCHT
BLICKWINKEL
KORREKTUR
ATMOSPHÄRE / HEIMWEH
WERK
WILLE
ARBEIT
SCHLUSSWORT
EINLEITUNG
Goût des Lebens
Was vermag ich denn mehr auf dieser Erde, als zu bezeugen, was ich gefühlt habe? Ein Mensch kann weiter nicht gehen. Wohin sollte ich weiter gehen, denn in mein Inneres, um es auszuleuchten und darzustellen? Die Bezeugung des Lebens ist das Subjektivste, das es gibt, und doch oder gerade dadurch sagt es auch einem anderen zu. Ich muss ganz bei mir sein, um dem anderen etwas sagen zu können, das auch ihn berührt.
Wenn ich sage, ich liebe die Welt, dann liebe ich sie, weil ich ihn ihr sorgenlos leben konnte. Sie hat mich in Ruhe leben lassen. Hätte sie es nicht, ich wäre ein zornigerer Mensch gewesen. Ich war stets auf eine Ungerechtigkeit gefasst, aber sie traf nie ein.
Da fluchen, schwatzen, weinen, lachen und hadern sie. Sie stehen mitten im Leben. Kommt es daher, dass ihnen der Goût für das Leben abhandengekommen ist? Für den Geschmack, die Freude am Leben muss man weniger in ihm stehen denn über ihm. Man soll es beobachten und bewerten wollen, man soll es auch loslassen können, ein bestimmtes Leben, wenn es nicht stimmt, wenn es durch die Probe fällt.
***
Liebe Leserin, lieber Leser
Was können uns Romane geben? Romane erzählen uns eine Geschichte. Ihr Erfinder, der Autor, präsentiert uns eine Art Film. Wir lassen uns auf seine Geschichte ein, wenn wir sein Buch in die Hand nehmen. Ob wir in guter Gesellschaft bei ihm sind, wird sich mit der Lektüre weisen. Wir sind aber nicht bei uns während des Lesens. Wir geben damit Eigenverantwortung ab. Wir sind für einige Momente nicht mehr wach. Wir schalten unser Denken aus.
Die beste Gesellschaft ist unsere eigene oder eine, die uns Fragen stellt. Nur wenn wir bei uns bleiben, können wir unsere Sinne schärfen. Romane fördern nicht unser Wachsein, im Gegenteil. Was können wir tun?
Wir sollen unsere Zeit nicht mit Romanen verschwenden. Lesen wir lieber nichts.
Lesen wir Texte, die Fragen aufwerfen zu unserem Leben. Wählen wir Autoren, die uns wirklich etwas sagen wollen, die uns den Ball zuspielen, die mit uns reden, die zu uns kommen.
Darum versuche ich in diesem Buch zu Ihnen zu reden. Wenn ich „Sie“ sage, meine ich Sie, die Leserin, den Leser, die bzw. den ich mir vorstelle. Die Monologe, die Sie hier in verschiedenen Längen vorfinden, suchen Ihre Meinung, Ihre Beteiligung. Somit soll dieses Buch eine Art Gespräch sein, obschon ich mir Ihre Meinung nur vorstellen kann und finalement diese meine Vorstellung auch nur meine Meinung ist. Somit rede ich mit mir selber. Aber dennoch: Man redet, man erzählt nicht, so hoffe ich. Und so hoffe ich auch, dass Sie für sich mir eine Antwort geben.
Talente
Große Talente sind das schönste Versöhnungsmittel.
Johann W. v. Goethe, Maximen und Reflexionen
Ein talentierter Autor prägt Begriffe, die eindeutig ihm zuzuordnen sind und die durch seinen Mund eine besondere Bedeutung und etwas ihm Charakteristisches ausdrücken. Es sind Schlüsselbegriffe, die einem Leser den Zugang zum Autor ermöglichen, aber auch den Zugang zu sich selber. Ich gebe Beispiele:
Friedrich Glauser brauchte zwei Wörter, die für ihn typisch waren und die aussagen, worauf es ihm ankam, was ihm wichtig war – und was einer beachten und reflektieren sollte, wenn er gut schreiben will: Atmosphäre und Korrektur.
Kurt Guggenheim prägte die beiden Begriffe Werk und Heimweh.
Schlüsselbegriffe lassen nicht nur erraten, was einen Autor im Innersten bewegt. Sie berühren den empfänglichen Leser und ermöglichen ihm eine Form von „Abgleich“ mit sich selbst. Ein Schlüsselbegriff ist ein Schlüssel. Er öffnet Türen.
Ludwig Hohl steht für die beiden Wörter Arbeit und Bild. Und welche Türen damit geöffnet werden, welchen Reichtum an Bildern Sätze kreieren wie: Der Mensch hat die Pflicht, reich zu sein, oder Arbeiten ist nichts anderes als aus dem Sterblichen übersetzen in das, was weitergeht, weiß ich selber gut. Zwei Begriffe werden zu Grundpfeilern eines ganzen Werks.
Nehmen wir nun die Schlüsselbegriffe dieser drei Autoren zusammen: Atmosphäre, Korrektur, Werk, Heimweh, Arbeit und Bild, so setzen wir damit die Kapiteltitel eines Buches, das es noch zu machen gilt, das aber – wenn wir nun nicht einfach hingehen und billig kopieren – ein respektables Werk sein müsste, von der Gewichtigkeit oder der Stoßrichtung der Begriffe her gesehen.
Kühn genug wären wir dann, es mit zwei eigenen Kapiteln zu ergänzen: Blickwinkel und Wille.
Nun denn, liebe Leserin, lieber Leser – vor Ihnen liegt der Versuch dieses Buches.
Juni 2017
Patrick Thali
I.
BILD / SEHNSUCHT
1. DREIMAL DER SÜDEN
Der Wille zum Leben
Der Süden! Alles Instinkt! Alles Wille zum Leben! Was ist Instinkt? Was gesund ist, was am Leben erhält, was Leben bejaht: Die Natur, die Sonne, die Luft. Instinkt ist körperlich. Der Süden ist Instinkt. Er ist Gesundheit.
Der Süden ist ein Bild, ein Ideal, wenn man nicht im Süden ist. Was ist ein Ideal? Ein starkes Bild, das uns trägt. Das Bild des Südens: Es bleibt lange intakt, trägt weit, selbst in Zeiten der Orientierungslosigkeit, der Müdigkeit, in Zeiten der Dunkelheit und Kälte. Ganz orientierungslos, sehr müde ist man nie, wenn man den Süden in sich hat. Man badet im Meer, badet sich Kraft an und Zuversicht, auch wenn es nur in der Vorstellung ist. Die Sonne scheint, das Licht ist eine Kraftquelle, auch wenn es nur eine Erinnerung ist. Der Süden macht Freude, auch wenn sonst nichts mehr Freude macht.
Der Süden ist vom Leben inspiriert. Inspiration – ein großes Wort. Was bedeutet es? Der Süden ist inspiriert, was heißt das? Ich gebe eine Definition: Etwas ist inspiriert, wenn es uns eine Antwort abverlangt, wenn wir nicht anders können als zu antworten. Etwas ist inspiriert, wenn es uns erschüttert, wenn es uns beunruhigt, wenn es uns betört und anzieht, wenn es in uns Sehnsucht erzeugt. Kunst kann inspiriert sein, eine Rede kann inspiriert sein, aber auch eine Gegend. Ein Bild, das uns trägt, ist ein inspiriertes Bild. Es ist da, es beschäftigt uns, es erfüllt uns. Was es ausmacht, dass der Süden inspiriert ist? Wenn ich sage, es seien die Lichtverhältnisse, die Lufttemperatur, die Trockenheit der Winde, die Wasserbeschaffenheit, die Gerüche, aber auch die Essgewohnheiten, die Küche, der Wein, die Oliven, der Käse, die Nüsse, eine positive Energie insgesamt, eine gesunde Stimmung, wäre dies eine Erklärung für Inspiration? Haben Sie eine bessere, eine umfassendere?
Der Süden ist Instinkt, er ist Ideal, er ist Inspiration. Er ist Gesundheit, ein tragendes Bild, er ist Sehnsucht. Dreimal der Süden.
2. DIE LANGE ANKUNFT
Und dann, an einem warmen, schönen Märztag, fragt man sich, ob das, was man sich in kalten Wintertagen, in der Dunkelheit ausgedacht hat, wohl richtig sei. Aber man hat es sich nicht ausgedacht. Es war der Stimmung der Zeit entsprechend. Was den Unterschied nun macht?
Die Sonne. Ganz einfach. Die Sonne.
Eine Vorstellung:
Sehnsucht
Ich hatte solche Sehnsucht nach dem Süden. Ich hielt die Nebelsuppe in Zürich nicht mehr aus. Ein Taxi brachte mich vom Bahnhof Toulon direkt auf die Halbinsel Giens hinaus. Da stand ich schließlich am Strand. Das Meer lag ruhig vor mir. Es war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Weiter musste ich nicht gehen. Dieser Ort war meine Sehnsucht. Ich konnte weiter nicht gehen. Verstehen Sie? Möwen ließen sich im blauen Himmel über der Brandung treiben. Ein helles Licht lag in der Bucht. Die Sonne hatte schon richtig Kraft.
Was würden Sie tun, wenn Sie am Ort ihrer Sehnsucht angelangt sind und diese Sehnsucht dennoch nicht eingelöst ist? Ich war im Süden angekommen und gleichwohl war ich es nicht. Wie gesagt, es war alles vorhanden, wie ich es mir vorgestellt hatte: das Licht, der Himmel, das Meer, die Möwen. Alles hatte die Farbe und den Geruch, wie ich es erwartet hatte. Und doch war alles so nüchtern, so ohne Antwort für mich.
Es ist so eine Sache mit der Vorstellung, nicht wahr? Immer und immer wieder fällt man darauf herein, auf die Illusion, dass die Vorstellung bloß Anlass ist für ein bestimmtes Tun, für eine Umsetzung in die Tat. Man vergisst, dass sie bereits Umsetzung ist. Die Vorstellung ist Ziel. Die Sehnsucht verlangt nichts weiter.
Nun, da ich diesem Irrtum wieder einmal erlegen war und eine Umsetzung in Form einer langen Reise auf mich genommen hatte, wollte ich immerhin profitieren von der schönen Landschaft. Aber die Sonne über mir blieb leer. Ich schaute in den blauen Himmel hinauf. Endlos wölbte er sich über mir bis zum Horizont, wo er mit dem Meer eine klare Linie bildete. Die Tiefe und die Weite dieses Blaus waren so trostlos, so ohne Ende, ohne Aussicht auf Veränderung. Es gibt nichts für einen Menschen, dort oben. Nach dem Himmel kommt das Weltall, ein noch endloserer Raum. Dort ist es nur kalt und einsam. Und man kann nicht atmen.
Die moralische Frage
Wenn man über nichts Bescheid weiß, muss man sich mit dem Spekulieren begnügen. Ich gehöre zweifellos zu denen, die ihre Sätze beginnen mit: „Ich glaube, dass …“, „Ich denke mir, dass …“, „Ich vermute, dass …“. Solche Sätze erwachsen aus dem Unwissen. Man ist nicht informiert, kann nicht aus Fakten heraus argumentieren. Ich habe kein Talent zum Wissen. Mich hat wenig wirklich interessiert, außer der Frage nach der Moral. Wenn man nichts weiß, wenn man auf keinem Gebiet ein Fachwissen hat, dann rückt die Frage nach dem menschlichen Verhalten in den Vordergrund. Man kann dieses Verhalten beobachten, täglich, an allen Orten. Man kann dann sehen, wie sich einer benimmt, wie er redet, was er sich erlaubt oder anmaßt, was er von sich hält und was er von den anderen hält. Das Denken, das aus der Beobachtung entsteht, wird ein beurteilendes, moralisch strenges Denken sein. Man schenkt dem anderen nichts und sich selber auch nicht. Es kann nicht sein, dass man einen anderen leicht aburteilt und sich selber über allen Zweifeln erhaben glaubt. Man würde so in einer verzerrten Realität leben, in einem Irrglauben. Nein. Ich habe viele Fehler gemacht, doch diesen, mich selber zu überschätzen und andere zu unterschätzen, nicht.
Die moralische Frage ist, so scheint es mir, eine der grundsätzlichsten Fragen zum menschlichen Dasein. Wie sich einer verhält im Leben, mit oder ohne Fachwissen, mit oder ohne Bildung, mit oder ohne Machteinfluss, mit oder ohne finanzielle Mittel, ist entscheidend, nicht wahr? Nur, was genau will man damit analysieren und aufdecken? Was will dies genau sagen: Einer hat eine strenge Moral oder einer ist moralisch flexibel? Ist einer integer, wenn er genau tut, was er denkt und sagt? Diese Definition reicht nicht. Auch Verbrecher halten ihr Wort. Ist integer, wer einen anderen sieht und sich in ihn einfühlen kann? Oder ist integer, wer eine klare Meinung hat, wer zuverlässig ist? Oder derjenige, der bereit ist, sich für eine Idee zu opfern? Sie sehen, wir befinden uns in einem Bereich, wo eine abschließende Definition schwierig ist. Mancher Übeltäter würde mit der Bejahung dieser Fragen zum moralischen Musterschüler werden.
Ich möchte Ihnen dennoch eine Definition anbieten, die mir plausibel erscheint: Integer ist derjenige, der in seinem Sinn für das Gute unbestechlich ist. Was ist das Gute? Das Aufbauende, das Wohlwollende, das Verbindende, das Freundliche. Aber wir wollen hier nicht zu weit nach dem Himmel greifen. Begriffsdefinitionen sind etwas sehr Persönliches. Das heißt, die Bilder, die mit einem Begriff mitschwingen, sind sehr persönlich. Dennoch möchte ich festhalten: Moral ist ein Sinn, ein Instinkt. Sie ist nicht lernbar. Sie macht im Menschen einen Urtrieb aus, einen angeborenen Reflex, einen Charakterzug. Genau dies macht Moral interessant. Nicht alle haben diesen Sinn, diesen Instinkt identisch und gleich ausgeprägt.
Ich biete Ihnen eine weitere Definition an: Moral ist das Ureigenste im Menschen und daher für andere das Interessanteste an ihm. Wie steht es wirklich mit seiner Moral? Diese Frage will erkunden, wie es im Herzen eines Menschen aussieht. Es ist die Frage danach, was einen Menschen belebt, was ihn begeistert, was ihn erfüllt, was ihn antreibt. Es ist nicht die Frage danach, was einer sagt oder tut. Tun und sagen kann einer viel, je nach Situation. Die Frage nach der Moral ist eine Frage nach dem Antrieb, dem Motor, dem Lebenselixier. Sie verstehen mich sicher, wenn ich sage: Diese Frage wird kaum je eine eindeutige Antwort finden. Oder können Sie die Frage nach dem Antrieb in Ihrem Dasein sofort beantworten? Ist nicht die eigene Moral für jeden eine nicht immer klar zu fassende Angelegenheit? Treiben mich edle Motive an oder tendiere ich zu einer niederen Gesinnung? Für andere haben wir diesbezüglich Klarsicht. Aber für uns selber hegen wir ein Gefühl, eine Vermutung, wagen wir eine ungefähre Selbsteinschätzung. Wer bin ich? Wer weiß es genau? Und damit ist nicht gemeint: Chauffeur, Putzfrau, Lehrerin, Sachbearbeiter. Wer bin ich, was treibt mich an?
Natur und inneres Leben
Dies war die Frage, die ich mir stellte, als ich am Strand stand und in den großen, unendlichen, blauen Himmel über mir schaute: Wer war ich eigentlich und was suchte ich? Ich hatte Sehnsucht nach dem Süden, nach diesem Ort, der Halbinsel Giens. Warum genau? Was zog mich an? Viele Fragen. Und kaum gültige Antworten. Wenn ich sagen würde, es waren die Sonne, das Licht, das Meer, die Wärme, der Duft nach Rosmarin und Thymian, nach Pinien und Salz, dann wäre dies richtig, der Wahrheit entsprechend. Wenn ich ergänzen würde, eine heimliche Liebe, eine Begegnung? – Das wäre auch plausibel. Aber es war nicht so. Ich war allein mit dem Meer und den Möwen und dem ockerfarbigen, feuchten Sand unter meinen nackten Füßen. Ich war allein unter dem großen, blauen Himmel. Vor allem aber war ich alleine mit mir. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass dies keine angenehme Erfahrung war?
Was will er jetzt, werden Sie vielleicht fragen, trauert er um seine Sehnsucht? Der Sand unter den Fußsohlen, die Sonneneinstrahlung auf der Haut, das kühle, frische Meerwasser um den Körper, das ist Leben, das macht den Puls unseres Seins aus! Ja, natürlich, Sie haben Recht, zu einem großen Teil. Aber Leben erstrahlt nicht nur aus der Natur. Obschon die Natur eine unglaubliche Kraft hat. Leben muss auch innerlich sein. Was einen bewegt, gibt Leben. Nur, was innerlich Leben gibt, was inneres Leben ausmacht, ist nicht offensichtlich.
Ich hatte Sehnsucht nach dem Süden. Ich hätte auch Sehnsucht nach etwas anderem haben können, nach einem Menschen, nach einer Liebschaft oder Freundschaft. Ich hatte Sehnsucht. Das war die Hauptsache. Ich fühlte etwas. Da war inneres Leben. Etwas fühlen ist Leben und die Frage scheint mir berechtigt: Lebt man innerlich, wenn man nichts spürt? Wenn man nichts liebt? Wenn man nach nichts Sehnsucht hat? Ja, Sie haben Recht, ich trauere um meine Sehnsucht. Meine These: Man soll sich Sehnsucht erhalten für ein gutes Leben. Man soll etwas fühlen wollen. Man soll sich darum die Sehnsucht nicht zu erfüllen suchen, dem Objekt der Sehnsucht nicht nähern. Was bedeutet dies? Entsagung um des Fühlens willen. Entsagung für inneres Leben.
Wofür und wovon
Es geht um folgende Frage: Wovon lebt einer eigentlich? Die Frage lautet nicht, wofür er lebt. Wofür er lebt, kann jeder leicht beantworten. Einer lebt für eine berufliche Aufgabe. Ein anderer lebt für eine kreative Arbeit. Ich gebe Beispiele: Frau Denzler ist Sachbearbeiterin. Sie lebt für die tägliche Bearbeitung von Versicherungspolicen. Aber wovon lebt sie? Was treibt sie zu dieser Tätigkeit an? Ist es ein Kompliment ihres Vorgesetzten? Ist es die Freude an ihrer Kompetenz, an der gründlichen und seriösen Arbeit? Sind es Macht und Respekt, die man ihr dafür zollt? Ist es der tägliche Umgang mit Arbeitskollegen? Oder ist es ein gutes Salär? Die Antwort auf die Frage nach dem „Wovon“ wird uns eine Antwort geben auf die Moral Frau Denzlers. Aber wie gesagt: Eine Antwort auf die Frage des Antriebs, des Motors ist so einfach nicht. Oft ist sie unklar oder sie ist schmerzhaft oder vielleicht erschütternd schlicht. Sollte sich Frau Denzler zugestehen, dass sie über Jahre hinweg ihrer Arbeit nachkommt, um von ihrem Vorgesetzten Josef Kraus mit einem Kompliment und einem freundlichen Lächeln belohnt zu werden? Sollte sie sich zugestehen, dass eine gemeinsame Tasse Kaffee mit ihm jeweils freitags um 15 Uhr in ihrem Büro für sie einen emotionalen Höhepunkt bedeutet? Er setzt sich jeweils auf die Kante ihres Pults, ein Macho alter Schule, und plaudert ungezwungen mit ihr. Sollte sie sich zugestehen, dass ihr dies gefällt? Dass sie davon lebt?
Ein anderes Beispiel: Wofür lebe ich? Um solche Texte, von denen Sie gerade einen lesen, zu schreiben. Wovon lebe ich? Von der Hoffnung, dass Sie diesen Text lesen. Vom Wunsch nach Anerkennung. Nicht wahr, es ist doch ein entscheidender Unterschied, ob man nach dem „Wofür“ oder dem „Wovon“ fragt. Ein Physiker lebt für die Forschung zur Lagerung von Energie. Er lebt von der Anerkennung seiner Leistung. Vielleicht gar wird seine Karriere gekrönt mit dem Nobelpreis? Das „Wofür“ fragt nach der Arbeit, die einer erbringen will oder muss. Das „Wovon“ fragt nach etwas sehr Menschlichem: dem Bild, das einer von sich selber macht, bezogen auf andere. Dieses Bild entspricht der schlichten Aussage: Seht, dies habe ich für euch gemacht. Anerkennt mein Können und respektiert mich dafür.
Keiner arbeitet nur für sich. Kein Künstler erschafft seine Werke nur für sich. Kein Arbeitnehmer macht Karriere nur für sich. Immer, ohne Ausnahme, erbringt der Mensch eine Leistung bezogen auf andere. Er lebt für etwas, weil er sich davon eine Belohnung durch andere verspricht. Eine Leistung ist an einen sozialen Vorgang geknüpft. Sie finden dies zu einfach? Aber zeigen Sie mir einen Künstler, der ein Leben lang arbeitet ohne Anerkennung, ohne Erfolg. Ich kenne keinen. Wer nie Anerkennung bekommt, hört irgendwann auf mit seiner Arbeit oder er hört auf, seine Arbeit gut zu machen. Er wird sich sagen: Wozu soll es gut sein? Es bringt ja doch nichts. Es interessiert niemanden.
Wer bin ich? Ein Wesen, das etwas leisten will und von der Anerkennung dafür durch andere lebt. So wird meine Leistung legitimiert und dauerhaft.
Mentale und körperliche Empfindungen
Aber was bringen solche Selbstanalysen? Sie schützen vor Ratlosigkeit nicht. Denn als ich schließlich am Strand stand, ich hatte mich auf diesen Moment sehr gefreut, verlor ich die Orientierung. Ich hätte in jenem Moment nicht sagen können, wer ich war oder was ich wollte oder wovon ich lebte. Ich spürte den kühlen, feuchten Sand unter meinen Füßen. Ich tat ein paar Schritte zum Wasser hin, schließlich ins Wasser hinein. Ich schätzte seine Temperatur auf ungefähr 18 Grad. Die Sonne brannte mir ins Gesicht. Meine helle Haut erforderte die Applikation eines hohen Schutzfaktors. Dies hatte ich bereits im Zug erledigt. Ich dachte dann, wenn man der Schönheit und der Kraft der Natur nichts entgegenhalten kann, innerlich, wenn man leer und orientierungslos ist, wenn man ohne Vision lebt, ohne Sehnsucht, dann ist auch die Natur leer und nüchtern. Wo innerlich Leere ist, ist auch äußerlich Leere. Man projiziert seinen inneren Zustand in die Welt hinaus. Man kann die Welt nicht anders empfinden als so, wie man in sich selber empfindet. Somit wird die Welt zum Spiegelbild des Innern jedes Menschen. Und da kein Mensch dasselbe empfindet wie der andere, ist die Welt für jeden anders.
Die Rede ist hier von mentalen Zuständen oder Gefühlen, nicht aber von körperlichen Empfindungen. Körperliche Empfindungen sind das Einzige, was wir nicht aus uns hinausprojizieren in die Welt, sondern das uns die Welt erfahren lässt. Man spürt Wärme und Kälte, man nimmt Gerüche wahr. Man sieht Licht und Farben. Man hört Meeresrauschen und das Geschrei der Möwen. Ich kann Ihnen weitere Definitionen anbieten: Körperliche Empfindungen favorisieren ein geistiges Klima. Oder: Körperliche Empfindungen sollen genügen, wenn der Geist erschöpft ist.
Es schien mir dies in der Tat das einzig Sinnvolle, was ich tun konnte: die Natur annehmen, sie mit meinen Sinnen aufnehmen, mich den Gerüchen, den Farben und den Geräuschen hingeben. Man musste sich dafür selber ein Stück weit aufgeben. Aber dieses Aufgeben war eben gerade das, was gut tat. Man konnte vergessen und abtun und, beinahe willenlos, ganz im Moment leben. Ich musste dazu, ohne Leistungsdruck, bloß akzeptieren, was um mich herum geschah. Keine Beobachtungen mussten festgehalten, keine Schlüsse gezogen werden. Es ging darum, mich zu integrieren in die Landschaft, an ihr teilzunehmen, mich zurückzustellen und aus mir herauszuschauen.
Ich setzte mich für einen Augenblick in den Sand, fühlte die feinen Körnchen unter den Händen. Überall lagen kleine Muscheln, Hölzchen und Steine herum. Schließlich nahm ich meine Shorts aus dem Rucksack, zog mich um und ging für ein Bad ins Meer. Unter dem gleißenden Sonnenlicht tauchte ich ein in das kühle Wasser und ließ mich auf den Wellen treiben. Die prickelnde Frische tat gut.
Es fiel mir das Annehmen der Natur nicht schwer. Das mediterrane Klima ist für den menschlichen Körper wie geschaffen. Das Meerwasser hat eine angenehme Temperatur. Die Sonneneinstrahlung ist nicht zu stark, die Luft nicht zu heiß. Die Pflanzen, Sträucher und Bäume duften gut und wuchern nicht allzu üppig und dicht. Es ist eine gefahrlose, milde Natur. Sie hat nichts von den Extremen, wie man sie in den Tropen findet. Sag das mal einem Pernambucano oder einem Céarense, er solle die Natur einfach annehmen. Er würde sagen: „Wenn ich mich der Natur überlasse, bin ich bald ihr Opfer.“ Im Nordosten Brasiliens sind die klimatischen Verhältnisse extrem. Die Trockenheit, die Dürre und die Hitze sind lebensfeindlich. Die Sonneneinstrahlung ist brutal. Wasser ist knapp. Dort zu leben heißt: die Natur besiegen. Wenn sich die Brasilianer ihr kampflos ergeben würden, wäre der Nordosten des Kontinents unbewohnt.
Das Paradies kann man sich schwerlich im Hinterland Pernambucos vorstellen. Das milde und vegetationsreiche Klima Südfrankreichs ist dazu besser geeignet.
Ich ließ mich für einige Minuten auf der Wasseroberfläche treiben, schaute zur Sonne hinauf. Nein, ihre Einstrahlung war nicht brutal. Sie war kräftig, ja. Das Licht war intensiv, die Farben leuchteten. Die Luft war trocken und klar, somit auch die Hitze gut erträglich. Es war alles wohltemperiert. In dieser Landschaft lag eine gute, wohlbekommende Energie. Obschon das Land viele Probleme hat. Über Politik will ich nicht reden. Wenn ich über Politik rede, bewege ich mich wieder im Spekulativen. Es bliebe dann beim inkompetenten Ich-glaube-dass oder beim Ich-denke-man-sollte und so fort. Ein solches Palaver will ich mir ersparen. Ich sage nur so viel: Was Europa fehlt zurzeit, ist ein Philosoph vom Format eines Erasmus von Rotterdam. Politiker sind keine Philosophen. Philosophie aber wäre nötiger denn Wirtschaft und Politik, weil sie in der Ausstrahlung und im Einfluss in menschlichen Fragen mächtiger ist. Wenn man nach Persönlichkeiten Ausschau hält, die es richten könnten, die Gewicht haben, kommen nicht viele in Sicht. Fast alle begnügen sich in der Selbstdarstellung, im Marketing in eigener Sache, statt das kulturell Verbindende Europas zu betonen. Kultur, Bildung und Kunst haben das Abendland von jeher ausgemacht und verbunden, und nicht ein politischer Wille.
Aber ich lasse mich wieder von meinen Gedanken forttragen.
Bleiben wir im Süden. Sie waren in jenem Moment in der Sonne nicht spürbar, die Probleme Frankreichs, will sagen Europas. Die Landschaft lag strahlend um mich herum. Sie kannte keine Identitätskrise. Ich war froh, ja sogar dankbar für diese Sorglosigkeit, während ich mich in der Sonne trocknen ließ. Es war eine fast freche Sorglosigkeit, eine unerlaubte, musste ich eingestehen. Aber dies war wieder eine Empfindung, die ich in die Natur hinausprojizierte und die bewies, dass ich innerlich auf dünnem Eis ging, dass ich dem Frieden um mich herum nicht traute, da meine innere Energie erschöpft war. Hier war es möglich, die Batterien wieder aufzuladen, wenn ich es denn zuließ. Es zulassen konnte ich, wenn ich Gelassenheit übte, wenn ich nichts anderes wollte, als mein Leben durch die Natur bestimmen zu lassen, für eine beschränkte Zeit wenigstens.
Ein leichter Wind ging über den Sand. Ich schaute auf das Meer hinaus. Die Sonne stand bereits im Westen und leuchtete als große, feurige Scheibe in die breite Bucht auf der Westseite der Halbinsel. Goldgelb glitzerten die sich bewegenden Wellen in ihrem Licht. Ich konnte mich an diesem Funkeln kaum sattsehen. Es hatte etwas Beruhigendes, Einschläferndes, etwas Suggestives.
Mild lagen die Hügelketten am Horizont. Im Gegenlicht sah man nur ihre sanften Silhouetten. Einige Segelschiffe lagen vor Anker. Ab und an kam ein Flugzeug angeflogen vom Westen her, um auf dem Flughafen von Hyères zu landen. Es war alles so friedlich, schlicht und natürlich. Was hätte ich dem noch beifügen können? Es war nicht an mir, diesem Naturschauspiel noch etwas beizufügen. Wer war ich denn, ich, ein kleines Menschlein? Aber ist es nicht dies, was die Natur uns lehrt, wenn wir unsere Zeit in ihr verbringen: Wende dich ab von deiner Innenschau, Mensch, und siehe mich. Schaue in die Welt hinaus und werde froh darüber.
Zeit und Langeweile
Ich packte schließlich meine Sachen zusammen und tat ein paar Schritte am Strand entlang. Nicht weit von meinem Badeort entfernt erblickte ich eine Bar oder eine Art Strandbude, die kleine Imbisse offerierte. Ich setzte mich an einen Tisch unter freiem Himmel, bestellte ein Glas Weißwein und einen Teller frische Austern. Es war nun Abend geworden und die Sonne stand knapp über den Hügeln am Horizont. Bald würde die Nacht hereinbrechen. Der leichte Wind war kühler geworden. Wie aus dem Nichts überkam mich ein Gefühl der Beklemmung. Noch standen mir einige Stunden zur Verfügung, bis ich im Bett meines Hotelzimmers einen erlösenden Schlaf finden würde. Wie wollte ich diese Zeit verbringen? Es war mir klar, dass ich mit dieser Sorge wieder in ein altes Muster zurückfiel, das mich schon beinahe das ganze Leben begleitete: Mir steht Zeit zur Verfügung und ich leide unter dem selbstauferlegten Druck, mit dieser Zeit etwas Sinnvolles zu tun. Nur, was war sinnvoll? War sinnvoll, etwas zu lesen oder die Nachrichten zu schauen? War sinnvoll, einige Sternenbilder zu erkennen und den Mond zu betrachten? War es sinnvoll, in dem Hotelgarten zu sitzen und in die Nacht hinauszulauschen? War es sinnvoll, etwas zu notieren? War es sinnvoll, sich zu üben im Nichtstun? Ich weiß es heute nicht und ich wusste es an diesem Abend nicht. Das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß: Langeweile ist etwas vom Unangenehmsten, das der Mensch erfahren kann. Langeweile ist ein Gefühl, das alles Äußere öde macht und innerlich Beklemmung erzeugt. Natürlich ist sie eine mentale Empfindung, ein inneres Erleben, das auf die Welt projiziert wird. Die Welt ist nicht langweilig. Wir sind gelangweilt. Immerhin kann man sagen: Langeweile ist nichts Nachhaltiges. Sobald sie vorbei ist, ist sie vergessen. Aber dieses Wissen nützt nichts, wenn man Langeweile empfindet. Es lindert oder vertreibt sie nicht. Ich bin der Meinung, wer ein Mittel oder einen Weg entdecken will, sie zu eliminieren aus seinem Leben, muss sich mit sich selber gründlich auseinandersetzen.
Meine Definitionen: Wer meditiert und sich dabei wohl fühlt, kennt keine Langeweile. Wer keine Beklemmung empfindet beim Nichtstun, hat Langeweile überwunden. Es mögen dies banale Sätze sein. Wenn ich nichts tue, kein Schauspiel sich abspielt vor meinen Augen zu meiner Unterhaltung, wenn nichts und niemand Ablenkung bringt und ich mich wohlfühle dabei, das heißt in mir selber, ganz mit mir allein wohl bin, habe ich einen respektablen Grad an Gelassenheit erreicht. Ich muss zugeben: Ich bin noch nicht so weit. Vielleicht sind Sie es? Er ist erreichbar, dieser Grad, davon bin ich überzeugt, durch Eigenbeobachtung, durch Selbsterziehung.
Aber bleiben wir bei den Ereignissen: Statt nun meine Austern und den Wein zu genießen, überlegte ich fiebrig, was ich nun nach dem Abendessen tun sollte. Die Sonne war soeben untergegangen. Es wurde frisch. Die Luft war feucht. Es gab Mücken. Natürlich würde ich zuerst den Spaziergang zurück zum Hotel machen; er dauerte vielleicht 30 oder 40 Minuten. Danach verblieben ungefähr zwei Stunden, die ungeplant waren. Dann dachte ich an den kommenden Tag, was würde ich unternehmen? Eine Wanderung? Eine Schifffahrt? Ein Tag konnte lange sein, wenn er ohne Inhalt blieb.
Sie werden denken, der jammert auf hohem Niveau. Einem, der Stress hat wegen ungeplanter Stunden in seinen Ferien, ist nicht zu helfen. Ich kann es Ihnen nicht übel nehmen. So viel zu meiner Verteidigung: Schauen Sie genau hin, in Ihren nächsten Sommerferien, oder beobachten Sie Menschen in Ihrem Alltag. Ich bin kein Einzelfall. Ich behaupte: Der ihm frei zur Verfügung stehenden Zeit Sinn zu geben, ist eine der größten Herausforderungen für den heutigen Menschen.
Ein nächtlicher Spaziergang
Ich nahm also den letzten Schluck aus meinem Weinglas, bezahlte die Konsumation und machte mich auf den Weg zurück ins Hotel. Es war ein Spaziergang durch eine kühle Nacht. Ich hatte keinen Pullover dabei, trug immer noch Strandtenü. Die Straßenbeleuchtung war spärlich. Ab und an kam mir ein Auto entgegen und blendete mich mit Nebelscheinwerfern. Linker Hand befand sich das kleine, flache Binnenmeer, das beinahe die ganze Halbinsel ausfüllte. Aber in der Dunkelheit sah man es nicht, auch die zahlreichen Fischreiher nicht, die sich zu dieser Jahreszeit in ihm aufhielten. Rechter Hand, über der Straße, standen dichte Schilfwände, die Sicht auf die Lichter von Giens verdeckend. Ich begegnete kaum jemandem. Ein Fahrrad ohne Licht überholte mich. Schließlich kam mir eine Gestalt entgegen, mit einem Hund an der Leine. Mit einer Taschenlampe leuchtete sie auf den Gehweg, dann in mein Gesicht. Mir missfiel diese Geste. Ich ließ ein höfliches „Bonsoir“ verlauten, um der Person die unbegründete Furcht vor mir zu nehmen. Ein helles „Bonsoir“ kam zurück. Es war die Stimme einer Frau. Ich erreichte die besser beleuchtete Parallelstraße zur Hauptverbindung zwischen Tour Fondue und dem Festland. Sie war kaum befahren. Es befanden sich einige Liegenschaften an ihr, mit einem großzügigen Garten auf die Seite des Binnenmeeres hinaus. Es war eine sumpfige, feuchte Gegend. Ein Pizzabäcker wartete am Straßenrand vor seinem beleuchteten Wagen und rauchte eine Zigarette. Es gab keine Kundschaft. Ich überquerte die Hauptstraße beim Rondell und bog in die schmale Quergasse ein, die an den Strand auf der Ostseite der Halbinsel führte. Die Bade- und Surfboutiquen waren schon alle längst geschlossen. Die letzten Meter bis zum Hotel ging ich barfuß durch den Sand. In der Ferne waren die Lichter des Festlandes sichtbar. Der Mond stand tief über der Insel Porquerolles. Ich gelangte zum Hotel durch den Garten, trat ein in das helle Entrée, wo sich die Rezeption und das Hotelrestaurant befanden. Ich setzte mich an die Bar und bestellte einen Pfefferminztee, um mich aufzuwärmen. Im Hotelrestaurant waren kaum Gäste. Ein einzelnes Paar belegte einen Tisch in der Mitte des Saals. Im Fernseher neben der Theke präsentierte eine schlaksige Moderatorin das Wetter für die kommenden Tage: Sonne und Wind bei 25 Grad.
Entsagung und Liebe
Ich möchte nochmals auf das Thema der Entsagung zurückkommen: Was braucht man zum Leben? Man braucht nicht viel und tut sich einen Gefallen, immer weniger zu brauchen. Was will ich damit sagen? Wir müssen weniger Fantasien und Gelüste umsetzen und mehr nachdenken. Wir setzen besser nicht um, da die Umsetzung keinen Gewinn bedeutet. Ein Beispiel: Ich befinde mich in meiner Wohnung in Zürich und stelle mir vor, wie ich an der Hotelbar auf der Halbinsel sitze und einen Tee bestelle. In meiner Vorstellung male ich mir das Interieur der Eingangshalle des Hotels aus. Ich sehe den Fernseher neben der Theke. Vorne an der Rezeption steht ein Angestellter und kontrolliert die Abrechnungen für die Nachtessen. Das Paar erhebt sich vom Tisch in der Saalmitte, wünscht der Angestellten an der Bar eine gute Nacht und geht in Richtung Ausgang. Ich stelle mir dies alles genau vor. Wozu soll ich morgen den Zug nehmen, um es nachzuprüfen? Um es wirklich zu erleben? Was bringt diese Umsetzung?
Dasselbe galt für die Situation an der Hotelbar, und damit komme ich wieder auf die Langeweile zurück. Warum musste ich an jenem Abend etwas umsetzen? Warum konnte ich nicht einfach ruhig nachdenken? Resultierte die Langeweile nicht aus der Furcht, nichts umzusetzen zu haben, wenn man doch etwas umsetzen müsste? Entsagen meint: sich nicht durch Neugier treiben lassen, nicht sofort etwas umsetzen wollen. Es gut sein lassen. Das war der Satz, von dem ich spürte, dass er richtig war, als ich an der Hotelbar saß: Lass es gut sein. Du musst gar nichts. Wer nichts muss, hat keinen inneren Druck, ist frei, etwas zu tun, das er mag.
Es kommt ein Mensch auf die Erde. Er bringt sich ein, er tut gut daran, etwas zu lieben. Schnell wird er alt. Bald wird er sterben und vergessen sein. Das menschliche Schicksal ist kein komplexer Vorgang. Ich gebe eine Definition: Der Mensch hat keine Rechte, denn zu lieben. Wer etwas liebt oder gut findet, gibt seinem Dasein Sinn und Legitimation. Leben heißt, etwas lieben. Wer in der Entsagung liebt, liebt in der Vorstellung, liebt still für sich. Es ist eine „verinnerlichte“ Liebe. Liebe ist nicht Lohn der Entsagung, sondern die Entsagung ist ein Verlangen der Liebe.
Was konnte ich lieben? Was konnte ich lieben in diesem Moment an der Hotelbar? – Alles. Alles? Die Teetasse. Den Fernseher. Das Interieur des Hotels. Die Farben und das Material der Tische und Stühle des Hotelrestaurants. Den Moment, an der Bar zu sitzen, an diesem Ort zu sein. Die Erinnerung an den Nachmittag am Strand, in der Sonne und im Wasser. Mein Leben in solchen Gedanken zu verbringen. Überhaupt einen Gedanken zu haben. Alles. Auch das Gitarrensolo, zu dem Keith Richards soeben am Ende von Jumpin’ Jack Flash ansetzte, Stones in Uruguay im Februar 2016, eine Übertragung im französischen Fernsehen. Seine Gitarre wird lauter. Was tut er? Er schrammt das Riff, nichts weiter. Der Sound ist gut. Er schwebt leicht umher. Ist es wegen des Windes? Der Mann spielt das Riff minutenlang, fetzt den Akkord immer wieder neu. Dieser angezerrte Sound, eine wahre Freude, noch einmal schrammt er ihn. Man sieht, auch Charlie Watts hat Spaß. Auch er spielt gut. Richards Fender-Amps liefern den richtigen Ton. Und noch einmal zelebriert er das Riff. Das ist Leben, das ist Liebe. Nicht wahr, lassen wir es geschehen, das Gute im Leben, lassen wir es zu. Wir sollen nichts weiter.
Es geht um die Disposition, das Leben gutzuheißen. Liebe ermöglicht diese mentale Disposition. Ja, ich würde behaupten, nurLiebe ermöglicht sie. Lieben wir, alles andere ist Zeitverschwendung und Selbstquälerei.
Sonne
In einer einigermaßen aufgeräumten und freundlichen Stimmung zog ich mich schließlich auf mein Zimmer zurück, nahm eine heiße Dusche und legte mich hin. Ich schlief sofort ein.
Am nächsten Morgen freute ich mich auf ein rechtes Frühstück. Ich war einer der ersten Gäste am Buffet. Nebst frischen Croissants packte ich mir Käse, Joghurt, salzige Butter, Honig und Kaffee auf mein Tablett. Ich setzte mich an einen Tisch auf der sonnigen Gartenterrasse und ließ mir, gut gelaunt, Zeit für das Essen. Was wollte ich unternehmen an diesem sonnigen Tag? Ich entschied mich für eine Wanderung nach Polynesien, der Südküste der Halbinsel.
Zurück in meinem Zimmer, bepackte ich meinen Rucksack mit Badetuch und Shorts, Sonnenschutz, genügend Wasser und Äpfeln, die ich vom Buffet mitgenommen hatte.
Dann machte ich mich auf den Weg. Der erste Abschnitt ging am Oststrand entlang. Die Sonne stand schon hoch über dem Horizont und ließ die Wasseroberfläche funkeln und glitzern. Es gab kaum Wind und das Meer lag ganz ruhig da. Durch die schmale Quergasse, die ich am Vorabend schon genommen hatte, gelangte ich zur Hauptstraße nach Tour Fondue. Ich folgte ihr für einige Meter, dann ergab sich eine direkte Verbindung zum Eingang Polynesiens. Es war der alte Weg nach Tour Fondue, ein autofreies Sträßchen zwischen den Bäumen, Wiesen und Gärten einiger wenigen Villen. Es war angenehm warm, nicht heiß. Die Luft war trocken und klar. Es duftete nach frisch geschnittenem Gras, Thymian und Rosmarin. Einige Zikaden sangen bereits. Ich ging auf diesem Sträßchen ohne Hast und Eile. Der Asphalt blendete im Sonnenlicht. Die Schatten der Bäume waren bereits kurz. Bald schon würde die Sonne senkrecht am Himmel stehen. Ich ging also auf diesem Weg. Ich war innerlich immer noch in der freudigen Stimmung des Vorabends. Es war, als wäre es eine