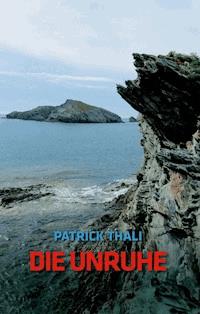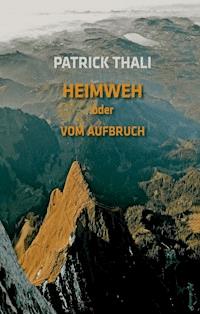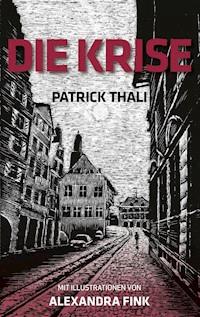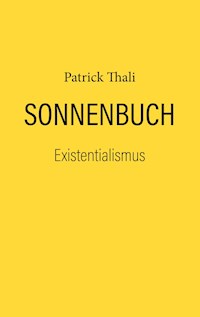
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sonne ist das grösste Abenteuer für den Menschen. Auch eine mentale Kraft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen geliebten Papa Bruno Thali
1938–2018
Weil es so schlicht ist, schlicht und wahr.
INHALT
Vorwort
Der Existentialist
Existentialismus
TEIL I BRÜCHE
Ethik
Die Verachtung
Dunkelheit
Das Geheimnis
Die Beugung der Angst wegen
Macht und Ohnmacht
Ernüchterung
Vom Schicksal
Innere und äussere Wirklichkeit
Von der Nützlichkeit
Eingliederung
Gefangen
Einordnung und Unterordnung
Willkommen zurück in der Farblosigkeit
Lassen wir Blumen blühen
Musikalische Kräfte
Von musikalischen und menschlichen Mächten
Machtgefälle
Machtstärken
Die Sitzung
Wahrheit
Licht und Entfremdung
Leichtes Spiel
Vom Stürzen
Ausverkauf
Schicksal und Selbstbestimmung
Mögliches und Unmögliches
Bonjour Tristesse
Höderers Büchlein
TEIL 2 SONNE
Offene Fragen
Natur und Geist
Das Wetter
Steine und Felsen
Das Geständnis
Sommerlied
Handlung im Affekt
Der Sonnenanbeter
Metaphysik des Lichts
Sommer in der Stadt
Sonnenlied
Macht und Freiheit
Zelebrieren
Reisen
Abendlied oder von der Vergänglichkeit I
Am Abend
Lichtverhältnisse I
Goldinseln
Lichtverhältnisse II
Brüche
Herbstlied oder von der Vergänglichkeit II
Verinnerlichung
Vom gut gemachten Werk
Die Bäume haben ihr Laub verloren
TEIL 3 E WIE ENTFREMDUNG UND EXISTENTIALISMUS
Geister entzünden
Philosophie
Freiheit
Metaphysik
Oppositionelles Denken
Determinismus
Persönliche Macht
Modernität
Der ganz normale Wahnsinn
Entfremdung
Machtmoral
Im Dienst der Gesellschaft
Leistung
Realität
Flucht
Was uns belastet
Von einer Unfähigkeit
Realitäten
Philosophen
Gesichter
Fremdbestimmung und Opposition
Sozialisation und Moral
Humanismus
Körper und Technik
Nietzsche, Horkheimer und Foucault
Im Buchladen (bei der Wahl eines Buches)
Sich einen Namen machen
Falsche Welt
Oppositionen
Kunst und Geld
Inspiration und Pragmatismus
Die unvoreilige Versöhnung
E wie Entfremdung und Existentialismus
Schlusswort
VORWORT
Lichtverhältnisse
Die Sonne und das menschliche Denken. Wir können diesen Zusammenhang kaum je abschließend behandeln.
Die Sonne ist das größte Abenteuer für den Menschen. Auch eine mentale Kraft.
In der Sonne sind wir ruhig. In der Sonne sind wir dort, wo uns die Unruhe hintreibt. In der Sonne können wir gut arbeiten, wir sind durch nichts mehr abgelenkt. Erst in der Sonne sind wir der Welt nahe, sind wir ganz bei uns.
Der Vorteil einer Stadt, die nicht zu hoch gebaut ist: Es gibt Licht in ihren Straßen, es ist hell. Wo Licht ist, werden menschliche Verhältnisse nicht überschätzt.
Licht ist stärker als persönliche Sorgen oder Ambitionen, es gibt dem folgenden, schlichten Gedanken Berechtigung:
Mensch, du musst nicht verzweifeln! Gehe in die Sonne! Lege im Licht dein Hadern ab.
Die Spannung aufzuzeigen zwischen einem Individuum und der Gesellschaft bringt nicht viel. Jeder hat diese Spannung in sich und muss mit ihr leben. Eine positive Botschaft zu vermitteln, bringt etwas. Eine positive Botschaft? Das Aufzeigen einer Lösung, eine Bejahung der Umstände, des Annehmens des eigenen Schicksals. In etwa so: Ich gehe in der Sonne und ich kann dieses Gehen in der Sonne genießen; es versteckt sich darin keinerlei Form von Ressentiment.
Sommer 2019
PATRICK THALI
DER EXISTENTIALIST
Der Existentialist ist nicht immer souverän. Er hat Ängste und Sorgen wie alle. Aber er verneint seine Malaise nicht. Er will sie orten, einkreisen und benennen. Er will Tabus brechen. Und er bricht sie, indem er sich ihrer annimmt und sie bezeugt. Er gibt damit seinem Leben eine „positive Drehung“ und Dynamik.
Der Existentialist bejaht sein Leben. Der Akt des Bezeugens belebt ihn. Er greift damit in die Geschehnisse ein und vermag so, seine persönliche Macht zu konsolidieren.
Er stand an der frischen Luft und rauchte eine Zigarette. Ich gehöre zu jenen, die aus ihrer Liebhaberei eine Dauerbeschäftigung machen wollen, dachte er, aber ohne rechte Entschlossenheit und wirkliches Talent. Für einen Moment fühlte er tiefe Müdigkeit in sich. Was soll daraus resultieren? Er schaute dem Räuchlein nach, das in der Kälte nach oben entschwand. – Reibung. Reibung resultiert daraus, mit allem, dachte er dann.
Und das war vielleicht etwas.
Ob wir stärker geprägt sind durch Erbgut, oder die Umwelt, oder eine Willensbezeugung, ist eine intellektuelle Auseinandersetzung mit menschlichen Lebensbedingungen, die in vier Wänden stattfindet, wo frische Luft fehlt. Bei einem Spaziergang an der frischen Luft dämmert uns auf, dass es doch darum geht, durch eine Willensbezeugung dem eigenen Dasein Glanz zu verleihen, das ansonsten bloß durch Erbgut und Umwelt geprägt bliebe.
Der Himmel über ihm war bleiern und dicht bewölkt. Und dann, während er den Stummel seiner Zigarette im Aschenbecher ausdrückte, setzte Nieselregen ein.
Drinnen notierte er:
Was er muss, und was er nicht muss, auf Erden, darüber kann ein jeder nur vor sich Rechenschaft ablegen.
Aber dies sollte er möglichst lange tun, der Mensch: mit seinen Beinen auf der Erde gehen. Das kann er später nicht mehr.
Und weiter notierte er:
Gehe in die Natur, immerzu, über Asphalt, Stein und Felsen.
EXISTENTIALISMUS
Dass wir den Willen haben, an das Ewige in unserer Realität anzurühren.
Im Mai, Juni, Juli oder August, wenn die Sonne herunterbrennt und blendet, wenn ihre Einstrahlung massiv ist, die Hitze akut, beinahe unerträglich, am Nachmittag, zwischen lärmenden Autos, aufgeheizten Hausmauern und Straßen, Beton und Asphalt, wenn der Schweiß uns aus den Poren quillt und in die Augen läuft, wenn die Augen brennen vom Schweiß und dem Ozon, erst dann erreichen wir die maximale Nähe zur Welt; dann ist auch der Sonnenstand der höchste.
In dieser Sonne möchten wir bleiben, so lange als möglich, und unsere Kräfte ins Maximale treiben. Und wir können sie nur hier ins Maximale treiben, denn nirgendwo sonst sind wir mehr zuhause. Die Sonne ist uns Heimat.
Unser größtes Verschulden besteht darin, dass wir hier falsch priorisieren, weil wir dies nicht immer klar sehen: Wir gehen nicht in den Schatten, um uns vor der Sonne zu schützen. Wir gehen in den Schatten nur, um sogleich wieder in die Sonne zurückzukehren.
Über den hellen Asphalt gehst du. Setzest Fuß um Fuß. Schwarz, hart und schnell bewegen sich die kurzen Schatten deiner Schuhe in der Geschwindigkeit deines Gangs. Das Licht blendet, du kannst deine Augen kaum offen halten. Sie sind die Dunkelheit des Fabrikinnern gewohnt. Die Sonne, deine Schritte unter der Sonne, sind Bezeugung deiner Existenz. Du siehst die Dinge und du nimmst sie an.
Am Abend gönnst du dir eine Suppe auf einer Terrasse. Es ist ruhig in der Straße, die Geschäfte haben bereits geschlossen. Aber die Sonne brennt noch immer mit voller Kraft. Noch steht sie hoch am Himmel. Ihr hartes, helles Licht ist intensiv. Dir steht der Schweiß auf der Stirn. Es ist genau so, wie du es für richtig befindest. Dein Dasein kannst du gänzlich gutheißen.
Du bist Existentialist.
TEIL I
BRÜCHE
ETHIK
Es ist die Macht über sich selbst, welche die Macht über die anderen reguliert.
MICHEL FOUCAULT
Wenn wir uns um uns selber kümmern, kümmern wir uns um die anderen und haben zu ihnen ein richtiges Verhältnis. Wenn wir über uns selber nachdenken, sehen wir ein, dass ein Erwerb oder ein Erobern von Macht über andere, das Schaffen eines Abhängigkeitsverhältnisses zwischen uns und ihnen nichts Positives in das Leben aller Beteiligter hineinbringt. Es entspricht nicht unserer inneren Realität oder unserer Wahrheit. Die Freiheit der anderen und unsere Freiheit zu bewahren entspringt unserer Einsicht, dass nichts es sich lohnt und dass es keinerlei Vorteile oder Verbesserungen bringt, jene zu ersetzen durch etwas anderes. Freiheit ist das Beste, was es zu leben gibt, für alle.
(Ob wir Freiheit wirklich leben können, ist wieder etwas anderes. Wir reden hier von unserer Lust, unserem Willen zur Freiheit.)
Indem wir den anderen in Ruhe lassen, verschaffen wir uns selber Ruhe, so könnten wir es auf eine Formel bringen. Jenen aber, die uns nicht in Ruhe lassen, die unser Frei-sein-Wollen nicht respektieren, weil sie sich zu wenig oder gar nicht um sich gekümmert haben – privat und als Angehörige von Institutionen –, sollen wir resolut entgegentreten.
Oppositionelles Denken, wie wir es hier verstehen, nährt sich am Erleben solcher Übergriffe, solcher Einbrüche in unsere Freiheit und die Freiheit anderer. Oppositionelles Denken ist auch eine Ethik, nämlich die, unsere Freiheit zu verteidigen und daraus einen Auftrag fürs Leben zu formulieren.
Auf einer politischen Ebene eröffnen sich uns diesbezüglich keine Möglichkeiten; künstlerisch allerdings wohl. Diese Schrift ist Zeuge davon.
DIE VERACHTUNG
Eine positive Bewegung in unsere Abhängigkeit werden wir hineingeben, wenn wir die Verachtung unseres Lebens ablehnen.
– I –
Juli
Dann hörte ich Werner Höderers helles, ein wenig flaches Lachen an der Kasse. Er war also wieder hier und hatte sich, ich sah flüchtig hin, einen Teller mit Brot und Butter und Kaffee auf das Tablett aufgeladen. Er verstand sich gut mit der Kassiererin.
Gestern hatte er gefehlt. Seine Tochter feierte Geburtstag und er, der Papi, hatte wohl den Auftrag, das Fest vorzubereiten. Bei Höderer hatte ich überhaupt das Gefühl, die Familie gehe vor. Was der immer für Erklärungen brachte, warum er spontan den Arbeitsplatz verlassen müsse. Seine Frau sei krank, sie habe Grippe. Dann sind seine Kinder krank oder sie haben Geburtstag oder der Kleinste hat sich beim Velofahren das Knie aufgeschürft oder es brennt in der Nachbarschaft. Immer muss der Papi nach dem Rechten schauen, die Familie beschützen, einen Transport zum Arzt organisieren oder die Kinder und seine Frau irgendwohin fahren.
Höderer brillierte durch Absenz. Es mussten Arbeitskollegen für ihn einspringen, die wiederum ihren Zeitplan spontan dafür umkrempelten. Das war auf die Dauer ärgerlich und eine Belastung. Wenn ich der Chef wäre, würde ich einmal ein Machtwort sprechen, dachte ich. Diese spontanen Sondereinsätze waren einem guten Arbeitsklima nicht förderlich. Höderer hatte deswegen in der Firma auch wenig Freunde, was ihn allerdings kaum zu belasten schien.
Mich ärgerte seine Priorisierung. Aber ich konnte sie irgendwie auch nachvollziehen. Sie war mutig. Die Familie hatte Vorrang, jederzeit. Das war eine edle, eine aufrichtige Haltung. Für die Familie würde Höderer vielleicht gar den Job hinschmeißen. So etwas würde ich mich nie getrauen. Bei mir ging der Job vor. Nicht, weil er mir gut gefiel. Aber ich und meine Frau waren abhängig von meiner Arbeit. Sie war unsere Existenzgrundlage. Warum sollte ich sie leichtfertig aufs Spiel setzen?
Der Job war auch Existenzgrundlage bei Höderer und seiner Familie. Und dennoch verhielt er sich, als wäre es nicht so. Das irritierte mich. Sein Verhalten war mutig, es war frech.
Höderer war in meinen Augen einer, der sich viel Freiheit herausnahm, unverschämt viel. Und er tat dies völlig selbstverständlich, als wäre nichts dabei. Ich kam mir neben ihm unbeholfen vor, zu angepasst, zu ängstlich. Ich empfand mich als bieder und übertreu, als einen, dem es an Wagemut und Unverfrorenheit ermangelte. Seine Direktheit überforderte mich, zumal er kein Blatt vor den Mund nahm.
Einmal kam es zwischen uns zu einem kleinen Wortgefecht, einem kleinen Schlagabtausch, der mich noch im Nachhinein beschäftigte. In einem Kontext, dessen Einzelheiten mir entfallen waren, ließ ich die wenig reflektierte Bemerkung fallen, ich sei halt auch nur ein Mensch. Höderer reagierte darauf sofort. „Zu sagen, ich bin auch nur ein Mensch, ist so ziemlich die billigste Art, nicht zu seinen Schwächen zu stehen“, sagte er. Im ersten Moment war ich ob dieser markigen Bemerkung erschrocken. Ich empfand sie als unnötig aggressiv. Sie war schonungslos offen und direkt. Aber ich musste mir eingestehen: Er hatte Recht. Seine Aussage war richtig. Ich verbannte fortan die Floskel aus meinem Vokabular und achtete darauf, vor Höderer keine Belanglosigkeiten zu schwatzen. Ich wollte mir nicht unnötig die Finger verbrennen.
Werner Höderers helles Lachen erklang erneut. Immer noch stand er an der Kasse. Ich schenkte der Szene für einen Augenblick meine vollste Aufmerksamkeit. Hinter ihm wollte schon eine ganze Traube Leute ihr Pausenbrot bezahlen. Er schien sich dadurch nicht beirren zu lassen. Er war ein unverschämter Kerl, anders konnte ich es nicht benennen.
Schlimm wäre es aber erst, wenn er falsch wäre, dachte ich dann. Unaufrichtig. Doch gerade diesen Angriffspunkt bot er nicht. Nichts tat Höderer heimlich. Die Sache mit der Kassiererin war offensichtlich. Sie dauerte schon eine Weile. Wie weit die beiden gingen, privat, wusste ich nicht. Aber so, wie sie sich soeben anlachten, war da zweifellos eine große erotische Energie vorhanden. Ja, ich übertreibe nicht, wenn ich sage: ein erotisches Blitzgewitter entlud sich soeben zwischen den beiden. Aber nie, keine Sekunde, hatte Höderer daraus ein Geheimnis gemacht. So selbstverständlich, wie er den Arbeitsplatz verließ für die Familie, so natürlich flirtete er mit der jungen Angestellten an der Kasse herum. Es war nichts Falsches, nichts Heimliches und Verstecktes darin. Er nahm andere beim Wort und er war offensiv. Weder Unterdrückung noch Perversion waren an Höderer festzustellen. Nicht der leichte, dunkle Hinterweg, das schmierige Arrangement waren seine Sache, sondern Offenherzigkeit und Direktheit. Der Mann sagte, was er wollte, und er holte sich, was er brauchte. Dies, das musste ich neidlos anerkennen, war ein durchaus akzeptabler und sauberer Charakterzug.
– II –
Mein Arbeitsweg führte von meiner Wohnung in der Selnau über die Stauffacherbrücke zur Tramhaltestelle am Stauffacher. Das kurze Stück Fußweg, an der Sihl entlang, genoss ich im Sommer besonders, wenn die Sonne bereits in der Frühe am Himmel über dem Zürichberg stand und in die Stadt hineinschien.
Heute Morgen verharrte ich für einen Moment am Ufer der Sihl und sah auf den Fluss hinunter. Friedlich floss er im Sonnenlicht Richtung Hauptbahnhof. Das Wasser war klar und transparent. Kniehoch und saftig stand das Gras auf der rechten Seite des Flussbettes. Auf dem Dach des ehemaligen Elektrizitätswerkes, gegenüber, sang ein Vogel. Es atmete eine ruhige und angenehme Atmosphäre, dieses Stück Natur inmitten der Stadt.
Doch etwas in mir drin stimmte nicht. Ich sah die Sonne nicht. Ich sah sie nicht vollständig, war ihr nicht wirklich nahe. Irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht, dachte ich. So, wie man gelebt hat, wird es einst ans Licht kommen.
In der Münzendruckerei beim Farbhof arbeitete ich schon viele Jahre. Kaum sah ich während der Arbeit Tageslicht. Vielleicht kam es daher, dass ich nicht zur Sonne hin gelangen, sie nicht erreichen konnte, weil ich sie aus meinem Alltag ausgeschlossen hatte. Ich wusste nie, wie das Wetter draußen war. Es plagte mich dieses Abgeschnittensein von der Natur. Das Wetter war mir wichtig. Es war, so fühlte ich, meine Verbindung zur Welt.
Aber wie sollte ich, der ich täglich viele Stunden im Neonlicht verbrachte, in wenigen Minuten auf meinem Morgenspaziergang eine Verbindung aufbauen zur Sonne? Zu kurz war die Zeit dazu und zu lang war sie nachher, in der lichtarmen Isolation.
Heute, am Sihlufer, kam es mir vor, als hätte ich mich versündigt an der Natur. Ich gab ihr zu wenig Gewicht in meinem Leben. Darum war ich nicht beteiligt an der Welt, war ich nicht ganz in ihr angekommen. Ich hörte den Vogel pfeifen auf dem Dach des Gebäudes gegenüber, ich sah das Glitzern des fließenden Wassers im Licht, doch ich war getrennt von allem, war nicht Teil dieses Geschehens. Es passierte alles an mir vorbei.
Ich gelangte schließlich zum Stauffacher, nahm, wie immer, das 2er-Tram Richtung Farbhof. Es war alles ein Ritual. Nichts Außergewöhnliches trat ein. Und so fand ich mich, wie immer, gegen 7 Uhr am Haupteingang zur Firma. Ich öffnete die Drehtüre mit dem Badge, den ich in meiner linken Hosentasche trug.
Ritual und Routine prägten mein Leben. Ich hatte lange Zeit nicht wahrhaben wollen, dass ich es mir damit einfach machte. Es gab auch stets gute Argumente dafür, die mich entlasteten: Sicherheit für die Familie, die Kinder, meine Frau. Ich hatte zwei Söhne. Der eine war gerade Vater geworden und ich war nun Großvater. Gestern war ich 58 geworden. In vier Jahren wollte ich mich pensionieren lassen. Ich freute mich auf die Zeit nach der Arbeit. Aber ich musste zugeben, ich war nicht wirklich gut vorbereitet darauf. Zu lange, zu viele Jahre hatte ich mein Leben vor mir hergeschoben, hatte ich meine Priorisierung auf die Sicherung der Versorgung gelegt. Nie hätte ich es gewagt, meinen Job an den Nagel zu hängen, oder etwas anderes zu machen, oder die Welt zu bereisen in meinen jüngeren Jahren. Ich hatte nie Ansprüche gestellt oder aufbegehrt. Ich hatte stets einen persönlichen Gewinn dem Wohlergehen der Familie hintangestellt.
Jetzt, da meine Frau und ich alleine waren, war ich mir nicht mehr sicher, ob diese Strategie noch aufging. Ich hatte mich geopfert für Sicherheit, so kam es mir vor. Ich hatte ein persönliches Weiterkommen verachtet, ich hatte damit mein Leben verachtet. Ich nutzte meine Zeit kaum sinnvoll.
Nur, es brachte nichts, bitter zu sein oder mit dem Leben im Nachhinein, dann, wenn es zum großen Teil schon gelebt war, zu hadern. Die Zeit war vorbei. Ob man sie verschwendet oder gut genutzt hatte, wusste man dann genau. Man muss das Leben, das man haben will, in jungen Jahren einleiten, dann, wenn man das eigene Schicksal noch formen kann.
Wer sich in einem Provisorium einrichtet, dachte ich, wer vor sich hin lebt, macht sich zum Opfer und scheitert am Leben. Ich hatte keine Zweifel an der Richtigkeit dieses Satzes. Früher hätte ich darüber gelacht. Nein, ich hätte nicht darüber gelacht. Ich hätte abgewinkt und gesagt: „Schon gut, ich habe Verpflichtungen, ich muss schauen, dass etwas auf den Teller kommt.“
Höderer traf bei mir einen wunden Punkt. Er gehörte einer Generation an, die ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag legte. Auch er musste zuschauen, dass etwas auf den Teller kam. Er hatte seine Verpflichtungen gegenüber seiner Familie, aber er schaute und sorgte auch dafür, dass er auf einer persönlichen Ebene nicht zu kurz kam. Höderer war souverän, hatte ich den Eindruck. Er hatte sein Leben im Griff. Im Grunde beneidete ich ihn darum. Dass ich souverän war, hätte ich nicht behaupten wollen. Immerhin, damit konnte ich mich ein wenig entlasten, hatte ich ein Sensorium entwickelt für die Thematik.
– III –
Noch ein verliebtes Lächeln im Gesicht, setzte sich Höderer schließlich an meinen Tisch und sagte: „Salut, Hanspeter, alles klar?“
„Ja, ja“, sagte ich.
„Geht’s dir nicht gut? Siehst müde aus.“
„Es geht.“
„Nimm es doch gelassen, Hanspi. Es hat doch keinen Sinn, hier zu leiden“, sagte er und biss herzhaft in eine Brotschnitte.
„Sehe ich so schlecht aus?“, fragte ich.
„Nein. Aber du scheinst besorgt, bedrückt. Letzthin habe ich irgendwo gelesen: Wer viel lacht, ist glücklich, und wer viel weint, ist unglücklich. Ich finde diesen Satz gar nicht so schlecht. Er sagt: Dein Glück liegt allein in dir und nicht in den Umständen.“
Hört, hört, auch noch Philosoph, unser guter Höderer, dachte ich zuerst.
Aber auch diese seine Aussage war, wenn auch ein wenig lapidar, so doch nicht falsch. Sie ist sogar, bei näherer Betrachtung, ziemlich kühn, dachte ich dann. Sie sagt: Du allein bist für die Qualität deines Lebens zuständig. Und nichts Äußeres kann diese verringern oder vergrößern.
„Alles ist eine Frage der Einstellung, oder, Werner? Dies willst du doch sagen“, sagte ich.
„Ja. Natürlich. Und diese hängt nur von dir ab. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich empfinde das Leben als Kampf. Unsere Bedingungen sind roh und grob, gar brutal. Sie sind es für alle. Unser Kampf ist aber nicht gegen sie gerichtet, sondern gegen die eigene Schwachheit, gegen die Resignation. Ich will nicht Opfer sein meiner Mutlosigkeit. Ich will souverän bleiben.“
„Ja, das glaube ich dir, das merkt man.“
„Hast du ein besseres Mittel für eine brauchbare Lebensbewältigung? Komm mir nun bitte nicht mit Anstand, Bescheidenheit, Anpassung und solchem Zeugs. Wir müssen nicht gefallen. Es bringt nichts, glänzen zu wollen. Wir passen uns damit zu sehr der Umwelt an.“
„Nein, nein, Werner. Ich bin absolut einverstanden. Ich habe dies nur nicht immer klar sehen können für mich.“ Ich hörte mich selber reden, bemerkte die Feigheit in meiner Stimme.
„Hanspi. Das höchste Glück für uns Erdenkinder ist, eine Persönlichkeit zu sein. Und das ist von Goethe und nicht von mir. Es liegt an uns, eine Persönlichkeit aus uns zu machen. Eine Persönlichkeit leidet nicht an den Umständen, sie hat Kraft genug, den Umständen entgegenzutreten.“
Höderer ist also belesen, dachte ich. Dies konnte ich von mir nicht behaupten. Er interessierte sich für die Welt. Ich war gefangen in meiner Malaise.