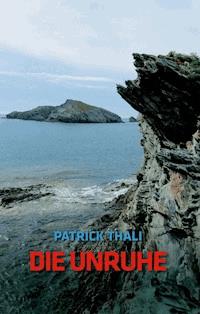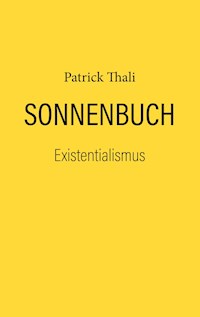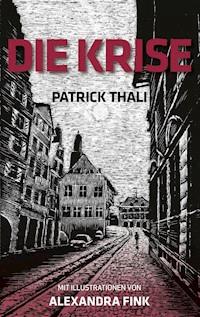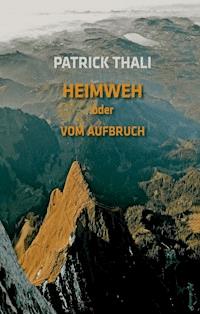
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im dritten Buch seiner Trilogie "Der Süden oder die Traurigkeit, die nie mehr verging" beobachtet Patrick Thali Menschen bei der täglichen Arbeit. Modernste Technik scheint manche zu überfordern und sie stossen dabei an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Eindringlich - ohne zu bewerten und ohne zu verurteilen - schimmert ein tiefes Mitgefühl des Autors für ihre Schwächen durch und lässt die Leser stille Zeugen von dramatischen menschlichen Schicksalen werden. Der Autor bewegt sich selbst inmitten dieser Schicksalsgemeinschaft der Stadt Zürich, beschreibt den äusseren Schein und die inneren Nöte der heutigen Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Es fehlt ‚in unserer innersten Seele‘, möchte ich sagen,an farbigen Bildern: das ist unser Übel.Und unsere Entscheidung ist das: welchen Weg wir,diese farbigen Bilder zu erlangen, einschlagen.“
Ludwig Hohl, Nuancen und Details
Inhaltsverzeichnis
HEIMWEH
BEOBACHTUNGEN
VOM AUFBRUCH
DIE KUNST DER UNBESTECHLICHKEIT
Vorwort
Die meisten von uns leben in Fremdbestimmung. Wir finden uns damit ab, da wir unseren Platz in der Gesellschaft sichern wollen. Ein Leben in Fremdbestimmung aber kommt einer schleichenden Selbstzerstörung gleich. Unsere Aufgabe ist nicht die fraglose Angliederung an die Gesellschaft, sondern die Distanzierung zu ihr, um ihr unser Eigenes anzubieten.
Es ist mir nicht entgangen, dass sich die Inhalte einiger Sätze, in anderer Formulierung, wiederholen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf Satz 3.22 der Kunst der Unbestechlichkeit verweisen, der den Grund für die Wiederholung benennt:
„Die mentale Verfassung eines Menschen wird nur dann deutlich, wenn er Weniges immer wieder sagt. Was er sagen will, das Wenige, das er zu sagen hat, muss er immer wieder neu sagen. Er muss dies tun, um seine eigenen Worte neu zu beleben. Denn seine Worte verblassen eigenartig schnell in seinem Empfinden. Er will sie neu beleben, aber auch genauer, deutlicher formulieren, um ihren Wert zu steigern, um seine eigene Arbeit zu steigern. Darum sagt, wer etwas sagen will, immer wieder Gleiches. Um etwas anderes zu sagen, müsste er ein anderer Mensch sein.“
Ermutigung soll sie sein, diese Schrift, in dir nach einer Aufgabe zu suchen, die dir ein gutes Verhältnis zur Welt ermöglicht. Möge sie dich zur Freude hinführen.
Mai 2015
Patrick Thali
HEIMWEH
Sabotage
„Nicht nur Verdienst, auch Treuewahrt uns die Person.“
Goethe, Faust II
Ich stand in der menschenleeren heiligen Kapelle in Paris. Die goldenen Lilien, das königliche Blau und das warme Rot der hohen Fenster leuchteten würdevoll im hellen Sonnenlicht. Sie tauchten das Kapelleninnere in einen edlen Glanz. Irgendwo ertönte ein Glöcklein oder ein Triangel. Dann hörte ich Meeresrauschen. Es wurden Schiffe beladen. Ihre weißen Segel trugen Wappen in den Farben Gold, Blau und Rot. Festlich blähten sie sich im Wind. Vor mir, bis zum Horizont, lag das Mittelmeer. Die weißen Schaumkronen der Brandung kontrastierten wunderschön mit dem hellblauen Himmel. Dann ertönte wieder der Triangel der heiligen Kapelle, der in langsamen, aber regelmäßigen Schlägen etwas anzukündigen schien. Er wurde immer lauter.
Ich erwachte mit dem pulsierenden Laut des Radioweckers. Das beleuchtete Ziffernblatt zeigte fünf Uhr. Es war Zeit, aufzustehen.
Im Bus saß Frau Bogner an ihrem Fensterplatz. Auf ihrem Schoß trug sie ihren kleinen roten Rucksack mit dem Mittagessen, bestehend aus einem Stück Käsekuchen, zwei Äpfeln, etwas Schokolade und einer Plastikflasche mit kaltem Tee. Ich kannte den Inhalt ihres Gepäcks, da sie, täglich, um 11.30 Uhr, am hintersten Tisch des Pausenraumes unserer Firma ihre Esswaren ausbreitete und sie langsam, bedächtig und alleine zu sich nahm. Frau Bogner war eine einsame Frau, eine Einzelgängerin, die mit niemandem aus der Belegschaft freiwillig ein Wort wechselte. Beinahe zärtlich hatte sie ihre Arme um den Rucksack gelegt und schaute mit ihren traurigen, ein wenig verschwollenen Augen aus dem Fenster. Es machte mich jeden Morgen betroffen, diese Augen zu sehen. Sie schienen Leid hinausschreien zu wollen, ohne wirklich zu schreien. Frau Bogners Augen schrien stumm. Ich nahm diesen Ausruf deutlich wahr. Er war der Ausdruck von tiefer Verzweiflung ob eines einsamen Lebens in Resignation. Unübersehbar hatte Frau Bogner resigniert. Sie lebte ihr Leben in Monotonie, wie viele andere auch, von Tag zu Tag, ohne etwas Bestimmtes noch zu erwarten. Ich dachte dann, dass der Gehorsam zu funktionieren – nichts anderes ist doch Resignation – nur durchbrochen werden kann, wenn man etwas zu benennen weiß, wofür man leben will, etwas, das einem die Sehnsucht nach Leben erhält. Denn die Gefahr der Resignation ist die: Wenn wir die Kraft oder den Willen nicht mehr aufbringen, ein letztes Stück Unabhängigkeit uns zu erhalten, eine Vision eines uns möglichen Lebens, werden wir allmählich sterben, innerlich. Ein resignierter Mensch ist ein lebender Toter, einer, der dem Leben abgesagt hat. Frau Bogner ist noch nicht ganz tot, dachte ich, noch schreit es in ihr, noch schauen ihre Augen verzweifelt, noch fühlt sie etwas. Die Frage war: Wie lange noch? Ich nahm eine Tageszeitung und begann zu lesen.
Kurz nach dem Produktionsstart um sechs Uhr fielen die ersten Störungen an. Ich hatte kaum den Becher Kaffee ausgetrunken, als mein Betriebshandy klingelte. Es war Hofer, mein Vorgesetzter. Ich nahm ab. „Tag, Herr Steiner, die Betriebsleitung ist schon ziemlich nervös! Ausfall in der Verpackungsabteilung. Wo sind Sie gerade?“ „Bin gleich vor Ort, einen Augenblick“, sagte ich, beendete das Telefonat und fuhr auf meinem Elektroscooter in die Verpackungsabteilung. Hofer stand bereits unruhig vor dem Kontrollraum. „Morgen, Steiner“, sagte er, „die Betriebsleiterin lässt nachfragen, was hier läuft, die sitzt auf Nadeln.“ Ich war noch nicht im Bild, hatte ja gerade erst angefangen. „Ich weiß nicht, muss schauen. Melde mich, wenn ich etwas erfahren habe“, stotterte ich ungeschickt. „Steiner, geben Sie bitte Gas, die Anlage muss laufen, und zwar jetzt!“ Immer dieser Hofer, dachte ich. Schon am frühen Morgen, kaum hatte der Arbeitstag begonnen, war er unzufrieden und aggressiv. „Gut, Herr Hofer, ich gebe Bescheid, sobald ich Genaueres weiß“, sagte ich und fuhr los, meinen Vorgesetzten hinter mir stehenlassend. Der Mann passte mir nicht. Ein Karrierist, nach oben gehorsam, war es schon mehrere Male vorgekommen, dass er, unter Druck, seine Belegschaft vor der Geschäftsleitung desavouierte. Statt seine Leute in Schutz zu nehmen, die in schwierigen Situationen einen guten Job machten, war er sich nicht zu schade dafür, bedauerlich den Kopf zu schütteln und vor allen zu sagen: „Steiner, Steiner, Steiner. Wir müssen schauen, dass wir da in Zukunft agiler reagieren können. So ein längerer Ausfall wird dann schnell teuer.“ Es fehlte nur noch, dass er gesagt hätte: geschmeidiger, tifiger, flexibler oder beweglicher. Dann klopfte er mir, wie zur Versöhnung, auf die Schulter. Aber er konnte mich damit nicht täuschen. Dem Mann mangelte es an Größe und Inspiration. Er mochte und unterstützte seine Mitarbeiter nicht. Ich spürte seine Verachtung. Kalt und gleichgültig war sein Gesichtsausdruck oder dann aggressiv. Ich fragte mich oft, was diesen Hofer eigentlich antrieb. Ich hegte einen großen Verdacht: Der Mann war innerlich leer. Er wusste nichts mit sich anzufangen. Eines Tages, vielleicht hatte ihn jemand dazu überredet, hatte er sich zu einer beruflichen Karriere entschlossen. Aber alles, das Druckmachen, das Fordern, das forsche Auftreten, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein Innenleben durch Leere bestimmt war. Er war nicht wirklich an dem interessiert, was um ihn herum vorging. Er wollte sein Gesicht wahren, wollte durch mehr oder weniger überzeugende Schauspielerei und improvisierte, markige Sprüche seine Position in der Firma festigen. In ihm drin musste es nicht selten geschrien haben: Ich kann nicht mehr! Ich fühle nichts und es interessiert mich nichts. Die Leere macht mich krank! Auch in ihm schrie sie, die Verzweiflung ob eines sinnlosen Daseins ohne echte Aufgabe. Auch bei ihm kam dieser Schrei nie aus dem Mund, aber ich spürte ihn deutlich.
Ich informierte mich beim Abteilungsleiter Hermann, was genau in der Verpackungsabteilung nicht funktionierte. Er verwies auf einen Ausfall in der Flaschenabfüllung. Ein Teilstück der Transportstrecke für abgefüllte und verschlossene Flaschen schien einen Schaden zu haben. Beim Untersuchen der Fördertechnik bemerkte ich eine defekte Motorenrolle. Sie drehte sich nicht mehr. Ich nannte Hermann die benötigte Zeit für die Reparatur: 20 Minuten. Er wiederum machte Meldung an Betriebsleiterin Baumgartner. Sofort begann ich mit der Demontage. Kollege Zgraggen, den ich über Funk um Unterstützung bat, erschien mit einer neuen Antriebsrolle, die er im Ersatzteillager gefasst hatte. Zu zweit führten wir die Arbeit innerhalb von 15 Minuten durch. Dann gab ich Hermann grünes Licht, die Anlage zu starten. Alles lief reibungslos an. Er dankte mir und Zgraggen für den Einsatz. Ich machte Meldung an Schaufelberger, unseren Organisator für Störfälle. Hofer war inzwischen verschwunden, wahrscheinlich hatte er sich in sein Büro zurückgezogen. Das war mir recht.
Per Funk erhielt ich von Schaufelberger die Anweisung, in die Abteilung mit den Mischbehältern zu fahren. Es erwarte mich dort Abteilungsleiter Küenzli, etwas stimme nicht mit einem Mischbehälter. Auf der Fahrt in die Abteilung stellte sich mir Hofer überraschend mit einem Papier in der Hand in den Weg und winkte mich zu sich. Ich hielt mein Fahrzeug an und stieg ab. Hofer las mir ohne Einleitung vor: „Störungsbehebung ungenügend. Auch heute wieder, wie schon die ganze Woche. Dazu immer wieder die gleiche Störung, ohne dass man mal schaut, was denn die genaue Ursache ist. Wieso muss ich immer anrufen, damit überhaupt jemand kommt? 25 Minuten Produktionsunterbruch im Hauptverarbeitungsfenster nicht optimal. Habe das dem technischen Verantwortlichen auch so mitgeteilt.“ Hofer schaute mich an, als erwarte er von mir eine Erklärung. Er drückte mir das Papier wortlos in die Hand. Ich sah die angegebene Uhrzeit der Meldung: 3.45 Uhr. Dies betraf die Nachtschicht. Ich hatte mit dieser Sache nichts zu tun. „Das betrifft die Nachtschicht, Herr Hofer, nicht uns“, sagte ich. „Ob Nacht- oder Früh- und Spätschicht, bei uns gilt generell, wir sind verantwortlich für unser Leistungsangebot, die Firma ist unser Arbeitgeber, schauen wir, dass wir unseren Ruf nicht unnötig schädigen.“ „Aber ich habe mit dieser Sache nichts zu tun, für alles kann ich nicht Verantwortung übernehmen“, wiederholte ich. Ich fühlte, wie in mir ob der Ungerechtigkeit Hofers Wut aufstieg. „Ja, Steiner, Sie waren es nicht, ich weiß, aber für uns alle gilt, daher auch für Sie: Wir müssen wachsam bleiben und die Dinge genau und doch so effizient wie möglich angehen, sonst haben wir alle ein Problem.“
Rutsch mir doch den Buckel runter, dachte ich. Diese schulmeisterliche Besserwisserei ging mir auf die Nerven. Wortlos stieg ich auf meinen Elektroscooter und fuhr davon. Das Papier in meiner Hand zerknüllte ich und warf es während der Fahrt in einen der Abfallcontainer, die überall im Betrieb aufgestellt waren.
Küenzli war schon sehr nervös. Hofer hatte mich mit seiner Zurechtweisung unnötig aufgehalten. „Behälter vier scheint ein Problem zu haben“, sagte er mit einem gehetzten Gesichtsausdruck und in hoher Stimmlage, „könnten Sie bitte schauen, was da nicht läuft!“ Er schien einer Panik nahe zu sein. „Natürlich, Herr Küenzli, ich gehe gleich schauen“, antwortete ich gelassen und versuchte ihn mit einem Lächeln zu beruhigen, obschon ich innerlich noch aufgewühlt war von vorher. Ich fuhr zum Behälter vier. Schnell konnte ich feststellen: Die Umwälzpumpe funktionierte nicht mehr. Mehrere Startversuche blieben ohne Erfolg. Ich vermutete einen Defekt an der Antriebskette. Eventuell hatte sie Unterspannung oder sogar einen Riss. Ich stieg für das Prüfen des Motors in den Maschinenraum unterhalb des Behälters. Tatsächlich, ein Kettenelement war beschädigt und die Kette lief lose neben den Zahnrädern. Das war so ziemlich der worst case. Der Behälter musste entleert, dann die Kettenführung entspannt und eine neue Kette aufgezogen werden. Dauer der Reparatur: zwei Stunden. Ich bat Zgraggen um Unterstützung und machte Meldung an Schaufelberger und Gubler, unseren Anlagewart und Materialverwalter. Gubler bot an, sonstige Störungen zu übernehmen, während Zgraggen und ich den Motor reparierten. Ich dankte ihm über Funk. Küenzli, der inzwischen hinter mir stand und alles mitbekommen hatte, machte Meldung an Betriebsleiterin Baumgartner. Auf ihren Befehl hin ordnete er seinem Mitarbeiter die Entleerung von Behälter vier an.
Wenige Minuten später konnten Zgraggen und ich mit der Arbeit beginnen.
Ich lag mit öligen Händen unter dem Motor, als Gubler mich wegen einer Störung an einer der Scharnierbandketten in der Flaschenabfüllanlage anrief. Die Steuerung eines Teilstücks sei ausgefallen. Zgraggen erklärte sich bereit, Gubler zu unterstützen. Fünf Minuten später teilte er aufgeregt über Funk mit: „Steiner, es sieht so aus, als ob ein ASI-Bus ausgefallen ist.“ „Dammi!“, fluchte ich für mich. Das hatte gerade noch gefehlt. „Braucht ihr Hilfe oder kommt ihr zurecht?“, fragte ich über Funk, den ich mühsam, unter dem Motor liegend, bediente. „Ja, wir wären froh, wenn du schnell kommen könntest“, meinte Zgraggen. „Hast du das mitbekommen?“, fragte ich Schaufelberger über Funk. „Ich gehe in die Flaschenabfüllung wegen dem ASI-Bus. Behälter vier muss warten.“ „Ja, wenn es denn sein muss, Frau Baumgartner steht neben mir und meint, Behälter vier müsse so schnell wie möglich wieder funktionieren.“ Ich schnaufte tief durch, dann sagte ich: „Ich kann mich nicht zweiteilen, der ASI-Bus ist auch wichtig, ich mache, so schnell ich kann.“ „Ja, in Ordnung“, erwiderte Schaufelberger mit matter Stimme. Ich konnte mir vorstellen, wie die Betriebsleiterin hinter seinem Stuhl stand und Anweisungen und Kommentare auf ihn niederhageln ließ. Schaufelbergers Aufgabe war keine leichte, ich wollte nicht mit ihm tauschen.
Beim defekten Teilstück in der Flaschenabfüllung waren mehrere Mitarbeiter damit beschäftigt, einzelne Flaschen in Harassen umzuschichten, um sie dann, etwa 20 Meter weiter vorne, wieder in die automatisierte Abfüllung einzuspeisen. Auch Frau Bogner war unter den schwitzenden Arbeitern. Ihre Augen hatten immer noch denselben Ausdruck von Traurigkeit und Einsamkeit wie heute Morgen im Bus. Über ihrer Oberlippe und auf der Stirn hatten sich Schweißperlen gebildet. Das ist Frau Bogner, dachte ich. Das ist sie ganz. Ich sah sie mitten in ihrem Leben, hinter dem kein zweites zu existieren schien. Die Monotonie war alles, was sie kannte. Sie hatte sich in ihrer Existenz als Arbeitnehmerin dieser Firma aufgegeben. Es tat mir furchtbar leid, die Frau in diesem Zustand zu sehen. Denn, nicht wahr, es war, als stände sie entblößt, nackt vor mir. Mehr war die Frau nicht, als was ich gerade von ihr sah. Ich schämte mich für dieses offenliegende Alles, was diesen Menschen ausmachte. Es war so erschütternd wenig. Ich hätte ihr liebend gerne zugerufen: Frau Bogner, brechen Sie auf! Lassen Sie die Glanzlosigkeit Ihres monotonen Daseins hinter sich! Machen Sie etwas aus Ihrem Leben!
Aber schon kamen mir Zgraggen und Gubler winkend entgegen, um mir den verdächtigen Steuerungskasten zu zeigen. Abteilungsleiter Hermann, mit dem ich heute Morgen wegen der defekten Motorenrolle schon einmal zu tun gehabt hatte, ging hinter ihnen. „Hast du schon etwas entdeckt, Gubler?“, fragte ich, meinen Elektroscooter parkend. „Eben nicht, im Sicherungskasten haben wir einen Ausfall, warum, wissen wir nicht“, meinte er. Zgraggen kauerte vor dem Kasten und versuchte mehrere Male, den Schütz wiedereinzuschalten – vergeblich. Schließlich bemerkte Hermann: „Könnte es sein, dass dies mit dem Umschichten der Harassen zusammenhängt?“ Er zeigte auf einen Stapel Kisten in der Nähe der Scharnierbandketten. „Wir waren hier am Umschichten, als es plötzlich einen Knall gab“, sagte er. Ich schaute mir den Umschichtplatz genauer an. Tatsächlich: eine Getränkekiste drückte gegen einen Unterverteiler im Scharnierbandkettenantrieb. Ich zog sie weg. Deutlich war der Eindruck in der ASI-Bus-Leitung auszumachen. „Quittiere bitte nochmals, Zgraggen“, sagte ich. Zgraggen quittierte. Mit einem lauten Warnsignal lief die Anlage wieder an. Zgraggen, Gubler und ich schauten uns erleichtert an. Ich wischte mir mit meinem schmutzigen Handrücken den Schweiß von der Stirn. Das war wohl erledigt, die Anlage lief. Sofort fuhren Zgraggen und ich auf unseren Elektroscootern zu Behälter vier zurück. Gubler machte über Funk Meldung an Schaufelberger, dass die Flaschenabfüllung wieder funktioniere. „Gut gemacht, Jungs“, hörte man Schaufelberger antworten. Aus seinen Worten war Erleichterung herauszuspüren.
Zgraggen und ich konnten die Arbeit an der Antriebskette ungestört beenden. Gubler behob zu unserer Entlastung anfallende Störungen. Das gelang ihm mühelos, nur einmal am Palettenetikettierer in der Verpackungsabteilung kam er kurz ins Schleudern, denn er wusste das Passwort des neu zu bootenden Rechners nicht auswendig. Ich konnte es ihm per Funk durchgeben. Eineinhalb Stunden nach Arbeitsbeginn übergab ich Abteilungsleiter Küenzli den reparierten Behälter vier. „Das gibt dann mal einen Kaffee, Steiner“, sagte er ganz aufgeregt. Er ist mir wirklich dankbar, dachte ich. Auch Küenzli stand unter Druck, es war offensichtlich. Betriebsleiterin Baumgartner war nicht dafür bekannt, viel Geduld und Verständnis aufzubringen für ihre Untergebenen. Ihm ging es wohl nicht viel anders als mir mit Hofer.
Nachdem alles Werkzeug zusammengepackt war, machte ich Meldung an Schaufelberger, dass Behälter vier erledigt war und neu gefüllt werden konnte.
„Dann werde ich mal eine kleine Pause machen“, gab ich Schaufelberger durch. Es war neun Uhr. „Guten Appetit“, kam es zurück.
Ich wusch meine Hände und das Gesicht am Waschbecken unserer kleinen Werkstatt. Dann fuhr ich mit dem Scooter Richtung Ausgang. In der Betriebskantine packte ich mir zwei Salamibrote und einen Kaffee auf das Tablett und setzte mich an einen Tisch am Fenster. Draußen schien die Sonne, der morgendliche Nebel hatte sich vorzeitig aufgelöst. Golden ragten einzelne Baumkronen bis zu den Kantinenfenstern herauf. Das meiste Laub aber lag bereits auf der Straße. Der Herbst war schon weit fortgeschritten.
Im Radio spielte gerade Crazy in Love von Beyoncé, ich mochte diesen Song immer noch. Schon einige Male hatte ich überlegt, was dieses Etwas ausmachte, das bei allen anderen Stücken der Sängerin fehlte. Es hing mit dem zähen, schleppenden Groove zusammen und dem Gesang, der immer ein wenig zu früh war, dem Song aufgeregt davonrannte. Es machte Freude, diesen drei Minuten Musik zuzuhören, sie hatten etwas Festliches, Feierliches, Glamouröses.
Dann kam Züri West. Willkommen in unserer Welt, dachte ich. Das ist die Schweiz. Biederer und nichtssagender konnte Musik nicht sein. So leben wir hier. So öde und leer ist auch unsere Kunst. Aber was erwartete ich? Was wollte man von Menschen erwarten, die unter Arbeit ihre Aufgabe in der Arbeitswelt und nicht eine persönliche Leistung verstanden? „Die Freude ist viel weniger ein Naturgeschehen als eine menschliche Schöpfung: die schwerste und größte“ hatte ich einst gelesen und mir schien dieser Satz treffend. Nur, wie kann einer Freude in sein Leben holen, ohne sich Zeit zu nehmen, über sein Leben nachzudenken? Über sein Leben nachdenken kann man nicht, solange man sich aufopfert in einer Funktion am Arbeitsplatz, dachte ich. Man verliert dort zu viel Zeit. Statt sich zu begnügen mit einem sicheren Einkommen und materiellem Wohlstand, dort stehenzubleiben – wäre ein Sich-Zeit-Nehmen für dieses Nachdenken und Weiterkommen als Mensch nicht viel wichtiger? „Denken macht die Größe des Menschen aus“, sagte Blaise Pascal. Mir war klar, dass er damit das Nachdenken darüber meinte, was man im Leben wirklich erreichen kann und wie man sein Dasein legitimieren will. Es ging um die Fragen der Sinngebung oder des Mutes zur mentalen Kühnheit, der Entwicklungsmöglichkeiten durch Erkenntnisse. Die Gefahr, diesbezüglich zu wenig zu leisten, galt für mich genauso wie für viele andere, darüber machte ich mir keine falschen Vorstellungen. Ich ließ mir mit jedem Arbeitstag wertvolle Zeit stehlen, anstatt diesen Fragen nachzugehen und Antworten darauf zu erarbeiten.
Meine Pausenzeit war um. Ich erhob mich und stieg die Treppe hinunter zum Betriebseingang. Genau 15 Minuten nach dem Abmelden bei Schaufelberger war ich wieder zurück. Pünktlichkeit und Genauigkeit bei Zeit- und Pausenregelungen wurden in unserer Firma großgeschrieben. Hofer betonte immer und immer wieder: Zeit ist Geld. Fünf Minuten Pausenüberzug, aufsummiert auf zig Mitarbeiter, würden schnell mehrere Stunden Leistungsausfall generieren. Solches Geschwätz machte mich nur noch müde.
Kaum stand ich wieder auf meinem Elektroscooter, den ich hinter den Eingangsschleusen neben dem Terminal für die Arbeitseinsätze der Mitarbeiter geparkt hatte, als mich Schaufelberger per Funk zu einen neuen Einsatz rief: „Schaufelberger an Steiner.“ „Verstanden.“ „Bist du von der Pause zurück?“ „Jawohl.“ „Sehr gut, kannst du in die Verpackungsabteilung fahren, dort erwartet dich Abteilungsleiter Hermann, es gibt erneut ein Problem am Palettenetikettierer.“ „Verstanden. Ich bin unterwegs“, sagte ich und fuhr los. Vor Ort stand Hermann neben dem offenen Aluminiumgehäuse des Etikettierers und schaute hilflos auf den Drucker und die vollautomatisierte Mechanik. Ich trat zu ihm hin. „Gibt es ein Problem?“, fragte ich. „Es läuft nichts mehr, der Drucker produziert keine Etiketten mehr“, sagte er, ein wenig verloren immer noch auf den Drucker schauend, als ob er so den Fehler entdecken könnte. Irgendwie tat es mir leid, wie Hermann hilflos vor dem Apparat stand. Es tat mir leid, weil es offensichtlich war, dass der Mann angesichts des komplexen technischen Vorgangs, den er kaum im Ansatz verstand, überfordert war und dass er deswegen ein schlechtes Gefühl hatte. Niemand konnte ihm einen Vorwurf machen, dass er das Gerät nicht kannte. Wir waren da zuständig. Hermann fühlte sich schuldig und inkompetent, wo er eigentlich gelassen delegieren könnte. Er lädt sich etwas auf, das andere sich aufladen müssten, dachte ich. Aber war die Hilflosigkeit, das Gefühl der Inkompetenz und des Überfordertseins einiger Mitarbeiter verwunderlich angesichts des hochtechnisierten Ablaufs? Wie sollte sich der Mensch nicht klein fühlen gegenüber diesen von Geisterhand gesteuerten knirschenden, klickenden, knackenden und stampfenden Apparaten?
Nach dem Öffnen des Bedienterminals neben dem Gehäuse des Etikettierers sah ich sofort, dass einer der beiden für den Ablauf zuständigen Powercomputer tot war. Vermutlich war die Netzspeisung defekt. Ich schätzte den Arbeitsaufwand auf ungefähr 45 Minuten und machte Meldung an Schaufelberger. Hermann schaute mich dankbar an. Nun schien das Rätsel gelöst. Ich war schon auf dem Weg ins Ersatzteillager, als über den Funk Hofers Stimme bellte: „Steiner, kommen Sie bitte in mein Büro!“ Herrgott noch mal! Was wollte der jetzt von mir? Und warum rief er mich über Funk an? „Herr Hofer, bin gerade an einer Störung“, antwortete ich. „Kommen Sie bitte in mein Büro!“, kam es mechanisch zurück. „Dammi!“, fluchte ich für mich. „Schaufelberger, hast du gehört, muss schnell ins Büro, nachher gehe ich zurück an den Etikettierer“, sagte ich. „Okay“, kam es matt zurück. Wir wussten beide, dass Hofers Aufgebot zu einem ungünstigen Zeitpunkt kam.
Zwei Minuten später klopfte ich an die Glastür zu seinem Büro. Er saß hinter seinem PC, schaute auf und rief: „Treten Sie ein, Steiner.“ Hofers Arbeitsplatz war so eingerichtet, dass er schon frühzeitig durch die Glastür sah, wer durch den Korridor auf sein Büros zuschritt.
„Können Sie am Sonntag die Schicht von Nievergelt übernehmen?“, fragte er mich geradeheraus. Ich war überrumpelt. Eigentlich hatte ich für das Wochenende einen Ausflug geplant, in die Innerschweiz. Ich dachte an eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, aber es war noch nichts Konkretes gebucht. „Äh, ja, das kann ich machen“, sagte ich. „Danke, Steiner, damit helfen Sie mir, ja, das wärs auch schon.“ Und schon schaute Hofer wieder auf seinen Bildschirm. Arroganter Schnösel, dachte ich. Nun hatte ich soeben mein Wochenende geopfert. Warum nur erleichterte ich ihm so seine Arbeit? Mit dieser voreiligen Opferbereitschaft machte ich mich doch nur zum Idioten. Er wusste genau, dass er mich fragen konnte. Ich war immer kooperativ, sagte immer zu. Mir war völlig klar, dass ich mir damit selber schadete. Hofer war das Wohlergehen seiner Mitarbeiter egal. Er brauchte Leute, die er einteilen konnte, Punkt. Es war mein Fehler, wenn ich nicht fähig war zu mehr Widerstand, zu weniger Anpassung.
Noch im Korridor rief mich Zgraggen über Funk an: „Steiner, brauche deine Unterstützung an einem Motor in der Flaschenabfüllung. Ölverlust.“ „Steiner an Gubler“, sagte ich, „Gubler, hast du Zeit, Zgraggen zu unterstützen, ich bin beschäftigt am Palettenetikettierer.“ „Negativ, bin an einer defekten Weiche in der Flaschenherstellung“, antwortete Gubler nervös in erhöhter Stimmlage, über seinen Funk war das lärmige Rattern der Anlage neben ihm deutlich zu hören. Mist, dachte ich. „Zgraggen, ich muss den Etikettierer zuerst machen, das hat Priorität, dann komme ich zu dir.“ „Steiner an Schaufelberger, der Motor in der Flaschenabfüllung muss warten, wir sind momentan voll belegt.“ „Zgraggen, hol bitte Ölbinder und sperr die Fläche ab, sonst haben wir eine Sauerei!“, rief ich über Funk. Ich fuhr auf meinem Elektroscooter zum Ersatzlager, um ein Netzgerät für den defekten PC des Etikettierers zu holen. Ich befand mich gerade zwischen den Schubladenstöcken für Netzwerkkabel, Ersatzrechner und Zubehör, als mein Handy klingelte. Das Display zeigte Hofers Namen. Ich nahm ab. „Hier Hofer, äh, Steiner, habe soeben eine Mitteilung bekommen von Betriebsleiterin Baumgartner, was ist da draußen los? Der Palettenetikettierer läuft schon eine ganze Weile nicht, dann gibt es eine Störung in der Flaschenherstellung, die nun auch schon mehr als 20 Minuten dauert. Schauen Sie bitte zu, dass der Laden läuft!“ „Wir sind dran, Herr Hofer, wir sind dran!“, schrie ich beinahe ins Telefon. „Es sind alle Mann an anstehenden Störungen beschäftigt.“ Ich war nervös, dieser Hofer riss einem den letzten Nerv aus. Immer in den dümmsten Momenten mischte er sich in das operative Geschäft ein. „Schon recht, Steiner, ich sehe, Sie sind im Stress, erledigen Sie die Sache einfach so schnell als möglich, sonst bekommen wir wieder Post von der Geschäftsleitung. Ich rechtfertige mich ungern für zu lange Störungen.“ „Ja, gut, dann mach ich jetzt weiter!“ Ich beendete den Anruf. So ein ungeschickter Kerl, dachte ich. Es ging ihm nur darum, gut dazustehen. Stets wollte er eine saubere Weste bewahren, damit seiner Karriere nichts im Wege stand. Ein armseliger Hund, dieser Hofer. Uns machte er damit kaputt.
Mit zitterigen Fingern, ich war gereizt nach diesem Telefonat, ergriff ich ein passendes Netzgerät und kehrte zurück an den Terminal des Palettenettiketierers.
Ich brauchte für den Einbau des Ersatzgerätes länger als vorgesehen, da ich nicht richtig bei der Sache war. Hofers Telefonat beschäftigte mich weiterhin. Nachdem ich den ausgebauten PC wieder zugemacht und angeschlossen hatte, startete er zwar, blieb dann aber hängen und bootete immer wieder neu. Das Netzgerät zu wechseln war wohl richtig gewesen, denn der PC hatte wieder Strom, aber irgendein Fehler musste sich beim Einsetzen und Verkabeln des neuen Netzteiles eingeschlichen haben. Ich entfernte das Stromkabel und die Schnittstellenstecker erneut, öffnete das Gerät und ging alle Anschlüsse nochmals durch. Da sah ich den Lapsus: Ich hatte den Endstecker des rosaroten Flachbandkabels vergessen. Ich schloss ihn an, schraubte den PC zu, befestigte alle Schnittstellenkabel und startete den PC erneut. Er fuhr regulär hoch und startete das Betriebssystem Windows 7. Ich war erleichtert und machte Meldung an Schaufelberger, dass der Palettenetikettierer seinen Betrieb wiederaufnehmen konnte. Ich winkte Hermann zu, der unweit von mir neben den Harassen- und Kartonstapeln stand, zeigte mit einem Daumen nach oben. Er lächelte, schien erleichtert und hielt ebenfalls einen Daumen in die Luft. Wir verstanden uns. Mit der Wiederaufnahme der Arbeit dieses Automaten hatte sich unser beider Druck ein wenig gelindert.
Ich fuhr, so schnell es der Elektroscooter zuließ, zu Zgraggen in die Flaschenabfüllung. Der hatte die ölverschmierte Fläche unter dem defekten Motor mit Absperrband gekennzeichnet. „Wo finde ich dich, Zgraggen?“, fragte ich über Funk. „Bin im Lager, Steiner, suche einen Ersatzmotor!“, kam es zurück. „Ich fange mit der Demontage an, sobald du mir bestätigst, dass wir einen Ersatzmotor im Lager haben.“ „Wir haben einen, habe ihn soeben gefunden!“, jubelte Zgraggen beinahe. Eigenartig, wie man sich, unter Druck, plötzlich an solchen Dingen erfreuen kann, dachte ich. Zgraggen freute sich wie ein Kind, weil wir nun, dank dem vorhandenen Ersatzmotor, unsere Arbeit nahtlos fortsetzen konnten und nicht unnötig zusätzlich belastet wurden durch das Fehlen eines solchen. Druck kann Menschen verformen, dachte ich. Unter Druck sieht man genau, wie stabil einer ist. Ich selber hätte mich nicht als besonders stabil oder widerstandsfähig bezeichnet. Auch ich war zu Opfern bereit. Die Frage, die sich stellte, war die: War einer bereit, alles zu opfern für eine Sache, für eine Firma. War einer bereit, sich dafür selber zu verneinen, abzuschreiben, zu verleugnen? Ich war dazu glücklicherweise nicht bereit, das wusste ich. Ich war fähig, mir einen kleinen Rest Unabhängigkeit zu bewahren. Ich empfand es als beschämend, zu sehen, wie einer sich den – von anderen Menschen bestimmten – Spielregeln demütig unterwarf. Wie nur kann sich ein Mensch anderen einfach so unterwerfen? Wer waren denn diese anderen, was waren sie mehr als man selbst? Mir tat diese armselige Selbstopferungsbereitschaft leid. Sie war so kläglich und glanzlos, so ohne Größe und Weitsicht.
„Gubler an Steiner?“, tönte es da aus meinem Funk. Ich antwortete: „Ja, Gubler, verstanden!“ „Steiner, kannst du bitte in die Flaschenherstellung kommen, es eilt.“ Gublers Stimme klang gepresst, beinahe ein wenig weinerlich. Ich merkte sofort, dass es dringend war, etwas musste dort vorgefallen sein. „Steiner an Zgraggen, Zgraggen, du hast es sicher mitbekommen, ich bin unterwegs in die Flaschenherstellung, Gubler braucht Unterstützung.“ „Verstanden, Steiner“, kam es von Zgraggen zurück.
Als ich in der Flaschenherstellung ankam, herrschte dort dicke Luft. Frau Baumgartner stand wild gestikulierend vor Gubler und zeigte immer wieder auf eine bestimmte Stelle in der Bandzufuhr der PET-Flaschenproduktion, wo vermutlich mein Arbeitskollege gerade im Begriff war, die defekte Weiche zu ersetzen. Neben ihr stand Abteilungsleiter Gomringer, die Arme vor der Brust verschränkt und Gubler eindringlich anschauend. „Inkompetent“, hörte ich Frau Baumgartner sagen, als ich mich der Gruppe näherte. Ich stieg von meinem Elektroscooter. „Was ist los, Gubler?“, fragte ich meinen Kollegen. Er hielt sein Gesicht weggedreht, der Apparatur zugeneigt, an der er tätig war. Er gab keine Antwort. „Gubler, was ist passiert?“, fragte ich noch einmal und versuchte dabei, in sein Gesicht zu sehen. Etwas schüttelte ihn. Seine Hände hielt er vor seine Augen. Da sah ich, dass der Mann weinte. Er bedeckte sein Gesicht, weil er sich dafür schämte. „Was ist hier los, Frau Baumgartner?“, fragte ich die Betriebsleiterin. Kalte Wut stieg in mir hoch. Gomringer und Frau Baumgartner standen beide vor mir und schauten mich an. Dann platzte es aus ihr heraus: „Das frage ich wohl Sie, was los ist. Wie lange wollen Sie hier noch rumbasteln? Seit bald 45 Minuten läuft in dieser Abteilung nichts mehr. Wir haben deswegen einen gravierenden Produktionsausfall! Also wenn diese Anlage den Betrieb nicht wieder aufnimmt in den nächsten zehn Minuten, dann müssen wir eskalieren lassen! Ich muss die Geschäftsleitung informieren und natürlich Ihren Vorgesetzten.“ Dann sagte Gomringer langsam mit rauchiger, belegter Stimme den Satz, der in mir den Entschluss reifen ließ, es den beiden heimzuzahlen: „Haben Sie keine anderen Mechaniker vor Ort, die effizienter sind, ihr seid ja wohl der Schlafkappentrupp der Firma.“ In mir stieg ein süßes Rachegefühl auf für das erlittene Unrecht. Ich sah, wie Gomringer und Baumgartner Blicke austauschten und sich dabei leicht anlächelten, als teilten sie eine heimliche Freude, sich gegenseitig zu überbieten an kränkenden Worten, die sie an uns zwei, den weinenden Gubler und mich, adressierten. Ich wusste, dass Frau Baumgartner sonst nie direkt auf den Mann zielte in ihrer Kritik. Hier ließ sie sich vermutlich von Gomringer, ihrem selbstgerechten, groben und heimlichen Lover mitreißen. „Mit denen werden wir demnächst einmal aufräumen“, hörte ich sie ihm hinter vorgehobener Hand zuraunen. Dann gingen die beiden in Richtung des Kontrollraums. Dort würde Baumgartner vermutlich ihre Telefonate und E-Mails diese Störung betreffend erledigen. Ihr zwei verdammten Verräter, dachte ich, den beiden nachschauend, das zahle ich euch heim.
Ich wendete mich Gubler zu und klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. „Kopf hoch, Gubler, komm, lass dich von denen nicht fertigmachen“, sagte ich zu ihm. Dann machte ich Meldung an Schaufelberger: „Steiner an Schaufelberger, bin hier bei Gubler in der Flaschenherstellung beim Weichenwechseln. In voraussichtlich 15 Minuten läuft die Anlage wieder.“ „Okay“, meinte Schaufelberger. Dann sagte ich zu Gubler: „Geh, sitz ein wenig ab, trink einen Kaffee und beruhige dich, ich mach das hier.“ Gubler nahm mein Angebot an, schaute auf den Boden und sage dann mit erstickter Stimme: „Danke, Steiner, bin in fünf Minuten zurück.“ Mein Gott, wie regte mich diese Sache auf. Verdammt noch mal, wir gaben unser Bestes. Wir waren drei Mann pro Schicht. Mehr Personal wurde von der Geschäftsleitung nicht bewilligt. Solche Situationen wie heute, wo einzelne Störungen über längere Zeit nicht behoben wurden, weil das Personal ausgelastet war, kamen immer wieder vor. Das war nichts Neues. Dass aber die Betriebsleiterin sich deswegen gehen ließ und sich nicht zu schade war, mit beleidigenden Drohszenarien Angst und Unfrieden zu säen, fand ich widerlich und armselig. Irgendwie wurde ich den Eindruck nicht los, dass Frau Baumgartner und Hofer zwei Machtmenschen waren, die, innerlich leer, lieblos und einsam, gerade darum an ihren Posten festhielten in der Firma, weil sie sonst, dort draußen, nichts waren. Sie waren auch hier beide nichts, flach, jeglicher Weitsicht, menschlicher Wärme und Großzügigkeit unfähig. Sie sind Opfer einer, auch sie überfordernden, Leistungsmoral, dachte ich.
Ich war mit der Montage der neuen Weiche beinahe fertig, als das Handy klingelte. Mir war klar, es war Hofer, ich brauchte seinen Namen auf dem Display gar nicht erst zu lesen. Ich wusste außerdem, dass dieses Gespräch unangenehm werden würde. Unangenehm für ihn. „Ja, Steiner am Arbeiten“, sagte ich ruhig. „Steiner, kommen Sie bitte in mein Büro“, sagte Hofer kurz angebunden. Ich ließ mir Zeit mit der Antwort. „Nein, jetzt kann ich nicht in Ihr Büro kommen, ich bin hier am Arbeiten.“ „Gut, dann komme ich zu Ihnen raus, Sie sind in der Flaschenherstellung, nicht wahr?“ „Ja, dort bin ich.“
Drei Minuten später tauchte Hofer auf und stellte sich vor mich hin. Ich beendete ruhig meine Arbeit und packte mein Werkzeug zusammen. „So, das wäre erledigt“, sagte ich für mich. „Steiner, ich mag es nicht besonders, wenn Sie meinen Anweisungen nicht folgen. Wenn ich sage, kommen Sie in mein Büro, dann habe ich gute Gründe dafür.“ „So?“, sagte ich. „Hören Sie auf mit diesen Spielchen, es war unerfreulich, was ich mir von der Betriebsleitung sagen lassen musste. Im Verlaufe dieses Vormittags musste die Firma wegen verschiedener Störungen empfindlich lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Ich würde mich gerne mit Ihnen zusammensetzen, um Wege zur Optimierung unserer Dienstleistung auszuarbeiten“, sagte Hofer in gereiztem Ton. Er machte mir damit die Sache leicht. „Spielchen, Herr Hofer, spielen Sie. Wir brauchen Sie hier nicht. Sie sind uns keine Hilfe. Sie unterstützen uns nicht. Sie geben uns keine Rückendeckung. Wenn Sie es nicht schaffen, sich hinter uns zu stellen, dann haben wir hier alle verloren. Sie und wir Mitarbeiter. Und ich sage Ihnen jetzt noch etwas: Ich beobachte, was Sie tun. Sie machen mir nichts vor. Für mich sind Sie der große Falschspieler in dieser Firma, ein Betrüger, ein Lügner, ich glaube Ihnen kein Wort. Nichts, was von Ihnen kommt, ist ehrlich. Nichts ist aufrichtig. Alles ist Berechnung, alles dient Ihrer sauberen Weste. Sie sind dazu da, uns kaputt zu machen, um über unsere Leichen nach oben aufzusteigen. Das zahle ich Ihnen heim, Hofer, da können Sie Gift drauf nehmen.“ Mir war klar, dass ich mit dieser Rede ein gutes Verhältnis zu meinem Vorgesetzten für immer unmöglich gemacht hatte. Aber es tat gut, den Kropf zu leeren. Hofer drehte sich wortlos um, sagte dann aber doch noch: „Sie wollen Krieg, Steiner, den können Sie haben. Ich werde dafür sorgen, dass Sie ihn verlieren!“ Dann ging er davon.
Ich sah, wie Gubler durch den Korridor, vom Pausenraum aus, langsam in die Flaschenherstellung zurückkam. Er war ein Häufchen Elend, demotiviert, unglücklich, schuldbeladen, das sah man an seinem schweren Gang. Seine verwaschenen Latzhosen waren zu kurz. Sein blauer Arbeitsanzug saß armselig um seine schmalen Schultern. Sein Bauch war aufgedunsen. Er war Junggeselle geblieben, keine Frau mochte ihr Leben mit seiner Schicht- und Wochenendarbeit teilen. So war er alt und einsam geworden als Mitarbeiter in der technischen Abteilung dieser Firma. Es war ein Hundeleben, Gublers Leben, ein würdeloses Dasein im Mittelmaß.
Ich befühlte die dicken Plastikrohre der ASI-Bus-Kabel neben der Flaschenförderanlage, welche die Produktionsanlagen miteinander verbanden. Der Kunststoff war von den Kabeln, die in ihm lagerten, leicht erwärmt. Als ich den Seitenschneider ansetzte, hatte ich Bilder von früher vor Augen, eine alte Erinnerung aus meiner Kindheit: Ein blauer Krug, gefüllt mit dampfender Milch, und ein roter Krug, mit heißem Kaffee, standen vor mir, bedeckt mit einer Wärmehaube, die meine Großmutter dann bald anheben würde. Es war ein stiller, feierlicher, würdiger Moment, dieses Heben, das die alte, gediegene Frau liebevoll zelebrierte. Es kamen dann nicht nur die beiden Krüge zum Vorschein, sondern auch weiße Tassen mit goldigem Rand und eine ebensolche Schale mit Würfelzucker.
Mit den durchtrennten Kabeln wurde es schlagartig still im Betrieb. Die Flaschenförderanlagen blieben stehen. Die Greifarme der Roboter standen erstarrt, mitten in der Luft. Das Rauschen der Umwälzpumpen hatte aufgehört. Für einen Augenblick war es ruhig wie in einer Kirche, dann ging irgendwo ein Alarm los. Unbeholfen kniete ich neben den zerstörten Kabeln, sah, wie Gubler mit erschreckten, geweiteten Augen auf mich zustürzte. Dumpf hörte ich ihn mit brüchiger, kraftloser Stimme rufen: „Steiner, was hast du getan?“ Durch meinen Tränenschleier nahm ich nur noch unscharf wahr, wie sich Menschen in den Produktionshallen unruhig hin und her bewegten, Schatten gleich, die, wie in Zeitlupe, kamen und wieder verschwanden. Irgendwie ging mich das alles nichts mehr an. Ich hatte furchtbares Heimweh.
Aufbruch
Von einem, der so tat, als wäre er einer von ihnen,aber niemand kannte ihn.
Der Mann mit dem Alphorn setzte an zu einem Ton. Kinder warfen Geldstücke in den Trichter seines Instruments. Der Alte ließ vom Spielen ab, lächelte für die Fotografen und nahm dann, als die Touristen schon außer Sichtweite auf dem Weg zur Zahnradbahn waren, das Geld und steckte es in seine Hosentasche.
Gubler saß auf der Terrasse des Hotels Pilatus-Kulm. Er schaute auf seine Uhr: 16.15 Uhr. Es wäre nun Zeit gewesen aufzubrechen, die letzte Bahn zurück ins Tal nach Alpnachstad ging um 16.25 Uhr. Er tunkte ein Stück Brot in die Suppe und steckte es sich, nachdem er es ein wenig hatte abtropfen lassen, in den Mund. Kauend und blinzelnd schaute er in die Sonne, die sich allmählich der Bergspitze hinter dem Hotel näherte und die Fassade des rustikalen Gebäudes in ein helles, blendendes Gelb tauchte. Die Nidwaldner-, die Obwaldner- und die Luzernerfahne wehten vorne, über dem Hoteleingang, im milden Wind, der die Tage gegen Ende November, selbst auf 2000 Meter Höhe, angenehm warm sein ließ. Gubler spülte mit Kaffee Träsch nach. „Zahlen bitte!“, rief er der Servierdame zu, die, mit einer großen, dunklen Sonnenbrille vor den Augen, die wenigen Gäste bediente. Ein schabendes Geräusch ließ ihn seinen Kopf nach links drehen. Er schaute die Kesselmulde hinunter, auf deren einer Seite die Bahnschienen durchführten. Dort ging es, das letzte Bähnchen, ein roter Flecken bewegte sich unter dem leuchtend hellen Felsenband talwärts. Gubler schaute auf seine Uhr. Es war gegen 16.30 Uhr. „Haben Sie freie Zimmer im Hotel?“, fragte er die Servierdame, als sie bei ihm einkassierte. „Wahrscheinlich schon, aber am besten fragen Sie an der Rezeption, da vorne rechts“, antwortete sie kurz und war schon wieder weg. Gubler blieb noch einen Augenblick in der angenehm wärmenden Sonne sitzen, dann erhob er sich und ging Richtung Hoteleingang. Einige Minuten später hatte er sich ein Doppelzimmer mit großem Bett gebucht, für 245 Franken. Das moderne, gepflegte, helle Zimmer war ihm das Geld wert, zudem war das Frühstücksbuffet im Preis inbegriffen. Ein rechtes Frühstück, so fand er, einige Tassen Milchkaffee mit ein wenig Brot, Butter, Honig und Käse, war der richtige Tageseinstieg. Er zahlte das Zimmer sofort und ging, den Schlüssel in der Brusttasche seines karierten Hemds versorgend, wieder nach draußen auf die Terrasse. Soeben verschwand die Sonne hinter der Bergkuppe im Westen. Sofort wurde es kühl.
Gubler hatte heute Mittag, nachdem Steiner die ASI-Bus-Kabel durchtrennt und damit die Produktion lahmgelegt hatte, die Firma wortlos verlassen. Er konnte, auch wenn er es liebend gerne getan hätte, Steiner nicht helfen. Dazu fehlte es ihm an Glaubwürdigkeit und Respekt vonseiten seines Vorgesetzten und einiger seiner Arbeitskollegen. Nicht einmal die Stempelkarte hatte er benutzt, um auszustempeln. Er legte sein Funkgerät ab, versorgte das Werkzeug in seinem persönlichen Schrank und durchschritt eine der Schleusen, welche die Produktionshallen von den Büroräumen und dem Hauptausgang trennten. In der Garderobe zog er sich um, nahm den Lift in die Tiefgarage, stieg in seinen Wagen und fuhr davon, Richtung Autobahneinfahrt Luzern. Er hatte Heimweh. Gubler war Innerschweizer, genauer Buttisholzer. Er lebte allerdings schon viele Jahre in Zürich, wegen der Arbeit.
Ihn hatte etwas erschreckt und aufgerüttelt, nachdem er seinen Kollegen Steiner gesehen hatte, wie er hilflos und apathisch neben den zerstörten Kabeln kniete. Steiner, der sonst nie die Beherrschung verlor, war in jenem Moment gänzlich von seiner Stärke und Ruhe verlassen und wirkte auf Gubler so armselig und hilfsbedürftig, dass es ihm Tränen des Mitleids in die Augen trieb. Aber nicht nur das; in seinem weichen, gutmütigen Herz entfachte sich Revolte, Widerstand. Schutzlos, so fühlte er, war er nun den negativen Kräften in diesem Betrieb ausgeliefert. Sein geschätzter Kollege Steiner würde wohl nicht mehr in der Lage sein, ihn gegenüber Aggressoren zu verteidigen. Dass ihn die anderen, Gabatuler, Wolgensinger und Hofer, nicht mochten, hatte er schon früh gemerkt. Sie fanden ihn inkompetent und lachten ihn aus, weil er übergewichtig war und deswegen beschwerliche Arbeiten nur mit Mühe erledigen konnte. Auch hatte er Respekt vor den Robotern in der Flaschenverpackung. Die vollautomatisierten Greifarme, die jeweils vier Harassen auf einmal packten, hatten eine unheimliche Kraft. Gubler überkam immer ein ungutes Gefühl, wenn er unter ihnen einen Schaden behob. „Musst halt abnehmen“, sagte Gabatuler herablassend, wenn er verschwitzt und schnaufend von einem Auftrag in die Werkstatt zurückkam. Dabei schwitzte er nicht immer vor Anstrengung, sondern aus Angst. Er, der freundliche, liebenswürdige Innerschweizer, hatte sich nie an den herben, groben Umgangston seiner Zürcher Kollegen gewöhnt. Gerne hätte er dazugehört, gerne wäre er bei ihnen gesessen im Pausenraum, um einen Spruch zu klopfen, um Geselligkeit zu pflegen. Aber sie wollten ihn nicht dabeihaben, dies spürte er deutlich, sie wollten ihn unter sich nicht dulden.
Gubler war viel alleine. Wenn er jeweils in der Kantine oder zuhause einsam sein Abendessen einnahm, suchten ihn Erinnerungen an früher heim. Oft ging er mit Vater und Mutter z’Bärg.