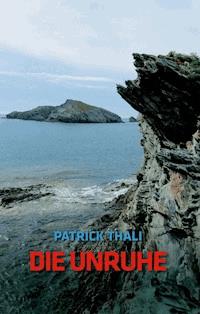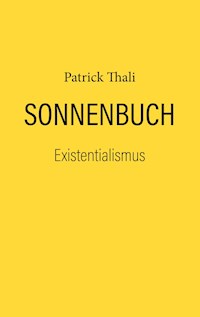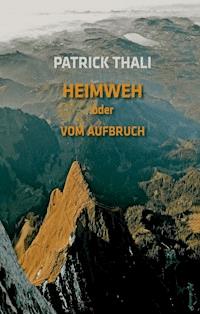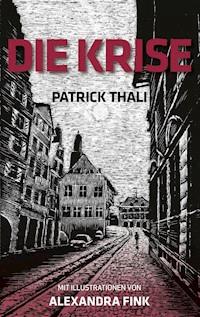Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über dem ganzen unteren Seebecken lag ein blauer Schimmer. Die Sonne stand schon fast senkrecht über uns. Vom Fraumünster her schlug es 11 Uhr. Mir lief der Schweiß über die Stirne. Ich konnte gar nicht sagen, wie sehr ich das alles liebte. Mit suchendem Blick überschaute ich die Sonnenlandschaft. Jemand musste es doch sagen, dachte ich. Jemand musste es doch sagen wollen, wie schön es hier war. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an Zürich – und an das Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Eltern
Trudi und Bruno Thali
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
Die stille Maus
Säckinger
Der Süden oder die Traurigkeit, die nie mehr verging
Der Einzelgänger
Das Geständnis
Frau Baumgartner
Fremdbestimmung (Die Sonne und ihr Einfluss auf das menschliche Denken – Remix)
Heimfahrt
Werde, der du bist
N.
La Vision (Der Einzelgänger II)
Der Musiklehrer
Tagesgeschäft
Albert Reber
Die Prinzessin des Südens
H.
Wie man vor die Hunde geht
Tomorrow never knows
Gehen
Das Lächeln
Sehnsucht
Szenefrau
Verzweiflung
Der Glanz des Willens zum Gelingen
100 Feststellungen eines Outsiders (aus Gerlachs Blättern)
ZWEITER TEIL: DER UBALD-ZYKLUS. Eine kriminelle Zürcher Geschichte
Die Fotografin
Max Werner Ubald
Sonnentanz
Julia Mader
Das Werk
Gregor „Stoni“ Steiner
Drei Freunde
Diese Prosatexte wurden möglich dank Kurt Guggenheim und Ludwig Hohl. Insbesondere vier ihrer Werke kann ich ohne Zögern als Hauptinspiration nennen: Das Pferdchen und Nächtlicher Weg von Ludwig Hohl, Wilder Urlaub und die Figur des Aaron Reiss in Alles in Allem von Kurt Guggenheim.
Ludwig Hohl und Kurt Guggenheim: Was zu ihren Lebzeiten nicht möglich war, sollen diese Texte erreichen: die beiden zusammenbringen, ohne etwas erzwingen oder mich mit ihnen messen zu wollen. Ich wollte damit dem inneren Druck, dies tun zu müssen, Abhilfe schaffen.
Als Sommerbuch war der vorliegende Band gedacht: leicht und blumig, wie die Thymian- und Rosmarinbouquets im Süden – dass es vielmehr in der Sonne liegt, rund, glücklich, einem Seegetier gleich, das zwischen Felsen sich sonnt. Zuletzt war ich’s selbst, dieses Seegetier: fast jeder Satz des Buches ist erdacht, erschlüpft in jenem Felsen-Wirrwarr nahe bei G., wo ich allein war und noch mit dem Meere Heimlichkeiten hatte (Nietzsche, Ecce Homo).
Allein, der Geist verdüstert sich, sinnt dunkel und ruhelos oft, wenn der Tag am hellsten ist, wenn die Sonne senkrecht am Himmel steht. Man sehnt sich dann eine Quellwolke herbei, die das Licht abschirmt und die Sinne besänftigt. Aber: Ihm ist keine Ermöglichung des Ausruhens mehr gegeben! Er hat sich so weit von allem Umgebenden entfernt – es ist so gar nichts mitgekommen davon –; solange er in der Erhitzung seiner Tätigkeit lebte, war er geschützt: nun will er sich auf die Rasenbänke niederlegen – sie sind nicht mehr da. Des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege (Hohl, Notizen).
Zürich, September 2014
Patrick Thali
ERSTER TEIL
Die stille Maus
Die Kunst der Lebensführung
Sie wollte noch nicht nach Hause gehen, obschon sie fertig war mit ihrer Arbeit. Da und dort begrüßte sie Kolleginnen, die gerade frisch angefangen hatten. Sie schlenderte ziellos in der Halle herum. Sie wollte Zeit gewinnen. Draußen wartete nichts Gutes auf sie. Drinnen war sie geschützt. Sie war verheiratet mit einem Mann, der sie schlug. Ihr Gesicht war schmal geworden in den letzten Jahren. Schon lange schminkte sie sich nicht mehr. Ihre Augen schauten, als würde sie ständig weinen. Sie war es gewohnt, zu schuften. Mit verzweifeltem Blick trug sie die schweren Kisten herum. Ihr Körper lebte. Doch was war das für ein Leben? Sie atmete, ihr Körper existierte. Wozu eigentlich? Sie hielt von sich nicht viel, dachte vielleicht gar noch, sie hätte nichts Besseres verdient. Ihr Leben war nur ein zerquältes, glanzloses Dasein. Sie hatte sich hineingefügt. Wie hätte man an diesem Leben etwas ändern können? Sie selber wusste es ja auch nicht. Vielleicht dachte sie diesen Gedanken einige Male am Tag: Wozu eigentlich? Dieses leidige, bemühte, zerschlissene, hoffnungslose Leben. Leben, das es einfach gab, das niemand brauchte oder wollte, niemand liebte. Lieblosigkeit, Krieg und Einsamkeit. Schuld und Scham. Ein stilles, schreckliches Grauen.
Aber die Frage ist nicht: Wozu lebe ich eigentlich? Denn man lebt, man hat dazu keine Alternative. Verstehe ich, trotz allem, mich selbst zu bewahren? Das ist die Frage.
Säckinger
Sein Name war Säckinger. Er hatte den Willen zur Gesundheit nicht.
Paul Säckinger stand verloren vor der Vitrine eines Telefongeschäftes in der Löwenstraße, nahe dem Eingang zum Shopville. Er schaute sich lange die neuen Handymodelle an. In seinen Ohrmuscheln steckten weiße Kopfhörer. Sein Lieblingsstück von Pierre Patou lief:
Es war ein Sonntag und da stand sie vor mir und sie lachte mich an und ich glaubte es ihr …
Säckinger studierte die neuen Apparate, so schien es. Wer aber genau hinschaute, sah, dass seine Augen wässerig waren. Obschon er da stand, vor dem Schaufenster, ein wenig lächerlich in seiner vorgebeugten Haltung, betrachtete er schon lange nicht mehr das, was dahinter zum Kauf angeboten wurde. Ganz war er in seinen Gedanken bei diesem Lied, das ihn mit aller Kraft erfasste und erschütterte. Es erinnerte ihn daran, was er in seinem Leben hätte anders und besser machen müssen; und es hielt ihm vor, was ihm noch und was ihm nicht mehr möglich war.
Es war ein Sonntag und ich hab mir gedacht, dass die Liebe vergeht und verweht über Nacht …
Säckinger hob den Kopf und blinzelte in die Sonne. Es war ein warmer Junimorgen. Es ging gegen 9 Uhr.
Er hatte eine Entscheidung getroffen. Eigentlich müsste er schon seit einer halben Stunde im Geschäft sein. Heute Morgen aber trieb ihn etwas dazu, das 3er-Tram vorzeitig am Löwenplatz zu verlassen, statt über das Central zum Heimplatz hinaufzufahren. Unschlüssig streunte er eine Weile an den Schaufenstern der Löwenstraße entlang, nahm Platz in einem Café, bestellte einen Espresso, blieb dann einen Moment sitzen, die Holzwand gegenüber anstarrend, und nahm schließlich seine ziellose Wanderung wieder auf.
Säckinger schaute an sich hinunter. Seine dunkle Krawatte lag über dem blauen Hemd. Er trug sein Jackett offen. Dieses Etwas, das ihn vorzeitig aus dem Tram trieb, es hatte ihn erschreckt, schockiert. Er wusste, dass es um Denise nicht gut stand. Einmal hatte sie ihm gesagt, sie wäre krank. Er dachte damals, sie sagte dies, um Druck zu machen, um ihm einen Vorwurf zu machen, ihm damit mitteilend, dass er sie krank machte. Was hätte er dem entgegnen können? Ihr Zustand, wie er sie heute Morgen am Stauffacher durch das Tramfenster erblickte, sprach eine deutliche Sprache, schien ihn geradezu anzuschreien. Mager, verkommen, mit glasigen Augen, schleppte sie sich der Sihlbrücke entgegen, ziel- und haltlos. Säckinger wusste, dass er für ihren desolaten Zustand verantwortlich war. Er hatte sie damals zurückgewiesen. Seine Mutter meinte, für ihren Sohn hätte sie etwas „Besseres“ erwartet. Dabei hatte er gefühlt, dass Denise für ihn bestimmt war. Sie war eine liebenswürdige, junge Frau, die zu ihm passte. Er wusste, dass sie seit damals, seit ihrem abschließenden Gespräch, das ihre noch frischen, zarten Bande vorzeitig auflöste, auf ihn wartete, ihren Liebeskummer im Alkohol zu ertränken begann. Denise war unglücklich und verletzt, doch Säckinger fand den Mut nicht, auf sie zuzugehen, ihr die Hand zu reichen. Er war schwach. Er konnte sich nicht durchsetzen gegen seine Mutter. Er war kein wortgewaltiger Mensch und er scheute Konflikte. So blieb eine Wiederannäherung aus während der folgenden Jahre.
Schließlich starb Säckingers Mutter. Der Sohn hätte nun Gelegenheit gehabt, die Dinge neu zu regeln. Wenn auch spät, so hätte er sich und Denise zusammenbringen können. Um aber sein Gesicht zu wahren, blieb er bei seiner einst getroffenen Entscheidung. Was nicht hatte sein sollen zu einem bestimmten Zeitpunkt, musste auch später nicht mehr sein, redete er sich ein. Er betrog sich selber damit. Säckinger verharrte in Unverbindlichkeit und Unentschlossenheit. Beweglichkeit war seine Sache nicht. Denise blieb abgetan. In stillen Minuten, in einigen lichten Momenten jedoch erweichte er beim Gedanken an sie und es erfasste ihn Reue und eine stille Sehnsucht ob des abgelehnten, verpfuschten Glücks.
Es kommt ein Sonntag und da bin ich allein und ich geh durch die Stadt, um nicht einsam zu sein …
Säckinger ahnte, dass er sich mit seinem passiven, widerstandslosen Dahintreiben versündigt hatte. Versündigt am Leben eines anderen Menschen und somit an seinem eigenen. Diese Erkenntnis schwebte dunkel über ihm. Es nützte nichts, sich abzulenken bei einem Bierchen mit Arbeitskollegen oder sich zu bemühen um ein diszipliniertes Auftreten am Arbeitsplatz, sich gewissenhaft und gründlich auseinandersetzend mit der zu bearbeitenden Materie. Es vermochte seine dunkle Ahnung nicht zu verscheuchen, in einem wichtigen Bereich versagt, eine zentrale Aufgabe vernachlässigt zu haben. Denn, nicht wahr, Disziplin hat vielleicht weniger mit einem guten, kompetenten Auftritt zu tun als mit der Gewissheit, in zwischenmenschlichen Fragen seinen Aufgaben nachgekommen zu sein. Disziplinlos ist, so dachte Säckinger, wer es nicht für nötig erachtet, sich und andere durch einen mutigen Entscheid zu retten. Solange dieser Entscheid nicht gefällt war, würde er an seiner Disziplinlosigkeit erkranken. So spürte er denn auch in letzter Zeit, wie sein Herz nur mit Mühe sein schwermütiges Blut durch die Adern pumpte.
Wir tun gut daran, etwas gelingen zu lassen durch unser Dazutun, durch unsere Zustimmung, durch unser Einbringen, so gut es uns möglich ist, sagte in ihm eine Stimme. Lassen wir etwas in Bewegung kommen durch unser Bejahen. Tun wir dies nicht, oder verweigern wir den Willen zum Gelingen, ist die Alternative eine einfache: Es würde nichts sein in unserem Leben und im Leben derjenigen, die mit uns etwas entstehen lassen wollen.
Es kommt ein Sonntag und da denk ich daran, wie die Liebe begann und dann wieder zerrann …
Säckinger hörte in sich hinein, stand da mit einem wässerigen, ein wenig blöden Blick nirgendwohin. Er hatte eine Entscheidung getroffen. Sie war die Folge der Beantwortung einer Frage, die er sich in den Minuten nach dem Erblicken der kranken Denise, in denen das Tram die Kasernenstraße hinauf über die Gessnerbrücke gegen den Löwenplatz fuhr, gestellt hatte: Wenn Denise zugrunde ging, wenn sie es nicht schaffte, sich zu retten, wenn er es nicht fertigbrachte, sie zu retten, welches Recht hatte er auf Leben? Auf ein rechtschaffenes, gelungenes Leben? Es war ihm die Antwort so offensichtlich, so klar und bestechend, dass er keinen Augenblick an ihrer Richtigkeit zweifelte: Sein Dasein war falsch und sinnlos, wenn es ein Dasein blieb in der Anpassung, im unbeholfenen Sich-zur-Verfügung-Stellen, in der Widerstandslosigkeit. Das Leben forderte von ihm Engagement, dachte er, er aber wollte von seinem Leben nichts. Die Unterlassungssünde würde ihn abstrafen.
Säckinger setzte sich in Bewegung. Er ging die Löwenstraße hinauf, am Anfang noch bedächtig, dann immer schneller. Jetzt oder nie, sagte es in ihm drin. Schließlich rannte er. Es wirbelte ihn die Melodie des Liedes in seinen Kopfhörern durch die Traurigkeit seines Lebens am Löwenplatz vorbei Richtung Botanischer Garten. Er hatte so viel Zeit gehabt, dem nachzukommen, was ihn gerufen hatte, bald nun war diese Zeit abgelaufen. Jetzt oder nie mehr, Säckinger, flüsterte es unerbittlich ihm zu. Vielleicht war Denise noch in der Nähe der Sihlbrücke? „Denise!“, schrie er schnaufend auf der Höhe des Schanzengrabens, einen Schatten auf der anderen Straßenseite erblickend. War es Denise? Sie antwortete nicht. Die Sonne blendete ihn. Er vermochte die Frau nicht richtig zu erkennen. „Denise?“, schrie er noch einmal. Es war doch Denise! Aber was war los? Sie sah ihn nicht. „Denise, ich bin es, Paul!“, rief er dem Schatten zu. Denise erkannte ihn nicht mehr. Ihre kalten, leeren, verbrauchten Augen sahen nichts mehr. Es ist zu spät, durchfuhr es Säckinger. Die ungeheuerliche Gewissheit ob dieser Erkenntnis packte seinen ganzen Körper. Ein heftiger Schmerz durchzuckte ihn und ein heiserer, schon fast nicht mehr hörbarer Ruf, tief aus seiner Brust kommend, entwich seinen verzerrten Lippen: „Denise, ich liebe dich doch.“ Dann brach er auf dem Trottoir zusammen.
Säckinger sah sich von oben auf dem Gehsteig liegen, ein Schatten inmitten gleißenden Sonnenlichts, unbedeutend klein. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite drückte sich ein zweiter Schatten an der Hauswand entlang. Für einen flüchtigen Augenblick waren sie sich nahe, Denise und er. Es lag nur die Sihlstraße zwischen ihnen. „Gott, erbarme dich deiner Menschenkinder“, hörte er sich sagen, er, der sich nie für höhere Mächte interessiert, sich höchstens darüber lustig gemacht hatte. Säckinger meinte damit sich, Denise und viele unzählige andere.
Es trug ihn aus der Stadt hinaus. Er sah unter sich den Botanischen Garten, dann die Allmend, die Autobahneinfahrt in den Albis, weit vorne schon den Zugersee, die weißen Alpen der Zentralschweiz im hellen Sonnenlicht und den wolkenlos blauen Himmel.
Es war ein Sonntag und da stand sie vor mir und sie lachte mich an und ich glaubte es ihr …
Sein Name war Paul Säckinger, diesmal. Er lebte sein Leben, aber nicht seine Aufgabe. Er hatte den Willen zur Gesundheit nicht.
Der Süden oder die Traurigkeit, die nie mehr verging
Ja, wovor uns graut, ist nicht die Wirklichkeit, wie sie uns erscheint, sondern was wir in sie hineingeheimnissen. Jedes Individuum strahlt seine ihm eigentümliche Willensaura aus und beeinflusst durch diese Atmosphäre seine Umgebung.
Walter Mehring, Die verlorene Bibliothek
Prolog
Als ich erwachte, hörte ich, wie draußen ein starker Wind ging. Er pfiff durch das Geäst des Kastanienbaumes vor dem Haus. Ich schaute auf den Wecker auf dem Nachttisch. Es war 2.30 Uhr. Ich hatte einen seltsamen Traum gehabt, wirre Bilder in atemberaubender Geschwindigkeit rasten durch meinen Kopf. Ich hatte den Eindruck, verrückt zu sein. Alles war unlogisch und doch hatte ich im Traum die Gewissheit, dass ich es war, der diese Gedanken dachte. Es war dieses unlogische, exzessive, berauschte Denken, mein Denken, und doch war ich fremdbestimmt, als würde jemand mein Denken manipulieren wollen, als wollte mich jemand in den Wahnsinn treiben. Erleichtert atmete ich die kühle Luft nach dem Erwachen und war froh, dass es in meinem Kopf ruhig und klar war. Er war furchtbar gewesen, dieser Traum. Kaum hatte ich mich auf die andere Seite gedreht, den Schreck noch in mir, knallte draußen ein Schuss. Ich erhob mich, blieb im Bett sitzen. Der Wind pfiff und rauschte, sonst war nichts zu vernehmen.
I. Flucht
Vor drei Tagen, am Freitagmittag, setzte ich mich in den Wagen und fuhr los. In Zürich war es kühl, regnerisch. Nach Erstfeld entschloss ich mich, über den Pass zu fahren. Vor dem Gotthardtunnel gab es zwei Kilometer Stau. Schon nach Andermatt riss die Wolkendecke auf und ein tiefblauer, klarer Himmel wurde sichtbar. Auf 2000 Meter Höhe glänzte der Schiefer im gleißenden Sonnenlicht. Die Felsbrocken, die verstreut in der braun-grünen Graslandschaft lagen, warfen tiefe Schatten auf die Nordseite. Die Dreitausender waren schneebedeckt. Das Thermometer meines Wagens sank auf 9 Grad Celsius. Der Himmel war so klar, dass sein Blau in der Nähe der Sonne schon beinahe in ein Schwarz überging. In der Leventina dann stiegen die Temperaturen wieder über 20 Grad, in Bellinzona schließlich zeigte es 27 Grad an. Mir lief der Schweiß von der Stirn. Ich fuhr aus einer herbstlichen Landschaft in den Sommer zurück. In Locarno machte ich einen kurzen Halt, um etwas zu trinken und mein Gesicht aufzufrischen in der Toilette eines Restaurants am Ufer des Lago Maggiore. Es war heiß. Schließlich erreichte ich Ascona. Ich parkte den Wagen am Seeufer, gleich neben der Piazza. Für einen Augenblick setzte ich mich auf eines der Bänklein am Wasser. Die Sonne brannte auf die Granitblöcke am Ufer nieder. Hell leuchteten ihre Oberflächen. Ihre Rückseiten, dem Boden zugewandt, blieben im Schatten schwarz. Ich konnte kaum auf den See hinausschauen, so blendete das Licht. Möwen und eine Entenfamilie spielten auf dem Uferstück, das in seinem ursprünglichen, wilden Zustand erhalten war. Es bestand aus losem Gestein und Sand. Meine Uhr zeigte 17 Uhr.
Ich schlenderte die Piazza entlang und setzte mich schließlich an ein freies Tischchen an der Sonne in einem gutbesuchten Restaurant. Es wurde mir ein Saltimbocca und ein Glas Rotwein aufgetischt.
Es herrschte eine eigenartige Atmosphäre auf der Piazza. Eine übergewichtige Frau an einem Tisch vor mir nippte an einem Glas Prosecco. Ich hatte den Eindruck, dieser Mensch wäre voller Schuldgefühle, als hätte sie kein Recht auf dieses Glas Prosecco, als wäre sie auf der Flucht vor einer Aufgabe, die sie dort, in der Deutschschweiz, unerledigt zurückgelassen hatte. Sie war hier in den Tessin geflohen, weil sie sich dort, auf der Nordseite der Alpen, schuldig gemacht hatte. Aber tat ich denn etwas anderes? Dann näherte sich ein älterer Herr in einem Clownskostüm, er trug eine rote Nase. Nahe der vordersten Reihe der Tische baute er seinen Stand auf und eröffnete das Spektakel mit ein paar Kunstkniffen, mit denen er Flaschen und Becher auftauchen und verschwinden ließ. Er lächelte dabei ununterbrochen. Nach jedem gelungenen Trick stieß er ein müdes Lachen aus. Es war offensichtlich, er war seiner Arbeit überdrüssig und doch musste er ihr nachkommen. Ich legte mir ein paar Geldstücke bereit für den Fall, dass er mich darum bitten würde. Er aber schien ein schüchterner Mensch zu sein und holte sich nur bei einer Familie mit Kindern, die ihm auch wirklich zugeschaut hatten, an einem Tisch in der vordersten Reihe ein wenig Kleingeld. Er schaute ratlos um sich, dann auf den See hinaus, sein Lächeln war verschwunden. Schließlich packte er seine Sachen und zog weiter.
Ich blieb bis zum Sonnenuntergang sitzen, dann machte ich mich auf, ein Zimmer in einem Hotel in der Innenstadt zu suchen. Die große Wanduhr eines Uhrengeschäftes zeigte 19 Uhr. Ein Hotel Garni, gleich hinter der Piazza, schien mir im Preis vernünftig. Ich ließ mir das Zimmer zeigen. Es war klein, aber sauber und in tadellos gepflegtem Zustand. Ich holte meinen kleinen Koffer aus dem Wagen.
Anschließend machte ich einen ausgedehnten Spaziergang durch die Altstadt. Der Himmel war klar, Sterne und der aufgehende Mond wurden sichtbar. Ich ging durch die schwach beleuchteten Gassen. Zeitweise kam ich mir vor wie im Zürcher Niederdorf an einem Abend unter der Woche. In schmucken Schaufenstern präsentierten Kleider- und Bijouterie-Geschäfte vorteilhaft ihre Markenartikel. Dazwischen gab es einige Kunstgalerien, die ihren Werken mit respektablen Scheinwerfern den richtigen Auftritt gaben. Kein Mensch weit und breit. Die Stadt war wie ausgestorben. In einem Grotto, in dem offenbar gutes Essen serviert wurde, saßen schließlich einige Touristen auf Holzbänken nebeneinander bei einem Steinpilzrisotto. Ich kehrte ins Hotel zurück. Früh ging ich ins Bett und schlief sofort ein. Es war noch nicht 22 Uhr.
Es musste weit nach Mitternacht gewesen sein, als ich aufwachte. Draußen wehte ein starker Wind. Kühle, frische Luft strömte in das Zimmer. Ich hatte einen unangenehmen Traum gehabt.
Die Treppe zu einem Aussichtsturm war starkem Licht ausgesetzt. Ich versprach mir von dort aus eine tolle Aussicht über den Lago Maggiore bis weit nach Italien hinein und stieg diese Treppe hinauf. Ich hatte Mühe, die Absätze zu erkennen im blendenden Licht. Es war sehr warm. Mühsam kämpfte ich mich nach oben. Zeitweise wurde mir schwindlig, die Absätze waren schwarze Flecken, Schatten. Die Landschaft war weiß, ich konnte kaum etwas erkennen. Als ich oben auf der Plattform ankam, erfasste mich eine Windböe, ich musste mich am Geländer festhalten. Der Turm war sehr hoch und schwankte, drohte wegzukippen unter meinen Füßen. Da sah ich eine Frau am Geländer stehen. Sie stand mit dem Rücken zu mir. Ich sah ihr langes, schwarzes Haar. Ich wusste sofort, wer sie war: Chantal. Sie drehte sich um und sah mich mit ihren schwarzen Augen an. Ich erschrak. Dann hörte ich sie sagen: „Ich liebe dich, aber du willst meine Liebe nicht.“ Ihre Augen waren kalt und hasserfüllt. Wollte sie mich hinunterstoßen? Plötzlich stand sie dicht neben mir. Ich wagte nicht, sie anzuschauen. Ich wollte ihre Augen nicht sehen. Ich wusste, wer Chantal war: eine Besessene. Mit einem Ruck drehte ich mich um und stieß sie mit aller Kraft von der Plattform. Ob sie stürzte, konnte ich nicht sicher sagen, eher kam sie auf mich zu. Ich hörte einen Schrei, dann erwachte ich.
Am Samstagmorgen war der Himmel wolkenüberzogen. Es sah nach Regen aus. Ich mietete nach dem Frühstück ein Fahrrad und durchfuhr das Maggiadelta. Die Trauben waren bereits reif, auch die Äpfel. Das Laub der Bäume begann sich zu verfärben. Die Maggia führte wenig Wasser. Beim Segelschiffhafen, hinter dem Golfplatz, saß eine Frau auf einer Bank und sah auf das Wasser hinaus. Ich erschrak. Sie hatte dunkelbraunes Haar und trug eine Sonnenbrille. Ich schaute genauer hin. Nein, es war nicht Chantal. Es war unwahrscheinlich, dass Chantal hier war. In Zürich wäre eine Begegnung wahrscheinlicher gewesen. Am frühen Nachmittag setzte Regen ein. Ich kehrte ins Hotel zurück, zahlte auch den angebrochenen Tag und packte meinen kleinen Koffer. Eigentlich wollte ich länger bleiben, aber nun war auch hier, im Süden, der Herbst eingekehrt. Die Lufttemperatur stieg nicht mehr über 17 Grad.
Ich fuhr zurück über den San Bernardino. Das Radio meldete wieder Stau vor dem Gotthard. Auf 1500 Metern war es neblig, kühl und nass. Das Thermometer zeigte noch 9 Grad. Auf der Nordseite, nach dem Tunnel, regnete es noch stärker. Die Fahrt auf der nassen Straße war mühsam. Ich kam nur langsam voran. Zum Glück gab es wenig Verkehr. Im Heidiland machte ich Halt für eine Suppe. In der Linthebene hatte es nebst starkem Regen noch Windböen. Zeitweise war die Sicht, auch bei vollem Betrieb der Scheibenwischer, miserabel. Als ich in Zürich ankam, dunkelte es bereits. Ich hatte fast vier Stunden gebraucht für die Rückfahrt. Es war 18.30 Uhr.
II. Chantal
Chantal war einer jener Menschen, denen man ihre Exzentrik nicht ansah. Gepflegt, gediegen, schön, wirkte sie im Umgang besonnen, selbstbewusst und abgeklärt. Dass hinter der ruhigen Fassade der Besonnenheit und Gediegenheit ein wildes Feuer loderte, wussten nur diejenigen, die mit ihr besser bekannt waren. Ich gehörte zu denen, die Chantal gut kannten. Wir hatten ein Verhältnis, über zwei Jahre. Chantal war in ihrer Leidenschaft absolut. Sie wollte besitzen, was ihr gefiel. Ihr Machtanspruch und das Bedürfnis der Kontrolle über jemanden, den sie als Freund einstufte, waren selbstverständlich. Für mich war sie ein Mensch, an dem man zugrunde ging. Ich wusste, dass sie mich liebte, dass ihre Leidenschaft mir galt seit jenen Tagen. Ich wusste, dass Chantal mich im Auge, mich ausgewählt hatte auch in den Jahren, in denen es vordergründig ruhig blieb, in denen ich sie kaum sah und nichts von ihr hörte. Sie besuchte mich in meinen Träumen. Sie manipulierte mein Denken, wenn ich im Bett lag und schlief. Ich wusste, dass sie auf den geeigneten Moment wartete, um mich zu holen. Meine Aufgabe bestand darin, diesen Moment zu verhindern, ihn unmöglich zu machen. Was konnte ich tun? Ich sah zwei Möglichkeiten: Entweder machte ich mich unerreichbar, indem ich die Flucht ergriff und verschwand, oder ich machte mich ungenießbar, unattraktiv, der Liebe dieser Frau unwürdig. Eine dritte Möglichkeit, sie unschädlich zu machen, kam für mich nicht in Frage. Ich war kein gewalttätiger Mensch. Ich wollte und konnte nicht in das Leben anderer eingreifen, über deren Leben bestimmen. Aber ich konnte auch nicht zulassen, dass andere in mein Leben eingriffen. Dass Chantal dies nicht begriff, nicht begreifen konnte, machte mich hilf- und ratlos. Ich hatte also zwei Optionen, um mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ich tendierte zur ersten, der einfacheren.
Am Samstagabend, nach der ermüdenden Rückreise aus dem Tessin, machte ich trotz Regens einen Spaziergang am Limmatquai entlang. Die frische Luft tat mir gut. Die Stadt war erstaunlich leer, was mir sehr behagte. Menschenauflauf hatte ich noch nie gemocht. Ich wurde den Eindruck nicht los, dass mich jemand beobachtete, als würden zwei Augen an meinem Rücken haften. Ich drehte mich um. Es war niemand da. Nur die Limmat rauschte beträchtlich, sie musste viel Wasser haben. Ich befand mich auf der Höhe des Grand Cafés. Durch die großen Fenster sah man in das Innere des hell und warm erleuchteten Lokals. Es gab nur wenige Gäste. Ich trat ein, setzte mich an einen freien Tisch und bestellte einen Salatteller. Ich saß dem Limmatquai abgewandt, als ich erneut ein starkes Gefühl hatte, dass jemand draußen vor dem Fenster stand und hineinschaute. Ich konnte dem Impuls nicht widerstehen, mich umzuwenden, um zu sehen, ob ich mit meinen Befürchtungen richtig lag. Es war in der Dunkelheit draußen niemand zu sehen, menschenleer war der Limmatquai. Der Regen hatte noch zugenommen. Der einzige Mensch, den ich sah, war mein Spiegelbild in der von innen beleuchteten Fensterscheibe: ein angstverzerrtes, gehetztes Gesicht. War das wirklich ich? Wer war ich eigentlich?
In der Nacht auf Sonntag suchte mich Chantal heim in einem unangenehmen Traum. Ich saß an einem Tischchen im Grand Café, draußen auf der Terrasse, für einen Milchkaffee. Die Sonne schien mir ins Gesicht und blendete stark. Helles Licht war überall. Trotzdem erriet ich eine Person, eine Silhouette, oben beim Brunnen des Lindenhofes. Ihr Haar flatterte im Abendwind. Ich sah ihr Gesicht nicht, dafür war sie zu weit weg und zu unkenntlich im Gegenlicht. Aber ich wusste, es war Chantal. Sie beobachtete mich, wie ich unten, an meinem Tischchen, meinen Kaffee trank und auf den Limmatquai hinausschaute. Plötzlich war sie verschwunden. Der Schweiß rann mir über die Stirne. Ich tastete nach einer Serviette und versuchte, so gut es ging, das Salzwasser aus den Augen zu wischen. Als ich wieder sehen konnte, stand jemand unmittelbar vor mir, über mir, vor der Sonne. Ich erblickte die schwarze Silhouette mit flatternden Haaren, die vorher beim Brunnen oben gestanden hatte, auf Berührung nahe bei mir. Ich erhob mich taumelnd, der Stuhl hinter mir fiel um. Ich verlor das Gleichgewicht und stürzte. Dann erwachte ich.
III. Aufbruch
Draußen pfiff und rauschte der Wind durch den Kastanienbaum, immer noch saß ich im Bett. Da klingelte es an der Tür. Ich erschrak. Der Wecker zeigte 2.40 Uhr. Es klingelte nochmals. Ich erhob mich, schlich in den Flur und spähte durch das Guckloch. Es war niemand im Treppenhaus erkennbar. Ich öffnete die Balkontüre und sah zur matt beleuchteten Türe hinunter. Niemand. Ich schaute in den wolkenverhangenen Nachthimmel. In der Dunkelheit waren die Bäume, die neben dem Haus nahe dem Waldrand standen, kaum sichtbar. Eine feuchte, kühle, regnerische Luft zog über den See und die Stadt das Limmattal hinunter. Ich kehrte ins Schlafzimmer zurück und legte mich wieder hin.
Es war offensichtlich, ich musste etwas unternehmen. Ich war verheiratet gewesen bis vor einem Jahr. Meine Frau, ein liebenswürdiger Mensch, hatte es nicht mehr ausgehalten. Zuerst glaubte sie mir noch, wenn ich ihr sagte, dass für mich mein Verhältnis mit Chantal abgeschlossen, dass von mir aus die Sache beendet wäre, definitiv, unwiderruflich, dass jeder Versuch der Annäherung nicht von mir kommen würde. Sie glaubte es mir und doch, irgendwann kippte sie. Warum? Ich wusste es nicht. Hatte sie mit Chantal Kontakt aufgenommen? Hatte sie mit ihr geredet? Hatte Chantal sie aufgesucht, ihr gedroht? Hatte Chantal ihr unwahre Dinge erzählt, kompromittierende Szenarien erfunden? Ich wusste es nicht. Wenn es darum geht, jemanden zu schädigen, sind viele Mittel recht. Was ist Wahrheit, was Lüge? Wer ist aufrichtig? Wer ist korrupt, intrigant? Wenn man immer genau wüsste, aus welchen Motiven heraus Menschen handelten, wäre vieles einfacher. Aber man weiß es eben nie ganz genau. Man hat Vermutungen, Instinkte, Gefühle, aber selten Beweise. Es gab damals nichts, das man wirklich klar hätte belegen können. Meine Frau war mir plötzlich fremd. Sie sprach kaum mehr mit mir. Es gab einen Vertrauensbruch zwischen uns. Es gelang mir nicht, sie auf meine Seite zurückzuholen. Denn so viel hatte ich begriffen: Es gab zwei Seiten, meine und die Chantals. Meine Frau befand sich zwischen diesen beiden Polen. Obschon es für mich nie diese beiden Seiten gegeben hatte, musste ich ihr Dasein aufgrund des Verhaltens meiner Frau anerkennen. Kurz vor der Scheidung fragte sie mich: „Wie geht es Chantal?“ Sie brachte mich hartnäckig, bis zu unserer Trennung, mit ihr in Verbindung, obschon es diese Verbindung nicht gab. Aber wie gesagt, ich konnte nicht dagegen ankommen. In dieser ganzen verwickelten und unguten Geschichte machte ich mich zweifach schuldig: Ich machte mich schuldig gegenüber Chantal, weil ich ihre Liebe nicht erwiderte, und ich machte mich schuldig gegenüber meiner Frau, weil ich es nicht schaffte, sie von der Stärke unserer Verbindung zu überzeugen.
Ich packte am Montagmorgen meinen Koffer erneut. Der Regen hatte nachgelassen, immer noch war es bewölkt. Es war noch früh, noch kaum richtig hell. 6 Uhr.
Als ich das Gepäck im Kofferraum des Wagens verstaute, hatte ich erneut das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Ich drehte mich um. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite nahm Herr Buggmann, mein frisch pensionierter Nachbar, die Zeitung aus seinem Briefkasten. Er lächelte. Wir grüßten uns mit einem kurzen Kopfnicken. Ich stieg in den Wagen und fuhr los. Die Bauarbeiten auf der A1 machten die Reise beschwerlich. Zeitweise ging gar nichts mehr. Bei Härkingen stand ich fast 20 Minuten. Schließlich lockerte sich der Verkehr nach Bern und ich entschied mich für ein anständiges Frühstück bei der nächsten Ausfahrt. Eine freundliche junge Frau servierte Brot, Butter, Erdbeermarmelade und einen Krug voll Milchkaffee in einer Konditorei neben der Post eines Ortes, den ich nicht kannte. Sie erinnerte mich ein wenig an meine Frau. Diese hatte ihr blondes Haar auch stets zusammengebunden getragen.
Ich hatte mir gestern – es regnete den ganzen Tag über und ich verließ das Haus nicht – Fotos angeschaut von Reisen, die meine Frau und ich zusammen gemacht hatten. Wir hatten einiges unternommen. Es gab Bilder von Brasilien, Kanada, Südafrika, Frankreich. Einmal sie, einmal ich auf dem Bild. Im Hintergrund waren das Meer, ein See, ein Wald, ein Strand erkennbar. Ein Foto aus dem Süden Frankreichs schaute ich mir genau an. Porquerolles. Meine Frau saß an einem Tisch, draußen auf der Terrasse eines Lokals, und trank einen Orangensaft. Sie hielt das Glas mit einem Lächeln nach oben. Hinter ihr war der Eingang ins Lokal erkennbar. Schwach war eine Person an der Bar im Inneren auszumachen. Zur Hälfte war sie bedeckt von der Angestellten, die ein Tablett mit leeren Gläsern hineintrug. Ich erschrak. Ich kannte die Silhouette. Die Person schaute in die Kamera. Ich hatte das Foto gemacht damals. Aber ich hatte nichts bemerkt.
Um 10 Uhr durchfuhr ich den Zoll bei Genf. Der Himmel war locker bewölkt, aber es war kühl. Um 12 Uhr war ich in Lyon. Ich parkte den Wagen am Rhôneufer und setzte mich für ein Mittagessen an einen Tisch in einem Restaurant am Place Bellecourt. Mich irritierte ein Betrunkener, der an einer Ecke unweit von meinem Tisch auf einem Treppenabsatz saß und auf einer Blockflöte vor sich hin dudelte. Dabei rauchte er eine Zigarette, die er im Munde ließ während des Spielens. Schließlich nahm er die Flöte von den Lippen, mit der anderen Hand mühselig die Zigarette aus dem Mund, wusste dann nicht, was machen mit Flöte und Zigarette in beiden Händen, und warf schließlich die Zigarette weg, darauf griff er zur Bierdose und nahm einen Schluck. Dann nestelte er umständlich mit der rechten Hand eine neue Zigarette aus dem zerdrückten Pack, steckte sie in den Mund, griff zum Feuerzeug und zündete sie an. Nach drei Versuchen brannte sie. Die linke Hand umklammerte stets die Flöte. Nach einem unzufriedenen Kopfschütteln setzte er schließlich die Flöte neu an und dudelte, ganz passabel, Mull of Kintyre. Er nahm sich diesmal wirklich zusammen. So kann man auch leben, dachte ich. Sich gehenlassen, im Alkohol versumpfen. Irgendwann lassen einen die anderen in Ruhe. Niemand ist gern Zeuge, wenn sich einer selber liquidiert.
Nach Lyon ging es schnell. Die Wolken verzogen sich und gaben die Sicht frei auf einen makellos blauen Himmel. Die Sonne brannte nieder in einer Kraft, die den Süden verriet. Das Thermometer, in Genf noch bei 13 Grad, stieg nun plötzlich auf 25 Grad. Ich öffnete die Fenster für frische Luft. Ich brauchte für die Strecke von Lyon bis Toulon knappe drei Stunden. Gut, ich fuhr schnell, oft zu schnell, aber das war bei dem sehr guten Zustand der französischen Autobahnen kein großes Risiko. Als ich mein Zimmer bezog in einem einfachen Hotel in Giens, war es immer noch warm, die Sonne schien über dem Meer. Es war 18 Uhr. Aus dem Fenster meines Zimmers hatte ich Sicht auf Porquerolles. Gerade kam eine der Fähren zurück, welche die Insel in dichtem Fahrplan mit dem Festland verbanden. Ich nahm eine kalte Dusche, legte mich für 15 Minuten hin. Dann zog ich mich an und ging hinunter in den Speisesaal. Die Terrasse im Westen wurde vom warmen Sonnenlicht durchflutet. Ich entschied mich dafür, draußen zu essen.
IV. Gewissheit
Ich nahm das 10-Uhr-Schiff am nächsten Morgen. Auf dem Oberdeck waren in der prallen Sonne viele Plätze frei. Blau erstreckte sich der Himmel bis zum Horizont, wo er durch das ebenfalls blaue Meer abgelöst wurde. Es ging ein angenehmer Wind. Ich hatte gut geschlafen und war ruhig und gelassen. Die liebliche, freundliche Mittelmeerlandschaft gab mir Mut. Auch war ich von der Richtigkeit meiner Unternehmung überzeugt. Ich hatte Energie und Kraft, mich den Dingen zu stellen. Badehose und ein Tuch trug ich in einem kleinen Rucksack bei mir. Ich wollte am Nachmittag auf der felsigen Seite der Insel schwimmen gehen. Das Schiff brauchte 20 Minuten für die Überfahrt. Es waren nicht viele Passagiere an Bord, obschon das Wetter nicht besser sein konnte.
Der Hafen lag fünf Gehminuten von der Straße entfernt, in der sich die meisten Restaurants befanden. Es war alles fast unverändert geblieben. Sofort fand ich die Terrasse wieder, wo meine Frau gesessen hatte mit dem Glas Orangensaft in der Hand. Ich betrat das Innere des Lokals. Ein älteres Ehepaar trank einen Kaffee an einem Tisch, ansonsten gab es keine Gäste. An der Bar arbeitete eine junge Frau. Es war nicht die, die auf dem Foto das Tablett in der Hand hielt. Ich ging zu ihr hin. „Chantal est ici?“, fragte ich sie.
„Elle est dans son bureau. Vous voulez que je l’appelle?“ „Oui, ce serait gentil.“ Sie ging nach hinten, dann hörte ich Gemurmel. Schließlich kam sie zurück. Hinter ihr ging eine ältere Dame. Es war Chantal, ohne Zweifel. Aber ich erschrak nicht, als sie vor mir stand, denn es war nicht die Chantal, die ich kannte. Vor mir stand eine graumelierte, gutaussehende, aber abgekämpfte Frau. Sie hatte das Gesicht von jemandem, der für den Lebensunterhalt einer Familie aufkommen musste. Da war nichts von der Gier und der Leidenschaft eines pervertierten, kranken Menschen. Ihre Augen trugen die Wärme und den Schmerz einer liebenden, besorgten Mutter. Dann sah ich ihre Familienfotos an der Wand neben der Bar. Da war Chantal mit ihrem Mann zu sehen, vor dem Eingang ihres Restaurants, zwischen ihnen ihre drei Kinder.
Chantal lebte ihr Leben. Das war nicht die Frau, die mich verfolgte, mich besitzen wollte, mich in meinen Träumen heimsuchte. Die Chantal, die da vor mir stand, kannte mich kaum mehr und hatte ganz andere Sorgen. Als sie mich erblickte, meinte ich in ihren Augen Angst auszumachen. Von Freude konnte keine Rede sein. Chantal hatte helle Augen, viel heller, als ich sie in Erinnerung hatte, all die Jahre.
V. Heimsuchung
Am Mittwoch fuhr ich nach Zürich zurück. Es war eine mühselige Fahrt durch Regen. Das Wetter hatte umgeschlagen. Ein feuchter Südwestwind trieb ein Sturmtief gegen Europa. Zeitweise konnte ich auf der Autobahn nicht schneller als 60 Stundenkilometer fahren. Völlig erschöpft kam ich zuhause gegen 22 Uhr an und ging sofort schlafen.
Als ich erwachte in jener Nacht, hörte ich den Wind durch das Geäst des Kastanienbaumes vor dem Haus pfeifen. Ich schaute auf den Wecker auf dem Nachttisch. Es war 2 Uhr. Erneut hatte ich einen seltsamen Traum gehabt, wirre Bilder in atemberaubender Geschwindigkeit waren durch meinen Kopf gerast. Erleichtert atmete ich die kühle Luft. Kaum hatte ich mich auf die andere Seite gedreht, den Schreck noch in mir, knallte draußen ein Schuss. Ich setzte mich auf. Der Wind pfiff und rauschte, ansonsten war nichts zu vernehmen. Ich erhob mich, holte die Taschenlampe aus dem Korridorschrank, öffnete die Balkontüre und machte die Lampe an. Ich sah sofort, dass das Polster meines Liegestuhls durchlöchert war. So gut es ging, suchte ich mit dem Lichtstrahl die Gegend unter dem Balkon ab. Hinter dem Kastanienbaum bewegte sich etwas. Ich leuchtete nochmals hin. Ihre gelben Haare klebten wirr und nass am Kopf, ihre Kleider waren vom Regen durchtränkt, sie schaute zu mir hinauf – mir direkt in die Augen. Ich war wie gelähmt. Dann bellte ein zweiter Schuss. Ich sackte zusammen. Ein wilder Schmerz durchfuhr meinen Oberarm. Dann fiel ich über den Liegestuhl. Für einen Moment musste ich bewusstlos gewesen sein. Schließlich schaffte ich es, mich ins Schlafzimmer zu schleppen. Ich griff zu meinem Handy, das auf dem Nachttisch neben dem Wecker lag, und rief die Polizei. Schon bald hörte ich das Blaulicht des sich nähernden Krankenwagens.
Epilog
Ich habe mich in Genf ganz gut eingelebt im Verlaufe des letzten Jahres. Von meiner Mietwohnung aus sieht man direkt an den Salève. Es ist schön hier. Mir geht es so weit gut, ich habe mich erholt von der Verletzung am Oberarm. Es war nicht weiter schlimm, eine Hautschürfung. Die Patrone fand man in der Mauer neben der Balkontüre, ebenso wie zwei weitere Einschüsse. Meine Ex-Frau wurde in eine Klinik eingewiesen. Ich wollte mit meinem Umzug nach Genf einen definitiven Schlussstrich ziehen unter meine Vergangenheit. Ich denke, es ist mir so weit auch gelungen. Meine Träume sind harmlos. Keine Drohszenarien mehr, keine Manipulation spüre ich in den Bildern im Schlaf. Nur heute Nacht hatte ich so etwas wie einen Rückfall. Aber ich möchte dem Ganzen kein Gewicht mehr geben. Ich habe heute meine neue Freundin, ein charmantes, nettes Mädchen, das ich vor zwei Monaten in einer Bar kennengelernt habe, zu einem Picknick eingeladen. Ich habe dafür in einen Korb allerhand eingepackt: Käse, Trauben, Brot, Äpfel und eine Flasche Rotwein. Das Wetter spielt mit. Für einen Septemberabend ist es erstaunlich mild. Die Sonne scheint, was will man mehr. Sie müsste eigentlich jeden Augenblick auftauchen. Es ist 18 Uhr. Sie hat bereits eine Viertelstunde Verspätung. So wie ich sie kenne, ist das nicht ihr Stil. Ich tippe ihre Nummer auf dem Handy. Keine Antwort. Für eine Sekunde habe ich das Gefühl, jemand steht hinter einer der Pappeln, die den Kiesweg nach oben zu der Villa säumen. Ich drehe mich um. Ihren blondgefärbten Pferdeschwanz sehe ich zuerst, ich zucke zusammen. Aber jetzt – na so was, da ist sie ja, Janine! Aber sie schaut ganz erschreckt. Was ist los? „Janine, was ist los, was hast du?“, rufe ich ihr entgegen. „Da ist eine Frau, die hat eine Pistole“, sagt sie, „dahinten steht sie.“ Sie zeigt mit der Hand in die Richtung des Parkeingangs. „Jetzt willst du mich aber auf den Arm nehmen“, sage ich. Ich habe ihr vor Kurzem meine Geschichte erzählt. Ich schaue sie an. Immer noch hat sie einen erschreckten Gesichtsausdruck, doch plötzlich lächelt sie. Ihre schwarzen Augen funkeln mich an. „Hast du Angst gehabt?“, fragt sie mich. „Nein, warum sollte ich?“ Aber ich lüge mit meiner Antwort. Zum ersten Mal sehe ich, dass ihre Augen keine guten Augen sind. „Sag mal, Janine, warum färbst du dir die Haare eigentlich blond?“, frage ich sie. „Ich sehe sonst aus wie eine Hexe, ich habe ganz schwarzes Haar“, meint sie. „Aber bist du denn keine?“ „Spinnst du?“ „Wahrscheinlich.“ Ich lege die Esswaren auf dem Tuch zurecht. Mein Leben verläuft in bekannten Bahnen. Ich muss damit umgehen. Mein Schicksal nimmt seinen Lauf. Ich lebe in meiner Wahrheit. „Lass es dir schmecken, Janine, nimmst du ein Glas Rotwein?“ „Ja, gerne.“ „Auf uns!“ Wir stoßen an. „Auf uns“, sagt sie und gibt mir einen Kuss.
Der Einzelgänger
Dass Einzelne anders empfinden und schmecken, das hat gewöhnlich seinen Grund in einer Absonderlichkeit ihrer Lebensweise, Ernährung, Verdauung, vielleicht in einem Mehr oder Weniger der anorganischen Salze in ihrem Blute und Gehirn, kurz in der Physis. Sie haben den Mut, sich zu ihrer Physis zu bekennen und deren Forderungen noch in ihren feinsten Tönen Gehör zu schenken: ihre ästhetischen und moralischen Urteile sind solche feinsten Töne der Physis.
Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft
- I -
E