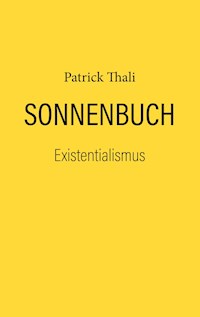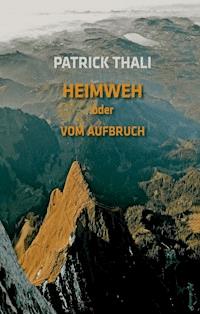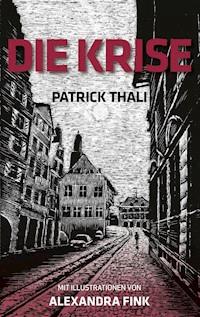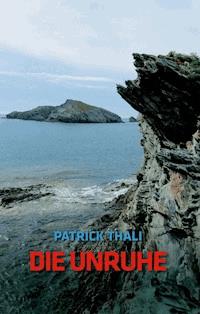
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zürich, Genf, Südfrankreich, Die Goldinseln. Atmosphären und Beobachtungen in der Nacht und im Sonnenlicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
VOM ABSCHIEDNEHMEN
ERNST UND SPASS
LEBENSKRAFT UND LEISTUNG
MUSIK UND KUNST
SCHREIBEN UND REDEN
DIE VISION ODER ÜBER WAHRNEHMUNG
VOM ANNEHMEN UND AUFGEBEN
VON DINGEN, DIE ANDERS HÄTTEN SEIN KÖNNEN
Vorwort
Auf dem Weg durch mein Leben habe ich mich verlaufen. Was hast du getan?
Um die Zeit herumzubringen und um meine Langeweile zu dämpfen, bin ich fremdgegangen. Ich suchte das Amüsement. Nun bin ich mir selber fremd geworden. Im Amüsement auf dieser Erde habe ich mich verlaufen.
Nicht Zerstreuung ist Sinn unseres Daseins, sondern das Tiefenschauen? Willst du dies damit sagen?
Dass Frauen und Männer sich darin gleichen, im andern eine Heimat finden zu wollen und ihm eine Heimat zu sein, dies will ich sagen. Im Fremdsein auf dieser Erde gleichen sich zu viele. Eine Heimat zu erlangen verlangt von uns Entschlossenheit zum Einzelgang, dem Einzelgang hin zur Treue.
Mai 2016
Patrick Thali
I. VOM ABSCHIEDNEHMEN
1 Über das Gelingen oder Scheitern eines Lebens
Wenn wir über das Gelingen oder Scheitern eines Lebens nachdenken, sollten wir uns zuerstKlarheit darüber verschaffen, ob derjenige, den die Untersuchung betrifft, liebesfähig war.
Ankunft
Der Zug fuhr pünktlich um 18.15 Uhr in den Hautbahnhof Zürich ein. Ich hatte Emma schon vom Flughafen aus eine SMS geschickt. Ich wollte ihr damit meine unerwartete Ankunft in der Schweiz kundtun.
– Noch blieb ihre Antwort aus.
Schließlich stand ich mit meinem Koffer in der Ankunftshalle. Es war drückend warm. Sofort klebte mir der Hemdkragen im Nacken. Ein junger Typ rempelte mich an. Offenbar störte ich. Ich erblickte den Glaskubus eines neuen Restaurants, das es bei meinem letzten Zürich-Aufenthalt noch nicht gegeben hatte. Time stand in weißen Leuchtbuchstaben angeschrieben. Wahrscheinlich war das Lokal klimatisiert. Mit meinem schweren Koffer durchquerte ich die Menge, nahm den Lift hinauf und setzte mich an einen Tisch gleich am Fenster. Ich versuchte, Emma telefonisch zu erreichen. – Sie nahm nicht ab. Ich bestellte einen Martini.
Die Reise war beschwerlich gewesen. Schon in São Paulo hatte sich am Vorabend der Abflug um fast zwei Stunden verspätet. Es gab technische Probleme, das Boarding wurde verschoben. In Lissabon verpasste ich dadurch am Morgen die geplante Anschlussmaschine nach Zürich und musste mein Ticket auf den Nachmittagsflug um 14.30 Uhr umbuchen. Ich verbrachte Stunden an einem Tisch einer Pizzeria in der Verpflegungssektion des Flughafens mit Lesen.
Einen Teil meiner vierundzwanzig freien Tage wollte ich in der Schweiz verbringen. Ich war Schweizer, meine
Eltern lebten in Wollishofen. Meine Tätigkeit als Ingenieur einer Bohrplattform vor der Küste Vitórias, Brasilien, verpflichtete zu einem sechzehntägigen „Offshore“-Aufenthalt, währenddessen ich die Ölbohrinsel nicht verlassen konnte. Darauf folgten vierundzwanzig Tage Erholungszeit. Ich bewohnte, wie alle Mitarbeiter, ein Zimmer in einem Container.
Ich versuchte nochmals, Emma zu erreichen. Sie nahm nicht ab. Ich bezahlte meinen Martini und verließ den Bahnhof Richtung Niederdorf. Ich schätzte die Lufttemperatur auf weit über 30 Grad. Die Sonne schien, die meisten Passanten auf der Bahnhofbrücke waren mit kurzen Hosen, leichtem T-Shirt und Sandalen bekleidet. Einige hatten einen Schirm aufgespannt, zum Schutz vor der Sonne. So etwas hatte ich in Zürich noch nie gesehen. Man hatte den Eindruck, die Hitze erdrückte die Leute.
Im Hotel Limmatblick, gleich beim Central, fand ich ein Zimmer mit Sicht auf den Fluss, auf der gegenüberliegenden Seite das Coop-Provisorium und die Amtshäuser. Bei meinen Eltern zu übernachten kam nicht in Frage. Sie lebten in einer kleinen, bescheidenen Wohnung in der Butzenstraße. Ich konnte mir ein Hotel in Zürich leisten. Zudem wussten sie nicht, dass ich hier war.
Nach einer kalten Dusche zog ich mir leichtere Kleider an. Ein Sommerhemd mit kurzen Ärmeln, eine weiße Leinenhose und Sandalen waren das Richtige bei diesem Wetter. Ich verließ das Hotel und ging gemächlich den Limmatquai hinunter. Auf der Münsterbrücke blieb ich einen Moment stehen und schaute auf die Alpen. Das späte Nachmittagslicht tauchte sie in ein warmes Gelb. Im Biergarten auf dem Bauschänzli verlangte ich ein halbes Poulet, dazu einen Zweier Roten aus dem Offenausschank und setzte mich mit dem Tablett an einen der grünen Tische gleich beim Eingang, von der Musik und der Tanzfläche genügend weit entfernt. Ich wollte in Ruhe zu Abend essen.
Erneut wählte ich Emmas Nummer. Es klingelte nur kurz, dann kam das Besetztzeichen, als habe jemand den Anruf vorzeitig beendet. Ich holte mir eine Tasse Kaffee am Buffet und schaute dann eine Weile der tanzenden Gesellschaft zu. Ein Unterhaltungstrio spielte Schlager und Hits aus vergangenen Jahren. Gerade war Waterloo von ABBA an der Reihe, gefolgt von Heinos Blau blüht der Enzian.
Ich wählte Charlies Nummer. Charlie Murer war ein alter Freund von mir. Wir hatten zusammen an der ETH studiert. Er könnte etwas wissen von Emma, dachte ich, er kannte sie ja auch. Es gab eine Zeit, in der wir zu dritt durch die Bars der Stadt zogen. Es war keine schlechte Zeit, doch irgendwann wollten Emma und ich allein sein. Wir wurden ein Paar.
Mein Anruf blieb ohne Antwort.
Während meines Gangs durch die Dreikönigstraße zum Hotel Hyatt dunkelte es ein. Immer noch war es sehr warm. Am Schanzengraben betrachtete ich nochmals die orange schimmernde Alpenkette hinter dem See. Bald würde man sie nicht mehr erkennen in der Nacht.
Vielleicht war Charlie an der Hotelbar, wie früher, und er hatte meinen Handyanruf überhört. Ich trat durch den Seiteneingang ein und bestellte am Tresen einen Appenzeller. Dann schaute ich mich ein wenig um. Ich kannte niemanden, Charlie war auch nicht da. Eine blondierte Lady, offenbar ein wenig angetrunken, blickte mir tief in die Augen und lächelte verwegen. Ich stürzte den Verdauungsschnaps hinunter, zahlte und brach auf. Wo nur war Emma, warum gab sie keine Antwort? Wegen ihr war ich in die Schweiz gereist, ich wollte mit ihr etwas besprechen. Ich ging zurück in mein Hotel am Limmatquai und legte mich hin.
Die Stadt
Am folgenden Morgen gegen 9 Uhr betrat ich für ein ausgiebiges Frühstück das Central Café. Ich hatte einen Tisch gleich am Fenster, das für ein wenig Frischluft geöffnet war. Ich ließ mir Zeit für das Essen. Anschließend las ich eine Tageszeitung und ließ mir ab und an Kaffee nachschenken. Bereits nach dem Erwachen hatte ich Emma eine SMS geschickt. Es ging nun gegen 10.30 Uhr. Noch immer hatte sie nicht geantwortet. Ich bezahlte und verließ das Lokal.
Es war bereits wieder drückend warm draußen. Die Sonne schien von einem makellos blauen Himmel. Ich entschloss mich zu einem Bad im See. Als ich die Tramgleise am Central überquert hatte und vor dem Fußgängerstreifen zum Dörfli kurz warten musste, überkam mich das Gefühl, jemand beobachte mich. Ich war mir zuerst nicht ganz sicher, aber doch meinte ich Charlies Gesicht auszumachen hinter der Windschutzscheibe eines silbrigen Wagens, der langsam an mir vorbeifuhr und dann weiter oben beim zweiten Fußgängerstreifen anhielt. Ich überquerte die Straße und rannte auf dem Gehsteig zu dem stehenden Fahrzeug hin. „Charlie!“, rief ich. Auf der Höhe des Hecks angekommen, sah ich gerade noch, wie das Fenster der rechten Vordertüre hochfuhr. Ich klopfte an die Scheibe der Hintertüre und rief nochmals: „Hey, Charlie!“ In dem Moment fuhr der Wagen los. An Charlies Seite saß eine Frau und für einen kurzen Moment wendete sie mir ihr Gesicht zu. Es war Emma. Ihre dunklen Augen blitzten mich an. Sie trug einen Sommerhut, unter dem sie sich zu verstecken schien. Unsere Blicke hatten sich für einen Bruchteil einer Sekunde getroffen. Der Abscheu, den ich in dem ihren las, erschütterte mich bis ins Innerste. Es schien dieser Blick sagen zu wollen: Alles, wirklich alles ist möglich und akzeptabel, aber diese Begegnung nicht. Sie darf nicht sein und ich will sie nicht! Schon war der Wagen in die Stampfenbachstraße eingebogen. Ich stand wie gelähmt auf dem Gehsteig. Was war passiert? Charlie und Emma in einem Wagen. Waren die beiden zusammen? Warum flohen sie vor mir?
Ich kehrte ins Hotel zurück und packte ein Badetuch und die Badehose in meinen kleinen Rucksack. Dann begab ich mich an den Hafen in der Enge und suchte mir einen Platz gleich gegenüber dem Springbrunnen auf den Steinquadern der Hafenmauer. So hatten es Emma und ich früher immer getan. Der Himmel über mir war stahlblau, einige Flugzeuge hinterließen weit oben weiße Kondensstreifen. Der Springbrunnen rauschte und von Zeit zu Zeit trug ein Windstoß frische und kühle Wassertropfen herüber.
Es vermochte die Schönheit dieser Landschaft aber nicht über die Kälte hinwegzutäuschen, die mir nun durch die Brust zog und mich mit Scham erfüllte. Ich war zurückgekommen in die Stadt, weil ich jemandem begegnen und meine und die Zukunft dieser Person angehen und regeln wollte. Ich war zurückgekommen, um Weichen neu zu stellen, um eine neue Ära in Angriff zu nehmen. Ich hatte ein konkretes Projekt. Aber ich war damit auf dem Holzweg. Die unschöne Begegnung am Central zeigte mir deutlich: Ich befand mich alleine in Zürich. Es hatte hier niemand auf mich gewartet. Mein Projekt war in der Einsamkeit des Alltags in den Tropen geboren worden und gewachsen. Ich hatte mir etwas zigmal vorgestellt und durch den Kopf gehen lassen draußen, über dem schäumenden Atlantik, ohne Rückfragen, ohne die Person, um die sich alles drehte, mit einzubeziehen. Mein grotesker Fehler wurde mir nun auf schmerzlichste Weise vorgeführt: Hier wartete niemand auf mich, weil das Leben weiterging. Ich hatte mich an etwas festgeklammert, dort unten, das nur für mich, aber für niemanden sonst von Bedeutung war. Emma hatte mit mir abgeschlossen, klarer hätte es ihr Blick nicht ausdrücken können. Du hast mich zu lange allein gelassen, sagten ihre Augen. Ich will dich nicht mehr treffen. Ich verachte dich für dein Fernbleiben und ich habe dich vergessen.
Ich war in Zürich nicht willkommen und störte nur. Dies war es, was die Stadt mir sagen wollte: Du bist geduldet hier, für eine befristete Zeit, genieße sie, aber wisse, dass du wieder gehen musst. Es war dies der Moment, in dem mich eine ungeheuerliche Einsamkeit überkam. Etwas, das mir ungemein viel bedeutet hatte, ein Ziel, ein Gedanke, eine Projektion, wurde nun durch die Realität weggefegt und zunichtegemacht. Die Stadt war diese Realität. Sie war die Kulisse der nüchternen Offenlegung meines lächerlichen Irrtums.
Ich schaute ein wenig auf das Wasser hinaus. Wie Spielklötzchen bewegten sich Motorboote, Kursschiffe und Pedalos durch das untere Seebecken. Es hatte dieses spielerische und schon beinahe sinnlose Treiben einen tröstenden Effekt auf mich. Nicht nur mein Aufenthalt in Zürich war sinnlos geworden, sondern der Stadt selbst, dem täglichen Treiben in ihr fehlte Sinn und Legitimation. Diese Einsicht nahm etwas von der unerbittlichen Kälte, die ich gerade noch empfunden hatte. Am Nachmittag bestieg ich am Bahnhof Enge ein 7er- Tram
Richtung Wollishofen. Ich wollte meinen Eltern einen spontanen Besuch abstatten. Sicherlich würden sie sich
freuen, ihren Sohn nach über einem Jahr wiederzusehen. Ich stieg die Butzenstraße hinauf und klingelte an der Haustür. Niemand öffnete. Ich drückte die Türklinke hinunter, es konnte sein, dass die beiden im Gärtchen hinter dem Haus saßen und die Glocke nicht gehört hatten. Die Tür war verschlossen. Ich klingelte nochmals – niemand kam. Meine Eltern schienen nicht zu Hause zu sein. Vielleicht waren sie unten am See oder sie machten eine Wanderung in den kühlen Glarner Bergen.
Zu Fuß am Seeufer entlang kehrte ich in die Stadt zurück. Die Sonne brannte erbarmungslos. Hinter der Roten Fabrik badeten Nudisten neben einem neuen Steg, der zum Hafen Wollishofen hinüberführte. Auf der Terrasse des Fabrikrestaurants tanzten drei Paare Tango. Vereinzelte Zuschauer hingen apathisch über einer Flasche Bier. Die Hitze war unerträglich. Die Luft war schwül. Es hatte kaum Wind. Weiter vorne beim Betonwerk fielen, im Gegenlicht der Sonne, schwarze Schatten ins Wasser. Braungebrannte junge Frauen und Männer sprangen vom Hafenkran in den See. Der Steinstrand hinter der Schiffsanlegestelle Wollishofen war mit menschlichen Körpern übersät. Auf der Landiwiese, unter den schattigen Bäumen, hielten einige ein Picknick ab, andere lagen einfach herum und dösten. Die Saffa-Insel war gut besucht. Viele schienen, ob der Hitze, Stunden im Wasser zu verbringen. Sie hielten eine Bierdose in der Hand oder eine Getränkeflasche. So etwas hatte ich bisher nur in Brasilien gesehen, vor allem an der Küste Bahias, wo es im Januar unerträglich heiß wurde und der Atlantik bis zu 28 Grad warm war.
Auf der Seeseite des Restaurants Terrasse am Bellevue waren fast alle Sitzplätze an den runden Tischen frei. Vermutlich trieb die Hitze die Kundschaft in das kühle Innere des Lokals. Ich setzte mich und bestellte eine kalte Schokolade. Da ertönte mein Handy zweimal. Eine SMS. Ich schaute nach. Emma. Es erstaunte mich nicht, was ich zu lesen bekam, dennoch war es in seiner Deutlichkeit verletzend: Geh zurück. Ich will dich nicht mehr sehen. Alles klar, dachte ich. Ich löschte die Botschaft sofort. Es beschämte mich, dass Emma so etwas nötig hatte, und ich schämte mich nun dafür, dass ich ernsthaft mit ihr gerechnet hatte. Sofort aber wurde mir klar, dass meine Gedanken durch Trotz und die Kränkung, die ich soeben erlitten hatte, vergiftet wurden. Ich liebte Emma. Sie aber sagte mir, geh zurück. Wohin denn? Nach Brasilien, auf die Bohrinsel? Natürlich würde ich dorthin zurückgehen – aber doch nicht für alle Ewigkeit. Geh mir aus den Augen, wollte sie wohl sagen. Geh irgendwohin, wo ich Ruhe vor dir habe, wo ich dich nicht antreffe. Warum schrieb sie nicht einfach: Bin mit Charlie glücklich verheiratet. Lust auf ein Bier? Oder: Ich will mit Charlie allein sein. Du störst. Oder ganz einfach die Wahrheit: Ich liebe dich noch, aber ich habe mich für Charlie entschieden. Mach es mir nicht schwer und lass mich in Ruhe.
Ja, dies war es wohl. Natürlich würde ich Emma in Ruhe lassen. Wie gesagt, ich liebte diese Frau.
Gerade weil ich Emma liebte, antwortete ich ihr nicht mit dem Satz, der mir seit Monaten durch den Kopf ging: Ich liebe dich und ich möchte dich heiraten, sondern ich erhob mich, legte den geschuldeten Betrag auf den Tisch und nahm den direktesten Weg zum Reiseschalter am Hauptbahnhof.
Abreise
Zum Abendessen im Johanniter gab es Fleischkäse mit Kartoffelsalat, dazu ein kühles Bier. Danach war ein Spaziergang durchs Dörfli der Verdauung förderlich. In die Chérie-Bar schaute ich schnell rein für einen Schlummertrunk. Der Pianist spielte bereits, obschon es noch kaum Kundschaft gab. Eine struppige Blondine mit glasigen Augen saß im hinteren Teil der Bar an einem Tischchen und sprach mit sich selbst. Ich beendete den Abend auf der Terrasse meines Hotels bei einem Whisky auf Eis, dabei beobachtete ich Passanten, die den Limmatquai hinauf- und hinuntergingen.
Am nächsten Morgen um 9.30 Uhr, nach einem Frühstück im Hotelrestaurant und der Begleichung der Rechnung für zwei Übernachtungen, bestieg ich den Intercity nach Genf. Dort würde ich zwei Tage verbringen. Beim Besuch des Seebades Pâquis, wo man auch hervorragende Salate bekam, konnte ich die Hitze gut überstehen. Die Abende verbrachte ich in der schmucken Altstadt. Beim Aufstieg zum Place du Bourg-de-Four boten sich äußerst angenehme Restaurants mit Sitzplätzen im Freien für ein Nachtessen und einen köstlichen Tropfen aus den Hängen über dem Léman an. Am Mittag des dritten Tages wollte ich den TGV nach Toulon nehmen. Ich hatte mir durch die Angestellte des Reisebüros am Bahnhof einen Sitzplatz am Fenster und ein Hotelzimmer in Bandol mit Meersicht für drei Wochen reservieren lassen.
Für den Rückflug nach Lissabon würde ich leider noch einmal nach Zürich zurückkehren müssen, aber nur für eine Nacht. Diese wollte ich diskret in einem Hotel direkt beim Flughafen verbringen. So konnte nichts schiefgehen.
2 Treue
Treue ist nicht körperlich, sondern mental.
Die Frau schaute mich erneut an, ganz kurz, von unten herauf. Für eine Sekunde, oder den Bruchteil einer Sekunde, kreuzten sich unsere Blicke. Sie lächelte flüchtig und wendete sich wieder ihrem Bildschirm zu. Dann schüttelte sie ihr Haar selbstbewusst und schaute ernst drein, als müsste sie nun ein delikates Problem lösen oder eine schwierige Mail beantworten. Das Spiel hatte begonnen. Eine erste Kontaktaufnahme hatte stattgefunden.
Die Mitarbeiterin schien sich ihrer Sache sicher. Vermutlich hatten nur wenige oder bis zum heutigen Tag gar keiner ihrem Charme widerstehen können. Vielleicht dachte sie, sie schnappe mich schnell, ohne viel Arbeit, wie immer. Dies zumindest war die Botschaft ihres verwegenen Lächelns von vorher: Ich kenne das Spiel der Heimlichkeiten, des diskreten Verführens – und es macht mir dieses Spielchen Spaß. Ich weiß, wie man ein Abenteuer in die Wege leitet, ohne dass es die anderen bemerken.
Sie schaute nun im Büro herum, als suche sie etwas oder jemanden, dann starrte sie wieder auf ihren Bildschirm. Ich war mir sicher, dass in den nächsten Sekunden ein neuer Blickaustausch stattfinden würde. Ich sollte mich nicht täuschen. In dem Moment, als die Frau zu mir herüberschaute, erhob ich mich und ging zur Kaffeemaschine.
Du kannst noch lange warten, dachte ich, während der Automat einen Milchkaffee zubereitete. Ich war verheiratet und ich liebte und respektierte meine Frau. Ich würde bei einem Eingehen auf diese Avancen einen groben Akt der Untreue begehen. Warum sollte ich dies tun? Nichts schien mir unnötiger und sinnloser. Ich hatte mit meiner Frau ein gutes Verhältnis, wir vertrauten einander. Wir lebten unsere Zweisamkeit ungestört, ohne Einbrüche von außen. Mir lag etwas daran, diese unsere intakte Welt zu erhalten und nicht zu gefährden. Ich betrachtete es gar als eine meiner Hauptaufgaben, eine solche Gefährdung oder Versuchung zu verhindern und bereits im Ansatz zu ersticken. Ich war diesbezüglich absolut intolerant. Treuebruch setzte ich einem Scheitern im Leben gleich. Wer sich sein Leben zerstören wollte, musste untreu sein.
Ich trank stehend meinen Kaffee und schaute dabei aus dem Fenster auf das Central hinunter. Es war ein hektisches Kommen und Gehen von Leuten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Limmat floss träge unter der Bahnhofbrücke hindurch.
Ich konnte der Mitarbeiterin keinen Vorwurf machen. Sie war vielleicht alleinstehend und hatte niemanden zu verlieren. Sie probierte einfach. Sie gefährdete sich damit nicht. Trotzdem irritierte mich die Angelegenheit. Es war Gefahr im Anzug – für mich. Ich wollte keine Gefahr. Die Frau spielte mit dem Feuer an einem Ort, wo ich Ruhe und Gelassenheit suchte. Ich brauchte keine Intrigen und amourösen Spielchen, um Spannung in mein Leben zu bringen. Ich empfand ein solches Gebaren als Ausdruck von Orientierungslosigkeit und voreiliger Bereitschaft zu Unverbindlichkeit. Aber Unverbindlichkeit wollte ich in menschlichen Dingen nicht durchgehen lassen. Hier war eine absolute Haltung unabdingbar. Auf keinem anderen Gebiet war dies sonst nötig. In moralischen Fragen musste man verbindlich sein, daran hatte ich keine Zweifel. Wer bestehen will im Leben, bemühe sich um Rechtschaffenheit. – Man kann im Leben nicht anders bestehen.
Ich setzte mich wieder an meinen Arbeitsplatz. Vorher drehte ich den Bildschirm um 180 Grad und stellte meinen Sessel auf die andere Seite des Tisches. Die Mitarbeiterin saß nun in meinem Rücken. Der Vorteil davon war: Ich hatte meine Ruhe und ich sah durch das Fenster den Himmel über dem Limmatquai. Der St.-Peter-Turm war ebenfalls sichtbar und die Möwen, die über dem Fluss kreisten.
3 Daphnis und Chloe
Erst wenn man von etwas Geliebtem Abschied nehmen muss, wird einem klar, was Treue bedeutet: ein Abschiednehmen von der Welt.
Komm, Chloe, gib mir deine Hand, komm. Ich möchte dir etwas zeigen. Schau, wie schön die Sonne über dem See steht. Schau, wie die Wasseroberfläche glitzert im Licht. Es blühen Palmen hier, so warm ist es. Folge mir, steigen wir hinauf durch das alte Dorf. Siehst du, wie hoch wir schon sind? Unter uns rauscht der kühle Bach, der von den Bergen in den See hinunterkommt und frisches Wasser mit sich bringt. Da, Chloe, nehmen wir den schattigen Weg im Wald. Es erwartet dich etwas, das dir gefallen wird. Es freut mich, dass ich dir dies jetzt zeigen darf. Komm, noch ein wenig weiter. Siehst du dort den Wasserfall? Habe ich dir zu viel versprochen? Gehen wir auf die schmale Brücke über dem Wasser, dann sehen wir ins Tal hinunter. Siehst du die Wasserbecken zwischen den Felsen? Wenn es richtig warm ist, kann man darin baden. Gefällt es dir? Ich wusste, dass es dir hier gefallen wird. Kehren wir zurück ins Dorf, an den See, meine Liebe. Dort geht nun die Sonne unter in wenigen Augenblicken. Sieh, die engen Sträßchen zwischen den Häusern, liebevoll sind sie aus Pflastersteinen gebaut. Und hier, schau, das gusseiserne Geländer über dem Dorfbach, wie schön und mit Liebe zum Detail wurde es von Menschenhand gefertigt. Mir scheint, alles ist Liebe hier. Chloe, schau, die gepflegten Geranien vor den Fenstern, die sauber gefegten Straßen und Wege im Dorf, die heimeligen Terrassen der Restaurants, das Sonnenlicht, das in den Bergbach und auf den Hang scheint, die Berge, die noch ein wenig Schnee tragen, auf der anderen Uferseite. Alles ist Liebe, alles erlebe ich für dich, Chloe. Ich will immer mit dir sein. Schau, die Seepromenade, die Ufersteine, die im Abendlicht glänzen. Gib mir deine Hand, gehen wir ein paar Schritte am Wasser entlang. Hast du gesehen, wie sauber es ist? Bis tief hinunter an den Grund sieht man, ein kühles Bad wäre jetzt das Richtige. Was meinst du? Schau, wie liebevoll das Ufer bepflanzt ist mit bunten Blumen, und überall gibt es kleine Brunnen. Es fließt Trinkwasser daraus. Nimm ruhig einen Schluck. Fragen wir den Herrn dort, ob er ein Erinnerungsfoto von uns machen würde? Chloe, komm ganz zu mir, ja, so, das gibt ein schönes Foto, mit dem See und dem blauen wolkenlosen Himmel dahinter. Vielen Dank, der Herr! Es sind schöne Momente mit dir, meine Liebe, ich möchte sie festhalten, in Erinnerung behalten. Denn wenn ich an etwas denke, wenn ich etwas genieße, dann denke und genieße ich es immer mit dir. Ich genieße es für dich, Chloe. So habe ich dich bei mir. Wie findest du das Foto? Schau, dein Daphnis, wie er sonnengebräunt am Geländer steht. Hinter ihm der glitzernde See und ein Dampfschiff, das gerade vorbeifährt. Ich habe das Foto für dich gemacht. Weil ich mit dir sein will. Weil ich mit dir glücklich bin. Weil ich dich liebe. Weil ich bei allem, was ich tue und denke, immer an dich denke. Und weil ich nicht begreifen kann, weil ich es nicht fassen und verstehen kann, warum ... du, Chloe – warum du?
4
Rosa war äußerst schön an jenem Tag. Ihr Haar glänzte, ihre Augen leuchteten. Sie war schön an jenem Tag, vielleicht sah es jemand, vielleicht auch nicht. So manche Schönheit ist verschwendet, ineffizient angelegt, da, ergreifbar und doch übersehen – und eines Tages ist sie nicht mehr, verschwunden, disparu ...
Dokumentieren wir unser Dasein. Wir brauchen dazu nur den Willen, Zeugnis abzulegen. Das ist alles. So erheben wir uns über das Vulgäre der Vergänglichkeit unseres Alltags.
Die Vögel sangen, der Himmel war blau. Die Sonne schien. Es war heiß. Ich schaute auf die Straße hinunter und hatte für einen Augenblick vergessen: Du würdest ja nicht mehr kommen. Du konntest nicht mehr kommen.
Da brach sie über mich herein, die Gewissheit, keine Familie mehr zu haben.
Ich kann doch meine Orchideen nicht alleine lassen, dachte sie.
Ihr Mann hupte unten auf der Straße. Sie trat auf den Balkon hinaus.
„Komm, wir müssen gehen, sonst verpassen wir den Flug!“
Ich kann doch meine Orchideen nicht alleine lassen; sie setzte sich auf das Sofa. Unten hupte es mehrere Male.
Dann klingelte es an der Tür. Sie trat an die Gegensprechanlage und drückte den Knopf.
„Ja?“, sagte sie.
„Komm jetzt, wir müssen los!“ Ihr Mann war aufgeregt.
„Ich komme ja gleich“, sagte sie.
Sie setzte sich erneut auf das Sofa neben ihre Pflanzen und schaute sie an. An der Tür klingelte es mehrere Male hintereinander.
Nein, dachte sie, ich will meine Orchideen nicht allein lassen.
Dann nahm ich nochmals ein Bad im See, das letzte in diesem Jahr. Die Blätter der Platanen am Mythenquai waren gelb, der Sonnenstand tief, der Abendwind kühl. Ich dachte an Vergangenes, die Zeit aber nahm mich mit. Ein grünes Blatt verwelkt in einer Winternacht.
Darum dokumentieren wir, möchten wir etwas festhalten, weil die Zeit es sonst wegträgt. Es bleibt uns nur zu sagen, was wir gesehen haben.
Die Sonne scheint schräg in die Stadt hinein. Sie zieht uns immer weiter durch die Zeit. Ich weiß, es liegt alles in meinen Händen. Die Sonne zieht und ich setze ihn an, den Stift auf dem Papier.
Es war an einem warmen, freundlichen Sommerabend im August, aus einem Fenster im Kreis 5 tönte James Last; man möchte festhalten, dass die Blumen schon bald verwelkt sind, dass es allmählich Herbst wird. Warum eigentlich, mag man fragen? Es ist doch auch so schön hier. Ja, das ist es; alles ist richtig, in Frieden und in Ordnung; noch ist es so. Vergänglichkeit und Flüchtigkeit bestimmen das Leben. Wir dokumentieren aus der Freude, der Vorfreude und dem Abschiednehmen heraus.
Dein Leben war, was du an ihm dokumentiert hast.
Zu spät
Die Zeit ist kurz, bald sind wir alt. Darum: Tun wir es, sagen wir es! Noch ist es nicht zu spät.
Kommt ein Musiker auf mich zu und sagt: „Es wäre doch wieder einmal Zeit, etwas zusammen zu machen.“ Zu spät, denke ich, es musste damals nicht sein, warum sollte es heute sein? Eine alte Liebe taucht auf, erinnert an junge Zeiten und an das, was hätte möglich sein können. Auch wenn die Sehnsucht bleibt – es ist zu spät.
Wir müssen vorwärtsschauen, abwägen, was noch möglich ist. Unsere Produktivität ist alles, auch wenn kaum Zeit dazu bleibt. Bleiben wir produktiv, so bleiben wir am Leben. Gerade wieder muss ich die Arbeit niederlegen, um dem Geldverdienst nachzugehen. Er raubt einem fast alle Zeit. Ich bete darum, dass es nicht so sein wird, dass ich einst sagen muss: Zu spät. Ich habe meine Zeit verpasst, habe sie ungenutzt verstreichen lassen. Wozu leben wir? Ich weiß es: Bleiben wir an dem dran, was uns am Herzen liegt. Behalten wir es immer im Auge. Denken wir an die Vergänglichkeit. Solange wir leben, müssen wir an unserer Sache festhalten.
5 Liberty-Bar
Nichts bindet, denn Liebe.
Da saß ich erneut in der Liberty-Bar auf Capri; dieses Mal mit Sahra, meiner aktuellen Geliebten. Wir genossen gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang, ich bestellte Gin Tonic für zwei. Von meinem Sitzplatz auf der Veranda aus sah ich meine Yacht im Hafen. Ich war reich, hatte eine gutgehende Firma geerbt und führte ein luxuriöses Leben als Bohemien. In diesem Augenblick erklang aus den Lautsprechern über uns Hurdy Gurdy Man.
Es war ein Song, den ich sehr mochte, der mir aber, bereits mit der Stimmung der Eingangsmelodie, immer wieder neu etwas deutlich vor Augen führte und mich auch dieses Mal erschütterte: Ich hatte vieles erreicht, konnte mir alles kaufen, konnte auf meinem Schiff in der Welt herumreisen, konnte mit Geld fast alles regeln, auch meine Beziehungen und Affären – aber niemals hatte mich in meinem fünfzigjährigen Leben eine Frau geliebt. – Das war, was dieser Song mir sagen wollte.
Ich verstand seine Botschaft nicht als Vorwurf. Sie war vielmehr Ausdruck einer Trauer darüber, dass auch mir ein solches Schicksal nicht erspart blieb. Auch du bist glücklos in der Liebe, auch du führst ein Schattendasein, auch du bist einer jener Eingebrochenen, die ein Leben vergebens gelebt haben. Es war eine leise Botschaft, die sanft und weich daherkam. Aber sie zerriss mich innerlich beinahe. Denn sie beschönigte nichts. Es ist dies dein Schicksal, es ist von Anfang an auch für dich verloren. Du bist einer jener vielen Gescheiterten, die verzweifelt über die Erde irren und keinen Sinn in ihrem Dasein erkennen können. Ich wusste mich gegen diese traurige Ankündigung nicht zu wehren, da sie – wie sollte ich sagen – richtig war, da sie der Wahrheit entsprach, da sie stärker war als irgendwelche Gegenargumente, die ich gegen sie hätte vorweisen und mit denen ich mich hätte schützen oder herausreden können.