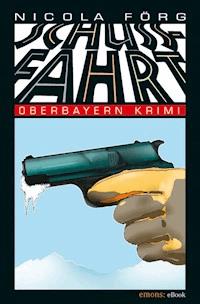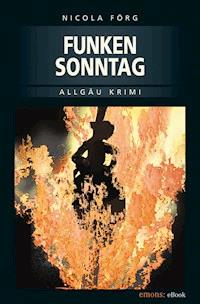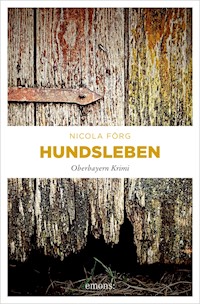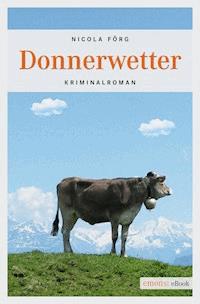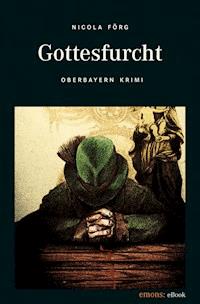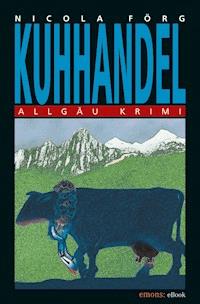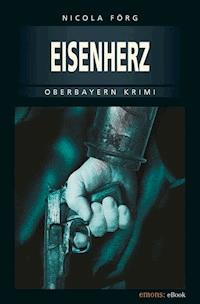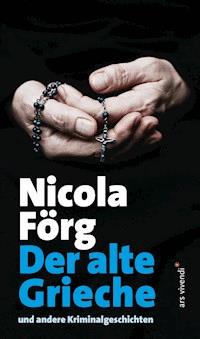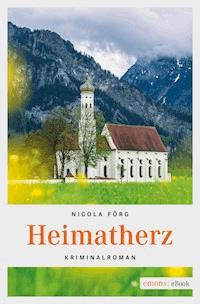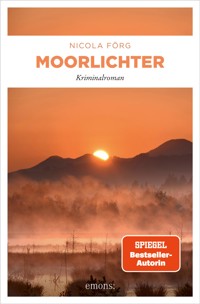9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein außergewöhnlich schönes Mädchen, das seinen eigenen Wert nicht kennt. Eine Liebe, die eine große hätte sein können, doch nie Erfüllung findet. Ein Erbe, verknüpft mit Bedingungen, das Wahrheiten enthüllt. Und eine unwillige Erbin, die Antworten sucht und eine Reise zu sich selbst beginnt. In "Hintertristerweiher" erzählt SPIEGEL-Bestsellerautorin Nicola Förg (u. a. »Böse Häuser«, »Flüsternde Wälder«) auf zwei Zeitebenen eine Geschichte über das Ungesagte zwischen der Kriegsgeneration und den Nachgeborenen, über Heimat und Heimatlosigkeit, Seelenorte und Seelenverwandte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Hintertristerweiher« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Das Zitat stammt aus:
Bruns, Ursula: Dick und Dalli und die Ponys. München: dtv Junior, 1982
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: U1berlin/Patrizia Di Stefano
Covermotiv: Ildiko Neer/Trevillion Images; Uwe Moser Moser/Alamy Stock Photo
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
PROLOG
TEIL I
Hohe Wogen
1
1940
1940
1940
Für die großartige Renate Prinzing,
die meiner Mutter eine verlässliche Freundin war
und auch mich in ihrem Herzen hat
Er hatte die Angst verloren und träumte nicht mehr im falschen Moment, seine Hände hatten feine, dünne Schwielen bekommen, und die anderen mochten ihn leiden … Er dachte, vielleicht hab ich mich wirklich geändert. Er ballte die Fäuste in der Hosentasche und versuchte wahrhaftig zu pfeifen. Es klang noch sehr kümmerlich, aber pfeifen kann man lernen. Mit ein paar Schritten war er neben Mans und nahm ihm den Besen aus der Hand. »Lass mich mal fegen«, sagte er lachend.
Ursula Bruns
PROLOG
»Es ist gut, mon cher. Wirklich.«
»Isabelle, du kannst doch nicht ganz allein … Du …« Maximilian kämpfte mit den Tränen. Dabei hatten sie es so oft durchgespielt, und jedes Mal hatte er versucht, es ihr auszureden. Mit Argumenten. Mit Drohungen. Sogar mit einer leichten Herzattacke, die er nicht einmal vorspielen musste.
»Maxim, wie lange kennst du mich?«
Er schwieg.
»Ich sage es dir. Seit dem Frühjahr 1958, als du am Hof aufgetaucht bist mit diesem gebrechlichen Moped.«
»Du warst das schönste Wesen, das ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Und das ist in all den Jahren so geblieben.«
»Du warst immer schon ein Schmeichler. Ein Mann der verführerischen Formulierungen.«
»Die bei dir aber nicht gefruchtet haben.«
»Maxim, ich hätte ja fast deine Mutter sein können!« Sie lachte hell. Ihr Lachen war immer noch so jung. »Natürlich haben deine Worte geholfen. Wir führen dieses Gespräch. Und du bist es, der mich begleitet.«
»Ich wünschte, du hättest jemand anderen auserkoren!«
Isabelle drückte seine Hand. Es war mehr ein Streicheln, ihre Kräfte schwanden.
»Maxim, du kennst mich, und ich weiß, dass du auch mehrfach unter meinen Ideen gelitten hast. Unter meinen Projekten. Aber du hast auch mit mir gelitten.«
»Du bist der sturste Mensch im Orbit!«
»Ach, Maxim! Ich bin unter Künstlern aufgewachsen, alles kam mir so leicht vor. Und dann musste ich erleben, dass nichts so ist, wie es scheint. Damals habe ich begonnen, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar für mich selbst, für meine Lieben und für alles, was ich getan habe. Ich habe immer selbst entschieden, mal gut, mal weniger gut, mal schlecht, aber ich habe entschieden.«
»Ja, du willst entscheiden, aber du bist nicht Gott! Und dann noch dieses Marionettentheater, das du da inszenierst!«
»Was meinst du?«
»Die Erbschaftsangelegenheit. Diese Bedingungen, die daran geknüpft sind! Du willst andere manipulieren!«
»Nein, nur das Schicksal anschubsen.«
»Es liegt im Wesen des Schicksals, dass man es eben nicht beeinflussen kann, Isabelle!«
»Das kann man sehr wohl, und wenn es nicht klappt, dann habe ich es zumindest versucht.«
»Ach, Isabelle!«
»Die Würfel sind gefallen. Du hast zugestimmt, meinen Letzten Willen zu verkünden. Thema beendet. Und ich will über meinen eigenen Tod bestimmen dürfen. Wieso sollten Fremde darüber entscheiden, ob oder wie wir sterben?«
»Weil sie dich lieben?«
»Wer mich liebt, lässt mich ziehen.«
Maxim goss sich einen Fingerbreit vom Talisker nach. Isabelle hatte gesagt, ihr helfe es schon, dass es die theoretische Möglichkeit eines menschenwürdigen Sterbens gebe. Das hatte er nachvollziehen können. Vielleicht werde sie gar keinen Gebrauch davon machen, hatte sie gemeint, aber sie wolle die Wahl haben.
Ihre erste Idee war es gewesen, sich mal beim Tierarzt umzuhören. Aber ihr alter Freund Fritz war lange tot, und er hätte Isabelle diesen Wunsch ohnehin verweigert. Tierärztin Susu hatte Isabelle von einem Kollegen erzählt, der versucht hatte, sich mit einem Medikamentencocktail umzubringen. Und gescheitert war. Nun saß er umnachtet in einem Heim. Isabelle hatte herzhaft gelacht und immer wieder den Kopf geschüttelt. »Wenn es ein Tierarzt nicht schafft, sich umzubringen, dann sollte ihm nachträglich die Approbation entzogen werden.« Ach, Isabelle!
Sie war dann den langen Weg gegangen mit Arztgesprächen, Attesten und rechtlichen Fragen. In der Schweiz war man sehr gründlich und sehr achtsam gewesen. Isabelle hatte schließlich ein »provisorisch grünes Licht« erhalten. Seitdem waren fast sechs Monate vergangen. Maxim hatte immer gehofft, sie werde es sich anders überlegen, und gleichzeitig gewusst, dass sie es nicht tun würde. Die Batterie an Schmerzmedikamenten war immer weiter gewachsen: Oxygesic, Novalgin, Amitriptylin, Schmerzpflaster, Dronabinol, Morphinampullen. Die letzte Chemo hatte sie schließlich abgebrochen.
Maxim erinnerte sich an seinen Besuch in der Klinik. Winzig war sie geworden, das Krankenhausnachthemd hatte sie umflattert. Draußen hatte fahles Novemberlicht geherrscht, Saatkrähen hatten auf den entblätterten Bäumen gesessen.
»Maxim, weißt du, was mein Problem ist?«, hatte Isabelle zu ihm gesagt. »In meinen Zellen tobt der Krieg, aber mein Herz ist zu gut für mein Alter! Ich werde nicht sanft einschlafen in meinem Lieblingsstuhl am See. Außerdem würde das nicht zu mir passen. Schließlich war auch mein Leben alles andere als sanft.«
Das stimmte. Isabelle war nie den leichten Weg gegangen. Sie hätte andere und einfachere Optionen gehabt, wenn sie damals mit zweiundzwanzig Jahren in Frankreich geblieben wäre, aber das Leben hatte anders gespielt.
Inzwischen rauchte sie sehr viel Cannabis, das machte sie leichter, das ließ sie zur Ruhe kommen und ihre Gedanken fliegen. Noch immer war sie die schönste und lebensklügste Frau, die Maxim jemals kennengelernt hatte. Und gleichzeitig die gewalttätigste. Dabei wusste er, dass sie im tiefsten Inneren eine Melancholikerin war.
Und nun war der Tag X gekommen. Ohne Plan B.
»Isabelle, du kannst nicht allein fahren!«
»Doch, das werde ich. Du bist entlassen. Das hältst du nicht aus.«
»Du könntest auf der Straße verunglücken.«
Sie lachte. »Dann hätte Gott wirklich einen schrägen Humor. Und die Schweiz hätte fünfzehn Gramm Natrium-Pentobarbital gespart.«
Und so fuhr sie am nächsten Morgen allein Richtung Schweiz. Es würde ein brillanter Sommertag werden. Sie hatte die letzten Tage schon Abschied genommen. Von all ihren Lieben, die sie in guten Händen wusste. Sie hatte alles organisiert.
Auf Bundesstraßen fuhr Isabelle immer siebzig, innerorts aber auch. In Bregenz leuchtete ein Blitzer auf. Diese Österreicher! Den Strafzettel würde sie nicht mehr bezahlen. Eigentlich eine amüsante Vorstellung. Isabelle beschloss, ihr Auto in Zürich mitten im absoluten Halteverbot abzustellen. Sie würde ein Ticket bekommen und eine Parkkralle. Und die Polizisten würden den Halter ermitteln und feststellen, dass dieser in ihrem schönen Land verschieden war. Mit Freitodbegleitung. Ihre letzte Tat würde renitent sein. Das war gut. Alles war nun gut. Die Ketten gesprengt. Die Wahl getroffen.
TEIL I
Hohe Wogen
1
Aurelie
»Kannst du vergessen! Numquam!«, brüllte Laurent, der neuerdings zu Latein griff, wenn er sie ärgern wollte.
»Ich bin da auch raus«, meinte Lotte, seine ältere Schwester.
»Mir ist egal, was ihr niemals wollt und wo ihr raus seid! Wir fahren morgen dahin. Isabelle will uns alle treffen!«
»Die Alte sieht doch eh nichts mehr!«, maulte der Junge. »Ihr habt mir versprochen, dass ich in Beuerberg zuschauen darf, wie die Profis spielen. Ich will das unbedingt sehen!« Laurent war dreizehn und hatte seltsamerweise keine Lust auf Fußball. Dafür spielte er seit einem Ferienschnupper-kurs vor zwei Jahren Golf und schien tatsächlich Talent zu haben.
»Du hast heute schon zugeschaut! Ich im Übrigen auch. Stundenlang musste ich am …«
»… am Loch zwölf«, ergänzte Laurent.
»… am Loch zwölf stehen und zusehen, wie die mit ihrem Schläger …«
»Driver heißt das, Mama! Und das Zwölferloch ist krass schwer: ein Par 5, und das Wasser ist direkt vor dem Green.«
»Egal, ein Tag am Golfplatz genügt mir vollauf. Wir fahren morgen zu Isabelle. Basta.«
»Basta«, äffte Lotte sie nach.
»Ende der Diskussion!«, rief Aurelie lauter, als sie es vorgehabt hatte. »Finis disputationis!«
»Krass, jetzt kriegt sie wieder diese Falte zwischen den Augen«, sagte Lotte ungerührt. »Pass auf, das macht alt.«
Kinder waren so eine Freude. Aurelie hätte was drum gegeben, wenn ihre eigenen etwas weniger schlau geworden wären. Sie legten den Finger in jede noch so kleine Wunde. Natürlich hatte auch sie keine Lust, ein Ochsenrennen zu besuchen. Eine so verrückte Idee konnte nur von Isabelle stammen, ihrer leicht wunderlichen Tante.
»Mama, wir waren jahrelang nicht mehr da. Was sollen wir jetzt auf einem Ochsenrennen?«
»Na ja, Lotte, jahrelang …«
»Na ja, Mama.« Das Kind konnte unglaublich süffisant sein, das hatte es sicher vom Vater. »Ich bin megaschlecht in Mathe, aber das kann sogar ich ausrechnen, dass es fast acht Jahre her ist. Ihr habt mich und drei Freundinnen damals rausgeschleppt zum Ponygeburtstag. Jetzt werde ich bald sechzehn. Das Ponyreiten haben wir abgebrochen, weil der kleine Laurent fast erstickt wäre. Pferdehaar-Allergie.«
»Haha!«, kommentierte Laurent beleidigt.
Stimmte das? Waren wirklich schon acht Jahre vergangen? Lotte hatte recht. Mit der gesamten Familie waren sie seitdem nie wieder auf dem Hof der Tante gewesen. Was nicht zuletzt daran lag, dass Eike, ihr Mann, die Tante furchtbar fand – und vice versa. Lotte war auch nicht so pferdebegeistert gewesen, dass man sie mit weiteren Besuchen auf dem Hof hätte locken können. Das war Aurelie eigentlich nur recht gewesen. In ihrer Lateinklasse am Gymnasium gab es genug Mädchen, die von diesem Ponyvirus befallen waren – Federmäppchen mit Pferden, Handyhülle mit Ponyfratze, Bildschirmschoner mit Hottehü. Eine andere Lehrerin aus dem Kollegium verbrachte das halbe Leben in eiskalten Reithallen.
Ab und zu war Aurelie alleine zu Isabelle gefahren, aber der letzte Besuch lag auch schon wieder einige Jahre zurück. Zwischendurch hatte sie ein paarmal mit ihr telefoniert, doch die Themen der Tante rankten sich immer um Pferde und andere Tiere, und das war so gar nicht Aurelies Welt. Wenigstens schrieb sie Isabelle zu Weihnachten immer eine Karte, was Lotte für »voll retro« hielt.
»Umso wichtiger, dass wir morgen kommen«, meinte Aurelie. Denn Isabelle war nicht irgendeine Tante, sie war die Tante, die Erbtante. Und diese Erbtante hatte zu einem Ochsenrennen geladen. »Sie hat mir eine SMS geschrieben, dass sie Lolek und Bolek am Start hat, ihre zwei Rennochsen. Und dass wir unbedingt kommen müssen.«
Es wäre ihr zuzutrauen gewesen, dass sie selber ritt, aber das hatte sie wohl doch an zwei junge Burschen aus dem Dorf delegiert. Warum auch immer, es musste einen Grund geben, dass sie die ganze Familie zu sich zitierte.
Am nächsten Morgen war Eikes Laune auf dem Nullpunkt. »Da fahren wir an einem traumhaft schönen Sonntag anstatt zum See zu einem Rennen, wo stinkende Kühe und Millionen von Fliegen warten«, brummte er.
»Ochsen«, verbesserte Lotte. »So was machen nur Ochsen, Kühe sind zu schlau für Unterjochung.«
Aurelie staunte. Wo sie das nur wieder herhatte? Manchmal war ihr die eigene Tochter unheimlich, und diese Momente wurden mehr.
Nach einer eher einsilbigen Fahrt erreichten sie den Ort des Geschehens. Schon vor dem Kaff wurde man von der Feuerwehr abgefangen und zum Parken genötigt. Der Parkplatz war eigentlich eine Wiese, und da es die letzten drei Tage durchgeregnet hatte, nahmen Aurelies teure weiße Ledersneakers augenblicklich ein Bodenkackbraun an, während Lottes Flipflops vom Boden angesaugt und quasi gefressen wurden.
In dem kleinen Ort herrschte Ausnahmezustand. Sie stapften weiter, vorbei an einem Bierstand, an dem die fröhliche Landjugend in Lederhosen hing. Ein junges Mädchen im Dirndl kotzte gerade hinter ein Auto.
»Zünftig! Los! Bringen wir es hinter uns«, sagte Eike in jenem Tonfall, der nichts Gutes verhieß.
Sie waren schon etwas spät dran. Gerade gab es den letzten Vorlauf. Zwei der Tiere schlenderten mehr so dahin. Der Obama und der Wiggerl. Ein Ochse namens Simmerl stand wie eine Statue mitten auf der Bahn. Da half es auch nichts, dass der Reiter mit einem Haselnussstecken auf das Tier eindrosch.
»I disqualifizier di! Schlagen verboten!«, schallte es aus dem Lautsprecher.
»Ja, Junge, wirf Wattebällchen auf das Tier, das hilft bestimmt«, grummelte Eike.
Lolek buckelte, und der Reiter flog vom Ochsen. Zum Glück landete er recht sanft auf dem durchweichten Boden. Nur Bolek stob rennpferdartig vorwärts, ganz gerade, wie an einer Schnur gezogen – ein Traumlauf.
»Der gehört der Tante«, meinte Lotte mit gewissem Stolz in der Stimme. »Wo steckt sie eigentlich?«
Gute Frage. Sie hatten mit ein paar wenigen Zuschauern ländlicher Couleur gerechnet, aber in der Arena, die durch eine Art natürliches Amphitheater aus Wiesenterrassen begrenzt war, johlten sicher viertausend Leute – oder mehr. Wie sollten sie da Isabelle finden?
Ein Ansager erklärte gerade die Rassen der Rennochsen: »Murnau-Werdenfelser, Pinzgauer, Braunvieh und Fleckvieh. Wobei die Rasse nichts über die Renneignung aussagt.«
Laurent hatte inzwischen gegoogelt und las vor: »Der Ochse ist das älteste belegte Zugtier, womöglich gab es davor schon Hunde, die man bei geringeren Lasten eingesetzt hatte. Lange vor Pferd und Esel gab es Ochsengespanne – ab der Mitte des 4. Jahrtausends v. Chr. in Mitteleuropa. Ochsenkarren gibt es in Asien und Afrika heute noch. Nur mittels Kastration war und ist es möglich, die gegenüber dem weiblichen Rind viel größere Arbeitskraft des Stiers für menschliche Zwecke zu nutzen. Einen Stier kann man kaum abrichten, der Ochse hingegen arbeitet als Zugtier mit.«
Lotte nickte. »Sag ich doch, Frauen machen so einen Scheiß nicht mit.«
Aurelie sah sie an. Ihre Tochter war speziell. Sie versuchte gerade, Schopenhauer zu lesen, weil ihre Freundin Lynn ihr das Buch gegeben hatte. Andererseits whatsappte sie stundenlang mit ihren Mädels, und manchmal daddelte sie mit ihrem Bruder. Lotte stand zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. In letzter Zeit haute sie pessimistische Parolen zum Klimawandel heraus, und Aurelie musste ihr recht geben. Ihre eigene Generation hatte Raubbau an der Welt betrieben und sich wenig um die Folgen geschert.
Aurelie hatte ihrer Familie eingeschärft, sich nicht vom Fleck zu bewegen, während sie nach Isabelle suchte. Vielleicht war sie am Abreiteplatz, wo die Ochsen sich aufwärmten. Doch noch bevor sie einen der beiden Reiter von Lolek oder Bolek zu fassen bekam, begann der Endlauf.
Der euphorische Kommentator erläuterte, dass Ochs und Reiter spätestens vierzig Meter vor dem Ziel eine Einheit bilden sollten – Reiter einigermaßen gerade obendrauf, Ochs einigermaßen geradeaus laufend – und so die Ziellinie passieren mussten, um gewertet zu werden. Lolek, der gerade noch geführt hatte, begann nun wieder, so wüst zu buckeln, dass der junge Mann himmelhoch abschoss wie eine Rakete. Ein Ochs namens Hiasl übernahm die Führung und lief fast elfengleich im sanften Trab dahin – und dann war auf einmal Schluss! Er legte sich kurz vor dem Ziel einfach hin. Nichts ging mehr. Bolek nutzte die Gunst der Stunde und übertrottete gelassen die Ziellinie. Das Volk johlte und raste. Als sich alle etwas beruhigt hatten, erschallte die Stimme des Ansagers.
»Gewonnen hat eindeutig der Bolek, geritten vom Beni Schwaiger, im Besitz von Frau Aurelie Brodersen. Bittschön, Frau Brodersen, kommen S’ Ihren Preis holen.«
Es wurde leise im Ring.
»Frau Brodersen, bitte zum Ansagerpult!«
Von irgendwoher war Eike gekommen. »Aurelie, warum gehört dir ein Ochse? Aurelie?«
»Frau Brodersen, bitte zum Ansagerpult!«
Eike schob sie vorwärts bis zum Kommentator, der ein Headset trug und mitten auf der Rennbahn stand. Beifall brandete auf. Irgendwie in Trance nahm Aurelie den Preis in Empfang, fünfhundert Euro und einen gewaltigen Schinken.
»Danke, ja, vielen Dank.« Sie sah sich um. Neben ihr standen Ochs und Reiter. Geistesgegenwärtig gab sie das Präsent weiter.
Dieser lederbehoste Beni, den Aurelie von irgendwoher kannte, schenkte ihr ein strahlendes »Vergelt’s Gott«, der Applaus toste, und Bolek zog eine grünliche Sabberspur über ihre Hose. Es wurden Preise an die Zweit- und Drittplatzierten vergeben, überall Ochsen, es war unglaublich laut. Aurelie stand im Auge eines Orkans, der allerdings allmählich abflaute.
»So, liabe Leit, das Zelt hat geöffnet!« Das war die letzte Ansage.
Menschen eilten an Aurelie vorbei, jemand hieb ihr auf die Schulter. »Den kauf i dir ab«, meinte ein anderer und lachte polternd. Mitten im Trubel stand Aurelie mit einem dicken, dümmlich blickenden Tier, dessen Führstrick sie nun wundersamerweise in der Hand hielt. Ihre Turnschuhe hatten sich endgültig im Matsch festgesogen. Die Zeit schien stillzustehen, bis ein älterer Mann auf sie zukam. Er trug einen ländlichen Janker, der sehr teuer aussah, und blickte mit wachen Augen durch seine Hugo-Boss-Brille.
»Grüße Sie, Aurelie, ich darf Sie doch so nennen? Ich bin Dr. Maximilian Pranger, der Anwalt Ihrer Tante und ein alter Freund.«
Bolek machte einen energischen Kopfruck und begann zu grasen, Aurelie schlingerte, der Anwalt umfasste sie gerade noch rechtzeitig, bevor sie hingefallen wäre.
»Wo ist Isabelle?«, stammelte Aurelie.
»Das bedarf einer Erklärung«, meinte der Mann, winkte diesem Beni zu und gab ihm flüsternd ein paar Anweisungen.
»Die Ochsen werden erst einmal heimgebracht«, erklärte er und lächelte. »Ihre übrige Familie ist auch da?«
Aurelie nickte. Eike war von irgendwoher dazugekommen. »Was geht hier vor? Sie sind wer?«
»Dr. Pranger. Ich hatte mich eben Ihrer Frau vorgestellt. Sind Ihre Kinder auch da?«
Selbst Eike war überrumpelt.
»Ja, die beiden haben bei der Siegerehrung zugeschaut. Sie können nicht weit weg sein.«
»Gut, dann suchen wir sie mal.«
Sie entdeckten Lotte und Laurent am Zaun. Lotte beobachtete den Reiter von Lolek, und er schien auch sie im Blick zu haben.
Aurelie rief mit einer Stimme, die sie selbst als hysterisch empfand:
»Lotte, Laurent, kommt bitte! Etwas Wichtiges!«
Am Ende landeten sie in einem Wirtshaus, momentan noch sehr spärlich besetzt, denn die meisten Besucher waren im Zelt. Nur ein Mann in einem Rollstuhl und eine Frau saßen an einem Tisch in einer dunklen Ecke. Über ihr hockte ein ausgestopfter Vogel, was auch immer das für einer war. Es war kalt hier drinnen.
Das Nebenzimmer war gänzlich leer. Pranger dirigierte die Familie hinein und schloss eine ziehharmonikaartige Tür hinter sich, die noch aus der Vorkriegszeit zu stammen schien. Pranger bedeutete ihnen mit einer Handbewegung, sich hinzusetzen, was sie alle verblüfft taten. Er begab sich an die Kopfseite des Tisches und öffnete seine Ledermappe.
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Isabelle vor einigen Tagen verstorben ist. Sie wollte das so, ganz still, ja … ähm …« Er rang nach Worten und schien nur mühsam die Fassung zu wahren. Dann zwinkerte er und blickte in die Runde.
Aurelie fühlte sich überrollt von einer Flutwelle aus Sätzen, die sie nicht verstand. Eike hatte die Augen zu Schlitzen verengt, Laurent suchte den Blick seiner Mutter, Lotte starrte auf die Tischplatte.
»Es ist meine ehrenvolle Aufgabe, Ihnen den Letzten Willen der wunderbaren Isabelle zu übermitteln.« Er rückte seine Brille zurecht. »Isabelle verfügte über ein Anlagevermögen in Papieren und Gold im Wert von rund drei Millionen Euro. Zudem besaß sie die Ferienanlage Belle Plage am Atlantik, die ich auf rund zehn Millionen taxiere. Es gibt dann noch die Villa Beaujolais in Les Sables-d’Olonne und ihr Haus am Hintertristerweiher.«
»Haus ist gut«, warf Eike ein. »Sie meinen diese Villa Kunterbunt mit dem Siechentierpark?«
So war Eike Brodersen: friesisch herb. Aurelie, ursprünglich aus der französischen Picardie stammend, hatte ihn beim Studieren in Hamburg kennen und lieben gelernt. Damals war er frech und unangepasst gewesen, was sie beeindruckt hatte. Er war so anders gewesen als die meisten ihrer weichgespülten Kommilitonen, die Lehramt studiert hatten. Anfangs war sie eher zurückhaltend geblieben, aber er hatte ihre Bastion mit Segeltörns, Picknicks am Strand und Einladungen zu Lesungen eingenommen. Ein Mann, der las, war ein Hauptgewinn, fand Aurelie. Sie hatten geheiratet und waren später nach München gezogen. Das eine Kind hatte den deutschen Namen Lotte bekommen, den Jungen hatten sie aus sprachlichen Paritätsgründen Laurent genannt, wobei Aurelie bemängelte, dass der Name in Bayern zu Laurenz verballhornt wurde. Aber die Familie lebte nun mal in München, und da waren die Kinder mit ihren Namen unter lauter Amelies, Laras, Finns und Noah-Alexanders gut aufgehoben. Dass die eigene Mama nicht am selben Gymnasium unterrichtete, das die Kinder besuchten, fand vor allem Laurent gut. Lotte hätte das gelassen hingenommen, sofern sie ihre Mutter nie in Französisch und Latein bekommen hätte. Aber zwei Schulen brachten die nötige Distanz.
Lotte war insgesamt nicht sonderlich pubertierend. Sie trank nicht, kiffte nicht und nahm, soweit Aurelie es überblickte, keine Muntermacher oder andere Drogen. Dass die Tochter, bis auf kleinere Ausfälle, ganz gut zu ertragen war, half dem Familienfrieden, denn Eike war nur bedingt mit Geduld oder gar Diplomatie gesegnet. Er war freier Reisejournalist und Fotograf, und obgleich die Zeiten hart waren für Freelancer, hatte er einen Stamm an Abnehmern. Außerdem gab es einen lukrativen Deal mit einer hochkarätigen Werbeagentur, wo er sich nach eigenen Aussagen »teilversklavt« hatte. Als Kreativmaschine. Seine markigen Sprüche über die Kunst des freien Wortes waren vor dem Hintergrund von Aurelies Beamtenstatus natürlich leicht dahingesagt.
»Hör mal, Eike! Siechentierpark – das war jetzt aber nicht besonders nett«, sagte Aurelie etwas lahm.
»Nett? Wozu soll ich nett sein, deine Tante war ja auch nie nett. Sie war eine Hexe. Ja, ja, ich weiß, Tante Isabelle ist die Erbtante und die kleine Aurelie die einzige Anverwandte.«
In Aurelie stiegen Bilder auf. Von diesem Hof, der an einem Moorweiher lag. Von ihrer Tante, die einen merkwürdigen Spagat vollführt hatte: immer die feine, stilsichere Französin und doch auch die bodenständige Bäuerin. Aurelie versuchte auszurechnen, wie alt die Tante eigentlich gewesen war, hochbetagt in jedem Fall, schließlich war sie im Jahr 1930 geboren. Das wusste sie noch.
1940
Isabelle
»Unsere Landsleute hören das Donnern nicht. Sie verschließen die Ohren vor dem Grollen«, sagte ihr Vater.
»Wir befinden uns doch schon seit dem 3. September 1939 im Krieg!«, rief Pierre. »Viele Franzosen sind für ihr Heimatland gestorben, und wir haben bereits jetzt diese ganzen elenden Flüchtlinge aufgenommen, die nun in Schulen, Kasernen und Wohnungen hausen.«
»Da hast du recht, doch sie ignorieren es. Dabei sollen unter den Flüchtlingen die beiden Tolstoi-Brüder sein, die Neffen des großen russischen Schriftstellers«, sagte Chantal.
»Wer ist Tolstoi?«, fragte Isabelle.
»Ein Mann monumentaler Bücher und noch monumentalerer Gedanken. Ein Anarchist. Exkommuniziert von der autoritären Kirche. Vegetarier«, erklärte Chantal.
Isabelle verstand wenig, aber um irgendetwas zu sagen, warf sie ein: »Bei mir in der Klasse gibt es Flüchtlinge, die den gelben Stern tragen.«
»Christen haben ein Kreuz, Juden tragen einen Stern«, sagte Jean-Luc.
»Du moralinsaurer Einfaltspinsel. Sag ihr doch, was die Nazis den Juden antun! Woher kommen diese Mitschüler?«
»Aus Polen. Sie sind sehr dünn und essen in der Rue des Teintureries in der Suppenküche«, berichtete Isabelle.
»Da draußen braut sich ein Beben zusammen, das größer ist als alles, was wir kennen!« Chantal nahm einen Schluck und verstellte ihre Stimme, sodass sie klang wie aus dem Radio. »Unsere Truppen kämpfen mit einer Kraft und Entschlossenheit, die den Deutschen bei allen Begegnungen schwere Verluste zufügt«, rezitierte sie. »So schallt die Propaganda, meine Lieben. Und wir in Les Sables schreiben ein städtisches Dekret, um das Badeleben am schönsten Strand Europas zu regeln. Merkt auf: Das Tragen von Strandkostümen ist auf öffentlichen Straßen verboten. Das treibt uns um. Ich habe mir meine Lebensmittelkarte für Zucker schon geholt, die echte Rationierung wird noch kommen.«
»Glaubt ihr wirklich, dass die Deutschen einmarschieren?«, fragte Jean-Luc.
»Was heute unsere viel besungene Promenade ist, war vor noch gar nicht so langer Zeit ein düsterer Platz, wo ertrunkene Seeleute angespült wurden. Freiwillig ging damals niemand in die Dünen. Erst 1866 wurde die Eisenbahn hierher gebaut und chauffierte mit den Vergnügungszügen die Pariser ans Meer. Wartet noch eine kleine Weile, dann werden die Hoteltreppen unter den Nazistiefeln ächzen«, behauptete Pierre.
»Du bist immer so apokalyptisch. Wie deine Bücher. Gelebte Depression«, beschwerte sich Jean-Luc.
Isabelle blickte auf. Die Erwachsenen schienen sie häufig gar nicht wahrzunehmen. Sie lauschte oft und war froh, dass sie wie ein kleines Hündchen auf dem Boden hocken konnte. Ihr Vater war ein Mann großer Gesten, dem sehr genau anzusehen war, wie er fühlte. Er verbarg nichts, er trug alles nach außen.
Chantal war da anders, und Isabelle spürte, dass sie längst nicht alles herausplauderte, was in ihrem attraktiven Kopf vorging. Isabelle vergötterte Chantal, die ihr rotes Haar nachlässig aufgetürmt hatte und stets Männerhosen trug. Sie rauchte wie ein Schlot und trank wie ein Kutscher. Chantal malte Bilder, die groß waren und sehr bunt. Die Gesichter der Menschen darauf waren grün und orange, ihre Haare blau.
Isabelle liebte Pierre, weil der ihr immer kleine Präsente brachte und sie nie wie ein Kind behandelte. Pierre war Journalist und Dichter. Und Jean-Luc war vor allem liebenswert und wollte immer etwas Gutes in den Dingen finden. Er hatte Geld, warum und woher, wusste Isabelle nicht. Jedenfalls musste er nicht arbeiten.
Es ging auf den Sommer zu. Isabelle schätzte diese Jahreszeit nicht besonders. Hier in der Villa Beaujolais gab es auf der Straßenseite zwei Türen, eine normal große und eine kleinere, die hinunter in den Keller führte. Isabelles Vater war Architekt und baute Häuser wie das ihre. In seinen Diskussionen mit den Kollegen Charles Charrier und Maurice Durand verurteilte er alles, was nicht funktional war. Ihm waren viele Kollegenentwürfe zu verspielt. Isabelle fragte sich, was am Spielen denn schlecht sein mochte.
Im Sommer lebte die Familie dunkler und beengt im Keller – die Bel Etage wurde vergoldet, alle vermieteten an Gäste. Wenn dieser Krieg war, dachte Isabelle, logierten vielleicht keine Stadtkinder in ihrer Wohnung, die mit ihren Müttern an den Strand liefen. So ein Krieg schien durchaus Vorteile zu haben.
»Momentan ächzen wir nur unter der heiligen Pflicht zur Aufnahme von Landsleuten«, sagte Chantal gerade. »Die Einheimischen lamentieren, dass die Flüchtlinge ihnen die Unterkünfte für die Sommergäste blockieren. Die werden sich noch umschauen und sich nach den Flüchtlingen zurücksehnen. Da kann das lächerliche Journal des Sables gerne ›Geduld und kaltes Blut‹ fordern. Es werden dunkle Zeiten anbrechen.« Ihr Blick fiel auf Isabelle. »Mein schönes Kind, würdest du flugs noch etwas vom Wein holen?«
Isabelle lächelte und huschte in den Keller. Es war elf Uhr vormittags. Um diese Tageszeit pflegte sich Chantal einen Sancerre zu genehmigen. Je später es wurde, desto schwerer wurden die Weine. Isabelle griff sich eine Flasche und öffnete sie mit der Erfahrung, die sie längst hatte. Als sie wiederkam, sah Pierre sie erstaunt an. »Ma chère, bist du schon wieder gewachsen?«
»Ein wenig.«
Es war ein typischer Tag in der Villa Beaujolais. Die Großen diskutierten, rauchten und tranken, Isabelle lauschte oder lief zum Strand. Die Schulprüfungen waren ausgesetzt worden – kein Nachteil, befand Isabelle.
Es war gegen halb zehn am Sonntag, den 23. Juni, als Pierre hereinstürmte: »Sie sind da! Um acht Uhr dreißig war das Knattern von Motorrädern zu hören. Männer in grässlichen graugrünen Regenmänteln haben das Büro des Bürgermeisters betreten und die Flaggen abgenommen. Alle großen Männer der Stadt wurden vor die deutschen Offiziere zitiert.«
Ihr sonst so sonnengebräunter Vater war blass geworden. »So schnell ist es also gegangen«, sagte er nur und goss sich und Pierre einen Calvados ein.
Bald schon wusste die Stadt, dass es eine Ausgangssperre ab zwanzig Uhr gab und Fahrverbote für Zivilisten. Die Telefone waren tot. Im Hôtel du Parc hatte die Kommandantur 13 ihre Zelte aufgeschlagen, im Majestic-Hotel die Hafenüberwachungsstelle. »Hafenkapitän« stand da nun, was Isabelle irgendwie lustig fand. Ernste Männer standen davor und bewachten das Gebäude. Sie hatten Isabelle und ihren Nachbarsjungen Maurice, der erst acht war, einfach ignoriert. Erst als Isabelle die Hände in die Hüften gestemmt und einem der Männer in die Augen gesehen hatte, war ein kaum merkliches Lächeln über sein Gesicht geflackert. Dann hatte er eine Handbewegung gemacht, als wolle er eine Fliege verscheuchen.
Diese Deutschen brachten die Erwachsenen dazu, noch mehr zu trinken und zu diskutieren. Chantal schüttelte den Kopf so heftig, dass sich ein paar Locken lösten und sie aussah wie eine der Fischfrauen in der Markthalle. »Wir sind gefangen inmitten der Boches!«, rief sie.
»Was sind Boches?«, fragte Isabelle.
»Diesen Ausdruck darfst du nie verwenden, Herzchen! Tête de boche ist der Holzkopf, dabei glauben die Deutschen, Boche würde Schwein bedeuten.« Chantal kicherte.
Der Juni verstrich, der Juli auch, man fand sich in die Situation. Automobile auf dem Remblai waren wieder erlaubt, nur vor dem Hôtel du Parc durfte man nicht parken. Der westliche Teil des Strandes war für alle offen, und den Fischern wurde gestattet, in einer Zone von fünf Seemeilen und nur zwischen sechzehn und einundzwanzig Uhr zu fischen, vorausgesetzt, sie hissten eine weiße Flagge oben am Mast. Auch die Kinos öffneten wieder. Chantal und Pierre sahen sich La Bête Humaine von Jean Renoir an. Und Chantal sagte, Jean Gabin sei ein Gott.
1940
Fritz
Der Himmel war groß. Und weit. Und irgendwo da draußen lag sicher die Verheißung. Die Wellen rollten auf den Grand Plage zu, das Wasser war fast schwarz, gekrönt von schmutzig weißen Hauben. Seine Kompanie war mehrfach verlegt worden. Anfangs war er auf Noirmoutier an der Atlantikküste gelandet. Eine leise Röte überzog noch immer sein Gesicht, wenn er sich an den peinlichen Vorfall damals erinnerte. Die Insel, die nur aus Kartoffelbauern zu bestehen schien, hatte eine Verbindung zum Festland: Le Gois. Früher waren die Menschen fußläufig über Sandbänke zur Insel gelangt, erst später hatte man den Damm errichtet – mit drei Plattformen, die auch bei Hochwasser nicht vom Meer überflutet wurden, und einigen Stangen mit Sprossen, im Volksmund Papageienmasten genannt, auf die man steigen konnte, wenn man von der Flut überrascht wurde. An jenem Tag war Fritz zusammen mit einem Kameraden über die Passage gefahren – im offenen Wagen. Die Flut hatte sie eiskalt und nass erwischt, vor allem aber den brandneuen Kübelwagen, der untergegangen war. Damit war aber auch nicht zu rechnen gewesen, dass dieses verdammte Wasser so schnell kommen würde!
Fritz stammte aus Unterfranken und kannte den Main. Im Gegensatz zu manchen Kameraden konnte er sogar schwimmen, das war keineswegs selbstverständlich. Dass ein Fluss bisweilen Hochwasser führte, wusste er natürlich. Bei der Mutter hatte er alte Fotografien von 1917 gesehen, auf denen die Einwohner der Altstadt vor dem Gasthaus zur Goldenen Krone auf Schelchen herumschipperten. Er hatte als Bub selbst miterlebt, wie Stämme und Flöße von den Lagerplätzen wegschwammen und zur gefährlichen Fracht des entfesselten Flusses geworden waren. Er hatte gesehen, wie das Hochwasser gefroren war und einen Eispanzer über die Flussauen gelegt hatte. Dennoch erschienen ihm Ebbe und Flut am Meer weitaus bedrohlicher. Wer zog da das Wasser weg und sandte es zurück? Natürlich wusste er von der Rolle des Mondes für die Entstehung der Gezeiten, aber das machte es nur noch gespenstischer.
Er und sein Kamerad Ludger hatten auf einer der Plattformen gesessen und dem davongurgelnden Auto zugesehen. Was für eine Schmach! Als Strafe hatte Fritz vier Wochen am Ende des Gois sitzen und die Passierscheine kontrollieren müssen, die man brauchte, um an Land zu gehen. Dabei war ihm keineswegs entgangen, dass sich etliche Zwangsarbeiter, die zur Errichtung der deutschen Verteidigungsbauten verdammt waren, an seiner Kontrolle vorbeigestohlen hatten.
Er hatte die Zeit genutzt, um Französisch zu lernen. Täglich hatte er mit Claire geübt, einer Bäuerin, die ihm immer mal ein Stück Käse zusteckte. Sie sammelte bei Ebbe Krebse und Krabben, sie war uralt, winzig und lachte ihn aus Augen an, die ihm fast schwarz erschienen.
Dann waren sie verlegt worden, erst weiter in den Norden nach Pornic und dann südlich nach Les Sables-d’Olonne. Dieses topfebene Land, diese Strände, dieser gewaltige Himmel, diese Wolkenberge. Der Himmel überspannte alles. Le grand ciel – ein großes Schauspiel mit immer neuen Lichtreflexen. Als Fritz zum ersten Mal in Les Sables auf dem Remblai stand, dachte er, das müsse das Paradies sein. Dieser geschwungene Strand, die feinen Hotels, die Promenade, die dem Schwung des Strandes folgte! Das wäre ein Ort für lange Ferien.
Es war acht Uhr abends nach einem lauen Septembertag, und Fritz sollte die Einhaltung der Ausgangssperre überwachen. Der Strand war leer, bis auf ein Mädchen, das jedes Mal zur Seite hüpfte, wenn wieder ein Brecher herankrachte. Er ging näher. Die Wellen hatten Algen mit im Gepäck, ein paar Äste, die bleich waren wie Knochen. Wieder ein Brecher – und etwas landete fast vor den Füßen des Kindes. Es war der Kopf einer Kuh, die ins Leere starrte. Das Mädchen betrachtete den Kopf genau. Die Zunge hing heraus, die Schnittstelle am Hals war ausgefranst.
»Du solltest dir das nicht ansehen«, sagte Fritz.
»Warum verliert eine Kuh ihren Kopf?«, fragte das Mädchen und drehte sich um.
In diesem Moment geschah etwas mit Fritz. Es durchfuhr ihn wie ein Blitz. Noch nie hatte er etwas Schöneres gesehen. Er war fest davon überzeugt, dass dies das schönste Mädchen der ganzen Welt war. Es hatte braune Locken, die fast bis in die Taille rieselten, die Augen waren so unglaublich blau, die Haut so weiß und die Sommersprossen auf der Stupsnase wie kleine Sprenkel auf Porzellan. Die Kleine lächelte ihn an.
»Du solltest gar nicht hier sein«, sagte er, weil ihm nichts Besseres einfiel.
»Ja, ich weiß. Mein Papa sagt auch, dass wir Ausgangssperre haben und dass ich zu Hause bleiben muss. Ich soll das Gemüse im Garten gießen, aber es gedeiht nicht. Der Porree ist seltsam grün, der Kopfsalat immer welk, und die fünf Tomatenstauden tragen auch nur spärliche Früchte. Alles ist staubig. Was soll ich ganz allein im Garten? Mir ist dort so furchtbar langweilig. Ich heiße Isabelle. Und du?«
»Ich heiße Fritz.«
»Fritz. Ritz. Blitz. Ein lustiger Name. Und du redest lustig.«
»Französisch ist schwer.«
»Finde ich nicht.«
Nun musste Fritz lachen. »Wenn man hier geboren ist, vielleicht nicht, da hast du recht. Kannst du etwa Deutsch?«
»Natürlich. Blitzkrieg. Hafenkapitän. Rommelspargel.«
»Woher hast du solche Wörter?«
»Die hört man.«
»Soso.« Er lächelte.
»Ja, zu Hause. Pierre und Chantal sagen, dass Deutsch hart ist. Gar nicht melodiös oder gar charmant. Weil es so viele Konso…dings hat. Wie in Strumpf. Was bedeutet Strumpf?«
Alles in Fritz jubilierte. Er führte eine sprachphilosophische Betrachtung mit dem schönsten Mädchen der Welt am schönsten Strand Europas.
»Du meinst Konsonanten. Strumpf heißt auf Französisch chaussette.«
Sie wollte gar nicht mehr aufhören zu lachen. »Strumpf, Sumpf, Mumpf!«, rief sie fröhlich.
»Und wer sind Pierre und Chantal?«, fragte Fritz.
»Pierre ist Dichter und Chantal Malerin.«
»Deine Eltern?«
»Nein! Es sind Freunde von Papa und auch meine Freunde.«
»Hast du keine Freunde in deinem Alter?«
»Doch, aber es sind noch Ferien. Außerdem bin ich schon zehn. Und du?«
»Zwanzig.«
»Das ist alt.«
Er lachte. »Aber jetzt musst du hier verschwinden, Isabelle. Sonst müsste ich …«
»Bist du ein Boche?«, unterbrach sie ihn.
»Ja, nein, also …«
»Du darfst nicht so ernst schauen. Das gibt Falten. Vor allem, wenn man alt ist«, sagte Isabelle streng.
»Woher hast du derartige Weisheiten?« Er schüttelte den Kopf.
»Von Chantal. Sie lacht fast immer, weil sie viel Wein trinkt. Wein macht lustig. Die Boches vertragen unseren Wein nicht, sagt Pierre. Sie saufen ihn wie Bier.«
»Ich komme aus einem Weindorf und kenne mich gut mit Wein aus. Ich vertrage ihn. Und kann einen guten von einem schlechten unterscheiden.«
»Das muss ich Chantal erzählen oder …« Sie überlegte. »Besser nicht. Die sagen, wir müssen besonders achtgeben bei denen mit den zwei kleinen silbernen Blitzen am Kragen. Am besten sollen wir dann den Bürgersteig wechseln. Ihr schneidet Kindern die Hände ab.«
»Unsinn!«
»Und ich soll keine Schokolade nehmen, weil die vergiftet ist.«
»Papperlapapp! Ich hätte hier gerade eine.« Fritz kramte in seinen Taschen und förderte eine etwas aufgeweichte Tafel zutage.
»Dann musst du aber mitessen!«, rief Isabelle begeistert.
»Damit du siehst, ob sie wirklich vergiftet ist?«
»Freilich.« Das Mädchen lachte verschmitzt.
Und so saßen sie auf einem Baumstamm und teilten die Schokolade, bis sich die Dämmerung herabsenkte.
»Isabelle, du musst jetzt wirklich nach Hause«, sagte Fritz.
»Gut, aber wir treffen uns wieder, Fritz, Ritz, Blitz!«
Sie rannte davon, ein Stück den Strand entlang und dann die Stufen hinauf.
Fritz blieb auf dem Baumstamm sitzen. Es war der erste Tag seit zwei Jahren gewesen, an dem er gelebt hatte. Gefühlt. Und von Herzen gelacht hatte.
Die anderen deutschen Soldaten soffen und vertrugen den Wein wirklich nicht. Sie verprügelten Franzosen, sie pissten in Gärten, sie torkelten betrunken umher und rissen Blumen aus den Töpfen. Die deutschen Behörden hatten den Verkauf von alkoholischen Getränken an Soldaten verboten – allerdings galt das nur für harten Tobak. Bier, Wein und Champagner blieben weiterhin erlaubt. Fritz war das Gebaren seiner Kameraden peinlich. Einige von ihnen verachteten die Vendée als Zwangsferienort und warteten nur darauf, an die richtige Front gehen zu dürfen. Blut und Boden – sie wollten das heimholen, was sie für das großdeutsche Reich hielten. Fritz zweifelte. Er zweifelte oft.
Seine Aufgabe war es, den Bau der Verteidigungsanlagen zu koordinieren. Sie bauten ein Blockhaus nach dem anderen, denn sie wollten die gesamte Küste unter Kontrolle haben. Aber wie wollte man bitte schön das unbändige Meer überwachen?
1940
Benedikt
Agnes war nun BDM-Führerin. Weil sie die dicksten Zöpfe hatte und die blauesten Augen. Das sagte zumindest die Oma. Agnes war vierzehn geworden und hatte auch schon Holz vor der Hütt’n. Das sagte Hanserl, der Großknecht. Für Benedikt war sie Agi, die große Schwester, die sich immer um ihn gekümmert hatte. Die Mama war bei der Geburt von Afra gestorben. Gott hat sie heimgeholt, sagte die Oma. Warum heim, sie war doch hier daheim?, hatte Benedikt einmal gefragt. Magst a Schelln?, war die Antwort gewesen. Benedikt lernte früh, dass man besser nicht nachfragte, sondern den Kopf einzog und sich unsichtbar machte. Das konnte er ganz gut: in Deckung gehen. Heute allerdings konnte er sich nicht wegducken, denn das Heu musste gemäht werden.
Seit drei Jahren hatten sie ein Pferd. Leni war ein Kaltblut, und irgendwie hatte es der Papa immer geschafft, das Pferd vor der Aushebung, wie sie das nannten, zu verstecken. Im Spätherbst letzten Jahres hatten Agnes und Bene die gute Leni in einen alten Stollen geführt und ihr immer wieder Heu vor die Nase gehalten, damit sie bloß nicht wieherte, während die Soldaten kamen. Der Papa hatte den Männern mit den Hakenkreuzen an den Jacken den Ochsen angeboten, aber der war ihnen zu alt gewesen. Sie hatten sich zwei Lämmer gegriffen, die Hühner waren ihnen entgangen. Die hatte die Oma vorher in den Keller gebracht, die Klappe geschlossen, einen Fleckerlteppich drübergelegt und sich samt dem Spinnrad daraufgesetzt. Wenn man gute Ohren hatte, hörte man die Hühner im Keller krakeelen, aber die Oma übertönte das mit ihrem Gezeter und Gejammer, dass sie doch die Lämmer brauche. Dass sie doch sonst verhungern würden.
Bene hatte Angst gehabt und sich doch fasziniert gefragt, wie das Ganze ausgehen würde. Die Staatsmacht gegen die Oma. Wie gefährlich Omas Versteckspiel war, das hatte er nicht begriffen. Auch nicht die lüsternen Blicke der Männer auf Agnes. Es war Afra gewesen, die sie alle rettete. Sie gab ein merkwürdiges Geräusch von sich und spie dann einem der Männer fast auf die Stiefel.
»Arg krank, das arme Kind«, behauptete die Oma. »Ansteckend.«
Die Männer zogen fluchend ab und vergaßen sogar die Lämmer.
»Kind, was hast du gegessen? Die Kirschen?«
Die Frage erübrigte sich, die Farbe und Konsistenz des Mageninhalts waren verräterisch genug.
Afra wiegte den Kopf hin und her. »Eine Birne, ein paar Kirschen. Und was von dem roten Zeug.«
»Von meinem Hagebuttenlikör?«
Afra zog die Schultern hoch und die Nase kraus.
»Wer auf den Punkt speiben kann, hat einen Orden verdient«, meinte Agnes ungerührt.
Seine beiden Schwestern waren völlig unterschiedlich. Agnes, groß und pragmatisch – Afra, klein, dünn, fast sphärisch. Afra war fünf, benahm sich oft merkwürdig und sagte komische Sachen. Ihretwegen musste sich die Oma oft bekreuzigen. Benedikt war mit seinen acht Jahren kein kleines Kind mehr, sein Blick wurde allmählich weiter.
Es gab immer wieder Situationen, in denen das Regime ihnen auf den Pelz rückte, aber eigentlich liefen sie alle unterm Radar. Hier gab es nichts, keine Industrie, keine Städte, nur Kleinbauern, die gerade so überlebten. Bene schnappte immer mal etwas auf, wenn sich der Papa, der Nachbar und die Knechte unterhielten. Wenn jemand im Krieg geblieben war, das war dann wohl so, als wenn Gott einen heimholte, dachte er. Der Nachbar hatte einen Radioapparat, aus dem laute, blecherne Stimmen kamen, die Bene als bedrohlich empfand. Natürlich wusste er, dass Krieg war. Agnes strickte mit ihren deutschen Mädels Socken für die Front. Sie ging gerne zum BDM, denn so entkam sie der Arbeit auf dem Hof. Dort konnte sie mit der Amrei und der Johanna kichern. Dass man einen schnellen Hitlergruß hinwerfen musste, das war eine Pflicht, die man, ohne nachzudenken, erfüllte. Bene war ab und zu beim deutschen Jungvolk gewesen, wo sie vor allem gewandert waren und Lieder gesungen hatten, deren Texte er sich nicht merken konnte. Er hatte es eher albern gefunden. Einmal sollten sie im Heuschober vom Ganahl übernachten, weil das die Jungen stärken sollte. Bene war ohnehin ein Bauernbub, seine Matratze war mit Stroh und Heu gefüttert. Da lag er jede Nacht. Ob ihn das aber stärkte?
Die Tage waren von der Arbeit und dem Wetter bestimmt, und heute musste der Omada eingeführt werden. Sie hatten sechs Tagwerk gemäht. Es war der dritte Tag, sie hatten das kostbare Gut stundenlang gewendet, jetzt war die Zeit der Ernte. Es hatte oft gewittert im August, doch nun lag seit Tagen ein Hoch über dem Land. Die Tage waren schon kürzer, der Nachttau feuchter, die Abende wurden schnell frisch.
Bene aß gerade sein Mus zum Frühstück, als Afra sagte: »Es wird regnen heute Abend.«
»Mädchen, es ist Kaiserwetter, woher soll da Regen kommen?«, grummelte der Vater.
Afra deutete nach Westen. »Von da.«
Sie wendeten mit großen Holzgabeln das Grummet, warfen es auf, flirrende Fäden rieselten zu Boden. Agnes reckte und streckte sich. Ihr schien der Rücken wehzutun.
»Das kommt von den Dutterln, die ziehn nach vorn«, raunte Hansel dem Erwin zu.
Erwin war ein Junge aus dem Bregenzerwald, der im Sommer gegen Kost und Logis auf dem Hof arbeiten durfte. Im Oktober zog er heim, im Winter konnte und wollte man einen unnützen Esser nicht durchfüttern. Aber die Oma gab ihm immer gestrickte Pullover und Socken für die kleinen Schwestern mit, die sich ein Paar Schuhe teilen mussten. Afra, die Agnes’ Schuhe auftrug, war aus einem Paar herausgewachsen – das würde Erwin mitnehmen können. Der Junge war fünfzehn Jahre alt, zum ersten Mal war er vor zwei Jahren zu ihnen gekommen.
»Wir müssen dem Herrgott danken, dass es uns so gut geht«, hatte die Oma gesagt.
Sie besaßen fünf Kühe, vier Mutterschafe, den Bock, immer wieder Lämmer, mal mehr und mal weniger Hühner – je nachdem, wie viele Habicht und Fuchs erbeuten konnten. Außerdem hatten sie Leni und den Ochsen. Sie nannten zwölf Tagwerk Wiesen, einen Hangwald und drei Tagwerk Roggen ihr Eigen. Im Gegensatz zum Erwin hatte Bene noch nie Hunger leiden müssen.
Agnes wurde zum Hof geschickt, um das Mittagessen zu holen: einen ordentlichen Ranken Brot und etwas Käse. Sie saßen im Schatten zweier Eichen, als von weit her ein Grummeln tönte.
Der Vater war wie elektrisiert. »Das darf nicht sein!«
Sie schossen hoch, das Winterfutter durfte nicht verderben. Leni, die am Wegrand graste, wollte nur ungern so früh ihre Pause beenden, doch nun wurde sie vor den Schwader gespannt. Das Grummeln war schon etwas lauter geworden. Der Vater und Leni arbeiteten gleichmäßig, keiner sah nach Westen. Leni wurde umgespannt, an den Wagen, es war inzwischen fünfzehn Uhr geworden. Gefleckte Schattenrisse legten sich über das Feld, dann riss es wieder auf, um wenig später dunkler zu werden. Der erste Wagen war beladen. Afra und Agnes saßen obenauf, Bene rechte die Reste zusammen. Irgendwo weiter im Westen rumste es. Bene hob die Augen. Es waren Wolkengebirge, die auf sie zuritten. Hoch und bedrohlich. Der Wagen war zurück, sie gabelten wie besessen. Wind kam auf.
»Der Wind, der Wind, das himmlische Kind«, sagte Afra.
»Jetzt halt den Mund, du Unheilsbotin«, herrschte der Vater sie an.
»Es wird noch nicht so schnell regnen«, sagte sie nur.
Der Himmel wurde immer grauer, der Wind fuhr in das trockene Grummet, hob es an, verwirbelte es, kleine Tornados gaukelten wie neckische Trolle über das Feld. Niemand sprach. Eine Wagenladung nach der anderen wurde im Heuboden abgeladen. Sie beluden gerade den letzten Wagen, als ein Blitz urplötzlich über den Wald zuckte. Das Donnern nahm zu, das Grollen und die Blitze kamen näher, die Abstände wurden kürzer.
»Runter da!«, rief der Vater gegen den Wind an.
Wenn der Blitz einschlagen würde, dann womöglich in den Wagen. Der Vater war wortkarg, aber Bene wusste, dass er nicht auch noch ein Kind verlieren wollte. Im Zweifelsfall würde er Leni opfern, denn ein mit Eisen beschlagenes Pferd konnte den Blitz anziehen. Nun rannten sie alle, um rechtzeitig am Hof anzukommen.
Der Wagen stand unter dem Vordach, als es anfing zu regnen.
»Hoffentlich haben sie beim Eitzenberger das Heu auch drin«, sagte Benedikt und sah in eine Wand aus Wasser. Flori Eitzenberger war sein Freund auf dem Hof hinter dem Hügel, unten am Weiher.
Afra lächelte Bene an. »Alles gut, habt nur Mut.«
Die Oma bekreuzigte sich.
2
Aurelie
Aurelie merkte, dass alle sie ansahen. Isabelle war tot? Das konnte doch gar nicht sein!
»Wie ist sie …? Ist sie …?«, stammelte Aurelie.
»Sie ist in der Schweiz verstorben.«
»In der Schweiz?«, fragte Eike ungläubig.
»Nun, in der Schweiz ist der Umgang mit dem Tod anders als hier.«
»Isabelle hat Sterbehilfe erhalten?«, flüsterte Aurelie.
»Ja, das war ihr Wunsch.«
»Aber …«
»Sie war sehr krank. Sie wollte selbst bestimmen, wann es so weit ist.«
»Na, das passt ja zu ihr«, sagte Eike leise, aber doch vernehmbar.
»Krass!«, kam es von Lotte.
In Aurelies Ohren rauschte es. Isabelle hatte den Freitod gewählt. Sie hatte gar nicht gewusst, wie krank ihre Tante gewesen war. Kein Wunder, schließlich war sie vor fünf Jahren zuletzt am Hintertristerweiher gewesen.
»Und die Beerdigung?«, fragte Laurent.
Pranger sah den Jungen an. »Gibt es nicht. Es gibt ein Urnengrab auf einem Schweizer Friedhof, das man besuchen kann. Sie wollte keinem eine Last sein.«
Eine Last? Isabelle war Aurelies einzige Verwandte gewesen. Ihr einziger Anker in die eigene Vergangenheit, die Aurelie ansonsten verdrängte. Nur in melancholischen Momenten dachte sie an das Meer, an ihren Großvater und die Mutter, die keine gewesen war. Und in solchen Momenten huschte auch Isabelle in ihren Gedanken vorbei, wo sie als Studentin öfter zu Besuch gewesen war. Aurelie war nicht allzu oft melancholisch, das erlaubte sie sich nicht, aber nun schoss ein Pfeil in ihr Herz. Sie hatte Isabelle vernachlässigt. Die Schule, die Kinder, Verpflichtungen, Eikes unstetes Leben mit seinen Recherchereisen, Urlaube – lauter Gründe, nicht an den Weiher zu fahren. Hatte sie etwa geglaubt, dass Isabelle hundert werden würde? Dass sie noch Zeit hätte?
Am liebsten wäre Aurelie jetzt hinausgegangen, weit weg von allen Menschen. Stattdessen saß sie in diesem Raum, umgeben von lauter ausgestopften Tieren, darunter auch ein Rehlein, ein geflecktes Bambi, das in Moos gebettet dalag. Das Moos war zerfleddert, das Rehlein zerschlissen. Wer stopfte denn bitte ein Bambi aus?
Isabelle mit ihrem Gnadenhof für Seniorentiere hätte das sicher missfallen. Früher hatte sie Islandpferde gezüchtet, doch als vor vielen Jahren ihr Mann gestorben war, hatte sie aus der Pferdezucht diesen Gnadenhof gemacht. Soweit Aurelie wusste, schmiss sie den Laden mithilfe einiger Nachbarn, beherbergte gebrechliche Viecher und bewirtschaftete zusätzlich einen Kiosk am Hintertristerweiher, wobei Kiosk etwas klein gegriffen war. Eher ein kleines Gasthaus mit Seeterrasse.
»Sie wollen uns also sagen, dass wir geerbt haben?«, wiederholte Eike. »Diesen Siechentierpark?«
»Herr Brodersen!«, unterbrach ihn Pranger. »Es handelt sich dabei um eine Art Seniorenresidenz für Tiere. Für die Ausgestoßenen, die ja auch noch einen schönen Lebensabend verdient haben.« Er blickte streng in die Runde. »Wie Lolek und Bolek, die eigentlich schon vor vier Jahren beim letzten Ochsenrennen hätten geschlachtet werden sollen.«
»Am Spieß hätten sie auch was hergemacht«, kommentierte Eike ungerührt.
»Papa!«, kam es von Lotte, die Vegetarierin im Übergang zur Veganerin war.
»Und wir erben jetzt die ganze Kohle, die Ferienanlage, zwei Häuser und den öden Gasthof?«, fragte Laurent, der das Pragmatische vom Vater hatte.
»Nun, im Prinzip ja, es ist nur eine klitzekleine Bedingung daran geknüpft«, entgegnete Pranger.
»Bedingung?«, hakte Aurelie nach.
»Nun, Isabelle hat verfügt, dass Sie lediglich ein Jahr lang den Gnadenhof und den Kiosk führen müssen. Also die Tiere versorgen und, wenn nötig, in den Tod begleiten. Wenn Sie sich dann des Erbes als würdig erwiesen haben, gebe ich das Geld frei.«
Das Wort »lediglich« hing im Raum. Auch »würdig« hallte irgendwie nach.
»Bitte?« Eike hatte sich erhoben und sich mit den Händen auf dem Wirtshaustisch aufgestützt.
»Ja, die wunderbare Isabelle war völlig klar bei Verstand, und sie wollte ihr Geld nicht einfach so an ihre einzige Erbin vergeben.«
»Einfach so«, flüsterte Aurelie.
Es war still, Stimmen drangen von draußen herein, die Siegesfeierlichkeiten waren noch in vollem Gang.
»Das ist doch kompletter Schwachsinn!« Eike war zum Fenster gegangen. »Wir werden das Erbe nicht annehmen!«
»Ja, aber was ist, wenn wir ablehnen?«, fragte Aurelie.
»Wollt ihr zwanzig Millionen ablehnen? Spinnt ihr?«, fragte Laurent, der in Mathe sehr pfiffig war.
»Die wunderbare Isabelle hat verfügt, dass dann eine andere Person erbt. Die überdies auch erbt, wenn Sie versagen.«
»Wenn der noch einmal ›wunderbare Isabelle‹ sagt, spring ich aus dem Fenster«, brummte Eike.
»Wir sind im Erdgeschoss, Papa«, bemerkte Lotte lakonisch.
»Wer erbt dann?«, fragte Aurelie.
»Das darf ich Ihnen nicht sagen.«
Wieder legte sich eine Art Schweigeminute über die Gruppe.
»Und wer will bitte schön kontrollieren, ob wir diese debilen Viecher – sofern wir überhaupt zusagen – richtig behandeln?«, fragte Eike.
Pranger lächelte weiter sein smartes Lachen. »Dafür hat die wunder… also die Isabelle auch gesorgt. Mir wird Bericht erstattet werden, ob Sie die lieben Tiere pfleglich behandeln.«
»Von wem?«
»Das darf ich Ihnen nicht sagen.«
»Krass«, meinte Laurent.
»Nice! Wir kriegen einen Tierpark und ein Feriendorf!« Lotte strahlte. »Das muss ich Emma erzählen!«
»Nichts wirst du!«, rief Eike.
Pranger fuhr fort: »Isabelle hat sich in Ihre Lebenssituation hineingedacht. Aurelie arbeitet ja nur von Dienstag bis Donnerstag, und Sie, Herr Brodersen, sind Freiberufler. Aurelie kann also bereits am Donnerstagabend oder Freitag früh an den Weiher reisen. Die Familie kommt nach Schulschluss am Freitag nach. Für die Tage von Montag bis Donnerstag hat Isabelle eine Tierpflegerin angestellt, und die Gastronomie am Hintertristerweiher …«
»Gastronomie – was für ein Name für ein paar Wurstbrote«, höhnte Eike.
»… die Gastronomie hat sowieso nur von Freitag um vierzehn Uhr bis Sonntagnachmittag geöffnet«, sagte Pranger unbeirrt. »Lediglich in den Sommerferien ist dort auch unter der Woche offen. Ein perfektes Konstrukt. Alles kann weiterlaufen wie gewohnt.« Er hob den Zeigefinger. »Muss weiterlaufen wie gewohnt! Keine Änderungen, die Stammtische vertragen das nicht.«
»Vertragen das nicht«, echote Aurelie, die sich fühlte wie nach einem Marathon, obwohl sie noch nie einen gelaufen war.
»Nun«, sagte Pranger. »Ich gebe zu, Sie etwas überfahren zu haben. Schlafen Sie drüber.« Er sah Eike an. »Natürlich können Sie ablehnen, was ich aber bedauerlich fände. Und was bestimmt nicht in Isabelles Sinn gewesen wäre.«
»Ach ja! Und deshalb tischen Sie uns diese krude Geschichte auf? Diese Alte hat mich gehasst. Das ist ihre letzte Rache!«
»Eike, das geht jetzt nicht«, flüsterte Aurelie.
»Papa, Tante Isabelle war etwas komisch, und ich hab sie kaum gekannt, aber zwanzig Millionen sind ganz bestimmt keine Rache«, sagte Laurent.
Aurelie hätte ihn am liebsten geküsst.
»Wie gesagt, lassen Sie das Ganze sacken, und rufen Sie mich morgen an.« Er reichte Aurelie sein Kärtchen mit seinem Namen. Ein Dr. Dr., eine Adresse und alles in erhabenen goldenen Lettern.
Ende der Leseprobe