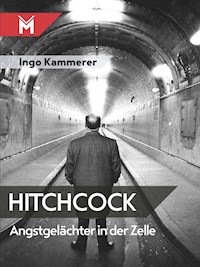
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mühlbeyer Filmbuchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Dealing with Hitchcock is like dealing with Bach. He thought up practically every cinematic idea that has been used and probably ever will be used in this form." (Brian de Palma) Alfred Hitchcock zählt zu den großen Regisseuren der Filmgeschichte. Das Werk des "Master of Suspense" ist ohne Zweifel ein besonderes und prägt das filmische Erzählen bis in unsere Tage. Gerade seine drängende Erzählweise bei mancher Abstraktion und die spezielle Rolle des Zuschauers als wesentlicher Teil des Überwältigungsspiels zeichnen Hitchcocks Filme nach wie vor aus und ermöglichen ein "Angstgelächter in der Zelle", das ungebrochen Wirkung erzielt. In "Hitchcock – Angstgelächter in der Zelle" flaniert Ingo Kammerer durch Alfred Hitchcocks Œuvre – konzentriert und kurzweilig, detailfreudig, und freigeistig assoziativ. Ein essayistischer Streifzug durch die Kunst dieses für die Geschichte des Films wegweisenden Werks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ingo Kammerer
Hitchcock – Angstgelächter in der Zelle
Inhaltsverzeichnis
I. REFERENZEN – Schöpfung des Zuschauers
Dichtung, Wahrheit, Wahrscheinlichkeitskrämer
Ein Kuchenstück – ein Kinderspiel
Antriebsmotor Angstlust
Unterwegs mit Ödipus, Adam und Damokles
Unsicherheit und Selbstmanipulation
II. PRINZIPIEN – Reinheit im Genrekino
Pure Cinema - Kameraerzählungen
Avoiding the cliché - Kontrapunkte
Purest expression - Abstraktionen
Only a movie - Bruchstellen
III. TENDENZEN – Muster und Spuren
The Birds will sing at 1.45!
Schnittmuster – SABOTAGE (1936)
Then your name isn’t Kaplan?
Bewegung – THE 39 STEPS (1935), SABOTEUR (1942), NORTH BY NORTHWEST (1959), TORN CURTAIN (1966), TOPAZ (1969)
We think Thorwald’s guilty
Bühne – LIFEBOAT (1944), ROPE (1948), DIAL M FOR MURDER (1954), REAR WINDOW (1954)
I don’t care anymore about me
Dressur – REBECCA (1940), SUSPICION (1941), NOTORIOUS (1946), VERTIGO (1958), MARNIE (1964)
Are they [human beings]?
Dopplung – SHADOW OF A DOUBT (1943), STRANGERS ON A TRAIN (1951), VERTIGO (1958), FRENZY (1971)
Risseldy, Rosseldy, now, now, now
Untergang – THE WRONG MAN (1956), THE BIRDS (1963)
Thank you, Norman
Musterschnitt - PSYCHO (1960)
Literatur
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2019 Mühlbeyer FilmbuchverlagInh. Harald MühlbeyerFrankenstraße 21a67227 Frankenthalwww.muehlbeyer-verlag.de
Lektorat, Layout: Harald Mühlbeyer
Umschlagbild:Alfred Hitchcock im Alten Elbtunnel, Hamburg 1960© Archiv Robert Lebeck
Umschlaggestaltung: Steven Löttgers, Löttgers-Design Birkenheide / Harald Mühlbeyer
ISBN:
978-3-945378-60-1 (PDF)978-3-945378-57-1 (Print)978-3-945378-58-8 (Epub)978-3-945378-59-5 (Mobipocket
Druck: BoD, NorderstedtPrinted in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für Luise
I. REFERENZEN – Schöpfung des Zuschauers
Filme sind kuriose Erscheinungen.
Ihre unmittelbare Inszenierung ermöglicht eine Erlebnisgegenwart, die bereits »ganz mit historischem Edelrost überzogen« ist (Thomas Mann), also vermittelt, zeitlich (weit) rückblickend erzählt wird. Stärker als in der verwandten Literatur wird in Filmen das paradoxe Gemisch aus Vergangenheit und Gegenwärtigkeit deutlich. Intensiver wirkt hier auch der Köder des Als-ob, jener Quasi-Realität, die das Leben darstellt, ohne es zu sein. Gerade dieses Spielerische des Films, sein traumähnliches Potential, ist es, das zur Grundlage seines Erfolges wird. Dabei sieht und hört der involvierte Träumer oder ›Zuschauer‹ doch eigentlich Wirklichkeiten zu und reagiert in Echtzeit je nach Fügung der projizierten ›Realität‹. Filmbetrachter sind nie so ganz bei sich. Sie gehen auf Reisen, entfliehen dem Alltag, riskieren stellvertretend Wagnisse, die ihnen unter normalen Umständen nicht in den Sinn kämen, und transzendieren so ihr multiples Ich in Erfahrungsräume hinein, die, genau betrachtet, gar keine sind.
Man hat es also mit einer besonderen Wahrheit zu tun – mit Kunst. Als »siebte Kunst« gilt der Film manchen Arithmetikern, wenn nicht sogar mehr auszumachen ist. Sind Filme doch dem alten Verbindungsideal des Gesamtkunstwerks – einer Mixtur aus darstellender und bildender Kunst, Dichtung und Musik – am nächsten. Und doch wird man bei Ansicht einiger Beispiele an vieles, kaum aber an ein Kunstwerk denken. Das sind natürlich alles keine Alleinstellungsmerkmale des Mediums und dennoch muss man Filme ästhetisch immer ein bisschen zwischen den Stühlen vertrauter Theorien platzieren, was die Betrachtungshaltung eines Sowohl-als-auch in mehr als einer Hinsicht legitimiert.
Gefragt ist somit Toleranz. Man kann sogar sagen: Sie ist die Grundbedingung gelingender Kinoverständigung. Denn diese Texte – natürlich sind Filme auch Texte mit einer besonderen Sprache – werden noch von einem völlig anderen Feld geprägt, das die Filmgestalt, Form- und Inhaltsfragen erheblich mitbestimmt. Gemeint ist der recht hohe Kostenaufwand, der für eine Filmproduktion benötigt wird. Die hierfür notwendigen Geldgeber investieren freilich in ein Produkt, das die Vorleistungen rechtfertigen und Gewinn erzielen sollte – mit der Folge, dass in allen Herstellungsphasen an ein (sehr) großes Publikum gedacht werden muss. Filme sind teure und daher wohlkalkulierte Texte für ein Tagesgeschäft, das im Fall der Kinoauswertung oft genug zwei Publikationswochen nicht übersteigt.
Und dann? Was bleibt von diesem kostspieligen Kunstprodukt nach wahrscheinlich kurzem Leinwandleben? Nicht viel, muss man sagen. Gelingt es einigen Filmen über die Erstauswertung hinaus, einen gewissen Glanz zu bewahren, so sind nur wenige davon nach einer Dekade noch relevant. Handverlesen schließlich ist der verbleibende Rest, der entweder filmgeschichtlich von Bedeutung ist oder es geschafft hat, generationenübergreifend wirksam zu sein. Kanon und Publikumszuspruch: Die so genannten »Klassiker« sind der sichtbare Teil des Eisbergs. Und es ist nicht schwer zu erahnen, warum nur diese eine fürsorgliche Behandlung erfahren. Auch hier sind Auswahlkriterien für die Aufnahme in die filmische Backlist – d.h. digitale Publikation, Restauration des Originalfilms, Wiederaufführung im Kino und somit Zuspruch eines Erinnerungswerts – oft genug Zahlenspiele, selten künstlerische Aspekte. Dies mag man bedauern. Ändern wird man es nicht. Jedoch: Überraschungen kommen vor.
Alfred Hitchcock zum Beispiel. Denn in dieser Genese des Vergessens ist Hitchcock so etwas wie eine Rarität. Das mag im ersten Moment irritieren – sind da doch einige Texte, die das Prädikat »Klassiker« redlich verdient haben! –, wird aber zweckmäßig, wenn man sich vor Augen hält, dass nicht nur jene Filmperlen der Öffentlichkeit zugänglich sind, sondern inzwischen eine komplette Hitchcock-Werkschau auf digitalen Medien vorliegt. Er ist damit einer der wenigen noch in Stummfilmzeiten aktiven Regisseure, dessen komplettes Werk1 (immerhin 53 Langfilme) zu erwerben ist. Das überrascht schon. Denn besonders im Früh-, vereinzelt auch im Spätwerk des Briten sind Schwächen festzustellen, kommt es zu Schlampereien und Schludrigkeiten, weshalb eine Publikation dieser Filme unter normalen Umständen wohl ausbliebe. Die Umstände sind aber nicht normal. Der Mann ist mehr als nur ein Regisseur von erfolgreichen Filmen. Er ist ein umfangreich ausgestatteter Bedeutungsraum, ein Wahrzeichen (nicht nur) des Kinos.
Schon der Name, die Lautfolge »Hitchcock« führt ein Eigenleben. Seit gut einem dreiviertel Jahrhundert ist dieser Zweisilber ein gängiges Synonym für Spannung und Überraschung, existentielle Bedrohungen, anziehende und zugleich abstoßende Phantasmagorien, unverschuldeten Identitätsverlust und dergleichen mehr. Allein die Bezeichnungen im alltäglichen Sprachgebrauch – und da liegt vieles vor, was »à la Hitchcock« gestaltet oder im Ganzen ein »echter Hitchcock« ist – machen deutlich, dass Person und Werk nicht zu trennen sind, das eine ins andere übergeht, mit diesem verschmilzt. Und beiden – oder soll man sagen der Symbiose, der Einheit? – gelingt die vom Film versprochene und durch das mediale Speichermodul ohnehin garantierte Unsterblichkeit. Keine Filmgeschichte ohne Positionierung des Briten, keine Generation ohne (offenes oder verstecktes) Hitchcock-Bild, kaum ein Werk eines relevanten Regisseurs ohne direkte oder indirekte Auseinandersetzung mit seinem Erbe. Hitchcock ist längst zum Multiplikator, zum Superzeichen geworden: Ikonisch vielfach reproduziert und gegenwärtig ist das Zeichen auch eines mit deutlicher Verweis- sowie gesetzter Bedeutungsfunktion. Ist es demnach Index und Symbol zugleich, vielleicht sogar eine Marke, die in ihrem Stellvertreterdasein das Attraktionsprinzip des Kinos stimmig widerspiegelt. Wer über Filme schreibt, schreibt immer auch ein wenig (gelegentlich viel) über ihn. Wer sich in irgendeiner Form dem Erzählphänomen der Spannung widmet – und wer mag schon darauf verzichten? –, trägt Hitchcock im Gepäck und nicht selten als Bürde mit sich. Wer sich schließlich dem unsterblichen Metagenre des Thrillers annähert, muss nach all den Jahren noch immer einen Vergleich mit ihm fürchten. Er ist nicht wirklich zu ignorieren, ist irgendwie immer mit dabei. Das hätte dem Egomanen in ihm sicherlich gefallen.
Aber nicht nur im filmischen Feld findet eine Auseinandersetzung mit dem katholischen Briten statt. Durchaus vergleichbar mit Franz Kafka, dessen Werk die Literaturwissenschaft zu immer neuen Auslegungsanstrengungen treibt, ist auch die schriftliche Auseinandersetzung mit Hitchcock inzwischen zu einer riesigen Materialfülle angewachsen und wird stetig fortgesetzt. Die Interpreten werden nicht müde, sich ihm und seinen (Film-)Ideen zu widmen. Und sie werden dabei auch immer wieder fündig. Möglicherweise liegt ja mit diesem Werk so etwas wie ein kulturelles Rätsel vor, dem auf die Schliche zu kommen nie so ganz gelingt, das zu erklären, zu deuten aber manche Anstrengung rechtfertigt. Unter der Oberflächenmaische einfach gestrickter Handlungen gärt es bei Hitchcock. Und jener angestoßene Prozess der Wandlung setzt sich nach der Filmansicht im Betrachter fort oder, wie Georg Seeßlen so schön formuliert: »Wer einmal in einem Hitchcock Film war, kommt nie ganz wieder heraus.« Endlosschleife Hitchcock? Dafür spräche auch jene Auslegung von Gerhard Bliersbach, der Hitchcockfilmen traumatisches Überwältigungspotential zuschreibt und einen Wiederholungszwang, »eine Art rituelle[n] Kinobesuch« als zwingende Folge benennt.
Nun gut. Natürlich kann man solche Perpetuum-Mobile-Tendenzen belächeln; man kann sie allerdings auch als Hinweis lesen, dass hier eine Schöpfung vorliegt, die die Menschen antreibt und beschäftigt, sie demnach wohl betrifft und angeht. Womöglich beschreibt ja diese Filmsammlung die Weltwahrnehmung der Zuschauer stimmig und löst so zwangsläufig Bestrebungen nach Erklärung und Sinndeutung aus. Ist Hitchcock mit seinen Thrillern vielleicht ein Vexierbild der Moderne gelungen? Fest steht: Unter dem allzu gefälligen Entertainment-Kostüm der Filmhandlung liegt das Unbehagen des modernen Menschenzoos – Neurosen, Ängste, Sehnsüchte, Gelüste, Möglichkeiten und zugleich Grenzen des Handelns – kaum wirklich versteckt. Auch sind die Wirkungsattribute jenes Kosmos erstaunlich farbenfroh: neben solchen der Bedrängung wie Orientierungsverlust, Bedrohung und Verzweiflung flackern auch manche des Glücks, die man etwa mit Klarheit, Lust und Komik umschreiben kann. Soviel wird deutlich: Eine monochrome Betrachtung führt nicht zum Ziel. Aber vielleicht ist hier ein ›Ziel‹ auch nicht zu finden. Wäre das doch eine Form der Generalaussage, eine Art Weltformel, die uns Hitchcock natürlich schuldig bleibt. Hier gibt es vielmehr einen großen Deutungsraum – nicht eines, sondern viele Ziele, nicht eine Sichtweise, sondern ganz unterschiedliche Optionen des Sehens werden angeboten. Das Labyrinthische hinter den simplen Storyfassaden ist irritierend verzweigt und nicht jeder Weg darin erforscht. Ergo ist eine Auseinandersetzung mit Hitchcock auch weiterhin gefragt und die Verbindung mit dem anderen großen Angstautor des 20. Jahrhunderts, Franz Kafka, in mancher Hinsicht gerechtfertigt.
1 Mit einer Ausnahme: Die zweite Regiearbeit – THE MOUNTAIN EAGLE (1926) – gilt als verschollen.
Dichtung, Wahrheit, Wahrscheinlichkeitskrämer
Denn Angst und Furcht, Orientierungsnöte und Identitätsverlust sind sowohl beim einen als auch beim anderen Schlüsselthemen des Werks. Das ist wohl kein Zufall. Wenn man also annimmt, dass eine solche Themenwahl eine Form der Ich-Spiegelung ist, dann liegt die Frage nahe, ob denn Hitchcock ein furchtsamer Mensch war. Auf jeden Fall. Ängste, Unsicherheiten bis hin zu panischen Ausfällen kannte er durchaus. Und nicht zu knapp, wenn man den Biografen1 glauben kann oder, was noch komplizierter ist, ihm selbst. Schließlich hat sich der in mancher Hinsicht zurückhaltende Hitchcock gar nicht so selten biografisch geäußert und war gerade im Hinblick auf seine Ängste erstaunlich redselig. Allerdings waren es immer dieselben Geschichten, die, selbst im Wortlaut nahezu identisch vorgebracht, das Gefühl der Inszenierung nie ganz abwegig erscheinen ließen. Man konnte und kann sich nicht sicher sein über den Wahrheitsgehalt dieser Stories. Muss jedoch zugeben, dass sie, wenn schon, alles in allem gute Erfindungen sind und die Fantasie der Zuhörer beflügeln. Also Dichtung oder doch Wahrheit? In gewisser Weise ist das eine unstatthafte Frage. Wer könnte schon über einen Einzelgänger wie Hitchcock verlässlich Auskunft geben? Und überhaupt: Was hätte man davon, wenn man einen Selbstdarsteller der Lüge bezichtigte? Somit glaubt man den biografischen Fragmenten, wie man auch den reichlich unzuverlässigen Erzählern seiner Filme glaubt. Bedingungslos. Dies aber aus gutem Grund. Weiß man doch: Das kann amüsant werden. Und enttäuscht wird man selten.
Da ist z.B. jene Schlüsselerzählung über den wohl fünfjährigen Alfred, der, mit einem Brief seines Vaters ausstaffiert, zur örtlichen Polizeistation geschickt und vom dortigen Wachtmeister nach der Lektüre für fünf Minuten in eine Gefängniszelle gesperrt wird. Den (erzieherischen?) Hinweis des Polizisten, so mache man es mit unartigen Buben, wollte Hitchcock noch in den letzten Interviews auf seinem Grabstein geschrieben sehen: »That’s what we do to naughty boys!« Ohne Zweifel ist das eine erstaunliche Geschichte. Und ein Plot, wie er sein muss: abhängiges Kind, schwarze Pädagogik, grauenhafte Pointe. Der Ich-Erzähler hat sofort unser Mitgefühl, das Publikum ist emotional involviert. Präsent sind die Richtlinien der Hitchcock’schen Vermittlung: Keine Erklärung des unerhörten Handelns stört die Wirkung der Ereigniswendung, keine Schilderung der Gefühle des Kindes behindert die individuelle Lesergestaltung. Und ganz nebenbei wird mit diesem biografischen (?) Einblick auch noch eine nachvollziehbare Ursache für die lebenslange Panik des Regisseurs vor der Polizei geliefert.
Man muss Hitchcocks Vorgehen gewissermaßen in praxi erleben und kann das mit Hilfe des Netzgedächtnisses auch, wenn man sich z.B. diese Gefängnisgeschichte im berühmten Interview mit François Truffaut anhört. Anders als in der publizierten Buchausgabe ist der Originalwortlaut weit ausführlicher, wirkungsspezifisch unmittelbarer und durch die Vergegenwärtigung der sonoren, auf Effekte bedachten Stimme Hitchcocks natürlich ein Ereignis von besonderem Unterhaltungswert. Was ist zu hören? Truffaut beginnt das Gespräch mit der Erwähnung der Gefängnisgeschichte und stellt zum Einstieg eine Frage, die ihm Hitchcock wohl nicht zugetraut hätte. Ob das denn eine wahre Geschichte sei, möchte Truffaut wissen. Und Hitchcock – gekränkt ob der Forderung eines Regiekollegen nach Wahrheit im Showbusiness – schweigt zunächst hörbar und gibt erst nach einem erneuten Anlauf Truffauts einige Hinweise zu diesem und jenem. Die unstatthafte Frage – fact or fiction? – beantwortet er selbstverständlich nicht. Zudem, so Hitchcock weiter, könne er sich nicht mehr erinnern, was er denn angestellt habe, um eine solche Behandlung zu verdienen. Im Gegenteil: Zur heiteren Verwirrung der Anwesenden trägt er im Folgenden bei, wenn er seinen Vater zitiert, der ihn doch immer als »little lamb without a spot« bezeichnet habe. Truffauts abschließender Versuch, durch die Behauptung, der Vater sei wohl sehr streng gewesen, mehr zu erfahren, verfängt wieder nicht, da Hitchcock kommentarlos bejaht und damit der Episode einen abrupten, freilich offenen Schluss erteilt.
Man kann dieses Vorgehen als ein Paradebeispiel effektiven Erzählens bezeichnen. Dem Hörer wird jenseits der pointierten Plotbasis nichts wirklich Wesentliches zur Ausschmückung und Erklärung geboten. Vielmehr sorgt das erwähnte »fleckenlose Lämmchen« für Ratlosigkeit. Zum einen ob der grausamen Strafe, zum anderen ob der Wahrhaftigkeit sowohl in Bezug auf die Storydetails als auch auf den historischen kleinen und großen Alfred. Die geradezu törichte Anschlussfrage Truffauts nach dem »strengen Vater« wird von Hitchcock beiläufig abgenickt. Wohlwissend, dass er damit alle Möglichkeiten der Zu- und Umschreibung erneut befeuert, den Spekulationen Tür und Tor öffnet, im Ganzen die Ratlosigkeit des Publikums noch steigert.
Dabei ist das Paradoxe an dieser Inszenierung, dass sie sowohl viel als auch wenig Hitchcock enthält. Das Potentielle als Unsicherheitsfaktor für den Wahrheitssucher lässt sich kaum ignorieren, das Werk als anleitende Größe ist durchweg präsent. Dagegen wird der dahinter stehende Mensch allenfalls angedeutet. Gekonnt spielt Hitchcock mit den Erwartungen Truffauts, lässt er ihn im Ungewissen und lenkt von einer möglichen Frustration ab, indem er durch eine humorvolle Bemerkung Heiterkeit auslöst. Es ist aber nicht jene Form des Humors, die einer aufbietet, der sich in die Enge getrieben fühlt und deshalb sein Heil in distanzierender Ablenkung sucht. Vielmehr dient der Spaß dem Spiel selbst, das Hitchcock hier mit Truffaut und also auch mit uns treibt: Er steigert die Unsicherheit des Wahrheitssuchenden durch das Kontrastpaar Strafe-Lämmchen so enorm, dass dieser – spät, aber nicht zu spät – einsieht, welch kuriosem Trugbild er aufgesessen ist. Ein Gespräch über Hitchcock handelt von Effekten, Manipulationen oder emotionaler Massenpsychose, niemals von der Wahrheit. »It’s only a movie«, machte der Brite frustrierten Mitarbeitern immer wieder klar. Nichts wirklich Wichtiges geschieht, keine Wahrscheinlichkeit ist zu berücksichtigen, keine Wahrheit oder Wahrhaftigkeit soll verkauft werden – nur ein Film. Aber immerhin auch nicht weniger als das.
Truffaut begreift und, was bleibt ihm übrig, lässt sich im Folgenden auf die Spielregeln ein. Wenn der kleine Hitchcock nun nicht in der Gefängniszelle gesessen haben und eigentlich sein Vater auch ein ganz umgänglicher Mensch gewesen sein sollte, so ist das überhaupt nicht von Belang, da der Werk-Person-Symbiose die Gefängnisgeschichte in der vorliegenden Form dient. Truffauts Funktion ist die des Berichterstatters, nicht des zweifelnden Kritikers, denn die höhere Wahrheit, die ›Wahrheit des Werkes‹ benötigt keinen Beglaubigungsbeleg der begrenzten Realität. Und die auf Letzteres beharrenden kleingeistigen »Wahrscheinlichkeitskrämer« – eine beinahe liebevolle Aburteilung all derjenigen, die sich um das Wirkliche hinter dem Werk, also um Unwichtiges, kümmern – sind ohnehin für Hitchcock verloren und sollen, wie Goethe einmal riet, ruhig verdrießlich sein / Und lebenslang verdrießlich bleiben.
Nun sind wir hoffentlich alle keine Philister in unserem Blick auf den Briten. Übellaunige Besserwisserei scheint kein sinnvoller Klärungsansatz zu sein beim Umgang mit einem Regisseur, der in Dramaturgien dachte und auch seine Lebensdarstellung solchen Form- und Wirkungsgesetzen komplett unterordnete. Ist also das, was wir von ihm wissen, alles Lug und Trug? Vielleicht. Und wenn schon. Spielfilme sind bunte Märchen mit mehr oder weniger Tiefgang, sind Traumgeografien für 90 Minuten, deren Unmöglichkeiten als künstlerische Freiheit bezeichnet werden können und in denen eine Anderswelt dargestellt wird, so dass ein Spiel mit der Realität beginnt ohne allzu große Rücksicht auf deren Regeln. Ein Filmemacher hat gefälligst erfinderisch zu sein, und Hitchcocks mögliche biografische Ausweitung dieser goldenen Regel macht nur deutlich, dass er immer Regisseur bleibt, auch im Leben, das das Werk spiegelt bzw. von diesem gespiegelt wird. Wen kümmern schon langweilige Wahrscheinlichkeiten? Krämerseelen eben.
1 Zwei Biografen – John Russell Taylor und Donald Spoto – prägen hier den Blick auf das Leben des britischen Filmemachers in Art und Weise einer ›Differenz im Gleichen‹. Taylors von Hitchcock autorisierte Biografie (1978) nennt die Lebensdetails (auch die unangenehmen), die Spoto fünf Jahre später erneut aufgreifen und in speziellen Teilen erweitern wird. Dabei verschiebt sich Taylors freundliche und verständnisvolle Betrachtung der Hitchcock’schen Verschrobenheiten unter den Händen Spotos zur ohne Zweifel spannenden, aber auch reichlich spekulativen Suche nach der »dunklen Seite des Genies«.
Ein Kuchenstück – ein Kinderspiel
Hitchcock hat jenes Prinzip auf den Punkt gebracht: »For me, cinema is not a slice of life, but a piece of cake.« Kein Stück Leben, sondern ein Stück Kuchen wird auf die Leinwand geworfen. Einerseits! Denn die englische Wendung, a piece of cake, bezeichnet auch das variablen Gesetzmäßigkeiten folgende Kinderspiel. Nicht das Leben mit all seinen Routinen und langen Weilen ist wahrhaftig darzustellen, sondern das Interessante, das dramaturgisch Gebeugte und Wirkungsvolle daraus oder, wie Hitchcock meint: »Drama is life with the dull bits cut out.« Natürlich ist die Wirklichkeit im Film immer präsent, um dann allerdings als Ausgangsmaterial für allerlei Drehungen und Wendungen genutzt zu werden. Einfühlung und Teilnahme am Film sind einem Publikum ja nur dann möglich, wenn auf der Textebene Erfahrungen angesprochen werden, die dem Zuschauer vertraut sind und also zu einem persönlichen Anliegen werden können. Dann aber sind die langweiligen ›Reste des Alltags‹ (und das ist keine Kleinigkeit) zu entfernen, ist das Material zu dramatisieren, wird ein Stück Kuchen oder ein nicht allzu kompliziertes (Kinder-)Spiel produziert.
Es ist nicht ohne Reiz, beim spielerischen Teil des »Kuchenstücks« zu bleiben und sich einige Erkenntnisse der Spieltheorie ins Gedächtnis zu rufen. Wenn der Mensch nach Friedrich Schiller »nur da ganz Mensch [ist], wo er spielt« und dieser Spieltrieb eben die beiden ständig im Kampf miteinander liegenden Triebe (Stoff und Form bzw. das egoistische Gefühl und die moralische Norm) in gewisser Weise ästhetisch auflöst, dann wird die menschliche Existenz im Spiel sowohl physisch als auch moralisch in Freiheit gesetzt. Ein freier Mensch ist ein Spieler, einer, der sich in der Spielhandlung selbst verliert und zugleich findet, »denn der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist«. Stoff- und Formstreben des Einzelnen kooperieren hier zum Zweck der »lebenden Gestalt«, der »Schönheit« des freien Seins.
Wie hat man sich das vorzustellen? Der Erziehungswissenschaftler Hans Scheuerl benennt einige Momenten des Spielerischen: das von irgendeinem anderen Zweck losgelöste Handeln der Akteure (Freiheit), die offene zeitliche Struktur bei permanenten Wiederholungsabläufen innerhalb der Spielhandlung (InnereUnendlichkeit), das illusionäre Als-ob des Spiels (Scheinhaftigkeit), das dem Spielenden einen Ausbruch aus dem Alltagseinerlei ermöglicht, wobei bestimmte Regeln natürlich notwendig sind (Geschlossenheit), damit die gestaltete Zeit unmittelbar erlebt werden kann (Gegenwärtigkeit). Hinzu kommt noch eine besondere Motivation. Spannungsmomente des Spielens sind nämlich Folgen der offenen Handlungskonstruktion, wodurch eine anregende Kombination aus Ungewissheit und Hoffnung den Spieler erfüllt und an das Spiel bindet (Ambivalenz).
Man hat den Eindruck, der Spieler könnte ein Kinobesucher sein: der Besucher eines Spielfilms. Zu deutlich ist die Korrespondenz der Phänomene, zu naheliegend die Verwandtschaft dieser Scheinwelten. Dabei ist gerade das zuletzt genannte Ambivalenzerlebnis das ›klebrige Kuchenstück‹ oder das Motiv für teilnehmende Spieleraktivität. Der Psychologe Heinz Heckhausen spricht von »Aktivierungszirkeln«, von kleinen Affekterlebnissen, die als Kippschwingungen zwischen Anspannung und Entspannung anregend wirkten, wenn sie »um einen mittleren Spannungsgrad herumpendeln«. Der Spieler suche zielstrebig diese »Anregungskonstellationen« der Erfahrungsunsicherheit auf – Neuigkeit/Wechsel, Überraschung, Verwickeltheit, Ungewissheit/Konflikt –, um das Angenehme der Kombination von Spannungsanstieg und -abfall erleben zu können. Wiederholungshandlungen sind zu erwarten, solange der mittlere Spannungszustand nicht zu heftig über- oder unterschritten wird. Wie immer liegt das Glück in der Mitte. Allerdings ist dieses Aktivieren nicht auf Handlungen in der Realität begrenzt und Heckhausen macht keinen Hehl daraus, wenn er bemerkt, dass »Aktivierungszirkel […] auch für andere zweckfreie Tätigkeiten die Basismotivation dar[stellen]«. Filme sind da durchaus mitgemeint.
Nun ist nicht bekannt, dass Hitchcock ein ausgeprägtes Interesse an der Spieltheorie oder an Spielen in irgendeiner Form hatte. Und doch ist da manches Spiel in Hitchcocks Werk oder vielleicht sogar grundsätzlich viel Hitchcock im Spiel. Soll doch nach seiner Ansicht das Drama nur das Interessante, Abwechslungsreiche, eigentlich die beschriebenen lustvollen Anreger im Film präsentieren. Ein Kuchenstück halt, das nun Biss für Biss Freude beim genießenden Zuschauer freisetzt. Schon mit dem ersten Happen der Hitchcock-Torte ist dieser dem scheinhaften und geschlossenen Treiben der Filmwelt verfallen, identifiziert er sich, nimmt gegenwärtig am ambivalenten Tun der Figuren teil und wünscht sich, wenn das Filmspiel ihn ganz freisetzt (oder ausfüllt), auch die Aufhebung oder Ausdehnung der Zeit. In diesem Sinne wird eine gesetzte Inszenierung zum eigenen Spielzeug, ein flaches Projektionsgebilde zur erlebnisreichen (Quasi-)Realität und können die vorgegebenen Spielregeln angenommen werden, weil die im Film platzierten Anregungen dem Zuschauerwunsch nach innerer Aktivierung Genüge tun. Natürlich innere Aktivierung, denn eine tatsächliche Teilnahme ist ja nicht möglich. Dennoch vergisst der Zuschauer in Momenten der Hingabe den weichen Kinosessel sowie manche Verhaltensregel und ist ganz Mensch im Schiller’schen Sinn: immer ein wenig der Welt enthoben.
Hitchcock erzählte Truffaut einmal merklich befriedigt, wie Joseph Cottens Frau bei der Premiere von REAR WINDOW in jenem Moment, als Grace Kelly in der Wohnung des Mörders von diesem entdeckt zu werden droht, ihren nebenan sitzenden Mann anschrie: »Nun tu doch was! Nun tu doch was!« Mrs. Cotten war, wie man so sagt, im Spiel gefangen und offenbarte sich als tief involvierte Mitspielerin. Sie hatte vom Kuchenstück genascht, und der verzehrte Anregungsthrill überstieg ein wenig ihr Realitätsbewusstsein. Wie dem auch sei. Wir sollten davon ausgehen, dass Joseph Cotten seiner Frau eine Stütze sein konnte. Was aber tat Hitchcock bei all den Entrückten rings um ihn her? Der lehnte sich wohl zufrieden zurück und sinnierte: That’s what we do to human beings!
Ist es denn nicht denkbar, dass Hitchcock ein wenig Rache nahm an all den anderen, den Schönen, Zufriedenen, Gefängnisfreien? Schließlich musste schon der kleine Alfred im Nachhinein seinen Zellenbesuch als gruselige Unwirklichkeit und böses Spiel einsehen, im unerhörten Moment selbst aber war er gefangen und ohnmächtig. Könnte man dies nicht vermitteln, als Erfahrung weitergeben, indem man über die Kunst Menschen dazu manipuliert, Unsicherheit in sicherer Umgebung zu empfinden? Zugegeben: Hitchcocks bittersüße Rache zur Offenbarung der eigenen Macht ist Spekulation. Allerdings keine wirklich fahrlässige. Denn auffällig oft nannte er sich »Svengali« (jener genialische Hypnotiseur aus George du Mauriers Roman Trilby) und fühlte sich wohl dabei. Auch ist eine seiner Lieblingsideen in diesem Zusammenhang entlarvend. Gegenüber dem Drehbuchautor Ernest Lehman erwähnte er einmal die Vorstellung, dass man im Kino der Zukunft gar keinen Film mehr vorführen müsse, sondern über ein ausgeklügeltes technisches System die Emotionen der Menschen direkt durch eine Orgel beeinflussen könne. Eine Taste ergebe dann viele »Aahs« im Publikum, eine andere manches »Ooh«, eine dritte möglicherweise ein »Nun tu doch was!«.
Mrs. Cottens Reaktion muss ihm gut gefallen haben, denn ganz offensichtlich durchlebte und äußerte sie die Pein des kleinen Alfred. Sie kann deshalb als Modell für jeden Zuschauer eines Hitchcockfilms stehen, auch wenn die meisten ihrer Nachfolger nicht verbal um Hilfe bitten. Man könnte doch – da Hitchcock die Massen immer wieder einlud in seine Zelle und diese zugleich zu ihrer eigenen machte – davon ausgehen, dass hier einer seine Lebenswunde therapiert, indem er sie den anderen symbolisch schlägt?
Aber genug davon. Fest steht, dass der Mensch sich nur im Spiel frei und unverstellt verhält. Ein erlebnisreiches Spiel muss es dann auch im Kino sein, wenn man den ganzen Menschen erreichen will. So ist die Mischung aus Freiheit und Geschlossenheit, Unendlichkeit und Gegenwärtigkeit, Scheinhaftigkeit und aktivierender Ambivalenz die Grundbedingung für die Teilnahmebereitschaft des Zuschauers am Als-ob-Entwurf der Leinwandwelt. Mit diesem freiwilligen Interesse an inwendiger Aktivierung kann dann die Manipulation der Gefühle starten und also Svengali sein Werk beginnen.
Antriebsmotor Angstlust
Blicken wir aber zunächst auf das Gefühl selbst, das es auf vielen Wegen anzusprechen gilt: den Thrill. Was ist das Geheimnis?
Freude an der Gefahr könnte man sagen. Einen Thrill zu erleben ist eine zwiespältige Angelegenheit. Einerseits gilt es, eine ganz reale Furcht auszuhalten, und andererseits macht dieses Spaß, wird der Grusel spätestens nach seiner Auflösung als angenehme Bewährungsprobe empfunden. Das ist freilich kein reines Phänomen der vermittelnden Kunst. Auch so manche Alltagssituation trägt durchaus Thrillmomente in sich und zieht wie ein klebriges ›Stück Kuchen‹ den Menschen (manche mehr, andere weniger) an sich heran.
Der Psychologe Michael Balint wies schon 1959 auf das besondere Alltagsphänomen des Nervenkitzels (Thrill) hin, das angstlüstern aufgesucht werde und durchaus Wirkung erziele. Einen magischen Raum solcher Erfahrungen entdeckte er im Jahrmarkt, Rummel oder Volksfest. Allerhand Unerhörtes werde dort geboten: scharfe und süße Nahrungsmittel, Glücksspiele, aggressive Schieß- und Wurfwettbewerbe, schwindel- und furchterregender Fahrspaß und dergleichen mehr. Der Besucher betritt eine Gegenwelt der Effekte und amüsiert sich am Unerlaubten, Entgrenzenden, auch Ungesunden. Es ist wohl der Schritt aus der alltäglichen Routine, der hier Entlastungsmöglichkeiten für »gestaute Gefühlsregungen und Triebwünsche« zur Verfügung stellt. Man wird wieder Kind, darf (muss!) es auch sein und kann jenen Rückschritt eine gewisse Zeit ohne Würdeverlust genießen.
Was aber ist nun der Kick, das Besondere des Erlebnisses? Mit Balint gesprochen »die objektive äußere Gefahr, welche Furcht auslöst, das freiwillige und absichtliche Sich-ihr-Aussetzen und die zuversichtliche Hoffnung, dass alles schließlich doch gut enden wird.« Angst haben macht unter diesen Prämissen also Spaß. Und nicht nur auf dem Jahrmarkt. Auch (Kinder-)Spiele, der Sexualkontakt mit einem neuen Partner und ›Risikosportarten‹ lassen sich bei zuversichtlicher Bewährungshoffnung und Freiwilligkeit als Thrillmomente des Lebens bezeichnen.
Zweierlei kommt hier zusammen: die Hitchcock-Zelle als Angstraum und die hoffnungsfroh erwartete Freisetzung des Eingeschlossenen. Anders als der kleine Alfred weiß der eingesperrte Thrill-Aspirant nämlich um den Spielcharakter, das zeitlich Begrenzte der Inhaftierung und kann sich zuversichtlich dem Zellenabenteuer aussetzen. Trotzdem ist der Angstraum da und mit ihm das mulmige Gefühl, ob man das wohl ohne Ausfälle – man denke an Mrs. Cotten – durchstehen kann. So wird jener Thrill zum Wesenskern für Hitchcocks Form der Unterhaltung: kleine Gefängnisschocks, die dem nach Entgrenzung lechzenden Publikum zur lüsternen Aufnahme angeboten werden. Ein ›Leinwand-Jahrmarkt‹ entsteht. Ein quasi-erotisches Spiel um Furcht und Spaß, ängstliche Teilnahme und humorvolle Distanzierung im Angesicht von gerahmten Aggressionsentladungen, Schwindelerlebnissen und Zuständen von Orientierungsverlust. Der Rahmen des Handlungsfelds ist dem Zuschauer dabei durchaus bewusst, die abgehobene Spielfläche mit eigenen Regeln und zeitlich begrenzter Wirksamkeit ist präsent und natürlich kennt man die Folgen. Denn am Ende wartet – und darum geht es schließlich – die Auszeichnung mit einem Hauptgewinn der Tombola.
Zweifellos sind die Gegensätze das Interessante an jenen ›Fieberkurven‹. Ohne ein klein wenig Furcht kann es kein lustvolles Erlebnis eigener Stärke geben und ohne das Erfahren einer Spannungsauflösung wird die Angst möglicherweise zur unerquicklichen Panik. Zwiespältige Gefühle bringen den Kick. Erst die Sicherheit der garantierten Befreiung macht aus der Gefängniszelle einen Bewährungsraum der besonderen Art. Somit ist jene Mischung aus (latenter) Ungewissheit und (guter) Hoffnung das anziehende Bindeglied oder der Klebstoff für den Thrill-Suchenden auf Zeit.
Unterwegs mit Ödipus, Adam und Damokles
Solcher Klebstoff wird am deutlichsten in einer Erzählform ausgegossen, die Hitchcock selbst den Meistertitel und seinen Filmen einen Beinamen einbrachte. Der »Master of Suspense« produzierte »Suspense-Thriller«, die als Subgattung des Thriller-Genres (nicht nur) nach Überzeugung von Charles Derry immer »Films in the shadow of Alfred Hitchcock« sind und bleiben werden. Auch hier (analog zum Thrill) ist es sinnvoll, das englische Wort beizubehalten, denn die direkte Übersetzung ist keinesfalls aussagekräftig. Spannung bedeutet letztlich alles und nichts. Jeder Film, jede Form der Kunstausübung will in irgendeiner Weise spannend sein, den Betrachtenden zur Auseinandersetzung verführen und einen ›bleibenden Eindruck‹ hinterlassen. Spannung entsteht ja immer dann im Wahrnehmenden, wenn Informationen fehlen, ihm also die vollständige Kontrolle über das Dargebotene erschwert und seine Neugierde angeregt wird. Solcher Kontrollverlust verunsichert den Betrachter und bindet ihn zugleich an den Text; das Fehlende will gefunden sein, die Informationslücke geschlossen und die Sicherheit (wieder) erworben werden. Suspense dagegen, so wie er filmisch durch Hitchcock kultiviert wurde, geht einige Schritte weiter und orientiert sich eigentlich an den grundlegenden Gesetzen antiker Poetik. Hitchcock griff auf den ›Urthriller‹ schlechthin zurück: die griechische Tragödie.
Diese klassischen Texte legen bereits vieles vor, was dem modernen Thrillergenre sein Gepräge verleiht: die Welt als permanent bedrohlicher Unheilsort, die Identifikationsfigur darin als Schicksalsträger oder Spielball der (göttlichen) Intrige, schließlich das am Helden vollzogene ambivalente Fallprinzip des unschuldig schuldigen Akteurs (tragische Schuld) als Publikumsofferte zur Teilnahme (Jammer, Schauder) und lustvoll-befreienden inneren Reinigung (Katharsis). Nun sind bei Hitchcock keine Götter mehr für die Misere verantwortlich. Das Schicksal ist rein irdisch und also vom Menschen gemacht. Auch sind die Akteure des 20. Jahrhunderts nicht verantwortungsbewusste Helden, sondern fehlbare Spielernaturen, die am Marionettenseil des Zufalls zappeln und mit absurder Folgerichtigkeit Befreiungsaktionen unternehmen. Zudem hat der Brite seinen Shakespeare gelesen und unterhöhlt so eine allzu ernste (tragisch reine) Handlungsentwicklung durch kleine komödiantische Brechungen, die als Entlastungsangebote das Publikum kurzzeitig von der Handlung distanzieren. Ansonsten aber ist da viel Griechentragödie im Hitchcock-Thriller und wird gerade im besonderen Honigsaum der Suspensesituation ein Kommunikationszwiespalt aufgegriffen, der schon den klassischen Texten besondere Wirkung verlieh: die tragische oder dramatische Ironie.
Wenn in Sophokles’ Oidipus Tyrannos der Chor in Richtung der Hauptfigur feststellt: »Entdeckt hat gegen deinen Willen dich die alles sehende Zeit« (V. 1213), dann ist es beinahe, als werde das Bedingungsfeld eines Hitchcock-Zuschauers erläutert. Suspensesituationen sind nämlich streng organisierte Zeitphänomene. Alle Handlung darin steuert auf einen fixierten Endpunkt zu, und dieser bietet stets Zweierlei an: Erwünschtes und Nicht-Erwünschtes, Erhofftes und Befürchtetes, Gelingen und Katastrophe. Das Suspense-Finale kann also gegen den Willen des Zuschauers produziert werden und ist, so oder so, eine Entlarvung, auch Aufklärung des begehrenden Betrachters.
Aber der Reihe nach und zurück zu Sophokles und der dramatischen Ironie. Das Faszinierende am König Ödipus ist ja, dass das Publikum von Anfang an weiß, wohin das Geschehen führt, und sich dennoch nicht langweilt. Vertraut mit dem Mythos um den Vatermörder und Mutterbeischläfer ist der Zuschauer der Hauptfigur um Längen voraus und leidet dennoch mit ihr. Man ist gleichermaßen erschüttert wie angetan von Ödipus’ Wahrheitssuche, seinem wackeren Vordringen in die Fesseln der eigenen (unschuldigen) Schuld und gruselt sich womöglich wohlig, wenn der Held nach errungener Erkenntnis die Unfähigkeit zu sehen durch Selbstblendung sühnt. Vielleicht auch deshalb, weil diese Verstümmelung als taugliches Bild für die Wirkungsweise der Tragödie bezeichnet werden kann. Wenn nämlich der Betrachter weiß, wohin das Ganze führt, wenn er quasi sieht, in welche Richtung sich das Schicksal des Helden wenden wird, ist er besonders involviert und vom aufrechten Gang des Königs sowohl beeindruckt wie auch schockiert. Iokaste, Ödipus’ Mutterfrau, die nicht weniger verstrickt ist, meint ja, jegliche Verantwortung und prüfende Rückschau verweigernd: »In den Tag hineinzuleben, ist das Beste« (V. 979), und kann mit dieser laschen Einstellung kaum Teilnahme des Zuschauers erringen. Ödipus dagegen stellt sich seiner Verantwortung, springt aktiv und bockig dem abzusehenden Super-GAU entgegen, was den Betrachter durchaus sehend blind werden lässt.
Tragische oder dramatische Ironie benötigt also einen doppelten Wahrnehmungsakt: ein allwissendes Vorwegnehmen bei zugleich unwissendem Einfühlen. Gebrochen ist die Informationsebene – die Identifikation des Zuschauers mit dem unwissenden Helden konterkariert sein Mehrwissen über die Handlungsfortführung, so dass ein ironisches Spiel der Angebote entsteht. Nah dran und doch weit entfernt ist hier aber kein Gelächter vom Teilnehmenden zu erwarten, sondern im Zuge der tragischen Figurenverstrickung ein Mitleiden oder, nach Aristoteles, ein Jammern und Schaudern ob der ungünstigen Gesamtsituation. Wenn sich schließlich – wie längst bekannt – das Geschehen wendet, bleibt ein betroffenes, in Furcht und Mitleid, Schweiß und Tränen gebadetes, aber auch kathartisch befreites Publikum zurück, das sich in diesem Zwiespalt gut aufgehoben fühlt. Die Beziehung zur Hitchcock-Zelle ist offenkundig: der garantierte Weg in die Freiheit nach kleineren, wohldosierten Angstgefühlen und Orientierungsneurosen. Es ist die dramatische Ironie, die den Hitchcock’schen Suspense ganz besonders nachhaltig prägt.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: In FOREIGN CORRESPONDENTsoll der US-amerikanische Auslandskorrespondent Johnny Jones, da er einer europäischen Spionageorganisation im Weg steht, getötet werden. Jones ist der Held des Films und somit die Identifikationsfigur des Zuschauers. Allerdings ab diesem Zeitpunkt erstmal nicht mehr, denn mit dem Auftreten des Killers, namens Rowley, wechselt die Perspektive, und es entsteht eine neue Einfühlungsoption für das Publikum: in die Figur des gedungenen Täters. Dass solches insbesondere bei einem Film aus dem Jahr 1940 eine Zumutung für das Publikum ist, sei grundsätzlich festgestellt und vorerst nicht weiter verfolgt. Warum und wie der doch eigentlich anrüchige Suspense hier funktioniert, ist aber recht interessant und im Hinblick auf die Wirkung dramatischer Ironie im Thriller aufschlussreich.





























