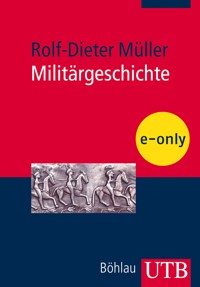14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
»Lebensraum im Osten« – das war das eher phantomhafte Kriegsziel Hitlers, bereits 1925 in seinem Buch ›Mein Kampf‹ entworfen. Der Wahn vom Ostimperium war aber bereits im Kaiserreich entstanden und erfaßte im »Dritten Reich« schließlich große Teile der deutschen Führungseliten. Auch in der Bevölkerung fanden solche Ideen Widerhall. Rund 10 Millionen Deutsche kämpften zwischen 1941 und 1944 in den Weiten Rußlands einen Kampf zur Versklavung und Vernichtung der östlichen Nachbarvölker, angespornt durch die Aussicht, in den künftigen Ostkolonien eine neue Existenz zu finden. Das Buch analysiert und dokumentiert die deutschen Planungen und Maßnahmen zur Ostsiedlung, die Initiativen von Professoren, Ministerien und Wirtschaftsverbänden, den hemmungslosen Drang der Generale nach Rittergütern im Osten. Himmlers SS brauchte sich mit ihrem »Generalplan Ost« nur an die Spitze dieser Bewegung zu setzen. Konkurrierende Entwürfe und Interessenkonflikte werfen ein bezeichnendes Licht auf Struktur und Machtverteilung im NS-Staat. Es wird deutlich, daß es sich dabei nicht um »Sandkastenspiele« für den Endsieg handelte, sondern um den eigentlichen Motor von Massenmord und Vernichtung, die mehr als 30 Millionen Menschen in Polen und in der UdSSR das Leben kosteten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Ähnliche
Rolf-Dieter Müller
Hitlers Ostkrieg und die deutsche Siedlungspolitik
Die Zusammenarbeit von Wehrmacht, Wirtschaft und SS
FISCHER Digital
Inhalt
Vorwort
Bei den raschen revolutionären Veränderungen in Mittel-Osteuropa in unseren Tagen ist es immer wieder zu Irritationen durch den Eindruck gekommen, daß die Frage der deutschen Ostgrenze »offen« sei. Kein anderes Problem im Verhältnis der Deutschen zu ihren Nachbarn hat in dem ausgehenden 20. Jahrhundert derartiges Unheil angerichtet. Vor 50 Jahren nahm der Zweite Weltkrieg seinen Ausgang an der deutschen Ostgrenze. Dort im Osten fanden die blutigsten Schlachten statt. Millionen von Menschen wurden Opfer des rassenideologischen Vernichtungskrieges, den die deutsche Wehrmacht gegen Polen, Juden, Russen, Ukrainer und andere slawische Völker führte, um Hitlers Wahn vom »Lebensraum im Osten« zu erfüllen. Dieser Krieg brandete schließlich zurück. Nun wurden Millionen Deutsche aus ihrer angestammten Heimat im Osten vertrieben, das Bismarck-Reich zerschlagen und die deutsche Ostgrenze weit nach Westen verschoben. 45 Jahre brauchte es, bis ein neues Deutschland seine Ostgrenze vorbehaltlos anerkannte.
Die besorgte Frage unserer Nachbarn nach der Verläßlichkeit dieser Anerkennung wird nur vor dem Hintergrund dieser leidvollen historischen Erfahrung verständlich. Es ist eine lange Erfahrung mit dem deutschen »Drang nach Osten«, die über den Zweiten Weltkrieg hinaus weit in die Vergangenheit zurückreicht.[1][1] In der gemeinsamen Geschichte gab es wohl auch Phasen friedlicher Durchdringungen, des kulturellen und wirtschaftlichen Austausches, der freundschaftlichen Begegnung. Aber eben nicht selten auch traten die Deutschen als Eroberer und Kolonisatoren auf. Hitlers Wahnvorstellungen eines neuen »Germanenzuges« nach Osten bildeten nur den völkermordenden Höhepunkt dieser verhängnisvollen Traditionslinie deutscher Geschichte.
Programm und Wirklichkeit nationalsozialistischer Ostpolitik gehören daher zu den wichtigsten Themen der Zeitgeschichtsforschung sowie der historisch-politischen Bildungsarbeit. Das Geschichtsbild wird weithin geprägt von der Rolle des Diktators und seiner schwarzen Schergen. Terror und Vernichtung, Zwangsarbeit, Vertreibung und massenhafte Umsiedlungen in den eroberten polnischen und sowjetischen Gebieten, darüber ist relativ wenig geschrieben und diskutiert worden. Lange nachwirkende ideologische Frontstellungen haben mit dazu beigetragen, daß Zielsetzung und Praxis der NS-Herrschaft in Osteuropa auch von der Forschung vernachlässigt worden sind.
Reicht es aus, Hitlers programmatische Schrift »Mein Kampf« zu analysieren, um etwas über die Absichten der Nationalsozialisten gegenüber den osteuropäischen Nachbarvölkern zu erfahren? Wie war es mit der Zustimmung und Mitwirkung der alten Führungseliten, die bereits im Ersten Weltkrieg den Griff nach dem Ostimperium gewagt hatten und 1941 darum erneut zu kämpfen entschlossen waren?
Daß die Wehrmacht als mächtigster Pfeiler des deutschen Nationalstaates Bismarckscher Prägung nicht abseits stand, sondern tief in die verbrecherische Kriegspolitik verstrickt war, diese Einsicht hat sich gegen vielfältige Widerstände und Legenden erst allmählich durchgesetzt.[2] Weniger bekannt ist die Tatsache, daß Millionen deutscher Soldaten nicht nur zur Erfüllung militärischer Aufgaben im Osten eingesetzt waren, sondern mit der Aussicht in den Eroberungskrieg geschickt wurden, als Siedler und »Wehrbauern« die künftige Herrenschicht der Ostkolonien zu bilden.
Auch über die Rolle der deutschen Wirtschaft, der Unternehmer, Konzerne und Verbände bei der Formulierung und Durchsetzung deutscher Kriegsziele im Osten ist nur wenig zu erfahren. Waren sie die eigentlichen Drahtzieher und Nutznießer, wie es in der kommunistischen Geschichtsschreibung hieß, oder nur mißbrauchte Experten, die für den Diktator die »Ausschlachtung« der besetzten Gebiete organisieren mußten?[3]
Daß Himmlers SS die eigentliche »Schmutzarbeit« im Osten betrieb und die Ziele des »Führers« hemmungslos in die Tat umzusetzen versuchte, ist dagegen weitverbreitete Einsicht. Himmlers »Generalplan Ost« gilt als eines der wichtigsten Schlüsseldokumente der Zeitgeschichte.[4] Er kennzeichnet die extremste Form der NS-Kriegszielpolitik, Utopie einer rassischen »Neuordnung« Europas, zugleich Handlungsanleitung für die Vernichtungs- und Siedlungspolitik während des Zweiten Weltkrieges. Der Holocaust an den Juden, der Massenmord an sowjetischen Kriegsgefangenen, die Euthanasie, die verbrecherische Besatzungspolitik in Polen und Rußland, alles Elemente und Konsequenzen des »Generalplans Ost«.[5]
Aber es war ein geheimer Planungsentwurf, von Himmler immer wieder revidiert und erweitert, keineswegs verbindlich für die anderen Institutionen im Dritten Reich, letztlich nur die makabre Nutzen-Kosten-Analyse entfesselter Planungsbürokraten[6], gleichwohl aber mehr als einer der zahlreichen Schubladenpläne für den Endsieg, Anstoß nämlich für die größte Völkerwanderung der Geschichte, 1939 in Polen begonnen und keineswegs auf Ost-Mitteleuropa beschränkt.[7] Der »Generalplan Ost« ist daher zu Recht Synonym für die NS-Kriegsziele im Osten geworden, obwohl darüber wenig bekannt ist und geforscht wurde.[8]
Das gilt noch mehr für die konkurrierenden Entwürfe und Beiträge von Wehrmacht, Wirtschaft und Ministerialbürokratie. Die Analyse der Siedlungsideen und Aktivitäten dieser traditionellen Führungsgruppen rückt die SS mit ihrem »Generalplan Ost« in ein anderes Licht, entdämonisiert den »Schwarzen Orden« und seinen erhobenen Anspruch auf den Osten.
Betrachtet man die Siedlungspolitik einmal nicht aus dem Blickwinkel der SS, sondern als einen dynamischen Prozeß, dann wird zweierlei deutlich: Einerseits war das Ringen um Pläne und Richtlinien für die Ostsiedlung ein wichtiges Vehikel für Himmler, um seinen Machtanspruch zu erweitern, und andererseits wird erkennbar, daß es hier über Meinungsverschiedenheiten und Kompetenzstreitigkeiten hinweg auch Gemeinsamkeiten gab.[9] Dem Traum vom Rittergut im Osten jagten manche Generale noch nach dem Menetekel von Stalingrad nach. Mit einem Geheimbefehl mußte Hitler diesen Drang förmlich bremsen. Dieser Befehl wirft – wie auch andere bislang meist unbekannte Dokumente, die im Anhang veröffentlicht sind – ein bezeichnendes Licht auf ein Kapitel der Geschichte des »Dritten Reiches«, das erst heute, nach mehr als vier Jahrzehnten, abgeschlossen wird.
Mein Dank gilt den Mitarbeitern des Bundesarchivs Koblenz, des Militärarchivs Freiburg, des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, des Staatsarchivs Nürnberg und dem Document Center Berlin, besonders aber für ihre Hinweise und Anregungen Dr. Norbert Frei und Dr. Hans Woller vom Institut für Zeitgeschichte München sowie Dr. Wolfgang Michalka vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
Freiburg
Rolf-Dieter Müller
»Der Russe muß sterben damit wir leben. Die stramme 6. Kompanie«
I. Die Wehrmacht: Mit Schwert und Pflug nach Osten
1. Der »Ostwall« in Polen – Befestigungslinie oder Siedlungsgebiet?
Die Ansiedlung von Soldaten und Bauern zum Schutz der Ostgrenze und zur Herrschaftssicherung in den annektierten polnischen Gebieten läßt sich bis in die friderizianische Zeit zurückverfolgen. Es waren damals vor allem Veteranen, die mit Landgeschenken versorgt wurden. Auch im wilhelminischen Deutschland, wo dieser Umgang mit der Ostgrenze und den östlichen Nachbarn bereits starke nationalistische, ja sogar rassistische Züge trug, blieb eine solche Verbindung von Schwert und Pflug zahlenmäßig von begrenzter Bedeutung.
Im Ersten Weltkrieg verstärkte sich dann das »Nebeneinander von militärstrategischem und siedlungspolitischem Denken«[10], wurden weitreichende Pläne für die Machterweiterung des Reiches nach Osten und die Kolonisierung angrenzender Gebiete diskutiert. Noch im Angesicht der Niederlage wurden 1919 Freikorpstruppen für das Baltikum gegen großzügige Landversprechungen angeworben. Viele von diesen Soldaten dienten zwanzig Jahre später in Hitlers Wehrmacht, vor allem in den rückwärtigen Einheiten und Ortskommandanturen im Osten.
In der Weimarer Republik war an die Fortsetzung einer offensiven Siedlungspolitik vorerst nicht mehr zu denken. Statt dessen trat eine andere Variante stärker in den Vordergrund: die Sicherung der östlichen Reichsgrenze durch eine gezielte Volkstumsarbeit, d.h. die Aufsiedlung und »Eindeutschung« der Grenzgebiete zur Abwehr polnischer Gebietsansprüche und zum Schutz vor polnischer »Unterwanderung«. Militärischer Grenzschutz und Siedlungsförderung bildeten auf diese Weise erneut eine Einheit.[11]
Dazu gehörten spezielle Militärsiedlungen für Soldaten, die nach Ablauf ihrer Dienstzeit eine Siedlerstelle in Ostdeutschland übernehmen wollten. Auf einen Heereslehrgut wurden sie mit der Landwirtschaft vertraut gemacht. Selbst ihre Frauen und Bräute mußten sich auf ihre »Tauglichkeit« überprüfen lassen. Die Militärsiedler wurden auch nach ihrer Entlassung von den Fürsorgestellen des Heeres betreut und beraten. Genaue Zahlen lassen sich nicht mehr ermitteln. Die Gesamtzahl der jährlichen Neusiedlungen betrug, einschließlich der Militärsiedler, vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten knapp 9000 (1931). Davon wurden 76 Prozent östlich der Elbe angesiedelt.[12]
Der bevölkerungspolitische Effekt blieb angesichts dieser geringen Zahlen minimal. Die ökonomische Misere in der ostdeutschen Landwirtschaft und der dadurch bedingte Geburtenrückgang trugen zum Leidwesen der Militärs noch zu diesem Ergebnis bei. Eine Intensivierung dieser Siedlungstätigkeit wurde deshalb nach 1933 von der Wehrmacht unterstützt, auch in ihrer stärkeren Ideologisierung. Die »Blut-und-Boden«-Parolen der Nationalsozialisten wurden von den Militärs durchaus verstanden, klagten sie doch seit fast einem Jahrhundert über die negativen Folgen der Industrialisierung für Geburtenziffern und Gesundheitszustand der Rekruten. In einer Schrift der Militärärztlichen Akademie hieß es deshalb 1937:
»Das Dritte Reich hat begonnen, aus den Lehren der Geschichte die Folgerungen zu ziehen. Wehrkraft und Siedlung sind nicht voneinander zu trennen. Eines bedingt das andere. Durch Urbarmachen und Bereitstellen allen entbehrlichen deutschen Bodens entstehen überall neue Bauern- und Arbeitersiedlungen, nicht zuletzt auch in den bisher menschenarmen Grenzgebieten des Ostraums. Wenn einmal das gewaltige Siedlungsvorhaben des Führers beendet sein wird, dann hält ein wehrkräftiges, schollengebundenes Siedlergeschlecht von deutschen Arbeitern und Bauern Grenzwacht gegen fremdrassige Unterwanderung.«[13]
Daß dieses Siedlungsvorhaben nicht auf Deutschland in den Grenzen von 1937 beschränkt war, mußte jedem, der die programmatischen Äußerungen der Nationalsozialisten zur Kenntnis nahm, klar sein. Hitler selbst erklärte es der Wehrmachtführung immer wieder. Wie ein roter Faden zog sich durch seine Reden und Ansprachen die Forderung nach »Lebensraum im Osten«. Das angebliche »Volk ohne Raum« sollte zu einem neuen »Germanenzug« nach Osten aufbrechen, zur gewaltsamen Landnahme, zur »Germanisierung« und Besiedlung Osteuropas. »Wenn wir aber von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Rußland und die ihm untertanen Randstaaten denken«, so Hitlers vielzitierte Maxime in seiner millionenfach verbreiteten Schrift »Mein Kampf«.[14]
Im Unterschied zu früheren Siedlungsvorstellungen dachte Hitler jedoch nicht an eine Art von Kulturmission, an ein friedliches Nebeneinander deutscher Siedler mit der slawischen Bevölkerung. Sein rassenideologisches Konzept lief auf die Versklavung bzw. Vernichtung der osteuropäischen Nachbarvölker hinaus. Mit dieser Zielsetzung betrieb er, unterstützt von den nationalkonservativen Führungseliten, Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. Die Okkupation der Tschechoslowakei bildete 1938/39 den Auftakt, doch mit der sofort aufgenommenen Siedlungspolitik unter der Ägide der landwirtschaftlichen Behörden und der SS war die Wehrmacht nicht unmittelbar verbunden[15] – anders im September 1939 in Polen. Hier übernahm das Militär zunächst die Besatzungsgewalt und wurde sofort mit den Folgen des nationalsozialistischen Siedlungsdrangs konfrontiert.[16]
Nach dem Abschluß der Kampfhandlungen in Polen hatte Hitler dem Reichsführer SS den Auftrag erteilt, die Umsiedlung der Volksdeutschen aus dem Baltikum sowie aus Ostpolen zu organisieren und ihre Ansiedlung in den annektierten polnischen Westgebieten durchzuführen.[17] Daraus entwickelte sich rasch eine heftige Kontroverse mit örtlichen Wehrmachtstellen, die bereits gegen die Übergriffe der SS während des Polen-Feldzuges protestiert hatten. Durch die wilde und planlose Vertreibung der polnischen Bevölkerung aus den Ansiedlungsgebieten ins sogenannte Generalgouvernement sah der Oberbefehlshaber Ost die militärischen Interessen erheblich verletzt. Dieser Konflikt wurde einer der Treibsätze für die tiefgreifende Vertrauenskrise, die das Verhältnis zwischen Hitler und Teilen der Wehrmachtführung im Winter 1939/40 bestimmte.[18]
Oppositionelle Regungen griffen vom Osten auch auf den Westen über, seitdem Hitler die Vorbereitung des Angriffs auf Frankreich befohlen hatte, den einige Heerführer in seinen Erfolgsaussichten skeptisch beurteilten. Die Verbindung beider Bereiche lag darin, daß Hitler zur Verstärkung der Westarmee die weitgehende Entblößung der Ostgrenze befahl. Er hielt das für möglich, weil er davon ausging, daß sein Bündnis mit Stalin für »absehbare Zeit« ungefährdet sein würde, eine militärische Bedrohung aus dem Osten also nicht zu erwarten war.[19]
So konnte Hitler auch für eine abrupte Beendigung der Militärverwaltung in Polen und die Einsetzung einer Zivilverwaltung unter Generalgouverneur Hans Frank sorgen.[20] Durch diese Maßnahme wurde der Oberfehlshaber (OB) Ost teilweise entmachtet und seinen wiederholten kritischen Einwänden der Boden entzogen. Beschränkt auf die Aufgabe der militärischen Grenzsicherung und der Ausbildung von Ersatzeinheiten für die Westfront, verfügte der OB Ost allerdings noch über einen erheblichen Einflußspielraum, um dessen extensive Auslegung sich Generaloberst Johannes Blaskowitz bemühte.
Die routinemäßige Anlage neuer Übungsplätze bot einen ersten Ansatzpunkt, um einerseits militärische Autonomiebereiche gegenüber der Zivilverwaltung zu schaffen und andererseits die angelaufenen Umsiedlungsaktionen einzudämmen bzw. zu kanalisieren. Die Heeresführung übernahm zunächst diese Linie.
Hitler sah Polen als deutsches »Aufmarschgebiet für [die] Zukunft« an und billigte daher den Ausbau der militärischen Infrastruktur. Neben dem Ausbau von Straßen und Eisenbahnlinien befahl er die Schaffung von Garnisonen, die wie »Ordensburgen« als Sicherungs- und Machtzentren im polnischen Raum wirken sollten.[21] Mit dem Führerbefehl vom 19. Oktober 1939 erhielt das Heer als Ersatz für die Militärverwaltung eine Reihe von Privilegien, insbesondere das Recht, sogenannte Schutz- und Sicherungsbereiche einzurichten. Der OB Ost beabsichtigte, entlang der Flußlinie Narew-Weichsel-San, die sich als natürliche Verteidigungslinie anbot, einen schmalen Streifen sowie einzelne Brückenköpfe zum Sicherungsbereich zu erklären.[22]
Der künftige Generalgouverneur Frank schien zu ahnen, daß die Wehrmacht dabei war, sich einen exterritorialen Streifen quer durch sein »Königreich« zu schaffen, und forderte eine möglichst rasche Offenlegung der Wehrmachtplanungen.[23] Schließlich schaltete sich Anfang November 1939 auch das Oberkommando der Wehrmacht (OKW), Hitlers eigentliches militärisches Büro, ein und forderte die Wehrmachtteile auf, ihre Vorhaben zu konkretisieren. Das OKW wollte diese Wünsche dann der Planungsstelle des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (RKF) übermitteln, um eine Abstimmung mit den Umsiedlungen zu erreichen.[24] Dahinter stand das Bemühen Keitels, jedem politischen Streit aus dem Wege zu gehen und sich auf die militärischen Interessen zu beschränken. Der Chef des OKW lehnte daher die weitergehendere Kritik des OB Ost an den Umsiedlungen ab.[25] Innerhalb des OKW gab es allerdings auch keine einheitliche Linie, da das Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt, formell nicht nur für die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft, sondern auch für Fragen der Landesplanung zuständig[26], die kritische Position des OB Ost unterstützte, und der Amtschef General Georg Thomas zur militärischen Opposition zählte, die sich bemühte, die Heeresführung in ihrem Konflikt mit Hitler und Himmler zu einem energischen Standpunkt zu veranlassen.
Am 22. November 1939 entschied sich Hitler nach einer Vorlage des Oberkommandos des Heeres für die Errichtung des »Ostwalls«. Da er bekanntlich die deutsch-sowjetische Demarkationslinie nicht als endgültige deutsche Ostgrenze betrachtete, sondern sich nach der militärischen Entscheidung im Westen wieder nach Osten, zur Niederwerfung der UdSSR und der Eroberung von weiterem »Lebensraum im Osten« zuwenden wollte, strebte er keine ständige Befestigung, also eine echte Verteidigungslinie an. Es ging vielmehr um die Errichtung einer Sicherungslinie, hinter der sich im »Spannungsfalle« größere Verbände versammeln konnten. Die von den Wehrmachtteilen geforderten Übungsplätze sollten Teil dieses Aufmarschgebietes und zugleich »Machtzentren« im polnischen Raum sein. In seiner Begründung, der Ostwall solle dem »Schutz des volksdeutschen Raumes nach Osten« dienen, steckte allerdings auch ein Element jener Politik, die Himmler in Polen verfolgte. Keitel forderte daher sowohl die Wehrmachtteile als auch den Reichsführer SS dazu auf, ihre Vorschläge einzureichen.[27]
Himmler war dazu aber noch gar nicht imstande. Während verschiedene SS-Organisationen derzeit noch mit der praktischen Umsiedlungsarbeit aus dem Baltikum beschäftigt waren, lief die Arbeit in der Dienststelle RKF erst in bescheidenen Ansätzen. Längerfristige und großräumige Planungen konnten nicht ohne weiteres erstellt werden. Nach einem ersten »Nahplan« wurden im Dezember 1939 mehr als 160000 polnische Bürger aus den annektierten Gebieten vertrieben, und in einem zweiten Nahplan sollten im Frühjahr 194040000 Einwohner den Baltendeutschen weichen. Insgesamt ging es um knapp 7 Millionen Menschen, die aus den »Eingegliederten Ostgebieten« ins Generalgouvernement, das geplante »Polen-Reservat«, umgesiedelt werden sollten.[28]
Himmler engagierte Professor Konrad Meyer-Hetling, Experte für landwirtschaftliche Soziologie und Siedlungswissenschaft, um eine systematische Planung in Angriff nehmen zu können. Lediglich vom Rassenpolitischen Amt der NSDAP lag bereits ein Siedlungsplan vor, der die landläufigen Siedlungsvorstellungen der Partei zusammenfaßte. Kernpunkt war die Forderung nach Schaffung eines Wehrbauerngebiets, die Aufsiedlung eines 200 km breiten Streifens diesseits der neuen Reichsgrenze.[29]
Aus dem militärischen Blickwinkel war ein solches Vorhaben uninteressant, ja eher gefährlich, weil die aus den Siedlungsgebieten deportierten Polen in den östlicher gelegenen Sicherungsbereich der Wehrmacht strömten und dort zwangsläufig für Unruhe sorgten. Eigene Vorstellungen zur Lösung des Problems hatte man im Oberkommando des Heeres (OKH) noch nicht entwickelt. Dort wurde in Weiterführung der bisherigen Überlegungen die Einrichtung von drei großen Übungsplätzen als Unterbringungs-, Ausbildungs- und Aufmarschräume gefordert. Vom OKW verlangte man die baldige Bekanntgabe der beabsichtigten Siedlungsräume im Generalgouvernement, um bei der anstehenden Erkundung der Plätze entsprechende Rücksichten nehmen zu können.[30] Als Vermittler zwischen OKH und RKF, wie es auch Hitler in einer erneuten Bestätigung der Heerespläne erwartete[31], trat das OKW aber nicht in Funktion, denn das mit der Federführung beauftragte Wehrwirtschaftsund Rüstungsamt war tief in die sogenannte Munitionskrise verstrickt. Der Streit um die Zielsetzung und Führung der Rüstungswirtschaft belastete das Verhältnis zwischen OKW und OKH und blockierte eine engere Zusammenarbeit der beiden Oberkommandos.[32]
So ergriff das OKH Anfang 1940 die Initiative. Nach ersten Absprachen mit den anderen Wehrmachtteilen lud die zuständige Amtsgruppe für Truppenübungsplätze zu einer Besprechung aller interessierten zivilen und militärischen Dienststellen in Lodsch am 16./17. Januar 1940 ein.[33] Besonders wichtige Adressaten waren die Spitzen der SS und des RKF, von denen eine Offenlegung ihrer Siedlungspläne erwartet werden konnte. Der konkrete Vorschlag des OKH für eine Sicherungszone mit entsprechenden Übungsplätzen fand, obwohl gegenüber der ursprünglichen Planung des OB Ost räumlich erheblich vergrößert, die Zustimmung Hitlers. Er legte aber fest, daß in der Sicherungszone keine Einsiedlung von Volksdeutschen stattfinden sollte.[34] Dennoch nahm man im OKH den Gedanken einer Verbindung von deutscher Siedlung im polnischen Raum und militärischer Infrastruktur-Planung sofort auf.
Den Anstoß dazu gab vielleicht das Zurückweichen Himmlers in der Siedlungspolitik. Den vielfältigen Protesten und Einsprüchen, insbesondere von Göring, Frank und Lammers, entsprechend, war der Reichsführer SS bereit, die Evakuierung der polnischen Bevölkerung aus den annektierten Gebieten mit Rücksicht auf die schwierige Lage des Generalgouvernements zu drosseln.[35] Andererseits interessierte man sich auch in der Wehrmachtführung durchaus für die Siedlungsmöglichkeiten und fand in Hitlers Absicht, den Kriegsteilnehmern künftig den Vorrang bei der Vergabe von Landbesitz und Gewerbebetrieben einzuräumen, einen Hebel, um bei der Ansiedlung mitzuwirken.[36]
Dem hatte Himmler Rechnung tragen müssen, indem er die Anweisung erteilte, keine endgültigen Besitzzuteilungen an die Umsiedler vorzunehmen und mit der zusätzlichen Ansiedlung von Reichsdeutschen erst nach Kriegsende zu beginnen, um die Soldaten nicht zu benachteiligen.[37] Nach Abschluß der laufenden Umsiedlungsaktion würde die SS also ihre Siedlungstätigkeit einstellen müssen, wenn ihr nicht durch die Wehrmacht Soldatensiedler zur Verfügung gestellt wurden. Wollte man im Osten »blühende germanische Provinzen« schaffen[38], dann war der RKF demnach auf die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht angewiesen, mehr noch: Die Wehrmacht hatte eigentlich gute Chancen, die Siedlungspolitik in Polen ganz an sich zu ziehen oder doch zumindest einen dominierenden Einfluß auszuüben.
Offenbar wurde im OKH diese Chance auch erkannt. Dort entwickelte man für die Besprechung in Lodsch einen umfassenden eigenen Siedlungsplan als Alternative zu Himmlers scheinbar planlosen Umsiedlungsaktionen. Als Vertreter des OKH ging Major Hartwieg von der Amtsgruppe Unterkunft und Truppenübungsplätze des Allgemeinen Heeresamtes in Lodsch zielstrebig ans Werk (Dokument 6). Die militärischen Aspekte – die Lage und Ausdehnung der Übungsplätze sowie der Sicherungszone – waren rasch behandelt. Sein eigentliches Anliegen kam in der Zielsetzung zum Ausdruck, »durch schnelle Erschließung des Landes den Ostraum dem deutschen Zentrum näher zu bringen«. Ausgangspunkt seiner überraschenden Ausführungen war die Feststellung, daß bei den Übungsplätzen im Umkreis von 50 km keine Juden und Polen geduldet werden könnten. Der notwendige Arbeiterbedarf sollte durch volksdeutsche Siedler gedeckt werden, schon um der Truppe die Gelegenheit zu geben, »sich zu Hause« zu fühlen. Für diesen Zweck reichten nach seinen Berechnungen die rund 270000 volksdeutschen Umsiedler aus dem Baltikum und Ostpolen nicht aus. Er kalkulierte auch bereits 400000 reichsdeutsche Familien ein, denen in Polen eine bessere landwirtschaftliche Existenzgrundlage geboten werden sollte.
Diese Überlegungen basierten einerseits auf allgemeinen Siedlungsplanungen und -berechnungen, wie sie in den vergangenen Jahren von verschiedenen Stellen diskutiert worden waren, bewegten sich andererseits aber auch auf traditionellen militärstrategischen Bahnen. Aus nationalsozialistischer Sicht wäre daran nichts zu beanstanden. Der OKH-Plan war sogar noch weiter gesteckt und radikaler als die augenblicklichen Pläne der SS. Er lief bereits auf eine Vorverlegung der Siedlungszone ins polnische Kerngebiet hinaus, ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht, während Himmler sich bei der Besiedlung der annektierten Gebiete zumindest in dieser Hinsicht formell korrekt verhielt. Unter Hitlers Vorgabe einer möglichst raschen »Eindeutschung« der Ostgebiete barg der OKH-Plan außerdem ein höheres Risiko, denn er verteilte das begrenzte Siedlungspotential über einen wesentlich größeren Raum.
Ob man nun die »Festigung deutschen Volkstums« in kleinen Schritten oder raumgreifender vollzog, war eine Frage, über die in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder heftig gestritten wurde, und auch die SS fand später im besetzten Rußland Gefallen an der Stützpunkt-Idee. Doch die Durchführung eines solchen militärischen Siedlungsprogramms würde nicht nur die zivile Autonomie des Generalgouvernements in Frage stellen, sondern auch den RKF an die Vorgaben der Wehrmacht binden. Der anwesende Vertreter des RKF, Stabsleiter Dr. Gebert, zeigte sich verblüfft und war nicht imstande, eigene Siedlungsvorstellungen vorzutragen. Er kündigte an, dem Reichsführer SS »die Gesichtspunkte zu einer letzten Stellungnahme und Entscheidung vorzulegen«. Die Aussprache mit den Zivilbehörden brachte weitere Bedenken und Einwände gegen die geplanten Ausbildungszentren hervor, vor allem natürlich von seiten des Generalgouverneurs, dessen Vertreter erhebliche Nachteile befürchtete. Dennoch drang der Beauftragte des OKH auf die Abfassung eines förmlichen Besprechungsergebnisses, das von den Hauptbeteiligten unterzeichnet wurde.
Welche Bedeutung kann dem skizzierten militärischen Siedlungsplan zugemessen werden? Hatte hier womöglich ein einzelner Offizier seine Kompetenzen überschritten? Gegen eine solche Vermutung sprechen die umfangreichen und detaillierten Überlegungen, die der Vertreter des OKH vorgetragen hat, und zwar in Anwesenheit zahlreicher anderer Wehrmachtvertreter und gewichtiger ziviler Stellen.[39] Ein solches Programm ohne Auftrag durch die Heeresführung vorzutragen, wäre eine Eigenmächtigkeit gewesen, die nicht zur Tradition der Stabsarbeit gehörte. Das Protokoll dieser Sitzung wurde außerdem vom OKH allen beteiligten Dienststellen zugesandt, ohne Wideruf der Siedlungsideen.[40] Vor allem aber widerspricht die Reaktion Himmlers einer solchen Deutung. Davon wird noch die Rede sein.
Es kann also von der These ausgegangen werden, daß mit Billigung der Heeresführung Ansätze zu einem eigenen Siedlungsprogramm im OKH entwickelt worden sind. Die Motive dafür lagen aber wohl kaum im eigentlichen militärischen Bereich. Der Vertreter des OB Ost, Oberstleutnant Gerlach, stellte schon in Lodsch klar, daß es nicht um einen »Ostwall« im Sinne einer Befestigungslinie wie im Westen des Reiches ging, sondern um den Ausbau einer Aufmarschzone. Eine militärische Bedrohung durch die UdSSR hielt er ausdrücklich für nicht gegeben, vielmehr sah er die größere Gefahr in der Möglichkeit eines polnischen Aufstandes. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall eines sowjetischen Angriffs sollten die Truppen direkt an der Grenze zur Verteidigung übergehen. Mit den derzeit zehn Landwehrdivisionen hatte der OB Ost in dieser Hinsicht offenbar keine Probleme.
Die Befestigungsarbeiten waren gerade erst in Gang gekommen. Ein Zehntel des geplanten Grenzzaunes von ca. 1000 km Länge war fertiggestellt, die Brückenköpfe der Sicherungslinie waren erkundet, teilweise schon mit Hindernispfählen verstärkt, Bautruppen und Festungspionierstäbe im Anmarsch. Der Stellungsbau beschränkte sich angesichts des strengen Winters auf die Sicherung der Unterkünfte und den Bau feldmäßiger Stellungen.[41] Eine »Gesamtplanung« wollte das OKH aber auf alle Fälle vornehmen, um zu einem späteren Zeitpunkt freiwerdendes Personal und Material einsetzen zu können und »allmählich in den planmäßigen Ausbau einer ständigen Ostbefestigung überzuleiten«.[42]
Das Interesse am Ausbau der Übungsplätze durch eine Zone volksdeutscher Siedlungen hatte also keine aktuelle militärische Bedeutung, sondern resultierte aus einer derzeit noch fiktiven Nachkriegsplanung. Die Motive für den Vorschlag müssen daher wohl eher im politischen Raum gesucht werden. Und hier fällt sofort ins Auge, daß der Konflikt zwischen Heer und SS in diesen Tagen seinem Höhepunkt zustrebte. Die Heeresführung wurde durch Angehörige der Militäropposition zu einem energischen Vorgehen gegen Partei und SS gedrängt.[43] Der Oberbefehlshaber des Heeres, Walther von Brauchitsch, verweigerte sich jedoch diesem Ansinnen und suchte mit allen Mitteln, zu einem Ausgleich mit Himmler zu gelangen. Diejenigen seiner Untergebenen, die ihn allzu hartnäckig zur Tat drängten, ließ v.Brauchitsch kaltstellen, und an das Heer erließ er eine Reihe von Befehlen, die um Verständnis für die Aufgaben der SS warben.[44] Er suchte darüber hinaus auch eine persönliche Aussprache mit Himmler, um die zahlreichen Streitfälle und Klagen zu bereinigen. In diesem Zusammenhang könnte das Siedlungsprojekt des OKH ein Signal an den Reichsführer SS gewesen sein, wieder zu einer gemeinsamen Plattform zurückzufinden.
Wie würde Himmler darauf reagieren? Seine Planungshauptabteilung machte sich nach den Neuigkeiten von Lodsch sofort an die Arbeit, um die eigenen Überlegungen möglichst rasch zu Papier zu bringen. Der Leiter, Prof. Konrad Meyer-Hetling, konnte bereits zwei Wochen nach Lodsch den Vertretern der Raumordnungsbehörden die Hauptlinien seiner Planung erläutern[45], die zwar auch strategisch angelegt war, aber nicht im militärischen Sinne, sondern entsprechend der Volkstumspolitik (Dokument 7).
Festgelegt werden sollte eine »Siedlungszone 1. Ordnung«, ein Grenzwall, nicht so weit nach Osten vorgeschoben, wie der OKH-Plan dies vorsah, sondern entlang der Grenze zum Generalgouvernement, lediglich im Nordabschnitt gleichlaufend mit dem Ostwall der Wehrmacht, ansonsten im Bereich der annektierten polnischen Landkreise. Dazu gehörte auch eine Siedlungsbrücke, eine Ost-West-Achse, die den Grenzwall mit dem Altreich verbinden und so zur Einschließung polnischer Siedlungsreservate dienen sollte, die man später germanisieren wollte.
Die Studie des RKF wurde bereits als »Generalplan« bezeichnet. Es handelt sich also um die Urfassung des Generalplans Ost (GPO) mit einem 5-Jahres-Programm, das nach Kriegsende beginnen sollte. Geplant war, 3,4 Millionen Deutsche anzusiedeln und rd. 4 Millionen Polen aus diesen Gebieten zu vertreiben. Damit verbunden war die Vorstellung einer grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Neuordnung. Die künftige Gesellschaftsordnung basierte auf einer Mischstruktur von deutschen Landarbeitern, bäuerlichen Wirtschaften und Rittergütern – jetzt Wehrbauernhöfe genannt – sowie einer mittelständischen Handwerksund Gewerbestruktur.
Es ist anzunehmen, daß die Planungshauptabteilung diese provisorischen »Planungsgrundlagen für den Aufbau der Ostgebiete«, wie in Lodsch angekündigt, vom Reichsführer SS absegnen ließ, bevor sie Ende Februar 1940 an das OKW weitergeleitet wurden. Bereits für seine Aussprache mit v.Brauchitsch am 2. Februar 1940 zeigte sich Himmler entsprechend präpariert. Das Ostwall-Projekt des OKH kam für ihn daher nicht in Betracht. Weil er aber selbst daran interessiert war, das Verhältnis zum Heer zu verbessern, machte er einen Gegenvorschlag, einen geschickten Schachzug, der auf die Entkoppelung von Siedlungsauftrag und militärischer Aufgabenstellung hinauslief.
Himmlers Idee war es, an der deutsch-sowjetischen Grenze einen Panzergraben als militärisches Bollwerk zu errichten, gebaut durch 2,5 Millionen Juden, deren Umsiedlung bereits in vollem Gang war.[46] Er griff damit einen Plan des Höheren SS- und Polizeiführers in Lublin auf, »durch jüdische Zwangsarbeit einen 40 bis 50 m breiten und 1,50 m unter dem Grundwasser tiefen Graben« anzulegen, 5 km hinter dem Drahtzaun des Zollgrenzschutzes. Das Gebiet zwischen Zaun und Wassergraben sollte unbewohnt bleiben.[47] Hierbei wäre es also um eine polizeitaktische Maßnahme zum Schutz gegen Schmuggler und Agenten gegangen. Der Ausbau zu einem Panzergraben als militärische Befestigungslinie war dagegen eine andere Sache.
Aber für Himmler ging es bei seinem Vorschlag wohl auch gar nicht so sehr um den militärischen Nutzen eines solchen Bauwerks. Die politischen Vorteile waren offenkundig. Eine solche Grenzbefestigung würde die drohenden Kompetenzprobleme im Generalgouvernement, wie sie das OKH-Projekt aufwarf, von vornherein ausschließen. Zum anderen würde sich Himmler die Möglichkeit bieten, für den Abtransport der Juden, die weder der Generalgouverneur noch das OKH in seinem Ostwall aufnehmen wollten, Ziel und Legitimation zu finden. Die Versklavung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung ließe sich hinter militärischen Notwendigkeiten verdecken und machte am Ende auch die Wehrmacht selbst zum Komplizen des Holocaust.
Der Oberbefehlshaber des Heeres ging auf diesen Vorschlag sofort ein und ließ ihn in den nächsten sechs Wochen von den zuständigen Experten einer ernsthaften Prüfung unterziehen.[48] Vom Siedlungsplan des OKH war fortan keine Rede mehr. Das OKW trug dieser neuen Situation Rechnung, als es am 2. März 1940 in einem Schreiben an die in Lodsch beteiligten Stellen über die nunmehr festliegenden »Planungsabsichten der Wehrmacht« informierte und damit die in Lodsch vorgetragenen Absichten des OKH korrigierte.[49] Festgehalten wurde dabei an der Sicherungszone und an den geplanten Ausbildungszentren. Dafür gab es immerhin einen Führerbefehl. Eine Ansiedlung von Volksdeutschen sollte aber – entsprechend den Planungsgrundlagen des RKF – nur im nördlichen, auf Reichsgebiet liegendem Teil stattfinden. Die weitergehenderen OKH-Forderungen von Lodsch wurden ausdrücklich widerrufen. Zusätzliche Juden wollte das OKW aber aus den militärischen Gebieten auf jeden Fall fernhalten. Der drohende Konflikt mit der SS über die unterschiedlichen Siedlungsvorstellungen war damit abgewendet.
Die zumindest partielle Zusammenarbeit bei der Ansiedlung lief sofort an. Himmler erteilte die Anweisung, die Transporte von Volksdeutschen aus Wolhynien und Galizien dorthin zu dirigieren, wo sie als Siedlungsgürtel für die geplanten Übungsplätze von der Wehrmacht gewünscht worden waren. Der Kreis Konin im Warthegau (Übungsplatz des Heereswaffenamtes) erhielt zusätzlich 4000 Familien, der Bezirk Zichenau (Übungsplatz Heer/Lufwaffe) 1000[50]. Auch der schwelende Streit mit Frank hätte beendet werden können, wäre der OB Ost nicht von sich aus aktiv geworden. Er ließ nämlich einerseits nicht nach, gegen die Übergriffe der SS zu protestieren, und andererseits übermittelte er dem Generalgouverneur eine offizielle Erklärung der Schutzbereiche, womit er den Anspruch eines militärischen Primats erneuerte.[51]
Frank eilte nach Berlin. Eine Aussprache mit v.Brauchitsch, Göring und Himmler zerstreute seine Befürchtungen. Entscheidend waren Hitlers Ausführungen auf der geheimen Tagung der Gau- und Reichsleiter der NSDAP am 29. Februar 1940.[52] Der »Führer« demonstrierte Siegesgewißheit und war überzeugt, daß der Sieg im Westen noch im Jahre 1940 errungen werde. Die Notwendigkeit einer militärischen Rückendeckung durch einen Ostwall entfiel damit, zumal Hitler die Ansicht bekundete, »daß die Russen in 100 Jahren nicht angreifen« würden. Ebenso wie sein Außenminister schätzte er die Moskauer Regierung als loyal ein, fügte aber bezeichnenderweise hinzu: »Wenn überhaupt eine Veränderung der Grenze in Frage kommt, dann nur weiter nach Osten. Aber das wäre eine Sache für spätere Zeiten.«
Mit dieser Rückendeckung durch den »Führer« konnte Frank die Auseinandersetzung mit dem OB Ost aufnehmen. Blaskowitz forderte vergeblich den Oberbefehlshaber des Heeres dazu auf, an den Schutzbereichen festzuhalten und an dieser Frage den Bruch mit dem Generalgouverneur herbeizuführen. Ohne den Ostwall-Plan aber gab es keine Möglichkeit, Frank in seine Schranken zu weisen.[53] Von Brauchitsch ging sogar noch weiter: Er drängte Himmler, am 13. März 1940 in Koblenz vor der höheren Generalität über die Aufgaben der SS im Osten zu referieren und auf diese Weise das gegenseitige Verständnis zu vertiefen.[54]
Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Zustimmung des OKH zu Himmlers Panzergraben-Projekt besiegelt, obwohl die Einschätzung des militärischen Werts und des Aufwands nicht einhellig war. Der General der Pioniere beim OB Ost hatte als zuständiger Experte schwerwiegende Bedenken. Das Grenzabschnittskommando Mitte stellte den militärischen Nutzen klar in Abrede und wollte auch keine »Judenkolonnen« eingesetzt wissen. Deren möglicher Einsatz durch die Wehrmacht sei ausgeschlossen, und die »Leitung der Arbeit in die Hände der SS zu legen, verbietet sich aus naheliegenden Bedenken«.[55] Eine solche eindeutige Ablehnung wollte selbst der OB Ost nicht vortragen, weshalb er als Kompromiß den Bau von Hindernissen entlang geeigneter kleinerer Grenzabschnitte anbot, »wobei die Heranziehung von Arbeitskräften (jüdische Zwangsarbeit) im Auge behalten werde«.[56] Die Heeresführung wollte jedoch davon nichts wissen. Ihr war es lieber, wenn sie sich nicht um die Juden kümmern mußte, sollte doch die SS selber eine eigenständige Bauorganisation nach dem Vorbild der »Organisation Todt« schaffen.[57] Blaskowitz resignierte schließlich und schlug sogar vor, gleich den ganzen östlichen Teil des Generalgouvernements der SS zu überlassen. So weit wollte der Generalstabschef des Heeres, der für die Ablösung von Blaskowitz als OB Ost sorgte, allerdings nicht gehen.[58]
Der rasche Sieg im Westen und die sofort anlaufenden Vorbereitungen des OKH, im Osten »Schlagkraft« zu bilden, schufen seit Juni 1940 eine neue Lage.[59] Der Schutz der Ostgrenze des deutschen Machtbereichs sollte nicht mehr defensiv, sondern offensiv ausgerichtet werden. Das bedeutete den Einsatz der Wehrmacht zur Erweiterung des »Lebensraumes im Osten«, die Eroberung neuer strategisch und ökonomisch wertvoller Räume im europäischen Teil der UdSSR. Das Problem eines »Ostwalles« und seiner Stützung durch Militärsiedlungen und Übungsplätze nahm damit völlig neue Dimensionen an.
Am polnischen Ostwall wurde dennoch zunächst weitergebaut. Die SS begann zwar mit dem Bau eines Panzergrabens an der Südostgrenze zwischen Bug und San – entsprechend dem Auftrag des OKH; die Masse der deportierten jüdischen Bevölkerung aber lenkte Himmler nun direkt zur Vernichtung in die Gettos und Lager. Anfang 1941 war der sogenannte Judenwall erst auf einer Länge von 13 km fertig, militärisch wertlos, da nicht besetzt und dilettantisch angelegt[60] – ein sinnloses Opfer, dargebracht, um die anfänglichen Auseinandersetzungen zwischen Heeresführung und SS um die Besatzungspolitik in Polen harmonisch ausklingen zu lassen.
Vorrang hatte jetzt der Ausbau der Infrastruktur für den beginnenden Aufmarsch gegen die Sowjetunion. Daneben wurden rd. 10000 Soldaten und Zivilarbeiter für den Weiterbau der Befestigungsanlagen an der Weichsel-Linie eingesetzt.[61] Dies war nicht nur eine Maßnahme zur Tarnung der deutschen Aggressionsabsichten, sondern auch zur militärischen Absicherung der deutschen Herrschaft in Polen. Die Zusammenarbeit mit der SS bewährte sich, als es im Winter 1940/41 darum ging, im Generalgouvernement die geplanten Truppenübungsplätze von Radom und Dembica als Aufmarschräume einzurichten. Der RKF kümmerte sich um die Deportation der polnischen Bevölkerung. »Eindeutschungsfähige« wurden ausgesiebt und als Arbeitskräfte ins Altreich gebracht.[62]
Die Absicht des RKF freilich, bei dieser Gelegenheit auch gleich als »3. Nahplan« weitere große Evakuierungen in der »Siedlungszone 1. Ordnung«, d.h. im Warthegau, in Danzig-Westpreußen und Oberschlesien, vorzunehmen und die Polen ins Generalgouvernement abzuschieben, schürte alte Interessenkonflikte. Zumindest die militärischen Wirtschaftsbehörden waren besorgt um die Folgen für die Kontinuität der landwirtschaftlichen Produktion und die Ernährungslage im übervölkerten Generalgouvernement.[63] Dort wurde immerhin eine steigende Zahl polnischer Arbeiter von der Wehrmacht in Werkstätten und Betrieben beschäftigt, als Panjewagenfahrer sogar in den Troß des Ostheeres eingegliedert.
Aus diesem Konflikt zwischen Siedlungspolitik und militärischen Wirtschaftsinteressen entstanden auch in den nächsten Kriegsjahren immer wieder Reibungen mit der SS. Der mutige Einsatz einzelner örtlicher Befehlshaber gegen die Deportations- und Vernichtungspolitik der SS konnte aber nur zuweilen bremsend wirken, denn die Wehrmachtführung in Berlin gab keine Unterstützung.[64] Am Prinzip einvernehmlicher Arbeitsteilung, im März 1940 für Polen, im Mai 1941 für Rußland besiegelt, wollte die militärische Führungsspitze unter keinen Umständen rütteln.
2. Der neue »Ostwall« in Rußland
Der Ostwall in Polen geriet aber schon Ende 1941 wieder ins Blickfeld, als mit dem Scheitern des deutschen »Blitzkrieges« vor Moskau und der Gegenoffensive der Roten Armee für einen Augenblick die Gefahr zu drohen schien, daß die Ostfront zusammenbrach. Der geplante neue Ostwall an der Linie Astrachan-Archangelsk war eine Schimäre in den Köpfen militärischer Stäbe und siegestrunkener NS-Führer geblieben. Im Rausch des Vormarsches im Sommer und Herbst 1941 hatte man sich Gedanken darüber gemacht, wie dieser riesige Raum nach dem Erreichen der angestrebten Operationsgrenze durch Stützpunkte, Garnisonen und Übungsplätze beherrscht, gegen den Ural und Sibirien durch eine östliche Militärgrenze zu sichern war. Konkrete Formen hatten solche Überlegungen noch nicht angenommen.
In der Wehrmachtführung stellte man sich eine bewegliche Verteidigung durch Panzerkorps vor, die von Zeit zu Zeit Vernichtungsschläge gegen eine sich möglicherweise wieder bildende feindliche Wehrkraft im Fernen Osten führen sollten.[65] Daß dafür auch längerfristig befestigte Garnisonen und Militärsiedlungen eingerichtet werden mußten, stand außer Frage. Der Ostwall sollte also keine Befestigungslinie im herkömmlichen Sinne sein, sondern – so Hitlers Vorstellung – »aus lebenden Menschen bestehen«.[66] Die Siedlungsfrage würde sich demnach in ferner Zukunft für die Wehrmacht in bislang ungeahnten Dimensionen stellen. Vorerst jedoch beschäftigten sich die Generalstäbler noch damit, die überraschend hartnäckig kämpfende Rote Armee – keinesfalls ein »tönerner Koloß« – zu schlagen und nach Osten zurückzudrängen.
Im Führerhauptquartier dagegen phantasierte man über das Phantom eines neuen Ostwalls, als die Wehrmacht vor Moskau bereits wieder den Rückmarsch nach Westen antreten mußte. Hitler erteilte noch im März 1942 den Auftrag an Krupp, ein einfaches Geschütz »für [den] späteren Ostwall« zu entwickeln.[67] Die eilig durchgeführte Bestandsaufnahme des alten polnischen Ostwalls war wenig beruhigend. Der Stellungsbau war schon lange eingestellt worden, die Truppenübungsplätze als Rückhalt der Stellungslinie nur schwach belegt.[68] Der Spuk ging bekanntlich rasch vorüber, die Wehrmacht schien die Ostfront doch stabilisieren und im Sommer 1942 sogar wieder offensiv vorwärtstreiben zu können.
Nach Stalingrad jedoch mußten alle Hoffnungen aufgegeben werden, die »Festung Europa« an einem neuen Ostwall verteidigen zu können, der die lebensnotwendigen Ölquellen im Kaukasus ebenso einschloß wie die wichtigen Erz- und Kohlelager im Donezgebiet und die fruchtbaren ukrainischen Felder. Es war den Deutschen nicht gelungen, die Ostfront zu einem Ostwall umzuwandeln. Die Front bewegte sich vielmehr zurück nach Westen. Wenn Hitler im August 1943 nach dem Scheitern seiner letzten Teiloffensive den »sofortigen Ausbau des Ostwalls« befahl[69], dann war das eine willkürliche militärische Maßnahme, ein Notbehelf, der nichts mehr mit den früheren Vorstellungen zu tun hatte. Es ging nur noch um rasch zu errichtende Verteidigungsstellungen, die von einheimischer Zwangsarbeitern gebaut wurden, eine verwüstete Zone von »verbrannter Erde«.
Alles blieb freilich Stückwerk, militärisch erfolglos, wie die Einrichtung von »festen Plätzen« im Sommer 1944, als die Heeresgruppe Mitte zusammenbrach und die Rote Armee in Richtung Weichsel marschierte. Hastig befahl Hitler nun den Ausbau des alten Ostwalls und ordnete die Verstärkung der Arbeiten durch den Reichsführer SS an.[70] Dieser war bereits dabei, Hunderttausende von volksdeutschen Siedlern, vor allem die Rußlanddeutschen, aber auch einheimische Kollaborateure, die aus dem russischen Raum nach Westen flohen, zur Stützung des Ostwalls auf polnischem Gebiet wieder anzusiedeln.
Zuletzt wurde auch die ostdeutsche Bevölkerung im Reich zum Opfer der alten rassenideologischen Verbindung von Militärstrategie und Volkstumspolitik. Die Zivilbevölkerung wurde nicht rechtzeitig evakuiert, denn sie sollte ja den »Menschenwall« gegen die »Flut aus dem Osten« bilden. Im Strudel des Untergangs zogen am Ende die Trosse der Wehrmacht zusammen mit den Siedlertrecks nach Westen, die neuen Siedler des NS-Krieges und die Nachfahren der preußisch-deutschen Ostsiedlung früherer Jahrhunderte.
3. Die Ansiedlung von Kriegsteilnehmern
In der Gruppe der NS-Siedler bildeten die ehemaligen Wehrmachtangehörigen nur eine verschwindend kleine Minderheit. Das ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert, war doch seit Beginn der Siedlungstätigkeit 1939/40, entsprechend Hitlers ausdrücklicher Weisung, von allen Verantwortlichen immer wieder betont worden, daß die Soldaten der Wehrmacht nicht nur einen vorrangigen Anspruch auf Ansiedlung im Osten haben, sondern die Speerspitze nationalsozialistischer Rassenpolitik und Ostsiedlung bilden sollten. Obgleich ihr Einsatz erst nach dem »Endsieg« vorgesehen gewesen war, gab es aber schon während des Krieges solche Militärsiedler. Woher kamen sie, und welche Rolle spielte die Wehrmacht in der praktischen Siedlungstätigkeit des »Dritten Reiches«?
Bei der Soldatenansiedlung ging es potentiell um große Zahlen. Bis Frühjahr 1942 waren immerhin fast 10 Millionen Männer in den Dienst der Wehrmacht gestellt.[71] Selbstverständlich kam für einen späteren Einsatz als Siedler nur ein kleinerer Teil dieser Soldaten in Betracht. Wie groß dieser Anteil aber tatsächlich sein würde, konnte niemand voraussagen. Die Heeresführung hatte dennoch gute Gründe, diese Frage schon während des Krieges aufmerksam zu verfolgen und die Regelung einer künftigen Veteranensiedlung rechtzeitig in Angriff zu nehmen. In erster Linie ging es darum, diese Aufgabe nicht der SS zu überlassen. Aber abgesehen vom Kompetenzproblem gab es auch Sachzwänge, die Veranlassung gaben, sich um die Vorbereitung der Militärsiedlung zu kümmern.
Zunächst einmal ist daran zu denken, daß die Wehrmacht sich in einem ungebremsten Prozeß personeller Aufblähung befand. Das Heer allein vergrößerte sich von 3,7 Millionen Mann bei Kriegsbeginn auf 6 Millionen im Frühjahr 1942. Da konnte vorerst kein Soldat für die Siedlung abgezweigt werden. Im Gegenteil, da die landwirtschaftlichen Berufe im Reich das größte Rekrutierungspotential darstellten, mußte die Wehrmacht darauf bedacht sein, den Zug zur Ostsiedlung nicht allzu früh in Gang zu setzen, wollte sie die Befriedigung ihrer personellen Bedürfnisse nicht gefährden. Sie sah sich ohnehin einer wachsenden Konkurrenz der Waffen-SS ausgesetzt. Wenn zwischen den einzelnen Feldzügen eine größere Zahl von Soldaten vorübergehend entlassen werden mußte, sei es zur Stützung der Rüstungsindustrie, oder sei es mit der Entlassung älterer Jahrgänge zur Hebung der Stimmung an der »Heimatfront«, dann hatte die Wehrmacht größtes Interesse daran, sich den Zugriff auf diese kriegserfahrenen Wehrpflichtigen zu erhalten. Sie wurden außerdem dringend an ihren alten Arbeitsplätzen zurückerwartet. Ein regelrechter Siedlungsdrang konnte bei diesen Soldaten vorerst nicht erwartet werden. Es gab vielmehr einen ungebrochenen Drang landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in die besser bezahlten und mit sozialen Leistungen ausgestatteten Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Auch der Arbeitsplatz »Wehrmacht« war in der Zeit glänzender Blitzfeldzüge und langer Ruhepausen so begehrt, daß viele Rüstungsarbeiter sich freiwillig zum Wehrdienst meldeten.
In den allgemeinen Erwartungen eines baldigen Kriegsendes bereitete die Wehrmacht seit April 1940 bereits eine allgemeine Demobilmachung vor. Im Rahmen der dafür ausgearbeiteten Vorschriften galt die Rückkehr zum alten Arbeitsplatz als Regel für die zu entlassenden Soldaten. Das entsprach sowohl den Bedürfnissen der unter dem allgemeinen Arbeitskräftemangel leidenden Wirtschaft als auch vermutlich der Masse der Wehrpflichtigen, die es in ihre gewohnten Lebensverhältnisse zurückzog. Das galt nach den Erfahrungen bei der Demobilmachung nach dem Ersten Weltkrieg[72] nicht für die Arbeiter in der Landwirtschaft sowie in den industriellen Niedriglohnbereichen, vor allem der Gebrauchs- und Konsumgüterindustrie, also in denjenigen Bereichen, die für eine künftige Ostsiedlung von größter Bedeutung waren.
Da die Oberkommandos bereits an gigantischen Rüstungsplänen für die Nachkriegszeit arbeiteten, lag ihnen zwangsläufig an einer funktionstüchtigen, mit Arbeitskräften reich ausgestatteten Rüstungsindustrie. Darüber hinaus hatte noch niemand eine Vorstellung über die künftige Friedensstärke der Wehrmacht. Eine große Zahl von Garnisonen, Festungen und Stützpunkten in ganz Europa, vom Nordkap bis zur Insel Kreta und – wenn das erstrebte Kolonialreich in Afrika Gestalt annehmen würde – auch in Übersee mußte dann bemannt werden. Dafür kamen nicht die älteren Jahrgänge und Familienväter in Betracht, sondern jene bewährten Frontkämpfer, die Hitler eigentlich zur Ostsiedlung einsetzen wollte. Hinter diesem Problem der Nachkriegsplanung zeichneten sich bereits grundlegende Ziel- und Interessenkonflikte ab, die einer raschen Umsetzung des ideologischen Dogmas vom künftigen »Wehrbauern im Osten« entgegenstehen würden.
Während sich die Wehrmachtführung bei dieser längerfristigen Planung der Militärsiedlungen vorerst sehr reserviert verhielt, war sie bei der Weiterentwicklung der traditionellen Veteranensiedlungen nicht so zurückhaltend. Im Kriege mußte mit einer steigenden Zahl von dienstunfähigen Soldaten gerechnet werden, die aufgrund ihrer Verwundung oder Krankheit einen Fürsorge-Anspruch geltend machen würden.[73] Nach dem Wehrmacht-Fürsorge-Gesetz von 1938 stand ihnen eine Rente oder eine vorrangige Arbeitsplatzvermittlung bzw. die Garantie ihres alten Arbeitsplatzes zu. Der Frontkämpfer-Vorbehalt bei der Ostsiedlung schuf eine weitere Möglichkeit, der Fürsorgepflicht gegenüber den Kriegsversehrten nachzukommen.
Auch dabei ging es durchaus um beträchtliche Zahlen. Im ersten Kriegsjahr waren es insgesamt 18344, im zweiten Kriegsjahr 43202 und im dritten Jahr 1941/42 bereits 76077.[74] Wie viele von diesen Kriegsversehrten aber bereit und imstande sein würden, eine Siedlerstelle zu übernehmen, war nicht vorhersehbar. Besonders verpflichtet sah sich das für Fürsorgefragen zuständige OKW gegenüber den dienstunfähigen bzw. nach Ablauf ihrer Verpflichtungszeit ausscheidenden Berufssoldaten. Da sie über keine andere Ausbildung verfügten und ein neuer Arbeitsplatz erst gefunden werden mußte, hatten sie einen Anspruch auf Umschulung in den Fachschulen des Heeres. Speziell die Landwirtschaftsschulen boten sich als Übergangsstation für eine Militärsiedlung im Osten an. Bereits bei der Besprechung am 16. Januar 1940 in Lodsch hatte das OKW daher einen Bedarf von 45000 ha Siedlungsland für die ersten zehn Jahre nach Kriegsende angemeldet, und zwar lediglich für ausgeschiedene Berufssoldaten, »bei denen ein Hunger nach Land bestehe, der berechtigterweise befriedigt werden müsse«[75].
Ob es aber tatsächlich möglich sein würde, die traditionelle Hinwendung ehemaliger Berufssoldaten zur öffentlichen Verwaltung auf die schwere Arbeit als »Wehrbauer« umzulenken, stand dahin. Der Gauleiter von Pommern, zugleich Bundesführer des »Reichstreubundes ehemaliger Berufs-Soldaten«, schrieb noch 1942 – aller Siedlungspropaganda zum Trotz –, daß die Tätigkeit des Berufsunteroffiziers in der Regel ihre Fortsetzung in der Beamtenlaufbahn finden werde.[76] Als durch die verstärkten Mobilisierungen nach Stalingrad sogar die Verwaltung ihren Personalbestand erheblich reduzieren mußte, drängte der Reichsminister des Innern darauf, die Maßnahmen zur Unterbringung von Versehrten und sonstigen Kriegsteilnehmern im öffentlichen Dienst zu verstärken.[77] Nachdem allerdings Himmler selbst Innenminister geworden war, konnte dieses Problem des Veteranen-Einsatzes im Sinne der Ostsiedlung als gelöst betrachtet werden.
Das Problem der Militärsiedler war demnach für die Wehrmachtführung nicht sehr drängend, für den RKF hingegen rückte es bald in den Mittelpunkt. Himmler erkannte, daß nach dem Auslaufen der volksdeutschen Umsiedlung aus den neuen sowjetischen Westgebieten kaum noch größere Siedlerzahlen zur Verfügung stehen würden. Er war also interessiert, das Einvernehmen mit der Wehrmacht in der Siedlungsfrage zu festigen und rechtzeitig Weichenstellungen für den späteren Frontkämpfer-Einsatz zu treffen. Die Anerkennung seiner Planungshoheit zumindest für den Bereich der Landwirtschaft durch die Wehrmacht im März 1940 war ein erster wichtiger Schritt gewesen.
Die Ansiedlung ehemaliger Wehrmachtangehöriger im gewerblichen Bereich bzw. ihre Versorgung mit ehemals polnischem Haus- und Grundbesitz war parallel dazu vom OKW mit Görings »Haupttreuhandstelle Ost« (HTO) geregelt worden. Die HTO hatte zusammen mit der Reichsgruppe Handel im Februar 1940 die Handelsaufbau-Ost GmbH gegründet, die sich um die Betreuung und Verwertung von 130000 polnischen Betrieben kümmerte. Rund 100000 wurden wegen mangelnder Eignung geschlossen und die verbliebenen 30000 zu 90 Prozent mit Umsiedlern und Volksdeutschen besetzt. Für Kriegsteilnehmer blieben also ganze 3000 Betriebe übrig – kein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sich die Wehrmacht für die Interessen ihrer Soldaten einsetzte.
Es war klar, daß zunächst die Umsiedler und Volksdeutschen »versorgt« werden mußten. Da die Baltendeutschen nicht so sehr in die kärgliche Landwirtschaft, sondern zum schnellen Geld in Industrie und Gewerbe drängten, war der Ausverkauf entsprechender polnischer Betriebe – trotz Frontkämpfer-Vorbehalt – schnell abgewickelt worden. Um die für Kriegsteilnehmer reservierten Betriebe zu erhalten, wurden im Frühjahr 1941 verschiedene regionale Auffanggesellschaften gegründet, die diese verwalteten, so daß sie jederzeit ausgegliedert werden konnten. Die Zahl der Bewerbungen zur Übernahme solcher Geschäfte stieg bis Anfang 1942 auf mehr als 10000. Den Bemühungen der Wehrmacht, schon während des Krieges Betriebe an Kriegsversehrte zu übergeben, widersprach jedoch die Reichsgruppe Handel. Sie hielt es für unzweckmäßig, allzu viele Einzelhandelsgeschäfte an diesen Personenkreis abzugeben.[78]
In einem ersten Erlaß zur Vorbereitung der Soldatenansiedlung im Osten nahm das OKW am 18. Oktober 1940 wiederholte Anfragen aus der Truppe zum Anlaß, um unter Berufung auf Hitler und Himmler den Frontkämpfer-Vorbehalt noch einmal zu bestätigen.[79] Dann wurde verkündet, daß zehn Prozent der vorhandenen Gewerbebetriebe bereits vor Kriegsende an entlassene Wehrmachtangehörige verteilt werden sollten. Andere Bewerber, d.h. aktive Soldaten, konnten aber schon jetzt Anträge bei den Wehrmachtfürsorgeoffizieren einreichen. Das OKH legte großen Wert darauf, diese Ankündigung zum »Gegenstand wiederholter Belehrung« der Truppe zu machen.[80]
Über das tatsächliche Interesse der Soldaten an solchen Bewerbungen ist nichts bekannt geworden. Die angeblich große Nachfrage war vielleicht nur ein Vorwand für das OKW, um größere Ansprüche gegenüber anderen Dienststellen geltend machen zu können. Bei den Soldaten war die Stimmung in den ungewissen Monaten nach dem Frankreich-Feldzug immer stärker von der Sorge über die zu erwartende längere Kriegsdauer geprägt. Selbst bei aktiven Unteroffizieren und Offizieren sei überraschenderweise, so wurde gemeldet, »die Neigung zum Dienen nach dem Kriege häufig schwach«[81], ganz anders als bei den eingezogenen Landarbeitern. Ältere Soldaten machten sich zunehmend Sorgen um ihren Zivilberuf. Angehörige freier Berufe fürchteten, daß sie von der daheimgebliebenen Konkurrenz für lange Zeit geschädigt werden könnten. Hier konnten Versprechungen über eine »goldene Zukunft« im Osten vielleicht durchaus eine gewisse Resonanz finden, wenn man die Bedingungen und Voraussetzungen für eine spätere Ansiedlung erheblich verbesserte. Aus ideologischen oder gar idealistischen Gründen allein war wohl kaum jemand bereit, sich auf die ungewisse Zukunftsperspektive eines »Wehrbauern« einzulassen.
Es gab bezeichnende Ausnahmen, die von der Aussicht auf ein Rittergut im Osten derartig angezogen wurden, daß sie mit ihrer Bewerbung nicht bis zum Kriegsende warten wollten, sondern bereit waren, ihren persönlichen »Drang nach Osten« auch außerhalb des Dienstweges zu verwirklichen. Dazu gehörte auch Generalmajor Johann-Joachim Stever, der sich als Kommandeur der 4. Panzerdivision im Frankreich-Feldzug nicht bewährt hatte und zur Führerreserve versetzt worden war. Er suchte ein Gespräch mit Himmler, um ihn »über die Möglichkeit seines Einsatzes bei der volkspolitischen Arbeit im Osten« zu befragen.[82] Das OKH reagierte schnell und gab ihm eine Infanteriedivision. Aber auch dort mußte er bald wieder abgelöst werden, und nach verschiedenen anderen Verwendungen wurde er im April 1944 endgültig verabschiedet. Die frühere Zusage des RKF, ihn in Polen als Landwirt anzusiedeln, war damit nichts mehr wert.
Wenige Tage vor Beginn des Rußland-Feldzuges meldete sich bei Himmler sogar der Erbgroßherzog von Oldenburg. Da er nicht alle seine sechs Söhne mit Grundbesitz ausstatten konnte, gestattete er sich die Anfrage, »ob grundsätzlich die Möglichkeit des Ankaufs größerer Güter im Osten nach Kriegsende für mich gegeben sein wird«. Die Antwort Himmlers, der auf den alten Adel ohnehin nicht gut zu sprechen war, fiel unmißverständlich aus: keine Ausnahme für den Erbgroßherzog. Wenn seine Söhne den Bedingungen – Frontkämpfer, Gesundheit, landwirtschaftliches Können usw. – entsprächen, könnten sie sich nach Kriegsende wieder melden.[83]
Dieses Vorpreschen einzelner Soldaten und Offiziere war eigentlich überflüssig, denn das OKW blieb bemüht, seine Fürsorgepflicht zu erfüllen. Nachdem die Weisung Nr. 21 zur Vorbereitung des Überfalls auf die UdSSR fertiggestellt worden war, versäumte man es nicht, rasch einen speziellen »Bevollmächtigten der Wehrmacht für Siedlungsfragen« (BW Sied) einzusetzen.[84] Dieser hatte sowohl die Vorbereitung für die Nachkriegszeit als auch die bereits anlaufende Ansiedlung entlassener Soldaten zu übernehmen. Die Wahl Karl v.Bornhaupts für diesen Posten demonstrierte die Kontinuität des Gedankens der Militärsiedlung. Als Sohn einer baltendeutschen Kaufmannsfamilie 1886 geboren, im Kadettenkorps aufgewachsen, war er 1918 als Adjutant des Gouvernements in Warschau mit der Rückführung von rußlanddeutschen und polnischen Siedlern beauftragt. Nach seiner Verabschiedung im Jahre 1920 betätigte er sich als Landesgeschäftsführer der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) für Mecklenburg-Strelitz. Seit seiner Reaktivierung im Jahre 1934 war er als Fürsorge-Offizier in verschiedenen Stellungen tätig, zuletzt als Leiter der Fürsorge-Abteilung beim Wehrkreis XXI (Posen). Von Bornhaupt kannte sich also in dem Geschäft aus und machte sich sofort daran, eigene große Ansiedlungsstäbe, parallel zu den Ansiedlungsstäben der SS, aufzustellen. Die Zeit drängte, schließlich sollte das »Unternehmen Barbarossa« im Spätsommer 1941 beendet sein, der künftige »Lebensraum im Osten« seine endgültige Gestalt angenommen haben. Dann würde eine Million Soldaten entlassen werden und der BW Sied vor riesigen Aufgaben stehen.
Zunächst aber bemühte sich v.Bornhaupt, die Ungeduld der Soldaten zu zügeln. So sorgte er für eine Verbreitung der allgemeinen Anordnungen Himmlers zur landwirtschaftlichen Siedlung in der Wehrmacht, und es gab Kommandostellen, die angesichts der »Bedeutung, die die Siedlungsfrage im deutschen Osten für unser Volkstum (habe)« und wegen des »weitgehende(n) Interesse(s) der Truppe an dieser Frage« die Einheitsführer aufforderten, Himmlers Verfügungen »im Rahmen der geistigen Betreuung« zum Thema dienstlicher Besprechungen zu machen.[85]
In einer weiteren Mitteilung hieß es Anfang April 1941, als der Aufmarsch im Osten in vollem Gange war: »Die vielfach geäußerten Befürchtungen, daß die landwirtschaftlichen Siedlungsobjekte schon heute an Reichsdeutsche vergeben würden und die noch an der Front stehenden Soldaten später leer ausgingen, entbehren jeder Begründung.«[86]
Das »Merkblatt Nr. 1 des OKW über die Verhältnisse in den neuen Ostgebieten« konnte fünf Wochen vor Beginn des Überfalls auf die UdSSR gerade noch rechtzeitig fertiggestellt und verkündet werden.[87] Es wurde zum »Grundgesetz« einer künftigen Militärsiedlung im Osten. In seiner allgemeinen volkstumspolitischen Orientierung entsprach es den Richtlinien Himmlers; dasselbe galt für die Festlegung der Siedlungsgebiete. Auffällig ist das Bemühen, den Soldaten die Zukunftsaussichten im Osten als besonders günstig darzustellen. Daher stehen die angeblichen Chancen im Handel und Gewerbe, in Industrie und freien Berufen im Vordergrund. Den alten Mythos des »Wehrbauern« sah die Wehrmacht also offenbar als nicht so werbewirksam an wie die SS. Sie setzte statt dessen auf jene Lebens- und Berufschancen, die wohl einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung, damit auch den wehrpflichtigen Soldaten, als erstrebenswert galten. Die Richtlinien des BW Sied führten also über die erste Fassung des GPO weit hinaus. Hier dürfte sich der Einfluß der HTO und anderer wirtschaftlicher Institutionen ausgewirkt haben. Als die Dienststelle des RKF nach diesen Ankündigungen die Initiative ergriff und die gewerbliche Ansiedlung ebenfalls an sich ziehen wollte, hielt sich das OKW zurück und überließ es der Reichsgruppe Industrie, den Führungsanspruch des RKF zurückzuweisen.
Wichtiger war es dem BW Sied offenbar, sich selbst stärker in den Verkauf von Betrieben einzuschalten. »Die Einschaltung des OKW ist insbesondere geeignet, einer in Kreisen der Wehrmacht auftretenden Beunruhigung und zutage tretenden Kritik seitens der Dienststellen des OKW entgegenzutreten und die Spitze abbrechen zu können.« Die Haupttreuhandstelle gab schließlich diesem Drängen nach und stimmte der Errichtung einer Verkaufskommission zu, an der auch die Siedlungsreferenten der Wehrmacht beteiligt werden sollten.[88]
Der Sogwirkung der SS konnte und wollte wohl auch das OKW sich nicht völlig entziehen, denn jetzt, nach der Wende vor Moskau, war mit einer Verkündung des vorbereiteten Siedlungsaufrufes an die zur Entlassung anstehenden Soldaten vorerst nicht mehr zu rechnen. Um so mehr interessierte sich der RKF um die Ansiedlung der Versehrten und anderer ehemaliger Kriegsteilnehmer aus den Reihen von SS und Wehrmacht. Bei der praktischen Ansiedlungstätigkeit im Warthegau und in den anderen eingegliederten Ostgebieten entwickelte sich eine derartig reibungslose Zusammenarbeit, daß das OKW schließlich seine eigenen Ansiedlungsstäbe auflösen konnte.[89] Dem BW Sied mit seinen Siedlungsreferenten wurden nur noch untergeordnete Betreuungsaufgaben zugewiesen. Ihren Ansiedlungsschein erhielten die Veteranen vom RKF, ebenso die Besitzurkunden.
Für den Warthegau hatte sich das Verfahren bereits eingespielt[90], im Baltikum jedoch mußte der RKF