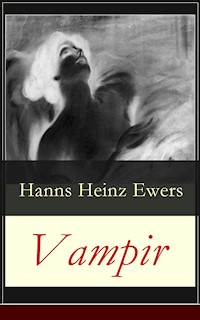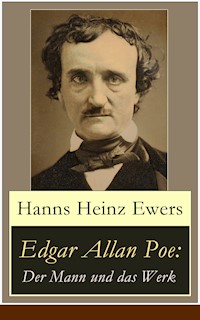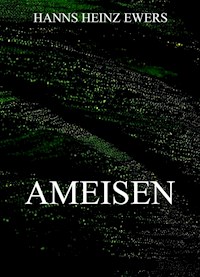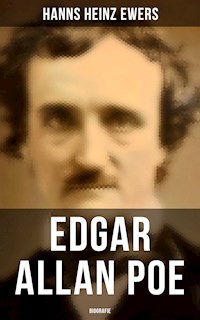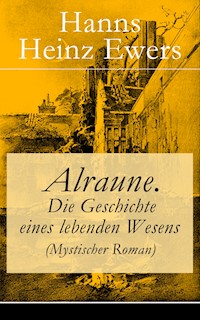Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ewers' Geschichten kreisen um die Themen Phantastik, Erotik, Kunst bzw. Künstler und Reisen in exotische Länder. Dieses E-Book enthält die seltsam-erotischen Geschichten: DAS HYA-HYA-MÄDCHEN, HÖCHSTE LIEBE, ALRAUNE UND DER CHAUFFEUR, JOHN HAMILTON LLEWELLYNS ENDE, EILEEN CARTER und AUS DEM TAGEBUCH EINES ORANGENBAUMS.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
DAS HYA-HYA-MÄDCHEN
HÖCHSTE LIEBE
ALRAUNE UND DER CHAUFFEUR
JOHN HAMILTON LLEWELLYNS ENDE
EILEEN CARTER
AUS DEM TAGEBUCH EINES ORANGENBAUMS
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag:
E-Books Edition Loreart:
Hanns Heinz Ewers
Höchste Liebe
DAS HYA-HYA-MÄDCHEN
Was er da niederschrieb, hatte ihm seine Pflegerin erzählt. Soeur Victorine hieß sie - aber Dr. Bonhommet, der alte, augenzwinkernde Arzt, nannte sie nur Dariolette. Das verstand sie nicht, und kein Mensch verstand es in St. Maria, noch in allen fünf Landen Guayanas. Die Wahrheit zu sagen: Wer hätte es heute verstanden drüben in Europa und wer selbst in Paris?
Der Deutsche, den sie pflegte, hörte den hübschen Namen: Dariolette. Das klang in seinen Fieberträumen - leicht, schmeichelnd, wie Vogeltrillern -, Dariolette. Dann wußte er: Er kannte es wohl, dieses Wort. Nicht gehört hatte er es, nein, aber doch gesehn irgendwo - Dariolette. Wo nur?
Immer klang es um ihn herum, durch lange Wochen ums Krankenbett, immer sang es in halbwachem Schlafe - Dariolette. Er murmelte es mit trockenen Krankenlippen, hörte die Blätter draußen rascheln, fern vom Fenster her - Dariolette. Dann, einmal, als Dr. Bonhommet ihm den Puls fühlte, flüsterte er das lachende Wort.
Da zwinkerte der alte Arzt, lächelte fast. Und in diesem Augenblick wußte der Deutsche, woher er den Klang hatte: Dariolette; es war, als ob ihm der Alte den Staub im Hirne weggeblasen habe. Den Staub von dem Schubfach seines Gedächtnisses.
»Amadis von Gallia« - der weltberühmte Roman, den so begeistert einst Don Quijote las. Und den er selbst las, weil Cervantes von ihm sprach, und weil ein deutscher Student doch so gründlich sein und alles selbst lesen muß, alles! So deutlich stand das nun wieder vor ihm; er sah sich in der Bibliothek sitzen, den alten Schweinslederband in den Händen. Sah genau die Seite, von der ihn zum ersten Male der Name anlachte: Dariolette.
Die war der Königin Zofe, ihre Freundin und Vertraute; war eine, die sich trefflich schickte, Gelegenheiten zu machen. So eine war Dariolette.
Und so nannte Dr. Bonhommet nun die Schwester Victorine. Groß war sie und schlank, blauäugig und blankzähnig - er dachte immer, daß sie rotblondes Haar haben müsse unter der weißgestärkten Haube. Sehr bleich war sie, wie alle Krankenschwestern. Und war schön, gewiß war sie schön trotz ihrer vierzig Jahre. Sanft auch und gut; still war ihre Frömmigkeit und nie aufdringlich.
Die - und Dariolette?
Er schrieb das alles auf, als er auf dem Dampfer saß, der ihn von Cayenne nach Paramaribo bringen sollte, nach Georgetown und dann nach Trinidad. Schrieb auf, was Soeur Victorine erzählt hatte und das, was der alte Hospitalarzt, Dr. Bonhommet, sagte, der immer so mit den Augenlidern zwinkerte. Der hatte es wieder von Gus Martens gehört.
Also Gus, ja, das war sein Freund, mit dem er die Fahrt gemacht hatte in die Berge. Der mußte dann fort, konnte nicht warten in St. Maria, bis er gesund sein würde, vielleicht in Monaten. Aber Gus hatte dem Arzt Bericht erstattet über alles, was da geschehn war. Und Dr. Bonhommet hatte es ihm wiedererzählt, so gut er es wußte. Das hatte dann Schwester Victorine ergänzt, die einiges miterlebt hatte. Und endlich fiel ihm, nach und nach, manches selbst wieder ein; Schleier hoben sich von allzu Verwischtem. Denn er war es ja, er, dem es geschehn war; und was erlebt worden war, hatte er selbst erlebt.
Unendlich köstlich war diese Fahrt über blaueste See. So still, so glatt, so alle Nerven leise küssend. Dann: dieses langsame Gesundwerden. Dieses Auferstehn vom monatelangen Tode, dieses Einatmen neuer Kräfte durch alle Minuten des Tages. So mag sich der Schmetterling fühlen, der aus der toten Puppenhülle schlüpft, nun am Blatte hängt und langsam, langsam die schlaffen Flügeln anfüllt mit warmer Sommerluft. Auf Deck lag er in seinem Liegestuhl, lächelte, schrieb das alles auf. Diese Geschichte von ihm selbst, der tot war. Und doch nun lebte. Wieder hinausreiste. In ein neues Leben, ins Glück vielleicht.
So war es: Er war sehr krank gewesen, und jemand rettete ihn im letzten Augenblick. Das war eigentlich alles. Nur - nicht sein Freund rettete ihn, Gus Martens. Auch nicht Dr. Bonhommet, noch die Schwester Victorine. Die nicht - eine andre war es.
Sie fuhren aus, um Gold zu suchen, »El Dorado« zu finden hinter den Bergwäldern. Überall hört man solche Geschichten an der Nordküste - von Venezuela hin bis nach Brasilien, seit Jahrhunderten schon. Das schlummert ein, das lebt wieder auf, verwirrt die Köpfe und jagt sie in die Berge hinein.
Keiner aber wußte mehr davon als Gus Martens, keiner kannte besser die fünf Guayanas. Achtmal schon war er ausgezogen, den See Parima zu finden, den See El Dorados, des vergoldeten Häuptlings. Er traf Gus Martens in dem Loch San Rafael, im venezolanischen Guayana. Gus war zurück, aus der Sierra von Pacaraima: Dort war er nicht, der große Goldsee mit dem Schatze des Goldkaziken. Aber Gus wußte nun, wo er war. Jeden Abend erzählte er davon, während er die Tage zubrachte, um mühselig die neue Fahrt vorzubereiten, Maultiere und Proviant zu kaufen, indianische Knechte anzuwerben. Jeden Abend erzählte Gus Martens - hatte ihn endlich soweit, daß er einschlug, Partner wurde auf halb und halb, Kosten und Gewinn. Dann zogen sie nach Südosten.
Spanier und Portugiesen, Deutsche, Holländer und Franzosen hatten gesucht durch die Jahrhunderte nun. Jetzt waren ein paar Yankees unterwegs. Gus hatte ihnen Märchen vorerzählt, so daß sie nun am oberen Orinoco suchten. Und dann die von Europäern importierten Menschen, Ostinder und Chinesen, Laskaren, Malaien und Neger aller Arten, entlaufene Sklaven, die sich im Busch umhertrieben. Ganz zu schweigen von den Indianern und all dem Mischvolk.
Immer war jemand auf der Goldjagd - schwarze Glücksritter und gelbe, braune, rote und weiße. Gus lachte - sie waren alle auf falscher Fährte, alle. Er wußte es, denn er war all diesen Fährten gefolgt. Ganz in die Irre lief - im achtzehnten Jahrhundert - der Spanier Santos, der, zweihundert Jahre später, den Spuren des Lorenz Keimis folgte. Die Ritter Georg von Speyer und Philipp von Hutten zogen ins Blaue hinein, wie Sir Walter Raleigh tat; und nur einer, Nikolas Horsmann, hatte den guten Wind in der Nase. Beinahe - beinahe fand er den Wundersee Parima.
Dann aber schüttelte der große Forscher Schomburgk viel Wasser in den berauschenden Wein, der allen goldtrunkenen Glücksrittern die phantastischen Köpfe umnebelte. Der Parimasee des Goldkönigs, erklärte er, das ist nichts andres als der Amucusee in Britisch-Guayana, am Macaparangebirge - und Gold ist schon gar nicht da! Und Schomburgk ist der Erforscher Guayanas und ist die ganz, ganz große Autorität. Exakte Wissenschaft - da gibt es halt nichts! Gus Martens lachte laut, wenn er das sagte.
Aber still und träumerisch wurde seine Stimme, wenn er seine Gedanken auseinandersetzte. Nie sei eine Sage aus nichts gewachsen, niemals. Waren die Schätze der Inkas nicht greifbare Wirklichkeit? Er, Gus Martens, würde den Goldsee finden und an seinen Ufern die Stadt Manoa del Dorado - an den Quellen des Oyapoc in den stillen Bergen der Tumac-Humac.
Durch Sierren ritten sie und durch Savannen. Kreuzten immer neue Flüsse, sahen immer neue, immer mehr Wasserfälle. Gus Martens kannte die Namen und nannte sie ihm. Kauderwelschte mit den Indianerstämmen stets in andrer Sprache und dazwischen in Spanisch, Englisch, Holländisch.
Weiter zogen sie gen Südosten, doch zu den Tumac-Humac kamen sie nicht. Vielleicht, jetzt, während er nach Trinidad fuhr, mochte Gus Martens dort sein, an den Quellen des Oyapoc, auf seiner neunten Ausfahrt zum Goldsee.
Das machte: der Deutsche wurde krank. Ganz plötzlich, so über Nacht. Das Fieber war nicht schwer, aber das schlimme war, daß ihm jede Speise zuwider war. Er vermochte nichts über die Lippen zu bringen, nicht einmal Wasser. Zwang er sich gewaltsam, doch etwas zu schlucken, so revoltierte der Magen, und er spie das Genossene nach wenigen Minuten wieder aus. Gus hatte alle möglichen indianischen Namen für die Krankheit, behauptete auch, daß schon vor viereinhalbhundert Jahren Ritter Philipp von Hutten an ihr zugrunde gegangen sei - verhungert und verdurstet. Ein Verlangen nur hatte der Kranke - Milch. Doch wenn ihm der Freund eine Büchse kondensierter Milch aufmachte, wurde ihm von dem Geruch allein schon seekrank. Nein, nein, frische Milch mußte es sein. Er hing weiter auf seinem Maultier, sah nichts von allem ringsum, hörte nichts mehr von dem, was Gus Martens erzählte. Nur von fern das Rauschen der Wasserfälle. Und im Hirne rauschte der Wunsch: Milch, frische Milch.
Einmal bekam Gus eine Ziege aus einem Indianerdorf - er brachte nicht einen Tropfen über die Lippen. Ein andermal erhielten sie warme Stutenmilch; er zwang sich, einen Becher herunterzugießen. Atmete schwer, spie alles wieder aus; wand sich durch zehn Minuten in Krämpfen.
Nein, das war es nicht, was er wollte. Kuhmilch vielleicht. Aber wo sollten sie hier eine Kuh auf treiben? Dann dachte er, die Milch vom Kuhbaum sei das, wonach er verlangte. Noch vor wenigen Wochen hatte er davon getrunken. Wenn nur die Troßknechte einen Kuhbaum finden wollten.
Sie fanden welche, schlugen mit Messern durch die Rinde, um den milchigen Saft zu gewinnen. Damals war er schon so schwach, daß er sich nicht mehr auf seinem Reittier zu halten vermochte; die Indianer hatten aus Zweigen eine Tragbahre gemacht, darauf trugen sie ihn. Sie brachten ihm die Milch, richteten ihn auf, setzten ihm die Kalebasse an die Lippen.
Er trank, trank. Dann brach er, im Augenblick. Nein, nein, das war nicht die Milch, nach der er verlangte, nicht die köstliche Milch des Kuhbaumes, die allein ihn heilen mochte!
Später, in dem kleinen Bungalow in St. Maria, das man Krankenhaus nannte, hatte ihm Dr. Bonhommet einen schönen Vortrag gehalten. Es sei da ein Unterschied, sagte er, der erkläre alles. Der mächtige Kuhbaum nämlich, von dem er in Venezuela getrunken habe, Palo de vacca von den Indianern und Galactodendron von den Gelehrten genannt, zu der Familie der Urticaceen gehörig - der wachse gar nicht im französischen Guayana. Dafür wachse hier ein andrer Baum, kleiner und mehr strauchartig - der Milchbaum, den die Indianer Hya-Hya, die Wissenschaftler aber Tabernamontane benennen - die Bergkneipe, auch ein hübscher Name. Dieser Milchbaum nun, aus dem Contortusgeschlecht, sei ganz und gar nicht mit dem Kuhbaum verwandt. Seine Milch aber schmecke wirklich wie Kuhmilch, und auch der Käse, den man aus ihm gewinne, sei durchaus dem Kuhkäse ähnlich. Die Milch des venezolanischen Kuhbaumes schmecke gar nicht wie Kuhmilch, sie sei süßer und blauer, schmecke wie - nun, wie eine andre Milch.
Und der kleine Dr. Bonhommet zwinkerte mit den runden Äuglein, und ein rasches, gutmütiges Grinsen huschte über seine Lippen.
Sehr viel erinnerte er nicht mehr von diesem Tage an, konnte auch nicht recht feststellen, ob das, was er nun niederschrieb, ihm aus eigner Erinnerung bekannt war oder aus den Erzählungen des Arztes oder der Krankenschwester.
Gus Martens brach die Fahrt ab, ob er gleich dicht am Ziele zu sein glaubte. Aber den Mann zu retten - den er doch vor ein paar Monaten erst getroffen hatte, und den er vermutlich nie wiedersehn würde -, das schien ihm dennoch nun wichtiger als alle Hoffnung auf die Schätze des Goldsees. Er ritt voraus, so schnell ihn sein Tier tragen konnte, immer nach Norden, um so bald wie möglich Hilfe zu holen. Und langsam, langsam folgten die Indianer mit der Tragbahre.
Aus diesen Tagen wußte der Deutsche nichts mehr. Er konnte nicht einmal sagen, ob er Durst empfand oder Hunger. Nur ein Rauschen der Wasserfälle klang in seinen Ohren, und in seiner Seele lebte die stille Sehnsucht nach Milch.
Dann, irgendwo, kam Gus Martens zurück, und mit ihm kam Schwester Victorine. Sie brachten frische Treiber und Maultiere, brachten eine richtige Krankenbahre, die von zwei Maultieren getragen wurde. So weich, so leicht schaukelnd lag man da.
Er erinnerte sich der sanften Schwester, gleich vom ersten Tage an; das Adagio ihrer Stimme tat ihm wohl. Was in ihm noch vorhanden war von letztem, schwachem Willen, das riß er zusammen, gab sich Mühe, wieder und wieder, alles zu schlucken, was sie ihm reichte. Aber es ging nicht, ging nicht. Nichts vermochte er bei sich zu behalten.
Mit dem Blick bat er sie um Verzeihung. Sprechen konnte er nicht mehr; selten nur hauchten die trockenen Lippen: »Milch! Milch!« Und der Schwester tropften große Tränen aus den blauen Augen.
Manchmal war er auf Minuten ganz klar. Dann hörte er Martens sagen: »Wir werden ihn nie lebend nach St. Maria bringen.«
Die Schwester sagte: »Wir müssen ihn hinbringen!« »Und wenn er hinkommt«, fragte Martens, »was dann? Dann wird er eben dort sterben! Er kann nichts trinken, nichts essen …«
»Wir müssen etwas finden für ihn«, sagte die Schwester.
»Milch«, flüsterte der Deutsche, »Milch.«
Gus Martens ritt wieder voraus, Dr. Bonhommet zu holen; die Schwester leitete den Zug. Sie sprach zu dem Kranken, strich ihm mit seidenem Tuch den Schweiß von der Stirn. Immer weiter ging es nach Norden, ohne Unterbrechung wie ihn deuchte.
Einmal machten sie doch eine Rast. Er hörte, wie die Indianer von einem Dorfe sprachen, das da liegen sollte; sah, wie die Schwester Victorine fortritt. Mit ihr zogen die Knechte. Seine Bahre hatten sie hingestellt, nur ein alter Indianer war bei ihm zurückgeblieben.
So lag er und wartete. Fast wach war er; das Ungewohnte des Nichtschaukelns hielt ihn wach. Stunden vielleicht lag er so, wer weiß das? Dann wurde der Alte unruhig, bat ihn, gehn zu dürfen, nach den ändern sehn. Da nickte er.
Lag wieder, ganz allein nun. Schlummerte, wachte wieder, wartete. Dann hörte er Stimmen.
Eine - das war der Schwester Stimme. Hastig sprach sie, aufgeregt, eindringlich, gar nicht, wie sonst ihre Art war. Und eine andre Frauenstimme, hell, fast ängstlich. Er verstand kein Wort - indianisch sprachen die beiden.
Dann war es still. Aber leise Schritte kamen heran, zögernd und langsam. Nun schlug er die Augen auf - eine Indianerin stand dicht an seiner Bahre. Große schwarze Augen sah er, schwarze Zöpfe, die nach vorn über die Schultern hingen. Zwei Reihen Zähne - nie hatte er so weiße gesehn. Sie beugte sich über ihn, kniete nieder. Sie sah ihn an, einen Augenblick nur, ernst, fast erschreckt. Dann reckte sich die braune Hand, rasch riß sie das Gewand von der Schulter. Und die starken Brüste hoben sich, senkten sich in hastigem Atem.
Langsam bog sich ihr Leib, über sein Gesicht schob sich die nackte Brust. Seinen Kopf drängte sie sanft zu sich hin, wie eines Kindleins.
Da schloß er die Augen, trank, trank.
Das alles hatte er vergessen, als er im Hospital lag; erinnerte sich erst daran, als ihm der Arzt davon sprach. »Das war die Rettung«, sagte Dr. Bonhommet. »Nie wären Sie lebend nach St. Maria gekommen. Ein kluger Gedanke war es - bedanken Sie sich bei Dariolette.«
Aber Schwester Victorine lehnte das ab - sprach nicht gern von diesem Teil der Geschichte.
Als er sich verabschiedete von Dr. Bonhommet, fragte er nach der Indianerin. Gewiß verdankte er dem Arzt sein Leben, ihm und der Schwester, auch seinem Partner, Gus Martens. Aber nicht weniger doch der Indianerin.
Wie sie heiße, wo sie wohne und wie er sich ihr erkenntlich zeigen könne?
Das sei nicht gut möglich, meinte Dr. Bonhommet. Tot sei sie.
»Tot?« fragte er. »Tot?«
Der alte Arzt zuckte die Achseln.
»Sie haben seltsame Sitten und Anschauungen, diese Buschindianer«, sagte er. »Für wenig Geld hätten Sie von ihrem Manne das Weib kaufen können - und seine Schwester dazu. Hätten es behalten dürfen, solange es Ihnen gefiel, um ein paar Silberstücke im Monat. Dann, wenn Sie sie zurückschickten, mit ein paar kleinen Geschenken vielleicht, hätte ihr Mann sie hoch in Ehren gehalten, kein Härchen ihr gekrümmt. So aber - als er zurückkam zum Dorf, hörte, was geschehn war, prügelte er sie tot.«
»Das ist ja Wahnsinn!« rief der Deutsche. »Sagen Sie, Doktor, kannte Schwester Victorine die haarsträubenden Sitten dieses Indianerstammes?«
Dr. Bonhommet zog die Schultern hoch, ließ sie nach einer Weile wieder fallen.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er; »es geht mich auch nichts an. Das aber ist ganz gewiß: als die Indianerin Ihr Leben rettete - wußte sie recht gut, was ihr bevorstand.«
Langsam fuhr er hinauf nach Trinidad über blaueste See. Schrieb dies nieder, lang hingestreckt im Deckstuhl. Sog die warme Luft ein mit allen Poren, wie ein Falter, der aus dem Totenschlaf der Puppe zu neuem Leben erwacht. Träumte still in die Sternennacht. Zwei Frauen traf er im Lande Guayana - zwei Frauen, die er nie wiedersehn würde. Soeur Victorine war die eine, die der Arzt von St. Maria Dariolette nannte. Die andre, die nun tot war, war eine Indianerin - nicht einmal ihren Namen kannte er.
Dennoch, dennoch, etwas war da in den Seelen dieser Frauen, das sie ihm verband. Wenn er nur wüßte, was das wohl war. - Still träumte er in die Sternennacht. Sah des Südens Kreuz und die breite, leuchtende Milchstraße, die durch alle Himmel zum Paradiese führt.
HÖCHSTE LIEBE
Ich glaube, es sei kein Mensch auf der Welt,
der nicht seinen Sparren habe;
und ich kann bei meinem Birn wohl merken,
wann andere zeitig sind.
H. J. C. von Grimmelshausen,
Simpl. Simplicissimus
Drei Jahre strahlte Hagen Dierks als großer Stern am Musikhimmel auf beiden Seiten des Atlantiks. Drei Jahre lang zitterten die Auerschüler, die Elman, Heifetz, Rosen und Seidel; und Fritz Kreisler selbst fühlte an heißen Schläfen die kühle Luft dieser Adlerschwingen. Nur: er lächelte. Sagte: Einer war vor mir, und einer wird nach mir kommen. Das ist er: Dierks.
Er war da - drei Jahre lang und dann verschwand er.
Nicht daß er, ein blutjunger Geiger wie fast alle die ändern, vom Konservatorium weg, im Sturm das Publikum nahm und die Konzertsäle füllte. Als er das tat, war er bereits fünfunddreißig Jahre alt - und war achtunddreißig, als er abtrat.
Öffentlich gespielt hatte er freilich zum ersten Male mit achtzehn Jahren.
Damals war es gewiß kein Mißerfolg - und doch auch kein ganzer Erfolg. Er spielte dann überall herum durch lange Jahre, blieb aber stets in der zweiten Reihe.
Dann kam der Krieg, und er war Soldat. Nach dem Kriege spielte er wieder. Aber es war grade, wie es vorher gewesen war: Aus der zweiten Klasse kam er nicht heraus.
Der reiche, alte Herr, der ihn hatte ausbilden lassen, sammelte alle Besprechungen ernster Kritiker. Es war erstaunlich, wie sich diese Herrn widersprachen - ob sie gleich in einem sich stets gleichblieben: daß nämlich dem Künstler irgend etwas fehle. Nur was dies eine grade sei - darüber sagten die Kritiker stets ein anderes. Bei dem einen Konzert wurde seine fabelhafte Technik gelobt, sein musikalisches Empfinden und sein künstlerisches Temperament - bedauert wurde nur der Mangel einer starken Persönlichkeit. An einem ändern Abend wurde gerade diese außerordentlich hochgestellt - dagegen ihm ein gewisser Mangel an Technik vorgeworfen. Wieder einmal sprach man ihm das Temperament ab oder auch ein tieferes musikalisches Gefühl - während zugleich wieder alles andere in den Himmel erhoben wurde.
Der alte Herr, selbst leidenschaftlicher Musikfreund und großer Kenner, mußte zugeben, daß die Kritiker recht hatten - alle. Die so überaus gegensätzlichen Besprechungen der Leistungen seines Schützlings hatten ihn so verwirrt, daß er eines Tages beschloß, sie nachzuprüfen, da war er ein ganzes Jahr lang mit dem jungen Künstler herumgereist und hatte jedes einzelne seiner Konzerte besucht. Es war wirklich so, wie die Zeitungen schrieben: jedesmal fehlte etwas. Bald dieses und bald jenes - aber einen vollen, großen, reinen Kunstgenuß gab auch ihm nicht eines der Konzerte. Er wußte gut: sein Schützling, an dessen Kunst er dennoch glaubte, hatte alles zur Verfügung und alles in so überreichem Maße, wie nur einer in hundert Jahren. Trotzdem: Nie konnte er das vereinigen; stets war bald dieses, bald jenes, unkontrollierbar ihm wie dem Künstler selbst - mangelhaft. Er glaubte, daß mit den Jahren das von selber kommen würde, aber die Jahre vergingen, und es wurde eher schlechter als besser. Geradezu erschreckend aber trat dieser wechselnde Mangel in den Jahren nach dem Krieg in Erscheinung. Dann, an einem Oktoberabend in Wirn, hatte Hagen Dierks plötzlich einen ungeheuren Erfolg er gab große, unantastbare, restlose Kunst. Und das tat er von nun an an jedem Abend, wo immer er spielte. Man rief ihn ins Ausland, erst nach Spanien, Holland und den skandinavischen Ländern. Er war dann der erste deutsche Künstler, der wieder nach London gebeten wurde, und gleich darauf mit nicht dagewesenem Honorar nach Amerika. Jedermann weiß das, und jeder, der ein wenig nur die Musik liebt, hat ihn gehört in jenen Jahren. Der Künstler war unermüdlich in dieser Zeit; nur zwei Monate im Jahre verbrachte er auf seinem kleinen Landgut am Niederrhein - durch zehn Monate spielte er jeden Abend vor Tausenden.
Dann starb er. Ganz unromantisch und prosaisch: Er erkältete sich, überhitzt, nach einem Konzert in dem zugigen Künstlerzimmer; bekam Lungenentzündung; war tot nach vier Tagen.
Das ist das, was jeder weiß von Hagen Dierks. Mehr aber wußte keiner.
Man vergaß ihn nicht, o nein. Niemand, der ihn hörte in diesen drei Jahren, wird ihn vergessen können sein Leben lang. Wenn aber all diese Menschen tot sind, wird er noch weiterleben in Büchern von Musikhistorikern, die sich Mühe geben werden, das Phänomen zu erfassen, das Hagen Dierks hieß - diesen seltenen Meteor, den leuchtendsten seit Paganinis Tagen.
Einer hat das bereits getan. Herr W. T. Reininghaus, eben jener alte reiche Herr, der ihn einst ausbilden ließ. Er kannte ihn besser als ein anderer Mensch und versuchte schon bei Lebzeiten seines Schützlings das Rätsel zu ergründen, obwohl dieser nie ein Wort darüber sprach, auch zu ihm nicht. Der alte Herr glaubte, das Geheimnis gefunden zu haben; er sprach auch gelegentlich davon zu einigen Freunden. Die hörten still zu und lächelten - sie glaubten die Geschichte nicht recht. Wohl die Tatsachen - denn die hatte der alte Herr peinlich zusammengetragen - aber nicht die inneren Zusammenhänge, nicht die Folgerungen, die er daraus zog.
Der alte Herr zweifelte manchmal selber daran; so brachte er seine Geschichte nie zu Papier. Und darum werden Musikhistoriker noch manchmal versuchen, das Rätsel des Geigenspielers Hagen Dierks zu ergründen; dieses musikalischen Wundermannes, der mit achtzehn Jahren reif war, dann durch vierzehn Jahre - wenn man die Kriegsjahre abrechnet - sich nicht entfalten konnte, stets einen Mangel zeigte - und immer einen ändern. Und der endlich ohne jeden sichtbaren Grund, von heute auf morgen die denkbar höchste Vollendung zeigte und die reinste Kunst in Jahrhunderten. Immerhin mag die Geschichte des alten Herrn und väterlichen Freundes des Künstlers späteren Gelehrten manche Anhaltspunkte geben, die sie benutzen mögen, wie sie wollen.
Hier ist sie:
An dem Abend seines ersten öffentlichen Auftretens begleitete Herr Reininghaus seinen Schützling zum Konzerthaus. Hagen Dierks, damals achtzehn Jahre und zwei Monate alt, war seiner Sache sehr gewiß. Er hatte jene unendlich glückliche Selbstsicherheit, die so viele junge Künstler in den ersten Jahren ihres Auftretens auszeichnet.
Als sie vor dem Konzerthaus die Straße kreuzten, sahen sie ein altes Hufeisen auf dem Pflaster liegen. Herrn Reininghaus fiel die Anekdote ein, die man von dem Neger Johnson erzählte, als er mit seinem Manager zu dem berühmten Wettkampfe in Rheno ging, bei dem er den Weltmeister Jeffries niedersehlug. So lachte Herr Reininghaus und sprach wie Johnsons Manager: »Heb’s auf! Tu’s in deinen Handschuh vielleicht bringt’s Glück!«
Aber der junge Geiger gab dem Hufeisen einen verächtlichen Fußtritt.
Dann, im Künstlerzimmer, zwei Minuten vor dem Auftreten, sagte er plötzlich nachdenklich: Wer weiß, vielleicht hätte ich das Hufeisen doch aufnehmen sollen!«
Dieser Abend war gewiß ein Erfolg, aber nicht ein so gewaltiger, wie die beiden sich geträumt hatten.
Es wurde dann in der Folge eine Manie bei dem jungen Geigenspieler, daß er jeden Talisman, den er nur auf treiben konnte, in der Tasche herumtrug. Er hatte rostige Nägel, vierblättrige Kleeblätter, kleine Belemniten; trug goldene Kreuzchen, Georgstaler, Stücke von Jade, Marienbildchen und kleine Holzbuddhas - wovon er nur immer hörte, das probierte er aus. Und warf es weg nach jedem Konzert. Er brauchte nicht die Kritiken am anderen Morgen zu lesen: Er wußte gut, was ihm gefehlt hatte an diesem Abend oder jenem. Und den kleinen Gott, den er vor ein paar Tagen eingesetzt, stieß er entrüstet wieder herunter von seinem Thron.
Nicht, daß er an die geheimnisvolle Hilfe irgendeines Fetischdinges recht geglaubt hätte. Er mißtraute jedem einzelnen gründlich. Was er glaubte, war nur das: Vielleicht gibt es doch etwas, das mir helfen kann. Vielleicht …
Im Grunde war das nichts als die Elastizität der Jugend. War die ewige Hoffnung, die sich nicht unterkriegen lassen wollte. Er war - künstlerisch - irgendwie krank, und er tat alles, diese Krankheit zu erkennen. Er arbeitete in diesen ersten Jahren fieberhaft und nach jeder Richtung hin. Seine Technik suchte er immer mehr zu vervollkommnen. Er studierte dazu auf allen Gebieten, suchte sich zu bilden, wo es nur ging, um seine Auffassung zu erweitern. Sehr bescheiden, gut erzogen, hübsch und von natürlicher Liebenswürdigkeit, hatte er das Glück, daß alle anerkannten Musikgrößen, die er kennenlernte, ihm zugetan waren, ihm seinen Weg zu ebnen versuchten, ihm gern allerlei Winke, Ratschläge, auch Unterricht gaben. Er tat, was er nur konnte, befolgte jeden Rat, kurierte an sich herum mit den abenteuerlichsten Mitteln. Aber es nutzte nie etwas. Was eigentlich das war, das ihm fehlte, das begriff keiner - und er selbst am wenigsten.
Körperlich krank war er nie. Trotzdem pflegte er seinen Leib nach jeder Richtung, trieb jeden Sport, der nicht seine Hand in zu große Gefahr bringen konnte; besuchte in den Ferien ein Sanatorium nach dem andern. Versuchte die abenteuerlichsten Kuren, um dem Fehler, den er zeitweise in den Nerven vermutete, beizukommen. Aber nichts half, gar nichts.
Die Jahre gingen, und nichts kam. Einmal - und dann noch einmal - dachte er, eine Frau würde ihm helfen können. Aber die »große Liebe« half ihm so wenig wie ein rostiger Nagel oder eine Mücke in Bernstein. »Wissen Sie«, erzählte Herr Reininghaus, »vielleicht war’s, weil er auch da mißtrauisch war vom ersten Augenblick an. Er glaubte nicht recht an die heilige Macht der Liebe! All seine Geschichten mit Frauen gingen rasch zu Ende - und ich denke, daß er sie fortwarf wie die Goldkreuzchen und Glückspfennige - gleich nach dem Konzert.«
Langsam erlahmte er dann. Nicht daß seine künstlerischen Darbietungen schlechter wurden sie blieben interessant genug. Blieben das, was sie stets waren: Elfzwölftelerfolg! Aber nur das letzte Zwölftel zählt - was nützt die schönste Himmelsleiter, wenn die obersten Sprossen fehlen? Hagen Dierks erlahmte in seiner Hoffnung. Nie erlosch diese ganz, flackerte immer wieder auf - aber nur kurz noch und in immer längeren Zwischenräumen. Er fühlte in langen Monaten, daß er das Höchste nie würde erreichen können - und nur das schien ihm lebenswert.