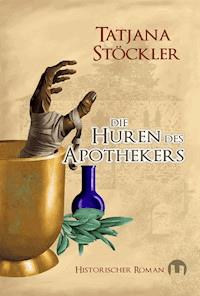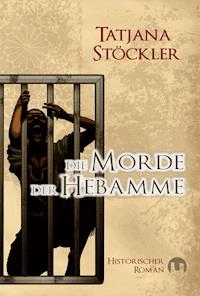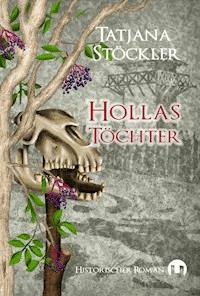
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Burgenwelt Verlag
- Sprache: Deutsch
Eine Bastion des Friedens an der Kriegsfront / Finstere Intrigen im Namen des Glaubens / Ein Schicksal, das nach Rache verlangt Hoohseoburg 745 AD: Die sächsische Fürstentochter Brune hat ihre gesamte Jugend im Tempel der Holla gelebt, doch der neuen Hohepriesterin missfällt ihre Eigensinnigkeit. Die beste Möglichkeit, sie loszuwerden, ist eine Heirat. Da kommen die Tributverhandlungen mit den Franken wie gerufen, denn der fragile Frieden zwischen Christen und Heiden soll nach Wunsch der Stammesfürsten mit einer Ehe besiegelt werden. Auf einmal findet sich Brune als Braut an der Seite von Arnulf wieder, einem fränkischen Edelmann, der sich fest dem christlichen Glauben verschrieben hat. Wohl oder übel ist das ungleiche Paar gezwungen, sich der Ratsversammlung beugen. Doch nicht nur Brune und Arnulf müssen ihre Differenzen überwinden, um sich im sumpfigen Grenzgebiet ein Heim zu bauen. Auch andere sind von der Verbindung und dem verheißenen Frieden nicht begeistert und schmieden finstere Pläne … Tatjana Stöcklers neuer historischer Roman verwickelt die Leserinnen und Leser in ein aufregendes Abenteuer im frühen Mittelalter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Hollas Töchter
Historischer Roman
von Tatjana Stöckler
Vollständige E-Book-Ausgabe der Druckausgabe
ISBN 978-3-943531-74-9 (Print Ausgabe)
© Burgenwelt Verlag | Jana Hoffhenke
Hastedter Osterdeich 241 | 28207 Bremen
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Jana Hoffhenke
Korrektorat: Ursula Schötzig
Umschlaggestaltung | Coverillustration: Diana Isabel Franze
Satz | Gestaltung: Eridanus IT-Dienstleistungen
Eiris sazun idisi, sazun hera muoder.
suma haft heftidun, suma heri lezidun,
suma clubodun umbi cuniowidi:
insprinc haftbandun, infar wigandun.
Einst saßen Idise, setzten sich Hehre Mütter.
Einige hefteten Fesseln, einige reizten die Heere auf.
Einige klaubten herum an des Volkes Fesseln:
Entspringe den Haftbanden, entkomme den Feinden.
Erster Merseburger Zauberspruch (ca. 750 n. Chr.)
Prolog
960 AD, Kloster Fulda
Verstohlen wischte Gotthilf sich die Augenwinkel und trocknete die Finger an seinem Überwurf. Seine Augen tränten nur vor Anstrengung, nicht etwa, weil ihn der Spott der anderen Novizen berührte. Es fehlte noch, dass Wasserflecken auf dem Pergament die Schrift verschmierten! Warum hinkte er beim Schreiben immer so sehr hinter seinen Mitschülern her? Die anderen waren schon längst fertig mit ihrer Seite. Er streifte die Tinte sorgfältig ab und setzte den Federkiel zu einem unbeholfenen Schwung an. »QUI EST IN« stand schon da, jetzt fehlte noch »COECIS«. Die Buchstaben fügten sich wunderbar in den Text, schnurgerade, nicht zu groß, nicht zu klein. Gotthilf atmete auf. Pater Benedictus würde zufrieden sein.
Das Scharren der Sandalen des Paters, der die Aufsicht über den Schreibsaal führte, übertönte das Kratzen der Federn auf dem Pergament und das leise Glucksen, wenn ein Kiel in das Tintenfass tunkte. Mit freudiger Miene drehte Gotthilf sich zu Benedictus herum und beobachtete, wie er durch die Pultreihen schritt, mal rechts, mal links die Arbeit der Novizen begutachtete. Gotthilf legte seine Feder zur Seite und senkte den Kopf, um dem Pater ungehindert Blick auf sein Blatt zu gewähren. Wie erwartet blieb er hinter dem Novizen stehen und schaute über seine Schulter. Doch kein lobendes Brummen ertönte. Der Atem des Paters beschleunigte sich.
»Gotthilf«, flüsterte er, »wir gehen hinaus.«
Welcher Fehler war ihm denn nun schon wieder unterlaufen? Mit niedergeschlagenem Blick faltete der Novize die Hände und schritt leise zum Ausgang des Schreibsaals. Hinter sich hörte er, wie Benedictus das zu kopierende Buch zuschlug. Verstohlen drehte Gotthilf sich um. Der Pater nahm den Folianten auf. Die Pergamentseite, auf der Gotthilf geschrieben hatte, knisterte leise, als Benedictus sie zusammenrollte und Gotthilf folgte.
Es genügte dem Pater nicht, vor der Tür des Saals stehen zu bleiben, er führte Gotthilf weiter den Gang entlang, bis sie vor den Vorratsräumen ankamen. Er öffnete eine Tür und schob den Novizen hinein. Ein Schwall von Sauerkrautduft schlug ihnen entgegen. Auf einem Tisch, der noch Reste von kleingeschnittenem Kohl aufwies, öffnete er das Buch und rückte es ins Licht, das aus einem Fenster hereinfiel.
»Lies«, forderte er Gotthilf auf und deutete auf eine Zeile.
Es handelte sich um das Gebet, das er kopieren sollte.
»Pater noster, qui es in coecis, sacri…«
Batsch! Eine Ohrfeige traf ihn. Tränen schossen in seine Augen. Unwillkürlich fuhr Gotthilfs Hand zur schmerzenden Wange. »Vater …«, stammelte er. Benedictus hatte ihn noch nie geschlagen.
»Was hast du falsch gemacht?«, sprach der Pater mit einer Strenge, die Gotthilf so von ihm nicht kannte.
Er blinzelte die Tränen fort und beugte sich wieder über den Text. »Pater noster, qui es in coecis …«
Batsch! Noch eine Ohrfeige.
»Coelis! Du dummer Junge! Coelis! L, kein C.«
Gotthilf kämpfte mit einem Schluchzen, Schluckauf schüttelte ihn. »Verzeihung, Pater, es ist undeutlich geschrieben …«
»Undeutlich! Gotthilf! Gott hilf dir! Dein Vater gab dir den rechten Namen, und wenn du nach dem Noviziat in den Orden eintrittst, werde ich mich dafür einsetzen, dass dein Name nicht geändert wird, denn du brauchst viel, sehr viel Hilfe von Gott! Dieses Gebet musst du auswendig können, aus dem Herzen sprechen, es muss dir in Fleisch und Blut übergehen, verstehst du? Der liebe Herr Jesus sagte es am Tag, bevor er sein Martyrium antrat, damit der himmlische Vater uns unsere Sünden verzeiht und wir nicht allesamt in der Hölle schmoren müssen.«
»Ja, Vater«, schluchzte Gotthilf.
»Weißt du eigentlich, was du da geschrieben hast?«
Benedictus hielt ihm das Pergament unter die Nase. »Coecis«, entzifferte Gotthilf.
»Und was ist das?«
Schniefend zog Gotthilf die Schultern hoch und schüttelte den Kopf. Er hatte es zwar irgendwo aufgeschnappt, aber er wusste die Bedeutung nicht.
»Coelis ist der Himmel. Das hübsche Blaue über uns, in dem der Allmächtige wohnt und worin er den Gläubigen nach ihrem Tod eine Wohnstatt bereitet. Schon mal davon gehört?« Natürlich. Benedictus sollte nicht so tun, als ob Gotthilf ihm niemals lauschte. Trotz regte sich in ihm, doch er biss die Zähne zusammen. »Und du hast Coecis geschrieben. Das ist eine unpassende Deklination des Coecums. Ein Teil des Darms, du …«
Das Schimpfwort, das an diese Stelle gehörte, verschluckte Benedictus, doch Gotthilf wusste auch so, welche Sünde er begangen hatte. »Gotteslästerung«, flüsterte er entsetzt. »Vater, vergib mir, das habe ich nicht gewollt.«
Benedictus seufzte. »Dessen bin ich gewiss. Du schaust nicht genau. Und zudem kommen noch die üblichen Fehler, dass du manchmal mit dem Buchstaben beginnst, der zur zweiten Silbe gehört, warum auch immer. Doch du sollst aus diesem hier lernen, dass es schwerwiegende Folgen haben kann, auch nur einen Buchstaben zu vertauschen. Nun gut, versuchen wir es noch einmal. Lies das Gebet!«
Gotthilf hielt die Luft an, um das sinnlose Aufstoßen zu beenden, trotzdem schüttelte sich sein Leib schmerzhaft. »Pater noster, qui es in coelis«, las er und schaute hoch. Benedictus nickte. Gotthilf atmete auf und folgte dem Fingerzeig des Paters, weiter vorzulesen. »Sacrificetur nomen tuum …«
Batsch, batsch! Zwei Ohrfeigen trafen das Gesicht des Jungen. Aus Schreck ließ er beinahe das Buch fallen und heulte vor Schmerz.
»Nein, nein, und wiedermals nein!«, schrie Benedictus. »Sanctificetur! Sancti, nicht sacri! Warum schaust du nicht, bevor du etwas plapperst! Wir opfern nicht den Namen des Herrn, wir heiligen ihn! Ist denn der Teufel in dich gefahren?«
»Verzeihung«, schluchzte Gotthilf.
Benedictus fuchtelte mit seinen Armen herum und wanderte in der engen Kammer auf und ab wie ein gefangener Wolf im Käfig. »Nein, so geht das nicht. So kann ich dich nicht gebrauchen. Was stelle ich nur mit dir an? Die anderen, die niemals auch nur ein Wort Latein gehört haben, kopieren den Text ohne solche Schwierigkeiten. Doch bis deine Kenntnisse der alten Sprache so weit gediehen sind, dass du deine Fehler erkennst, vergehen Jahre.« Er grübelte. »Dann musst du eben lernen, einen Text zu kopieren, ohne die Bedeutung zu kennen. Komm mit.«
Er stürmte so schnell aus dem Raum, dass Gotthilf kaum folgen konnte und sogar das wertvolle Buch und das Pergament neben dem Sauerkraut liegen lassen musste. Benedictus steuerte einen Nebenraum der Bibliothek an, den der Novize noch nie gesehen hatte. Folianten, Kladden und Zettelsammlungen verstopften Regale, überschwemmten Pulte und stapelten sich auf Tischen und Fensterbänken. Aufgewirbelter, nach Moder riechender Staub flirrte im einfallenden Licht und reizte die Nase zum Niesen. Gotthilf staunte. »Wo sind wir hier?«
»Eine Gerümpelkammer, genauso wie wir sie für Säcke und Kisten haben, in denen Obst und Gemüse gelagert wird. Wir werfen nichts weg, denn selbst die schlechteren Sachen dienen vielleicht noch den Armen. Diese Bücher und Pergamente bringen dem Kloster keinen Nutzen mehr, aber sie können verschenkt oder ein weiteres Mal gebraucht werden, indem jemand die Tinte abschabt. Und manchmal …«, er blätterte durch einen Stapel vergilbter, zerrissener Pergamente und zog schließlich eines hervor, »findet sich etwas, das einem Lümmel wie dir hilft.«
Gotthilf nahm das Geschriebene entgegen und überflog den Text. »Da verstehe ich nicht ein einziges Wort! Was bedeutet Idisi? Welche Sprache mag das sein?«
»Kommt es darauf an? Du sollst kopieren, nicht verstehen. Los, mach dich an die Arbeit. Und gib dir dieses Mal Mühe, genauso wie ich mir Mühe geben werde, deine Lästerungen aus dem Buch zu löschen.«
Einen Augenblick verharrte Gotthilf verwirrt, dann verneigte er sich. »Danke, Vater Benedict. Ich verspreche Besserung.«
Zurück im Schreibsaal kopierte Gotthilf den unbekannten Text fünfmal, doch wenn er die Buchstaben verglich, fand er wieder und wieder Fehler. Es musste an dem schon mehrfach beschriebenen Pergament liegen, dessen nur teilweise ausgelöschte Schrift ihn ablenkte. Das war es, ganz sicher.
Kurz vor dem Nachtgebet schlich er zu der vollgestopften Kammer und stöberte zwischen den Papieren, fand aber nichts Passendes. Schließlich griff er nach einem Buch vom Fensterbrett. Es lag unter einem Stapel zerrissener Einbände und sah so verstaubt aus, als ob seit Jahren niemand mehr hineingesehen hätte. Kein Wunder, es handelte sich um ein Sakramentar. Diese wurden nach und nach aussortiert und durch solche Voll-Missale ersetzt, wie Gotthilf gerade eines schrieb, damit kein Priester mehr mit drei Büchern auf dem Altar hantieren musste. Niemand würde nach der alten Schwarte suchen. Gut.
Willkürlich schlug er den Band auf. Die Seiten schimmerten neu und die Worte eines Taufgebets lagen jungfräulich auf weißem Untergrund. Noch hatte niemand die Buchstaben abgeschabt. Persönlicher Besitz war verboten, doch dieses Buch würde Gotthilf heimlich behalten und darin üben, wenn niemand zusah.
Unter dem Überwurf trug er es in seine Kammer, klappte den Deckel des Tintenfasses hoch, steckte die Feder hinein und öffnete den Einband. Gleich die erste Seite, das Buchbinderblatt, lag völlig unberührt vor ihm. Zufriedenheit durchströmte ihn. Noch nie zuvor hatte er auf frischem Pergament geschrieben. Jetzt würde es gelingen. Sorgfältig malte er die Buchstaben: »Eiris sazun idisi …«
Kapitel 1 - Die wilde Jagd
Dezember 745 AD, Tempelwald südöstlich von Hoohseoburg
Schwester Bredelin presste ihre Hand auf den Mund, um das Lachen zu unterdrücken. Dampfwölkchen quollen zwischen ihren Fingern hervor wie Rauch aus dem Maul eines Drachen. Brune musste hart an sich halten, um nicht ebenso albern wie ihre Freundin zu kichern. Die Jungen sahen aber auch zu lustig aus, wie sie durch die Blaubeersträucher stolperten! Nein, kein Grund zum Spott. Es handelte sich um ein Ritual zu Ehren der Götter und bedeutete für jeden einzelnen der Knaben ein einschneidendes Erlebnis. Kinder hatten den Tempel betreten; morgen früh wachten sie an der Seite der Idisen als Männer auf.
Energisch stieß Brune dem Mädchen den Ellenbogen in die Seite. Vor Überraschung quiekte sie, und der Kopf eines dunkelhaarigen Jungen fuhr herum. Bredelin riss erschreckt die Augen auf, fasste an die Krone, ob sie noch richtig saß, und lief davon. Hinter dem Gebüsch musste es für den Jungen aussehen, als ob eine Hirschkuh, eine Hindin, flüchtete, da er nur die Spitzen der Geweihkrone sah. Aus den Augenwinkeln verfolgte Brune den Weg der Jungfrau. Gut, sie lief genau in die richtige Richtung, entfernte sich vom Friedhof. Der Junge folgte ihr.
Schade, diesen Schwarzhaarigen hatte Brune für sich selbst auserkoren, doch auch die sechs anderen besaßen ihre Reize, und wenn es nur ihre Jugend und Unschuld war. Brune bückte sich zu ihren Schuhen und zog an den Bändern, damit sie nicht darüber ins Stolpern geriet. Auch die Fibel saß fest im weichen Leder des Mantels, das sich um ihren Hals schmiegte. Sie nahm einen tiefen Zug von dem Duft der Kräuter, nach dem ihre Kleidung roch, weil sie im gleichen Raum aufbewahrt wurde.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung hoben sich Geweihspitzen hinter den Zweigen eines Schwarzdorns, die diesmal von zwei Jungen bemerkt wurden. Ob das Schwester Almagunda war? Gleich hob sich ein weiteres Geweih, das nur die beiden Verfolger erkennen konnten, woraufhin sie sich trennten, jeder Junge einem der Mädchen hinterher.
In der Zeit, die Brune zum Beobachten benötigte, verschwanden noch zwei weitere Jungen aus der Gruppe, jagten ihrer Hindin, dem Geschenk ihrer Göttin, hinterher. Ein Braunhaariger und ein Blonder standen noch zwischen den Sträuchern und blickten sich verwundert um. Der Trank ließ sie taumeln und verwirrte die Sicht, gaukelte ihnen allerlei vor, weshalb das Mädchen auf der anderen Seite hüpfte, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und schließlich einen Zweig zerbrach, bis schließlich der Braunhaarige sie bemerkte und die Jagd begann.
Brune hatte der Hehren Mutter Losli widerwillig versprochen, als älteste Schwester auf die anderen Novizinnen aufzupassen und erst zum Schluss zu gehen, obwohl ihr der Ton der Priesterin nicht gefiel. Sie war die älteste Novizin bei der diesjährigen Jagd, das stimmte schon, doch bei Weitem nicht die älteste Jungfrau im Tempel. Außerdem glaubte Losli als Einzige, dass Brune ewig hier ausharren müsse. Die ersten Jahre hatte sie einer Heirat entgegengefiebert, alle anderen Schwestern beneidet, denen ein Gemahl ausgewählt wurde, mit dem sie irgendwo als Herrin ein Haus oder eine Burg bezogen, doch mittlerweile wusste sie die Freiheiten im Tempel zu schätzen. Was allerdings nicht bedeutete, dass sie lieber dableiben wollte.
Ein Griff überzeugte sie vom richtigen Sitz ihres Kopfschmucks, dann erhob auch sie sich. Die trunkenen Augen des Blonden richteten sich auf sie, er trat unsicher einige Schritte auf sie zu. Eigentlich sah er, abgesehen vom grobschlächtigen Gesicht, gar nicht so übel aus; sie musste ihre Freundinnen nicht beneiden. Seine nackte Brust zeigte keine Behaarung, doch die Muskeln bewiesen fleißiges Üben mit Schwert und Speer. Auf den Wangen wuchs noch kein Flaum, der die kindlich gerundeten Kieferknochen verbarg. Trotz des Rausches zeugten seine Bewegungen von Stärke und Ausdauer. Brune fühlte Erregung durch ihren Körper fließen. Sie freute sich darauf, wie seine sehnigen Hände über ihren Körper gleiten würden.
Kurz bevor er sie erreichte, wich sie zur Seite aus und eilte auf den Weg zur Grotte. Dort hatte sie alles für sich vorbereitet, das Privileg der Ältesten, während die anderen Mädchen sich Hütten aus Schilf geflochten hatten. Der schwankende Gang verriet ihr, dass der Junge sicher keine langen Umwege brauchte. Trotzdem wandte sie sich dem Teich zu und umrundete ihn. Er sollte seine überschüssige Kraft verbrauchen, aber noch genügend davon für sie aufsparen.
»Hab ich dich!«, schrie er und sprang mit gewaltigem Schwung auf sie zu. Überrascht von seiner Schnelligkeit wich Brune aus und raffte ihren Rehledermantel um sich, während sie zu einem Holundergebüsch rannte. Also reichte der kleine Abstecher noch nicht! Im Zickzack hetzte sie durch das Unterholz und wagte nun nicht mehr, sich nach ihm umzudrehen. Seine schweren Tritte bewiesen, wo er sich befand, auch ohne dass sie ihn sah. Immer lauter keuchte er, besaß aber noch genügend Atem, nach ihr zu rufen: »Bleib stehen, Hindin, ich krieg dich doch!«
Nun wurde auch Brune die Luft knapp. Der eisige Wind tat in der Kehle weh, die Anstrengung stach in der Seite. Doch noch immer hörte sie ihn dicht hinter sich. Den ganzen Tag waren die Jungen dem Jäger hinterher durch den Wald gefolgt - woher nahm ihr Blonder die Ausdauer? Wie ein Hase schlug sie einen Haken. Sie wagte einen Blick nach hinten und beobachtete befriedigt, dass er die scharfe Kurve nicht schaffte und in den Graben stolperte, den sie vom Pilzesuchen kannte. Wütend brüllte er auf. Wasser platschte und verriet, dass er mehrere Male ausrutschte. Brune nutzte die Zeit, die er zum Herausklettern brauchte, um ihr warmes Wollkleid abzustreifen, ohne die Fibel zu öffnen, die den Mantel zusammenhielt. Sofort, als sie das Kleid von sich warf, biss der Frost ihren Leib wie ein Raubtier. Einen Augenblick überlegte sie, ob der Junge nicht auch fror, nur mit einer Bruche bekleidet, jetzt nass, doch sie erinnerte sich: Die Erregung hielt ihn warm. Er keuchte so laut, dass Brune es aus der Entfernung hörte. Also durfte er erschöpft genug sein. Nun schlug Brune den direkten Weg zur Grotte ein. Nach kurzer Zeit sah sie durch das Eibendickicht das Lagerfeuer flackern und wurde langsamer.
»Ha!«, brüllte er, und um Haaresbreite hätte er sie erwischt.
Seine Finger berührten schon den Umhang, doch Brune konnte ihn in letzter Sekunde an sich raffen. Nur noch wenige Schritte um die Nadelsträucher herum, dann stand sie im Licht des Feuers auf weichem Sandboden, geschützt vor dem kalten Wind.
»Die Hindin!«, rief er, stürzte in die Grotte und blieb abrupt stehen. »Aber …« Er stammelte. »Du bist keine Hirschkuh.«
Ein Ausbund der Klugheit also! Nun, das mussten Männer nicht sein, denn an der Klugheit der Kinder hatten sie keinen Anteil. Hauptsache, sie taten, was man von ihnen verlangte. Brune nahm das Geweih ab, fasste die Säume des Leders und breitete die Arme aus, wodurch sich der Umhang öffnete und ihren nackten Leib entblößte. Ein Windstoß ließ das Feuer aufstieben, trug warme Luft zu ihr, umschmeichelte ihren Körper, und sie spürte, wie sich Hitze in ihrem Schoß sammelte, ihre Haut kribbelte. Sein Blick heftete sich auf ihre Brüste, kroch herunter zu ihrem Schoß, und sie fühlte ihn wie feine Nadelstiche über ihren Körper wandern. Mit offenem Mund starrte er sie an.
»Nein, keine Hindin. Ich bin eine Idise. Die Göttin schickt mich zu dir«, erklärte Brune, wobei sie sich bemühte, nicht in Lachen auszubrechen, weil er so entgeistert gaffte. Sie erfüllte ihre Pflicht als Tochter Hollas, und sie brauchte keinen Trank, der sie diese Wahrheit glauben ließ. »Komm näher«, lockte sie ihn, »damit Holla dir ihre Gnade zuteilwerden lässt!«
Langsam trat sie rückwärts, auf die weichen Bärenpelze zu, wobei sie die Fibel löste und den Umhang fallen ließ.
»Oh, meine Göttin!« Er stöhnte und folgte mit kleinen Schritten. Der Lendenschurz verdeckte nicht, was sich ihr entgegenreckte, nach Belohnung für die durchjagte Nacht lechzte. Sie streckte die Arme aus und nahm seine Hände, um ihn zum Lager zu führen. Willenlos folgte er, ließ sich neben ihr nieder. Tief sog sie seinen Duft nach Mann ein, seine Erregung, den Raubtiergeruch nach Anstrengung und Mühe. Seinem Atem entströmte das Aroma von Met und wilden Kräutern. Als sie seine Lippen mit den ihren berührte, umfing er sie und riss sie an sich, presste seinen Mund auf sie, warf sie herum, bis er auf ihr lag und sein Gemächt pulsierend gegen sie presste. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie das Blut in ihren Ohren rauschen hörte. Grob liebkoste er ihre Lippen, seine Hände legten sich auf ihre Brüste, und Schauer fuhren durch ihren Körper, seine Muskeln verkrampften sich.
»Nein, nicht so«, stieß sie hervor, als sein Mund ihren Hals heruntertastete und ihr Luft zum Atmen gab. Sie schob ihn von sich, bis er mit dem Rücken auf den Pelzen lag. Zitternd beobachtete er, wie sie die Bänder seines nassen Schurzes löste und dem Freiheit gab, was darunter nach ihr verlangte. Er stöhnte auf, als sie seine Männlichkeit berührte. Seine Finger griffen nach ihren Brüsten und sandten Wellen der Erregung durch ihren Körper, die Lust sammelte sich in ihrem Schoß, die Göttin bereitete sie für den Mann vor.
Doch da war es schon geschehen. Ein Schwall Feuchtigkeit ergoss sich auf die feinen Bärenhaare, hinterließ schimmernde Perlen. Ein Fluch entfloh ihren Lippen.
»Oh Holla, oh Wotan, ihr Götter, steht mir bei!«, stieß der Junge zwischen hektischen Atemzügen hervor.
»Du bist unnütz!«, schrie sie wutentbrannt. Wie sie sich auf diese Begegnung gefreut hatte, und jetzt verdarb dieser Stümper es mit seinem Ungeschick. »Die Göttin wird dich verfluchen!«
Entsetzt riss er den Mund auf. »Du … du bist keine Göttin«, stammelte er.
Ein Stich des Gewissens brachte Brune wieder zur Besinnung. Sie atmete tief durch und schickte ein Stoßgebet zu Holla.
»Natürlich nicht«, sagte sie mit erzwungener Ruhe und legte ein Lächeln auf ihre Lippen. »Ich bin eine Idise und diene der Göttin. Beruhige dich, es wird alles gut«, tröstete sie ihn, streichelte seine haarlose Brust und ließ ihre Lippen über seine Haut gleiten. Für den Moment war ihr die Lust vergangen, aber sie musste dies jetzt zu Ende bringen. Behutsam setzte sie sich auf ihn, rieb ihre empfindlichsten Teile an ihm, bis das Prickeln wieder anfing. Sie bewegte sich auf ihm, streichelte ihn, legte seine Hände auf ihre Brüste, bis auch er begann, sie zu liebkosen. Ein Stoßgebet zur Göttin ließ ihre Erregung zurückkehren. Nicht lange dauerte es, und die Kriegsgötter erneuerten seine Kraft, richteten seine Würde wieder auf. Brune fieberte der Vereinigung entgegen, genoss seine streichelnden Hände, nahm seine Jugend in sich auf und gab sich völlig dem Liebesspiel hin. Die Göttin beschenkte sie beide, doch erst die nächsten Wochen würden zeigen, ob ihr Segen diese Nacht überdauerte.
Dezember 745 AD, Kloster Fritzlar
Arnulf senkte den Kopf und konzentrierte sich auf die Schmerzen in den Knien, auf denen er schon seit über einer Stunde wartete. Er sollte büßen. Der harte Steinboden in der winzigen Kammer bedeutete gar nichts gegen das Kreuz, an dem der Herr gelitten hatte, und wenn Arnulf seine Sünden offenbaren wollte, dann machte das Stechen in den Gelenken nur den Anfang.
»Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum …«, begann er zum wiederholten Mal das Gebet, das der Priester ihm befohlen hatte, während der Wartezeit hintereinander aufzusagen, um sich auf die Beichte vorzubereiten. Es wirkte. Mittlerweile musste er nicht mehr über die lateinischen Worte nachdenken, er sprach sie auswendig, auch wenn er den Sinn noch immer nicht begriffen hatte. Doch Pater Willegis erklärte regelmäßig in seinen Predigten die Gebete, und so würde er auch dieses eine demnächst so wiederholen, dass auch Arnulf es verstand. Nein, es ging nicht um die Worte, denn an seinem Lateinunterricht gab es nichts auszusetzen, doch die Sache mit der Vergebung … Es fiel Arnulf so schwer, über Unrecht hinwegzusehen, seine Augen zu schließen, wenn eine Sünde begangen wurde.
Das Schloss quietschte in seinem Rücken, doch Arnulf verbat sich, den Kopf zu drehen und hinzuschauen. Ein Hauch Weihrauch wehte in seine Nase und reizte zum Niesen. Der Krieger in ihm fragte mit klopfendem Herzen, ob es ein Überfall der Sachsen oder Wikinger war, doch der Christ wusste, dass in Gottes Obhut niemand gegen Seinen Rat handelte. Energisch verdrängte er die Bilder der zerstörten Taufkirche in Hammaburg und der verstümmelten Leichen der Missionare, die ihre Augen wie eine Anklage gen Himmel richteten. Gottes Ratschluss.
Das Schlurfen der Sandalen verriet Pater Willegis, und Arnulfs Herzschlag beruhigte sich. Ohne Stocken beendete er das Gebet. Niemandem vertraute er so wie seinem Ziehvater, und in allem wollte er so werden wie er: ein Streiter für den Glauben.
»Amen«, stimmte Willegis ein. Auch er kniete nieder, und gemeinsam sprachen sie ein erneutes Mal die vertrauten Worte.
Der alte Priester richtete sich mühsam auf und setzte sich auf die Holzbank, während Arnulf seine demütige Haltung beibehielt und die Schmerzen ihn aufforderten, einfach wegzurennen. Nach gebührendem Schweigen begann er: »Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt.«
Willegis seufzte und Scham stieg in Arnulf hoch, weil er seinen Mentor enttäuschte. Dennoch, es musste sein. Auf keinen Fall durfte er mit einer belasteten Seele in den Kampf ziehen. Wenn er Willegis auf seinen weiten Reisen begleitete, konnte hinter jedem Busch ein Wegelagerer lauern, ein Wikingerboot nordische Krieger ausspeien oder eine Horde Sachsen herangaloppieren. Also musste er ständig gerüstet sein, stets auf einen Kampf vorbereitet. Mit einer reinen Seele. »Beim Anblick von Weibern überkommen mich sündige Gedanken.«
Erneut klagte Willegis leise. »Arnulf von Aquis, das Weib ist die Ursache der Erbsünde, und alles an ihm ist sündig. Allein sie zu schauen, verdirbt den vorzüglichsten Mann. Dein Alter ist schwierig, weil dein Fleisch noch dem Willen des Herrn widerstrebt, ein keusches Leben zu führen. Was bittest du den Herrn, dir zu vergeben?«
Die verhängnisvollen Bilder entstanden sofort wieder vor Arnulfs Augen, und selbst hier, im Angesicht des Priesters, durchgefroren auf dem harten Stein des Kapellenbodens, die Beine so verkrampft, dass er sie kaum noch spürte – abgesehen von den Schmerzpfeilen, die seine Knie aussandten –, selbst in diesem Augenblick durchbrodelten ihn Wellen der Lust. Tränen der Enttäuschung über sein Unvermögen liefen ihm die Wangen herunter.
»Vorgestern, bei den Waffenübungen mit Etzold, geriet ich ins Schwitzen und leerte meinen Wasserschlauch. Ich beabsichtigte, ihn am Fluss zu füllen, doch als ich mich der Niederung näherte, hörte ich von Weitem schon helle Stimmen und Lachen. Also band ich mein Pferd an einem Gebüsch fest und ging den weiteren Weg zu Fuß, wobei ich überflüssige Geräusche vermied, denn zusätzlich zu dem fröhlichen Volk mochten sich heidnische Krieger verstecken …«
»Du schweifst ab, mein Sohn«, ermahnte Willegis ihn gelangweilt.
»Verzeih, Vater.«
»Nicht mich musst du um Verzeihung bitten, es ist der Herr, dem du die Zeit mit überflüssigen Worten stiehlst. Schildere, was du gesehen hast und deine Gefühle dazu.«
»Jawohl, Vater.« Arnulf fuhr mit der Zunge über seine spröden Lippen und räusperte sich. »Ich sah eine Schar Mädchen am Fluss, die Wäsche wuschen und sich dabei balgten. Einige hatten …« Arnulfs Gesicht brannte vor Scham, weil bei der Erinnerung seine Männlichkeit sich begehrlich erhob. »Einige hatten ihre Kleider am Ufer von sich geworfen und standen enthüllt im Wasser. Durch ihre Bewegungen spritzten die Wellen hoch und umspielten bloße Schenkel, die Gischt benetzte ihre … Oberkörper … Sie tanzten und sprangen herum, wobei ihre weichen Teile … hüpften …« Er hielt inne, weil sein Mund so trocken wurde, dass die Zunge sich nicht mehr vom Gaumen löste. Er schluckte krampfhaft. »Doch auch diejenigen, die noch ihre Blusen trugen, boten einen … Anblick … Das Wasser hatte den Stoff durchnässt, bis er am Busen klebte, wobei die Kälte die Haut zusammmenzog und die Brustwarzen … Herr, ich bekenne, dass bei diesem Anblick der Teufel in mich fuhr und mich dazu aufforderte, eine von diesen Satanstöchtern zu packen, ihr die durchsichtigen Fetzen vom Leibe zu reißen und mein Gemächt in sie zu stoßen, bis die Sünde aus ihrem schreienden Maul herausschoss! Vater, Ekel schüttelte mich, und Schmerzen durchtobten meinen Schoß, sodass ich stockstarr dastand und nur mit offenem Maul gaffte.«
Willegis atmete schwer und verknotete seine Finger in Gebetshaltung. Es musste den alten Mann schmerzhaft treffen, wie sehr sein Schüler dem Bösen verfallen war. »Aber … du ließest sie gehen?«
Die Stimme des Priesters krächzte, als ob er kurz vor dem Weinen stand. Wie tief hatte Arnulf ihn enttäuscht? »Vater, sie bemerkten mich nicht einmal. Ich brach in die Knie und flehte den Herrn an durch das Gebet, das du mich gelehrt hast. Mit geschlossenen Augen hörte ich noch immer ihr Gekicher, doch die Rede an den Herrn half mir dabei, mich aufzurichten und fortzugehen.«
Willegis knetete seine Finger, und seine Stimme klang streng. »Arnulf, mein Sohn, dein Vater, der Freiherr von Aquis, war ein Mann von schätzenswertem Edelmut.« Jetzt kam es, jetzt kam bestimmt das vernichtende Urteil! »Ich erinnere mich genau an den Tag vor noch nicht achtzehn Jahren, als deine Mutter im Kindbett verstarb und dich hilflosen Säugling zurückließ, dein Vater ein weinendes Bündel voll Schuld. Alle Kraft war von ihm gewichen, als wir sie begraben mussten. Deinem Bruder hast du es zu verdanken, der als vierzehnjähriger Knappe vom Hof des Königs herbeieilte, dass du zu den guten Schwestern in Bischofsheim in Obhut gegeben wurdest. Dein Vater benahm sich so teilnahmslos, er hätte dich am Grab deiner Mutter liegengelassen, dem Verschmachten preisgegeben.« Wie oft hatte Arnulf diese Begebenheit schon gehört? »Da die Nonnen keine Knaben aufnahmen und dich nur aus Barmherzigkeit retteten, beknieten sie mich, dich fortzunehmen, sowie du feste Nahrung essen konntest. Jedoch ich suchte vergeblich einen Edlen, der sich deines Blutes würdig erwies, dich aufziehen wollte wie sein Eigen, dich lehren konnte, ein Leben für Gott zu führen. Als Beichtvater der Nonnen und auch Männer vom Schlage deines Vaters reiste ich durch die Lande und zeigte dich einem jeden Würdenträger, den ich traf, doch nirgends fand ich so gute Bildung für dich wie bei mir. Darum bliebst du an meiner Seite.«
Das stimmte, denn Arnulf hatte mehr Latein gelernt als an den besten Schulen, die Bedeckung des Paters brachte ihm besser das Kämpfen bei als der Königshof den Knappen, und das Leben auf der Wanderschaft stellte ihn vor Aufgaben, die andere Knaben niemals bewältigt hätten. Arnulf nickte versonnen, hörte nur mit einem Ohr der alten Geschichte zu, doch auf einmal durchfuhr es ihn wie ein Blitzstrahl: Wollte der alte Priester ihn fortjagen? War diese Beichte das letzte Zeichen von Verkommenheit, das er brauchte, sich endgültig von seinem Ziehsohn loszusagen? Arnulf spürte deutlichen Widerstand beim Einatmen, als ob er erstickte.
»Vater«, brachte er heraus, »es war immer mein Bedürfnis, an deiner Seite zu stehen. Damals, um mich am Busen deiner Gelehrigkeit zu nähren, jetzt, um jeden Schaden von dir und deiner Mission fernzuhalten. Du hast mich gelehrt zu kämpfen, mit meinem Körper und meiner Seele, und für dich kämpfe ich gegen jede Gefahr, so wie ich dereinst für die Pilger im Heiligen Land streiten werde.«
»Brav, mein Sohn«, antwortete Willegis. »Eine treffliche Aufgabe für einen Zweitgeborenen. Diese Gesinnung erwarte ich von dir. Doch beobachtete ich in letzter Zeit an dir einen allzu großen Willen zu Händeln und Raufereien. Sowie sich die Gelegenheit bietet, gebrauchst du deine Fäuste.«
»Vater, nur zum höheren Lobe des Herrn und …«
»Arnulf«, unterbrach der Priester ihn, »du schweigst, wenn ich spreche.«
Beschämt senkte Arnulf den Kopf. Er wusste genau, was der Alte meinte. Am gestrigen Abend bei der Rast in einer Schenke hatte einer der niederen Waffenknechte aus dem Zug eine Schankmagd auf seinen Schoß gezogen, sie an den Brüsten festgehalten und sie bedrängt. »Bist du denn auch eine gute Christin? Oder brauchst du meine Hilfe, damit ich den Teufel aus dir herausvögele?«
Statt empört zu fliehen, hatte sie ihn angegurrt wie eine Taube. »Für dich bin ich gerne eine böse Heidin, damit du das Seelenheil in mich hineinspritzen darfst. Solange du nur genügend Kupfer für mich dalässt …«
Aufgebracht hatte Arnulf ihr eine Ohrfeige verpasst, dass sie dem Knecht vom Schoß geflogen war, und anschließend den Knecht mit den Fäusten bearbeitet, bis andere vom Zug Arnulf von ihm gerissen hatten. Fünf waren dazu nötig gewesen. Es tat ihm noch immer nicht leid, dass die Hure einen Zahn verloren hatte und der Knecht mit seinen zugeschwollenen Augen den weiteren Weg nicht mitmachen konnte. Sie hatten es beide verdient. Nur hätte Arnulf nicht in diese Wut geraten dürfen.
Nach angemessener Bedenkzeit fragte Willegis: »Was hast du dir dabei gedacht, als du gestern den Raufhandel begannst?«
Arnulf schwieg. Die Söldner hatten seinem Ziehvater in allen Einzelheiten berichtet, wie es zu dem Streit gekommen war, wer wen zuerst geschlagen, welche Schäden alles insgesamt verursacht hatte und wie hoch die Forderung des Wirtes lag. Willegis zahlte die Kosten aus dem, was der Besitz Arnulfs abwarf, weshalb nichts ungesühnt blieb.
»Nun?« Womöglich klang die Stimme des Alten noch strenger.
»Vater, ich …« Wie sollte er nur erklären, was in ihm vor sich ging, wenn die Söldner herumhurten? »Mir erschien es, als ob die Dirne einen der unseren zur Sünde verführte. Darum züchtigte ich sie. Und der Söldner verdiente die Strafe dafür, dass er so willig darauf einging.«
»Arnulf, es ist dein Recht als Edler, einen Untergebenen zu züchtigen, weshalb die Bewaffneten des Zugs dir gehorchen müssen. Die Söldner sind keine Streiter Gottes, und solange sie ihre Verfehlungen beichten, wird der Herr ihnen vergeben. Doch dem Weib darfst du keinen Vorwurf machen. Die Eva ist dem Teufel verfallen, lebt in Sünde und zieht einen guten Mann mit sich ins Elend. Nur die edelsten aller Weiber widerstehen, wenn es auch oft große Mühe erfordert.« Er seufzte. »Frage nur die gute Äbtissin in Bischofsheim, welche Fährnisse sie eingeht, die guten Schwestern auf dem rechten Weg zu behalten. Doch eine Wirtshaushure …« Er machte ein Gesicht, als ob er sich übergeben müsse. »… verdient nicht deine Anteilnahme. Sieh sie wie ein Stück Fleisch, das den Hunger der Söldner stillt. Auch bei solchem machst du dir keine Gedanken, ob das Schwein ein dem Herrn wohlgefälliges Leben führte.«
Willegis stützte die Hände auf die Knie und beugte sich zu seinem Schützling. »All die Jahre hoffte ich, in dir den Sanftmut deiner Mutter zu finden, nicht den hochfahrenden Ehrgeiz deines Vaters, der ihn mit dem Tode deiner Mutter ins Verderben führte. Mir kam sogar der Gedanke, dass er nach dieser tragischen Begebenheit den eigenen Tod begrüßte, als er ihn im Feld ereilte.« Diese Behauptung entsetzte Arnulf, doch er wagte nicht, den Alten zu unterbrechen, weil sein Blick sich in der Unendlichkeit verlor. »Er war ein Krieger sondergleichen, ein wahrer Streiter für den Herrn, wie er nur selten zu finden ist, nicht zu vergleichen mit den Bezahlten, die uns begleiten. Solche wie ihn brauchen wir, um unsere Mission vor den Heiden zu schützen, doch muss man sie im Zaum halten. Was ich mir am wenigsten wünsche, ist eine Kirche voll erschlagener Friesen und Sachsen, weil ein Heißsporn seinen Zorn nicht bezähmen kann.«
Die andere Wange hinhalten. Keines der Gebote des Herrn fiel Arnulf so schwer wie dieses. Ein jedes Mal, wenn einer dieser Heiden dem Herrn lästerte, stieg ihm das Blut zu Kopfe, es rauschte in den Ohren und vernebelte seine Sicht. Wie von selbst ballten sich die Fäuste und schossen vor, um den Heiden zu strafen. Dabei unterschied er nicht zwischen den Neckereien der Halbwüchsigen und dem beißenden Spott der Unbelehrbaren. Willegis hatte recht, Arnulf musste sich besser beherrschen.
»Ich gelobe, mich bei jeder Streitigkeit zurückzuhalten und nicht mehr als Erster meine Faust oder mein Schwert zu heben.«
»Ein guter Vorsatz, mein Sohn.« Willegis wiegte bedenkend den Kopf. »Um dir dabei zu helfen, werde ich für dich die Versuchung verringern. Deine Buße soll es sein, für ein halbes Jahr in keinem Gasthaus mehr Wein, Bier oder Met zu trinken.« Damit konnte Arnulf leben. Er war dieserlei Getränken sowieso nicht übermäßig zugetan. »Weiterhin wirst du dich von jedem Kampf fernhalten, sofern dir nichts anderes befohlen wird.« Das war schon schwerer zu bewerkstelligen, denn die Kameraden würden ihn Feigling schimpfen, wenn er sich bei ihren Streitereien zurückzog. Allerdings wenn es ihm befohlen wurde … Arnulf nickte demütig.
»Doch damit nicht genug.« Genau diese Worte fürchtete Arnulf. Sein Herz begann zu rasen und der Schweiß brach ihm aus. Machte Willegis jetzt endlich seine Worte wahr, ihn wie einen tollen Hund davonzujagen, wenn er nicht fähig war, in der Gnade des Herrn zu wandeln?
»Mein Junge, ich habe an dir mein Möglichstes getan, dich zu einem guten Christenmenschen zu erziehen, wenn es mir auch so schwer gefallen ist wie sonst nichts in meinem Leben. Dein Jähzorn ärgert mich, doch will ich ihn deinem jugendlichen Alter zuschreiben und hoffen, dass die Zeit dir helfen wird, dich zu beherrschen. Deine Gelehrigkeit steht höher als die eines jeden Edlen, den ich je besuchte. Du führst dein Schwert besser als jeder Söldner, der mich je begleitete. Auch bemühst du dich nach Kräften, das Wohlwollen des Herrn zu erlangen. Da nehme ich als Beispiel den Sold, den der Bischof in Worms dir wie jedem anderen meines Gefolges zahlt, den du an die Armen verschenkst. In all diesen Belangen konnte ich mich deiner Bildung zuträglich erweisen, doch von einem verstehe ich nichts: davon, als ein Edler über die Hörigen zu bestimmen.«
Die Rede des Geistlichen verwirrte Arnulf mehr, als sie erklärte. Natürlich konnte Willegis ihm nicht beibringen, wie ein Besitz zu verwalten war, denn er strebte, wie Jesus Christus, die Besitzlosigkeit an. Doch diese Notwendigkeit bestand gar nicht! Arnulfs älterer Bruder als Erbe des Vaters regierte seine Besitzungen, doch die bescheidenen Ländereien, die aus der Familie von Arnulfs Mutter, der zweiten Frau seines Vaters, stammten, durften Arnulf nicht davon abhalten, sein Leben dem Dienst an den Gläubigen zu widmen.
»Vater, ich strebe nicht nach weltlichen Gütern.«
»Dem mag zwar so sein, doch das ändert nichts daran, dass du nicht nur Gott, sondern auch dem König verpflichtet bist. Er fordert deine Unterstützung ein, sei es als Zehnten, sei es als Hände für die Arbeit. Du musst dafür sorgen, dass auf deinem Besitz Brot und Soldaten wachsen. Auch das muss gelernt sein, und bei mir kannst du das nicht lernen.«
»Aber Vater! Meine Ländereien werden von einem Vogt verwaltet, den du eingesetzt hast, und ich werde später einmal ins Heilige Land ziehen und die Pilger beschützen. Dafür brauche ich kein Land, und der Vogt wird Sorge tragen, dass der König sein Recht bekommt.«
Willegis schnaubte. »Schluss damit. Widersprich mir nicht. Der königliche Gesandte Garlef von Niederwald wird morgen Abend hier im Kloster ankommen. Er hat sich bereit erklärt, diesen Teil deiner Erziehung zu übernehmen. So Gott will, lernst du bei ihm auch die Königstreue und Gelassenheit, die einen Gesandten ausmachen. Du wirst dich für ein Jahr seinem Gefolge anschließen.«
Arnulf verlor den Halt und musste sich mit einer Hand auf dem Boden abstützen. Entsetzt starrte er Willegis an. »Aber … Herr … ich …«
Der alte Mann erhob sich und legte Arnulf eine Hand auf den Scheitel. »Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Erfülle deine Buße, und deine Sünden seien dir vergeben. Garlef wird sich deiner annehmen und dich auf seine Reise nach Hoohseoburg mitnehmen. Er redet dort mit dem sächsischen König Theoderich und wird einen guten Mann zusätzlich zu seiner Bedeckung nicht abschlagen. Befolge jeden seiner Befehle, was es auch sei.«
Willegis wandte sich zur Tür, ohne auf Arnulfs Gestammel einzugehen. Als er die Hand auf die Klinke legte, drehte er sich herum. »Und übe das Paternoster jetzt noch weitere hundert Mal.«
Januar 746 AD, Tempel der Holla, südöstlich von Hoohseoburg
Nur allmählich ließ das Zittern nach, und die Bürste entglitt nicht mehr so schnell Ellekes Fingern. Sie biss sich auf die Lippen, um das Stöhnen zu unterdrücken. Mit beiden Händen schrubbte sie die Dielen, bis die ranzig riechende Seife sich auflöste und schäumte. Jedes Vorstrecken der Arme drückte den eisernen Halsring gegen ihren Nacken, und jedes Mal verfingen sich ein paar Haare im rauen Metall und ziepten. Die heftigen Bewegungen beim Scheuern rissen ihr die aufgeweichte Haut der Knie auf, doch dieser Schmerz bedeutete kaum etwas gegen die Striemen auf ihrem Rücken, die bei jeder Bewegung der Schultern brannten, als ob sie gleich aufspringen würden. Diese Gefahr bestand allerdings nicht, darauf hatte Mutter Losli geachtet. Der Knecht Notger musste immer mit genau der Wucht zugeschlagen, dass Elleke noch tagelang leiden würde, aber nicht so scharf, dass ihr Fleisch aufplatzte. Das hätte eine Behandlung durch die Kräuterfrau nötig gemacht, und die hätte Elleke womöglich von der Arbeit befreit. Ganz zu schweigen davon, dass Narben eine Wertminderung für eine Sklavin bedeuteten. Nein, Elleke sollte sich quälen, ihre Aufsässigkeit bedauern, daraus lernen, dass sie nie wieder der Priesterin widersprach.
Losli hatte gewonnen. Elleke würde ihr nie mehr ins Gesicht sagen, dass sie eine Heidin war, dass Gott sie strafen würde und dass sie kein Recht habe, eine Christin als Besitz zu bezeichnen. Sie war mit der Gewissheit aufgewachsen, dass der Herr schützend seine Hände über sie breitete und verhinderte, dass ihr ein Leid geschah, wenn sie nur immer seine Gebote befolgte. Während die Schläge auf ihren Rücken prasselten, hatte Elleke die Hoffnung aufgegeben, dass der Allmächtige sie rettete.
Jetzt entwich ihr doch ein Schmerzenslaut, als sie sich auf ihren blutigen Knien aufrichtete und die Bürste in den Eimer tauchte. Mühsam kroch sie rückwärts und setzte ihre Arbeit fort, wobei sie die Schlieren ihres eigenen Blutes beseitigte.
»Bevor du schlafen gehst, tauche dein Hemd in Wasser. Das kühlt schön. Morgen geht es dir besser«, flüsterte Bogdana ihr zu und fuhr gutgelaunt mit dem Trockentuch über den Fußboden, wo Elleke fertig war.
Ob Bogdana das beurteilen konnte, bezweifelte Elleke. Kaum eine der Sklavinnen war so sanftmütig und ergeben wie Bogdana aus Mähren. Sie erfüllte den Priesterinnen jeden Wunsch, selbst wenn sie ihn noch nicht geäußert hatten. Am liebsten hätte Elleke vor Verachtung ausgespuckt, doch das hätte sie auch wegwischen müssen. Zu ihren Racheschwüren den Priesterinnen gegenüber fügte sie in Gedanken hinzu, dass sie auch jeden, der klaglos ihren Befehlen folgte, mit der Rute bestrafen würde. In Gedanken malte sie sich aus, wie der Knecht den Stock schwang, diesmal auf ihr Geheiß, und Bogdana die feiste Kehrseite versohlte. Im Hintergrund knieten die »Hehren Mütter« und jammerten, an Händen und Füßen gefesselt, die Stricke miteinander verknotet, damit sie nicht wegkriechen konnten. Diese sollten das volle Maß von Ellekes Rache spüren, mit Angst in den Augen auf ihre Auspeitschung, bei der Elleke keine Gnade gewähren würde. Das Fleisch sollte Notger ihnen von den Rippen schälen, ihnen und ihren hochnäsigen Schülerinnen, und anschließend sollte er …
»Willst du ein Loch hineinscheuern?«
Glockenhell klang die Stimme der Priesterschülerin Bredelin über Elleke, aber sie wagte nicht, hochzublicken. Sie traute sich nicht einmal, mit dem Scheuern innezuhalten, denn Losli hatte ihr befohlen, nicht vor Sonnenuntergang aufzuhören. Also fuhr sie nur ein wenig langsamer und sanfter über den Holzboden. Sie hasste Bredelin, wie sie alle Heiden hasste. Diese Tempelhure sollte ihr nichts befehlen dürfen, ganz einmal davon abgesehen, dass sie nicht viel älter war als Elleke.
»Die Hehre Mutter Losli schickt mich. Ich soll dir sagen, dass du dich morgen nach der Arbeit für das Thing feinmachen sollst.«
»Feinmachen?« Jetzt schaute Elleke doch hoch, bewegte aber weiterhin die Bürste über den Boden.
»Du weißt schon. Bade, kämme deine Haare, binde dir Bänder an die Ärmel … so was. Losli sagt, du sollst deine neue Bluse tragen.«
»Aber … für die Küchenarbeit ist sie zu gut.«
»Du sollst ja auch nicht in die Küche, sondern die Männer bedienen. Flechte dir Perlen in die Zöpfe, damit siehst du bestimmt hübsch aus.«
»Ich bin nicht hübsch«, trotzte Elleke und spürte, wie Tränen ihre Wangen herunterrannen.
»Was für ein Unsinn!«, rief Bredelin fröhlich. Sie hockte sich neben Elleke, fasste ihr Kinn und hob es an. »Wunderhübsch bist du. Lächle, und der Sommerhimmel strahlt aus deinen Augen. Du wirst dir aussuchen können, wessen Bett du wärmst.«
Wie ein Blitzschlag überfiel Elleke die Erinnerung. Die Männer, die sie aus dem Schlaf zerrten, die Truhen durchwühlten, alles Wertvolle in Säcke stopften und mit sich nahmen, den Rest auf einen Haufen warfen und verbrannten. Himmelhohe Lohen stiegen aus dem Dach ihres Elternhauses. Sie sah es nur aus den Augenwinkeln, weil sie am Hals mit einem Strick an die anderen Frauen gebunden war – ihre Schwestern und Basen, die Töchter der Nachbarn, Mägde, alle Jungfrauen. Wie eine Herde Vieh wurden sie an den Strand getrieben, wo die Wikingerboote warteten, vorbei an den Leichen der Männer – Väter, Brüder, Knechte –, die der Angriff im Nachtkleid überrascht hatte. Die Bestien hatten sich auf den Booten nicht einmal die Mühe gemacht, Elleke von ihren Mitgefangenen zu lösen, während sie eine nach der anderen auf der Seefahrt entjungferten. Zu Elleke waren sie besonders oft gekommen, weil sie so hübsch war.
»Nein«, wiederholte sie. »Ich bin nicht hübsch.«
»Ach Quatsch!«, tadelte Bredelin sie. »Die Bedienungen haben es gut beim Thing. Niemand darf sie schlagen oder verletzen, oft gibt es ein Trinkgeld, manchmal sogar ein kleines Schmuckstück, wenn du mit jemandem für die Nacht mitgehst. Stell dir vor, du wirst Geld bekommen!«
Geld? Kaum drang das Wort in Ellekes Gehirn, doch dann stutzte sie. Eine der alten Mägde hatte davon geträumt, sich mit erspartem Geld die Freiheit zu erkaufen. Die Priesterinnen hatten in Haithabu für die Sklaven, auch für Elleke, einen gewissen Preis gezahlt, und wenn sie diesen zurückerstatten konnte, würden sie Elleke freilassen. Doch bisher ergab sich keine Gelegenheit, an Geld zu kommen. Eröffnete sich mit Bredelins Angebot eine Aussicht für Elleke? Nein! Wenn es bedeutete, dafür die Qualen erneut zu erdulden, wollte sie auf immer Dielen schrubben.
»Ich will nicht«, murmelte sie und schüttelte energisch den Kopf.
Enttäuscht erhob Bredelin sich. »Genau das sagte Losli vorher. Dass du dich allem und jedem widersetzen wirst, dass die Schläge vom Morgen nicht genug waren, dich zu brechen. Du bist ein aufsässiges Stück Fleisch, dem man Vernunft einprügeln muss. Losli verlangt Gefügigkeit von dir, dass du ihren Befehlen gehorchst. Darum wird heute Nacht Notger zu dir kommen. Er wird dir zeigen, wie du dich den Gästen gegenüber zu benehmen hast, und Losli hat ihm erlaubt, auch grob zu werden, wenn du dich sträubst.«
Notger? Warum ausgerechnet dieser Knecht? Nicht nur, dass Notger mit seinem krummen Arm sie abstieß, er hielt sich auch noch für etwas Besseres, weil er ein freier Mann war. Sklaven verachtete er und behandelte sie wie Vieh. Obwohl die Priesterinnen es nicht guthießen, geboten sie ihm keinen Einhalt. Da er den Mägden mit Respekt entgegentreten musste, hielt er sich mit seiner Herrschsucht an die Sklavinnen. Er war auch grob zu ihnen, wenn Losli es nicht erlaubte – wie würde er jetzt erst mit Elleke umgehen? Ein Schluchzen löste sich aus ihrer Kehle, und sie krümmte sich zusammen.
»Pah«, rief Bredelin. »Jetzt stell dich nicht so an! Was ist dabei, auch ihn noch in dein Bett zu lassen? Du sollst etwas lernen! Losli hat dich nur gekauft, weil der Wikinger sagte, du seist freudig und anschmiegsam im Bett und dass du gar nicht genug davon bekämst. Glaube mir, ich weiß es, Notgers Schwanz ist auch nicht kleiner als der eines Wikingers. Und wenn er es dir nicht ordentlich besorgt, such dir unter den Gästen einen Besseren aus!«
Beleidigt drehte sie sich um und stolzierte davon.
Ein Weinkrampf schüttelte Ellekes Schultern, und ihre Kehle tat dabei mehr weh als die Striemen auf ihrem Rücken. Womit hatte sie den Herrgott beleidigt, dass er sie so strafte?
Dicht vor ihrem Kopf fuhr Bogdanas Tuch auf dem Boden herum. »Arbeite weiter«, raunte sie Elleke zu. »Notger soll darauf achten, dass du bis zum Abend keine Pause machst.«
Verstohlen blickte Elleke auf, und tatsächlich entdeckte sie unter dem Tisch im Nebenraum Notgers mit Mist aus dem Stall beschmutzte Beinlinge. Seit einer Woche trug er sie, ohne daran zu denken, sie zu wechseln. Und er würde sie auch nicht ausziehen, wenn er heute Nacht zu ihr kam. Elleke biss die Zähne zusammen und quetschte die Borsten so fest auf den Boden, bis Holz auf Holz schabte. Dabei stellte sie sich vor, es sei Notgers Rücken, den sie mit Eisenborsten malträtierte.
Januar 746 AD, Tempel der Holla, südöstlich von Hoohseoburg
Brune drückte den Arm des Brotmännleins in Form, bevor die Magd es in den Ofen schob. Hunderte dieser kleinen Gebilde hatten sie schon fertig gebacken, und es wartete noch eine Menge Teig darauf, knusprig am übernächsten Tag die hungrigen Mäuler zu stopfen. Seit den Mannbarkeitsfeiern waren sechs Wochen vergangen, in denen die Vorbereitungen auf das Thing immer mehr den Tagesablauf bestimmten. Gestern hatten die Knechte geschlachtet, und zusätzlich zu dem Duft des Kuchens aus den Backöfen erfüllte Bratendunst das Langhaus, der von den Spießen auf dem Hof hereinzog. In großen Töpfen blubberte Grütze, in Schüsseln weichte getrocknetes Obst. Jede Hand wurde gebraucht, denn die Stammesfürsten brachten nicht nur ihre Familien und Freunde mit, sondern auch jeden Diener, der nicht unbedingt auf den Höfen nötig war. An den Besprechungen nahmen nur die gewählten Fürsten teil, doch auch alle anderen wollten versorgt werden.
Obwohl König Theoderich aus Hoohseoburg Lebensmittel geschickt hatte, mussten die Priesterinnen das meiste aus den eigenen Beständen beisteuern. Brune konnte sich noch genau erinnern, wie sehr sie als Sechsjährige über die schier unendlichen Vorräte gestaunt hatte, die hier für den Winter eingelagert waren, wo es doch gar nicht so viele Frauen im Tempel gab. Doch dann begingen sie das alljährliche Thing – und die Speisekammern leerten sich wie von Zauberhand. Das ging so weit, dass sie sich geängstigt hatte, ob sie alle nicht bis zum Frühjahr hungern müssten. Mutter Losli hatte sie zurechtgewiesen: Niemand würde eine Dienerin Hollas darben lassen.
Genauso wie sie damals, staunten auch heute neugierige Kinderaugen über die Unmenge an Nahrung, die von kundigen Händen bereitet wurde. Allerdings waren dieses Jahr nur drei Novizinnen gekommen, weniger als jemals zuvor. Losli tat es mit einer abfälligen Handbewegung ab. Die Scharmützel mit den Franken machten den Sachsen das Leben schwer, und sie behielten ihre Töchter lieber bei sich, statt sie auf die gefährliche Reise zum Tempel zu schicken. Nächstes Jahr würde sich das wieder ändern.
»Nicht naschen!«, rief Brune und schlug sanft auf die vorwitzigen Finger eines Mädchens, die halb im Teig steckten. Brune zupfte ein Stück ab und zeigte den Kleinen, wie ein Männlein geformt wurde. Mit Feuereifer nahmen sie Teigklumpen entgegen und stürzten sich in die Arbeit.
»Brune, Losli verlangt nach dir«, rief Almagund über den Arbeitstisch hinweg. Ihre Augen blickten tadelnd, doch sie sagte nicht vor den Mägden, was sie darüber dachte, dass Brune sich vor der Stallarbeit drückte. So benahm sich eine Freundin. »Lass mich auf die Kleinen aufpassen. Oh, wie niedlich!«, lobte sie ein buckliges Männlein. »Das hast du gut gemacht. Nimm jetzt Nüsse und drücke sie als Augen hinein.«
Schlechtes Gewissen stach in Brunes Herz. Sie wusch Teigreste von ihren Händen und trocknete sie sorgfältig ab, bevor sie die Schürze wechselte und sich eilig auf den Weg in den Tempel machte. Losli steckte schon seit Tagen im Schreibzimmer und listete alles auf, was die Frauen im Tempel noch vorzubereiten hatten. Missgelaunt hob sie nicht einmal den Blick, als Brune eintrat.
»Du solltest in den Ställen helfen«, empfing sie ihre Schülerin.
Brune senkte schuldbewusst den Kopf. »Hehre Mutter, die Knechte misteten gerade aus, und die Dämpfe bereiten mir immer Kopfschmerzen …«