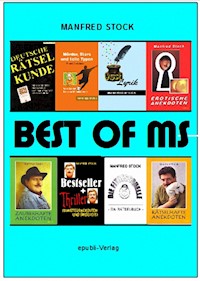Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein abenteuerlicher Fluchtversuch aus der DDR, eine ungewöhnliche Liebesgeschichte hinter den Mauern eines Stasigefängnisses und zahlreiche humoristische Anekdoten aus dem Leben des Protagonisten sind die Hauptzutaten für diesen Roman. Der amüsante und witzige Erzählstil des Autors lässt den Leser am Leben des Ossis Horst Kramp in den Jahren 1987 bis 1992 teilhaben. Dabei ist die tonale Ähnlichkeit des Namens Horst Kramp zu Forrest Gump gewollt. Der Protagonist ist ähnlich naiv und ebenso liebenswert wie dieser. Ein Buch für alle, die die Welt der DDR gekannt haben oder mehr darüber wissen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Onkel Fritz, der meine Fragen beantwortete, als meine Mutter es nicht mehr konnte.
Für Christiane, der ich die Endfassung meines Weltbildes verdanke.
Inhaltsverzeichnis
Es ist an der Zeit
Horst Kramp, der Halbrusse
Urlaubspläne I
Urlaubspläne II
Annette Gruber
Kontakt mit dem Feind
Von Angesicht zu Angesicht mit IM „Agathe“
„Schimpfen Sie niemals auf das System!“
Anekdote aus dem Leben eines scheußlichen Kerls
Klopfzeichen mit Julia
Hähnchen machen auch nicht satter als Broiler
„Wonderful Life“?
1. Es ist an der Zeit
„Hallo Heinz.“
Es ist wirklich ein äußerst unangenehmes Gefühl, sich mit einem warmen Hintern auf eine kalte Klobrille zu setzen. Es ist an der Zeit, dass jemand die beheizbare Klobrille erfindet. In derlei lästigen Momenten grüße ich immer meinen imaginären Freund Heinz. Ich tue das auch, wenn ich Schmerzen habe, niesen muss oder über allen Maßen erstaunt bin. Dann grüße ich Heinz. Und ich habe keine Ahnung, wer das wohl sein mag. Während ich mein Geschäft in meiner gemütlichen Zweizimmerwohnung im Hamburger Stadtteil Winterhude verrichte, regnet es mal wieder. Die Einheimischen nennen es „Hamburger Schmuddelwetter“. Ich bin kein Einheimischer. Ich bin vor genau vier Jahren aus dem Osten gekommen.
Am ersten März 1988 rollte der Zug in Hamburg ein. Auch damals regnete es. In diesen vier Jahren ist nicht viel passiert, außer dass ich in einer Fabrik der Autozulieferbranche gearbeitet habe. Gestern wurde ich entlassen. Heute sitze ich auf meinem Lokus und bin abgesehen von der kalten Klobrille recht entspannt. Mit einer Abfindung von zehntausend DM lässt es sich am Tag nach einer Entlassung relativ entspannt scheißen. Wortfetzen einer ostdeutschen Bierwerbung dringen aus dem Radio an mein Ohr. „Es ist an der Zeit…“ Sage ich doch. Es ist an der Zeit, dass jemand die beheizbare Klobrille erfindet. Während ich mir die Hände wasche, denke ich darüber nach, wofür es eigentlich wirklich Zeit ist in meinem Leben. Ich komme zu der Erkenntnis, dass es mal wieder an der Zeit ist, eine meiner Untugenden zu bekämpfen. Meine ausgeprägte Abneigung gegen die Obrigkeit und überhaupt gegen Menschen in Uniformen, Roben oder imaginären Halskrausen muss einer gründlichen Hinterfragung unterzogen werden. Ich hatte in den letzten vier Jahren keine Zeit für solche Dinge. Ich musste täglich zwei Tausend Kolben im Akkord drehen. Für die Autozulieferbranche. Ich war für die Nuten und die Mulde der Kolben verantwortlich. Auf ein Tausendstel Millimeter genau. Vier Jahre lang. Der gestrige Tag war eine Erlösung. Ich hatte mich schon gefragt, wann der Personalchef mich wohl zu sich rufen würde. Die Belegschaft sollte aus Gründen der Rationalisierung von sechshundert auf dreihundert Mitarbeiter reduziert werden. Die Leute gingen und gingen und kein Personalchef rief mich zu sich. Warum war ich auch immer pünktlich? Warum hatte ich nie krankgefeiert wie meine Kollegen? Warum war meine Ausschussrate so gering? Mein Gott, die wollen mich behalten! Ich muss diesen stupiden Job noch etliche Jahre weitermachen. Furchtbar. Eine Kündigung kam nicht in Frage. Das schickte sich nicht. Außerdem musste ich eine Wohnung bezahlen. Ich wollte nicht unter der Brücke landen. Ich wollte meine Arbeitskraft anbieten und Geld verdienen. Freilich, wenn sie mir kündigen würden, wäre es etwas anderes. Dagegen kann man nichts machen. Dann würden sie mich abfinden. Ein Nettomonatsgehalt für jedes Jahr. Zehn Tausend Mark. Damit ließe sich der nächste Tag entspannt angehen. Zweihundertfünfzig Leute sind schon entlassen worden. Und Horst Kramp war noch immer nicht dabei. Gestern dann endlich die Erlösung: Der Personalchef rief mich zu sich. Puh, Glück gehabt. Er setzte mir die prekäre Lage der Firma auseinander und bedauerte, einen so guten Mitarbeiter wie mich zu verlieren. Bla, bla, bla. Er bot mir zehntausend Mark Abfindung, wenn ich den Auflösungsvertrag sofort unterschreiben würde. Ich tat es augenblicklich. Er hatte leichtes Spiel mit mir. Viele Kollegen drohten mit dem Betriebsrat und verhandelten über eine höhere Abfindung. Manche hatten Glück. Meine Sache war das nicht. Ich kam aus dem Osten. Da lernte man so etwas nicht. Ich sagte Ja und Amen und unterschrieb den Auflösungsvertrag. Später ärgerte ich mich. Vielleicht hätte er auch zwölftausend bezahlt? Aber ich konnte nicht mit einem Personalchef feilschen. Er hatte einen schicken Anzug an. Einen mit Nadelstreifen. Einem Mann in so einer Position durfte man doch als einfacher Arbeiter nicht selbstbewusst gegenübertreten. Oder?
Ich trockne mir die Hände ab und besehe dabei mein Gesicht im Spiegel. Ich setze eine ernste Miene auf und sage: „Ich will zwölftausend plus ein volles Urlaubsgeld. Dann sind Sie mich los.“ Danach lache ich, zeige mir einen Vogel und erwidere: „Lächerlich. Vergiss es!“ Ich bin frustriert und hole mir das letzte Bier aus dem Kühlschrank. Es ist die Sorte, die gerade in der Radiowerbung angepriesen wurde. „Es ist an der Zeit…“ Stimmt, sage ich mir. Diese Unterwürfigkeit vor Personen, die in meinen Augen höhergestellt sind als ich, muss aufhören. Schluss mit dieser Angst. Was soll das auch? Ich lebe jetzt in einer Demokratie. Da kann jeder sagen, was er denkt. Ich muss es schaffen, immer zu sagen, was ich denke. Insbesondere gegen Leute der Obrigkeit. Das wird sehr unangenehm. Ich hege einen nicht unerheblichen Groll gegen solche Figuren. Auch wenn ich im Unrecht bin, weil ich aus Parkplatzmangel mal wieder im selbigen Verbot stehe, entwickele ich gegen die sich unnatürlich schnell herbeieilende Politesse einen ebenso unnatürlichen Hass. Was kann die arme Frau dafür? Natürlich nichts. Und doch bin ich stets dazu geneigt, sie zu fragen: „Wie fühlt man sich so, wenn man dreiunddreißig Prozent seiner Lebenszeit darauf verwendet, auf Fehler seiner Mitmenschen zu lauern, um diese sofort und ohne Gnade zu dokumentieren und zu bestrafen?“ Ich unterlasse es jedoch immer. Ich habe zu viel Angst, dass ich dann womöglich verhaftet werde. Ich sage auch äußerst ungern bei Gericht als Zeuge aus. Ich hasse Gerichte. Ich gehöre zu den Menschen, die bei einem Unfall schnell weglaufen, damit mich ja niemand anspricht, ob ich etwas gesehen hätte. Freilich, wenn Blut fließt, ist das etwas anderes. Dann vergewissere ich mich vorher noch, ob nicht aus irgendeiner Ecke ein Mensch herbeigeeilt kommt und die Worte „Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt“ von sich gibt. Meistens ist dies der Fall. Ich hatte in dieser Beziehung bisher großes Glück. Ich bin dem Schicksal sehr dankbar dafür, dass ich auch noch nie Zeuge eines Verbrechens geworden bin. Kein tödlicher Schrei aus der Wohnung meines Nachbarn. Keine Vergewaltigung im nahen Stadtpark, während ich dort gerade spazieren gehe. Kein Banküberfall. Kein Tankstellenraub. Nichts dergleichen kreuzte bisher meinen Weg. Danke lieber Gott, denn ich hasse Kripobeamte. Auch wenn ich etwas gesehen hätte, ich würde bei ihrer Befragung alles vergessen haben. Komplett. Ich würde mich schuldig fühlen. Mich verdächtig machen, was das Ganze noch verschlimmern würde. Ich bin in dieser Beziehung einfach ein gebranntes Kind. Ich versuche mir oft einzureden, dass es ganz normal ist, wenn man in seinem Leben einmal mit der Stasi zu tun hatte. Und doch ist es mein Wille, wenn auch nicht mein letzter, in dieser Beziehung eine Normalität einkehren zu lassen. Ich möchte ein gesunder und wachsamer Bürger sein, der die staatlichen Organe darin unterstützt, Kriminalität und Vergehen lapidarer Art in den Griff zu bekommen. Ich möchte angepasst sein. Ich habe das so gelernt. Immerhin vierundzwanzig Jahre lang. Es waren die ersten vierundzwanzig Jahre meines Lebens und ich lebte sie in der „Deutschen Kratschen Plik“, wie Erich Honecker immer zu sagen pflegte. Leider hatte ich mit der Stasi zu tun. Das klingt erst einmal harmlos. Mein Gott, Stasi. Na und? Ha. Ihr Unwissende. Ihr fragt euch, wie die Menschen in der DDR es sich vierzig Jahre lang gefallen gelassen haben, derart unterdrückt zu werden. Und ich sehe, dass ihr nichts wisst.
Ich habe noch immer einen Hass gegen die Obrigkeit. Die Wahrheit ist natürlich, dass ich mich hasse für meine Angst gegen die Obrigkeit. Ich muss etwas dagegen tun! Ich lebe doch nun in einem demokratischen Land. Da muss doch keiner mehr Angst haben. Oder? Mein Verstand verneint diese Frage vehement. Und doch, es ist dies eine Baustelle, bei der ich ganz ohne Bauplan auskommen muss. Eine Baustelle, die als Ergebnis ein Kartenhaus oder eine Freiheitsstatue hervorbringen kann. Für den Moment bekämpfe ich das heraufziehende Unbehagen darüber mit einem kräftigen Schluck dieses Gerstensaftes, der schon immer besonders war. Freilich ohne allzu freundschaftliche Gefühle aufkommen zu lassen, hat sich doch auch schon Johnny Walker als falscher Freund erwiesen. Doch wie beginnt man den Kampf gegen die eigenen Unzulänglichkeiten? Das radikale Löschen des bestehenden Lebens durch Flucht zieht mitunter einen Blick in die Mündung einer Kalaschnikow nach sich, wie damals, im Sommer 1987 an der ungarisch-österreichischen Grenze. Nein, diese Reset-Taste möchte ich tunlichst vermeiden. Ich kann ja nicht schon wieder flüchten. Und wohin auch? Flucht ist keine Lösung. Das wahre und moderne Leben verlangt Alternieren. Plus, Minus. Plus, Minus. Doch was bedeutet das? Zurück zu den Wurzeln? Genau! Mein nächster Kampf, für den ich mir den schwergewichtigen Gegner „Vergangenheitsbewältigung“ ausgesucht habe, soll dort stattfinden, wo ich vor nahezu fünf Jahren den Entschluss fasste, den Kampf gegen ein übermächtiges System aufzugeben. Ist das nicht genial? Ich bin stolz auf mich und leere die Bierflasche in einem Zug. Ich überlege krampfhaft, ob ich noch Alkohol im Hause habe. Die Tatsache, meinen längst fälligen Vorstoß an die Front des Lebens mit der positiven Kraft der Versöhnung beginnen zu wollen, geht erst einmal nicht ohne Alkohol. Ich erinnere mich an das Geburtstagsgeschenk meiner Nachbarin Frau Lindner vom letzten Jahr. Eine Flasche Wodka. Weil ich doch aus dem Osten bin. Da trank man doch immer Wodka, nicht wahr? Ich antwortete ihr damals, dass ich nicht ganz so weit aus dem Osten komme. Ich finde die Flasche in der Abstellkammer. Das lässt mein Gehirn ein paar Endorphine freisetzen. Ich lächele und werte es einerseits als Geschenk und Zustimmung von oben und andererseits als Bestätigung dafür, dass man nicht unbedingt durch die Gegend joggen muss, um dies zu erleben. Ich schenke mir einen ein. Ich muss heute nicht in die Fabrik. Erledigt der Fall. Ich kippe den Wodka hinter und denke an Frau Lindner. Sie grüßt immer freundlich, wenn ich ihr im Treppenhaus begegne. Frau Lindner ist wirklich nett. Sie hat die Wohnung direkt gegenüber der meinen. Nicht selten beobachte ich sie durch den Türspion, wenn sie ihre Wohnung verlässt. Dann sehe ich sie mit ihrem Einkaufskorb und hoch gestecktem Haar durchs Treppenhaus huschen. Sie ist so fleißig, die Gute.
Gegen Mittag brate ich mir ein Kotelett. Man fängt ja rasch an zu schludern, wenn man arbeitslos ist. Ich habe mir vorgenommen, stark zu bleiben. Ich decke sogar den Tisch und verzehre das Kotelett mit Salzkartoffeln und Beilage. So würde das Gericht auf den Speisekarten der Mitropa-Gaststätten stehen. Eine Beilage bestand meistens aus einer Tomatenscheibe und einem Salatblatt. Dazu trinke ich in Ermangelung des Bieres ein Glas Wodka. Später sitze ich auf dem Balkon und lese in der Zeitung von den Schlechtigkeiten der Welt. Frau Lindner hängt derweil im Hof die Wäsche auf. Sie trägt eine Schürze. Meine Mutter trug auch immer eine Schürze. Ich wundere mich, dass man das im Westen auch tut. Als mich Frau Lindner sieht, winke ich ihr unaufdringlich zu. Ich gehe dann wieder in meine Wohnung, weil sie mich sonst sicher ansprechen würde. Ich bin ihr gegenüber seltsam befangen. Sie wirkt so erwachsen, wenn sie mit ihrem Dutt durchs Treppenhaus schlurft. Sie mag Anfang vierzig sein.
Ihr Mann kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die zwei Töchter studieren auswärtig. Sie erzählt viel von ihnen, wenn sie mich von Zeit zu Zeit am Wochenende zum Mittagessen einlädt. Sie sind ihr ganzer Stolz. Ich glaube, sie mag mich. Dieses Gefühl erwidere ich natürlich.
Wer mich mag, den mag ich auch. Trotzdem ist sie natürlich viel zu alt für mich. Ich werde nächstes Jahr dreißig. Nein, also Frau Lindner, bei aller Liebe. Das geht nicht. Was genau nicht geht, überlege ich, während ich neues Bier kaufen gehe, denn der Wodka neigt sich am späten Nachmittag bereits dem Ende zu. Ich komme zu keinem Ergebnis. Vielleicht liegt es am Wodka. Frau Lindner ist eben meine Nachbarin. Schluss, aus, Ende. Außerdem habe ich gerade Simone Kellermann am Start. Über diese Dame wird später noch zu berichten sein.
Gegen Abend beschließe ich, das wenige Geschirr von Hand zu spülen. Bis zum Freitagskrimi ist noch etwas Zeit. Im Hintergrund läuft die Tagesschau, aber die Nachrichten kenne ich bereits aus dem Radio. Plötzlich klingelt es an der Wohnungstür. Es ist dieser piepsige Ton, der mir verrät, dass der Besuch schon oben an der Tür ist und nicht unten vor der Haustür. Um diese Zeit? Das gab es noch nie.
Ängstlich bemühe ich den Spion, das Abwaschtuch wie zum Gebet zwischen den Händen geknüllt. Frau Lindner steht da, ohne Schürze und mit offenem Haar.
Ich atme tief durch, begleite noch den Sekundenzeiger meiner Uhr auf seinem ewigen Ziel zur Zwölf und öffne exakt um 20 Uhr 14 die Tür.
Ich merke sofort, dass außergewöhnliche Gründe Frau Lindner zu dieser Störung veranlasst haben. Sie lächelt heute nicht. Die Furcht, der nächsten Minute meines Lebens nicht gewachsen zu sein, bemächtigt sich meiner. Und noch während ich mich ein ‚Guten Abend’ murmeln höre, taste ich mich gedanklich durch meine Biografie, vorbei am Gestern, vorbei an Bildern, die sich in meinem Kopf eingebrannt haben, vorbei an Sätzen, die mich noch heute zutiefst erschrecken: Wir müssen reden, kommen Sie bitte mit, Eltern haften für ihre Kinder, Ihr Antrag wurde abgelehnt ...
Auf der Suche nach einem Halt, der mich den Kampf mit der Ohnmacht gewinnen lässt, gelange ich nun an den Punkt der ersten Begegnung mit Frau Lindner. Es ist ein Augenblick in meinem Leben, für den ich einen warmen Platz in meiner Seele reserviert habe, denn es ist ein glücklicher Augenblick, getragen von den Säulen der Sympathie, der Achtung, des Interesses und der Warmherzigkeit. Es war keine Liebe auf den ersten Blick damals. Nein, Frau Lindner ist zu alt für mich. Außerdem drückt sich für mich in einer heiß und innig beginnenden Liebschaft die Gewissheit zweier Seelen aus, dass diese Beziehung keine Zukunft hat. Die panische Angst, dass jeder Tag der letzte sein könnte, lässt dann die Emotionen zu einem Erektionsball werden, der in seiner Gier die Langsamkeit überrollt. Nein, meine Zuneigung zu Frau Lindner war anderer Art. Es war eine Bewunderung darüber, wie sie ihr Leben meistert, das nicht einfach zu sein schien.
Ich richte mich im Türrahmen auf. Ich lächele jetzt. Fest umklammere ich den Haltegriff in der Untergrundbahn meiner Erinnerung, während diese quietschend auf die nächste Station zurast. Ich frage mich, ob ich dort aussteigen muss. Vor mir steht Frau Lindner. Ihre Worte vermischen sich mit der Ansage in der Metro meiner Gedankenwelt: „Nächster Halt: Entscheidung.“ Ich blicke verstohlen um mich und bemerke, wie die ersten Fahrgäste sich von ihren Sitzen erheben und sich an der Ausgangstür positionieren. Ich bewundere diese Menschen in diesem Augenblick. Als Frau Lindner mit ihrer Hand meine Schulter berührt, zucke ich zusammen. „Entscheidung.
Bitte aussteigen! Zurückbleiben bitte! Piep piep piep. Rums.“
“Und nun das Wetter für morgen, Donnerstag, den zweiten März.“
Ich trete einen Schritt zurück. Mit Schweißperlen auf der Stirn gebe ich meiner Wohnungstür einen leichten Schubs. Sie fällt ins Schloss. Ich taumele ins Wohnzimmer und setze mich wie in Zeitlupe auf die vorderste Kante meines Fernsehsessels. Die Schweißperlen haben sich auf ihrem Weg hinab ins Bodenlose in Tränen verwandelt. Es fallen zwei Schüsse in dem flimmernden Kasten und ich weiß nun: Der Bahnhof ist weggefahren. Der Zug ist stehengeblieben.
Es ist nachts um drei, als ich aufwache. Ich sitze noch immer bekleidet in meinem Fernsehsessel. Dunkel erinnere ich mich, dass Frau Lindner an meiner Wohnungstür klingelte. Ich fühle Peinlichkeit. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich war betrunken. Ja genau. Das ist eine gute Erklärung. Unter Alkoholeinfluss ist das Bewusstsein beeinträchtigt. Ich ziehe mich aus und lege mich ins Bett. Als ich aufwache, steht die Sonne schon hoch am Himmel. Es regnet nicht.
Was für eine Überraschung. Als ich später Frau Lindner im Treppenhaus begegne, entschuldige ich mich bei ihr. Ich sei betrunken gewesen. Ich habe den vierten Jahrestag meiner Ankunft in Hamburg gefeiert. Es täte mir leid. Sie hat Verständnis. Frau Lindner ist wirklich toll. Irgendwie mag ich sie.
Später telefoniere ich mit Andi. Er saß damals mit mir auf der Anklagebank. Ich muss ihn davon überzeugen, sich zum Zwecke der Doppelversöhnung mit mir in unsere damalige Bezirkshauptstadt zu begeben, weiß ich doch, dass mein Kampf auch der seine ist, wenngleich er bisher der Taktik des Verdrängens und des Vergessens den Vorzug gab. Ich werde ihn mit der besten Biersorte locken, die dieser Teil unseres geliebten Landes je hervorgebracht hat. Ich werde über die Notwendigkeit der Herzensbildung für ein angenehmes Himmeldasein nach dem Tod dozieren. Das wird ihn beeindrucken.
Nachhaltig zumindest das Bier. Und wenn am Beginn meines Kampfes auch noch der dunkelste Punkt meines neuen Schlachtfeldes, nämlich mein abgrundtiefer Hass gegenüber der Person des damaligen Staatsanwaltes, einer zumindest abgeschwächten Gefühlswallung zugeführt werden könnte, dann wäre schon viel gewonnen.
Die Anträge auf Einsicht in unsere Stasiunterlagen bei der Gauck-Behörde in Berlin hatten wir zeitgleich ausgefüllt. Als Ort der Einsichtnahme entschieden wir uns für die Außenstelle Magdeburg, unserer ehemaligen Bezirkshauptstadt. Diese liegt jetzt nur noch so viel Autominuten entfernt, wie wir damals Striche auf unserem Bierdeckel hatten. Beim Überqueren der Staatsgrenze, die zu einer wohltuend harmlosen Bundeslandgrenze mutierte, stellt sich bei mir jedoch wieder dieses seltsame Gefühl ein. Es ist ein Gefühl, das Schmetterlinge haben müssen, wenn sie in den Bäuchen der Menschen so allen Grünzeugs beraubt wurden und sich in der bedrückenden Enge des Magens neben zu verdauendem Allerlei zurechtfinden müssen. Rein landschaftlich sagt mir der Übergang vom farbenfrohen Klatschmohnfeld zum grauen Kartoffelacker, dass ich im Gestern meines Lebens angekommen bin. Eine Tatsache, die mich meinen Namen vor mich hinmurmeln lässt: „Horst Kramp. Ich heiße Horst Kramp, bin bald dreißig Jahre alt und frei. Frei, wie der gerade entlassene Bundesligatrainer.“ Solche Sätze stärken mein Selbstbewusstsein ungemein, verdrängen sie doch diese Lebensabschnitte, in denen ich durchaus nicht mehr wusste, wie ich hieß, geschweige denn, die Überzeugung hatte, frei zu sein.
Lebensabschnitte, in denen mir meine Identität nicht nur physisch dadurch geraubt wurde, dass man mir meinen Personalausweis wegnahm. Weiß der Himmel, wie meine Eltern auf Horst gekommen sind. Sie riefen mich immer „Lass das!“ oder „Tür zu!“.
Normalerweise hießen Jungs zu Beginn der sechziger Jahre in der DDR Michael, Andreas oder Torsten. Sollte es ein wenig ausgefallener sein, wäre auch Hilmar oder Heiner möglich gewesen. Horst ist ein Name aus den vierziger, maximal fünfziger Jahren. Walter, Werner und Paul sogar aus den Zwanzigern und früher. Mein Großvater hieß Paul.
Inzwischen ist der Name ja wieder modern. Horst wird niemals wieder modern werden. Es ist eher ein Schimpfwort. „Du Vollhorst!“
So werden heute Menschen genannt, die man nicht leiden kann. Ich heiße Horst. Horst Kramp. Das klingt ein bisschen wie Forrest Gump.
Zum Glück kannte diese debile Filmfigur zu Zeiten meiner Geburt noch niemand. Man hätte mich wohl in meiner gesamten Kindheit gehänselt. „Willst du eine Praline, Horst?“ „Nein, danke, man weiß ja nie, was man da bekommt.“ Man hat mich also nicht gehänselt, obwohl ich Segelohren hatte. Allerdings kann ich nicht leugnen, dass ich mit Forrest Gump seine Gutgläubigkeit und Naivität gemein habe.
Wohlwollend kann man auch sagen: Mich verbindet mit Forrest sein reines Herz. Vermutlich würde auch ich eine sterbenskranke Frau heiraten, die mich ihr ganzes Leben verschmäht hat. Aber wenn sie mir dann kurz vor dem Tod schöne Worte macht, kann ich einfach nicht anders. Ich muss das dann unbedingt gut finden und fühle mich dermaßen gebauchpinselt, dass mein Verstand aussetzt. Im Falle einer Jenny hätte ich es allerdings nicht allzu lang bereuen müssen. So ist es kein Wunder, dass mein damaliges Lebensgefühl beinhaltete, ein Namenloser im Namen des Volkes zu sein. Noch heute scheue ich mich mitunter, formlose Dokumente, wie E-Mails zum Beispiel, angesichts solcher Erlebnisse mit meinem vollen Namen zu unterschreiben. Es reicht dann gerade noch zu meinen Initialen. Ein Tick, der ein bisschen mit dieser Namenlosigkeit kokettiert und mein Ich auf eine leicht pathologische Art und Weise zurücknimmt, in der Hoffnung, eine Portion Verständnis in die Sternzeichen Löwe belastete Gefühlskasse gespült zu bekommen.
Wir haben die erste Etappe unseres geografischen Ziels erreicht, doch zum ideellen Ziel der Versöhnung ist es noch ein langer Weg.
2. Horst Kramp, der Halbrusse
Ich bin das Kind eines Busfahrers aus Sachsen-Anhalt und einer Revolverdreherin aus Königsberg. Beim Betrachten der politischen Weltkarte muss ich also konstatieren: Ich bin Halbrusse. Trotzdem musste ich nie Hunger leiden und hatte eine schöne Kindheit, vor allem weil mein Opa, ich nannte ihn liebevoll Oppeschnoppe, und meine Oma, Ommeschnomme, mich immer in den Urlaub mitgenommen haben. Einmal fasste ich in der Nacht vor der Reise in die Fassung einer Lampe ohne Glühbirne und bekam einen elektrischen Schlag. Das war nach dem Zahnwechsel das Härteste, was mir passierte. Ich dachte, diese Nacht überlebe ich nicht und wenn ich morgen früh aufwache, bin ich tot. Es kam aber anders. Ich lebte noch und konnte bei lebendigem Leibe die Reise mit Ommeschnomme und Oppeschnoppe auf dem Schiff Hoppetosse in die Südsee antreten.
Sorry, aber wenn sich ein Satz lustig anhört, muss ich ihn unbedingt aufschreiben. Eigentlich ging es mit dem Zug nach Thüringen, wo ich das erste Mal in meinem Leben ein Fußballspiel zwischen Einheit Ilmenau und Traktor Schwarzburg live erleben durfte. Außerdem lernte ich zu jener Zeit Zuckerstreuer kennen, die beim Umdrehen nur eine gewisse Dosis ihres Inhaltes preisgaben, was für mich eine wissenschaftliche Innovation ersten Ranges war.
Ich wuchs in der Kreisstadt Schönebeck an der Elbe auf. Sie war damals mit fünfzigtausend Einwohnern die größte im Bezirk Magdeburg und lag etwa fünfzehn Kilometer südlich von der Bezirkshauptstadt. Ich hatte keine besondere Beziehung zu dieser Stadt. Mit acht Jahren trat ich der Betriebssportgemeinschaft Motor Schönebeck bei, Sektion Fußball. Ich schoss gleich im ersten Spiel zwei Tore beim 3:1 Sieg gegen Traktor Eggersdorf. Die erste Männermannschaft schaffte es zeitweilig bis in die zweithöchste Spielklasse im DDR-Fußball. Der Name Motor Schönebeck rührte davon her, dass die Mitglieder des Klubs offiziell Angestellte des volkseigenen Betriebes Traktoren- und Dieselmotorenwerk waren.
Heute würde man sagen, dass diese Firma der Sponsor des Klubs war, vorausgesetzt es gäbe sie noch, was nicht der Fall ist.
So lebte ich mein Leben in Schönebeck gleichmütig dahin, besuchte die Polytechnische Oberschule „Käthe Kollwitz“ und anschließend die Erweiterte Oberschule „Otto Grotewohl“. Man konnte jeden Punkt des Ortes zu Fuß erreichen und die Sorgen hielten sich in Grenzen. Mit Ausnahme meines elften Lebensjahres, was aufgrund eines familiären und deshalb emotional sehr belastenden Ereignisses sehr schwierig war, worüber gleich noch zu sprechen sein wird, war ich in den ersten zwanzig Jahren meines Lebens eher glücklich als unglücklich und ich tat, was man von mir verlangte. Eine nicht unwesentliche Schwäche wäre vielleicht noch erwähnenswert. Es ist eine Schwäche, die im Grunde sehr peinlich ist. Und doch ist diese sehr mangelhaft ausgeprägte Fähigkeit kein Grund, in den Wald zu gehen, um sich mit einem Strick an einem der vielen Bäume aufzubaumeln. Es geht um das Binden von Schleifen und Knoten. Ich kann es einfach nicht. Ich beherrsche nur eine Schleife und selbst die sehr schlecht.
Das Dilemma meines Lebens begann im Kindergarten des Volkseigenen Betriebes Kraftfutter Mischwerk. Frau Schnuphase war eine sehr strenge Erzieherin. Wir hatten Angst vor ihr. Sie spielte ganz gut Blockflöte. Aber sie hatte immer etwas Speichel in den Mundwinkeln und ich fragte mich damals, woran das wohl läge und ob ich später auch diesen Ekel an mir entdecken würde.
Eines Tages fragte Frau Schnuphase alle Kinder, wer denn schon eine Schleife binden könne. Es meldeten sich einige, unter ihnen auch Gunnar Strauch, der mir dann zugeteilt wurde, es mir beizubringen.