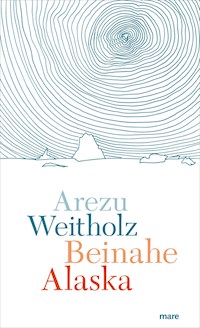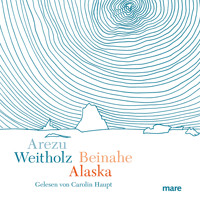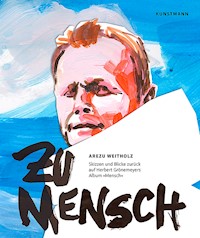Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines Tages bleibt Frieda beim Synchronsprechen im Studio die Stimme weg, die Worte haften nicht mehr. Jonas, ihr Freund, vermittelt ihr die Möglichkeit, an der portugiesischen Algarve ein Hotel zu hüten, das über den Jahreswechsel schließt. Allein mit Hotelhund Otto, dem Hausmeister und Handwerkern hat Frieda nicht viel zu tun: Strandspaziergänge, Einkaufen, Kochen, Schauen. Sie lüftet Zimmer und ihre Gedanken. Das Hotel Paraíso ruft bei ihr Erinnerungen an einen anderen Ort wach, an dem sie sich wohlfühlte, aber nicht bleiben konnte: die Tankstelle in einem niedersächsischen Dorf, wo sie aufwuchs, bis sie irgendwann erfuhr, warum sie trotzdem nicht dazugehörte. Und während Frieda in Portugal darauf wartet, dass Jonas nachkommt, wird eine Frage immer drängender: Kann das Dazwischen ein Zuhause sein?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
mare
Arezu Weitholz
HotelParaíso
Roman
mare
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich
geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des
Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Covermotiv Arezu Weitholz
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-839-7
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-744-4
www.mare.de
Tread softly, because you tread on my dreams.
W. B. Yeats
Windflüchter gibt es nicht, der Wind bläst aus allen Richtungen.
Es ist leicht, hier zu vergessen, wer man war.
Aus dem Notizbuch
Früher oder später fragt jeder, der meine Geschichte hört, ob ich irgendwann meine leiblichen Eltern gefunden habe. Ja, habe ich. Ob ich sie getroffen habe? Ja, auch. Wie das war, wollen die Leute immer wissen. Es tut nichts zur Sache, sage ich dann. Ich kann nichts Haftbares über sie sagen. Meine Unheimlichkeit ist nicht meine Herkunft, auch wenn das einen prima Dorfroman abgeben würde. Meine Unheimlichkeit sind Sie: andere Menschen.
Eins noch. Alles ist wahr. Nichts davon ist genau so geschehen. Suchen Sie sich was aus.
João redet in einem fort. Ich weiß jetzt, wie die Kaffeemaschine funktioniert, wie man ohne Schlüssel das Tor zur Personalküche öffnet und wie man zu den Kühlschränken findet, die so groß sind wie begehbare Kleiderschränke. Ich weiß, wo Kartoffeln, Möhren und Haferflocken lagern, wie man mit einem Fausthieb den Strom in der Hauptküche abschaltet und wie der Ofen angeht. Ich weiß, wo die Zimmerschlüssel sind, kenne die Zahlenkombination für die Tore (1982), den Spazierweg einmal ums Haus, den Garten und die Tennisplätze, ich könnte rein theoretisch sogar die Sauna im Spa-Gebäude anschalten, aber ich werde ganz sicher nicht in die Sauna gehen, solange ich hier bin. Ich bin doch nicht bekloppt.
Ich weiß, wo Anzünder liegen und das Reserveholz, wie man in die Wäschekammer kommt und wie die Waschmaschine funktioniert. Ich weiß, wo der Sommelier die guten Flaschen hingestellt hat, die ich trinken darf, und auch, wo er ein paar hervorragende für uns gebunkert hat, denn bald ist Weihnachten, und Jonas kommt. Ich weiß, dass der Aldi im nächsten Ort billiger ist als der Supermarkt hier ums Eck. Ich weiß, wo ich das Strandgut stapeln soll: am Rand des Gartens vor dem linken Tor. Ich weiß, wo sich das Futter für die beiden Liebesvögel befindet, die abends immer zugedeckt werden müssen. Sie sind der Talisman des Hotels. Man nennt sie auch »die Unzertrennlichen«. Sie brauchen zehn Stunden Schlaf, nagen gern an Rosmarinzweigen, und wenn einer stirbt, stirbt auch der andere. Die Hotelgäste mögen den Gedanken an die Treue zweier Wesen zueinander, auch wenn es nur Vögel sind.
Was ich auch weiß, ist, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen, denn gleich geht die Sonne unter. Hinter uns knallt die rote Tür zu.
»Hier liegt der Schlüssel zur Feuertür, und da geht es raus in den Garten«, sagt João.
Im Lichthof des Personalbereichs wächst eine gewaltige Kastanie in den Himmel. Bänke und Tische stehen halb im Freien. Ich werfe der roten Tür einen kurzen Blick zu und merke mir, über dem Kreisding aus Holz liegt ein Schlüssel.
João ist der Hausmeister. Er arbeitet seit dreißig Jahren hier und kennt jede Ecke der weitläufigen Anlage, jedes Knirschen im Gebälk. Er weiß, wo was lose ist, wackelt oder zieht. Er ist um die sechzig, groß, schlaksig und hat es so eilig wie einer, der sich ständig auf dem Sprung nach woanders befindet. Er könnte Mechaniker im Maschinenraum eines Hochseedampfers sein oder ein viel beschäftigter Professor. Oder beides. Ist er vermutlich auch, auf seine Art.
Das Paraíso, in dessen Innereien wir herumlaufen, ist ein kleines Hotel mit vierzehn Zimmern und liegt an der Algarve fast direkt am Meer. Eine hohe hellgelbe Mauer umgibt das Gelände, und ein wunderschöner, parkähnlicher Garten fällt sanft zu den Klippen ab. Ich soll auf das Hotel aufpassen, denn es ist wie jedes Jahr den Winter über geschlossen. Die Besitzerin braucht selber Urlaub, will die Gebäude aber nicht allein lassen. Ich war bereits im Oktober hier, doch jetzt haben wir Dezember, und João soll mir alles noch mal ausführlich zeigen, erklären, Fragen beantworten, nur komme ich gar nicht dazu, welche zu stellen. Er redet ununterbrochen, und klack, klack, klack fallen die Informationen wie Tetris-Elemente ineinander in mein Gehirn.
Als ich die Besitzerin im Oktober kennenlernte – sie holte mich vom Flughafen ab –, stand sie rauchend vor dem Gebäude. Sie hatte dunkle, kurze Haare, trug kein Make-up und wallende Gewänder in Grau und Erdfarben. Neben ihr saß ein großer schwarzer Hund.
»Das ist Otto«, sagte sie mit einer rauen, reifen Stimme, die so gar nicht zu ihrem jungen Gesicht passen wollte, »dann lernen Sie den auch schon mal kennen.«
»Hallo, Otto«, sagte ich.
Der Hund guckte mich stumm an, sein Schwanz schlug auf den Asphalt.
»Er mag Sie. Willkommen in Portugal, Frieda«, sagte sie.
Ihre Alterslosigkeit und die Ruhe, die sie umgab, verliehen ihr etwas Zenmönchhaftes. Ich weiß bis heute nicht, ob es stimmt, aber als ich ihr damals die Hand gab und in ihre hellgrauen Augen sah, dachte ich: Du hast auch nicht viele Freunde. Nein, ich dachte: Du traust auch nicht jedem.
Das Paraíso, erfuhr ich von ihr, war nicht immer ein Hotel. Ein brasilianischer Rinderbaron ließ es 1931 für sich und seine Familie als Ferienresidenz bauen. Es besteht aus zwei Gebäuden, im Haupthaus befinden sich vierzehn Zimmer, das Gästehaus daneben wird heute als Spa genutzt. Das Hauptgebäude ist ein lang gezogener Bau, und die hellbeige verputzten Steinwände sind an den meisten Stellen rund oder geschwungen, sodass es kaum spitze Ecken gibt. In dem großen Garten wachsen hohe Pinien, Araukarien, Zypressen, Palmen, Orangen- und Zitronenbäumchen, massenhaft Strelitzien, Rosen und Kräuter – verschiedene Sorten Minze, Rosmarin, Thymian. Die Klippen stehen unter Naturschutz, und der Weg zum Hausstrand ist zwar öffentlich, aber so schlecht zu erreichen, dass selbst zur Sommersaison nur wenige Leute da hinfinden, eigentlich ist es also ein Privatstrand. 1968 kaufte eine französische Baronin das renovierungsbedürftige Anwesen und machte daraus ein Hotel für Freunde und Bekannte, die Wert auf gehobene Küche legten – und auf Diskretion. Es hat keine Webseite und wird nur in wenigen Reiseführern erwähnt. Erscheint mal ein Restauranttester, kochen sie extra schlecht, damit sie nicht noch mal aus Versehen einen Michelinstern bekommen.
Falls es hier in der Nacht Geräusche gebe, sagt João und öffnet die Tür zum Garten, seien das die Büsche, die Bäume oder die Bougainvilleen. Er zeigt auf die alten Ranken, an denen grellpinke Blüten blühen. Ich nicke und frage mich, wie man das überhaupt hören soll bei dem ständigen Rauschen des Meeres, diesem Krschkrsch und Schschsch, das durch alle Gänge zieht, durch die Flure und den Garten. Oder stellt jemand nachts den Atlantik ab? Es rauscht wirklich in einer Tour, als habe der liebe Gott die Waschmaschine an. Man hört es überall, im Lichthof, drinnen im Haus, im Garten, hier auf dem Hof, nur an der Straße hinter der Mauer mit dem elektrischen Tor hört man es nicht. Schon bei meinem ersten Besuch ist mir das aufgefallen. Es ist, als sei das Rauschen etwas, das allein hier bei uns, zwischen den hohen Mauern des Paraíso, wohnt.
Im Direktionsbüro erklärt João den Kasten mit dem Feueralarm. Es gebe nur drei Gründe, weswegen der überhaupt anspringen würde: Rauch, Nässe, Spinne. Eigentlich sei es ein Spinnenalarm. Die Sensoren der Alarmanlage seien zu fein eingestellt. Sie schlügen bei jeder Kleinigkeit aus. Da müsse nur eine winzige Spinne über den Schalter laufen.
Das gibt es bei Menschen auch, denke ich. An manchen Tagen sind die Sensoren zu fein eingestellt.
»Morgen bringe ich den Hund«, sagt João. Wir gehen zur großen Glasschiebetür, die man abends mit einem Nagel an der Seite sichern muss. Er drückt mir ein Schlüsselbund in die Hand, lächelt und verabschiedet sich. Ich bedanke mich und merke mir: 1982. Nagel. Otto, morgen.
Ich habe noch nie einen Hund gehabt, aber ich habe auch noch nie ein Hotel gehütet. Von Bekannten weiß ich, dass man fit wird, wenn man einen Hund hat, weil der dauernd ausgeführt werden muss. Gewissermaßen freue ich mich also auf Otto. Er wird mein Personal Trainer werden. Eine Bekannte von mir spricht mit ihrem Hund, als wäre er ein Kind. Vielleicht wird man so, wenn man zu lange allein lebt. Vielleicht sollte ich Jonas heiraten, damit ich nicht später mit einem Hund rede wie mit einem Kind. Eine Osteopathin erklärte mir mal, Hunde und Pferde seien die einzigen Tiere, die auch von Osteopathen behandelt würden. Sie hätten ähnliche Beschwerden, was am ständigen Menschenkontakt liege. Sie nähmen Sorgen und Lasten der Menschen in sich auf. Ich hoffe daher, Otto steckt sich bei mir mit nichts an.
Es passt zu meiner Lage, auf ein Hotel aufzupassen, das eine Pause macht, sich regeneriert, von einem anstrengenden Jahr erholt. Ich bin müde, und ich bin erschöpft – was nicht das Gleiche ist. Wer müde ist, will schlafen. Wer erschöpft ist, ist leer. Burn-out, habe ich gelesen, bekommt man auch nicht von Zuvielarbeiten, sondern von Zuweniganerkennung beim Zuvielarbeiten. Ich konnte das Wort noch nie leiden. Burn-out klingt nach Feuer. Mir ist immer nur kalt gewesen.
In der siebten Klasse erklärte uns der Mathelehrer, dass man nie auf null kommt, egal, wie oft man eine Zahl teilt. Man kann beispielsweise die Zahl 1 immer und immer wieder durch 2 teilen, es bleibt stets ein Rest. Ich habe im vergangenen Jahr mein Herz immer wieder in zwei Teile geschnitten und es zu spät gemerkt. Aber wie hätte ich das auch merken sollen? Hätte jemand gefragt: »Haben Sie denn kein Herz?«, hätte ich erwidert: »Doch, ich habe ein Herz«, auch wenn es nur noch ein hauchdünner Fetzen war.
Jeder, dem ich erzählt habe, dass ich das Paraíso hüten würde, erwähnte als Erstes Shining. Ich hätte nie gedacht, dass die Leute Shining noch kannten, vor allem nicht, dass sie mir zutrauten, durchzudrehen, so wie Jack Nicholson. »Ach, du hütest ein leeres Hotel, das ist ja bestimmt unheimlich. Wie in Shining!« Dann sprachen sie von Zwillingen, von Gespenstern, von Teppichmustern und schließlich von sich – so wie jeder früher oder später von sich redet. »Ganz allein in einem leeren Hotel, also ich könnte das nicht.« »Ich hätte ja Angst, so allein.«
Ich interessiere mich aus beruflichen Gründen für das Spannungsfeld, das entsteht, wenn man etwas nicht sehen, aber sehr wohl empfinden kann. Aber Gespenster? Bis vor Kurzem arbeitete ich als Sprecherin, las Hörbücher. Sie kennen meine Stimme vermutlich nicht. Oder vielleicht doch. Sagt ihnen Oskar, der Hase etwas? Liebe in den Marschen? Ein Fall für Annalene? Nein? Macht nichts. Ich mag auch keine Hörbücher hören, und wenn jemand im Radio redet, schalte ich es ab oder drehe es leise. Ich kann hören, wenn was nicht stimmt. Das ist ein Problem.
Der eigentliche Grund, warum ich hier wohne, ist die sogenannte dead week, das sind die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr – jene Woche, in der man nicht weiß, wer man ist oder was das alles soll. Hausbesitzer müssen sich in Portugal während der Dead Week vor Ocupados in Acht nehmen. Das sind Banden, die nach spanischem Vorbild leer stehende Häuser besetzen. Sie wechseln die Schlösser aus, manchmal melden sie einen Telefonanschluss auf ihren Namen an, und wenn sie länger als achtundvierzig Stunden irgendwo wohnen, kann man sie nicht mehr vertreiben, in Spanien zumindest. In Portugal sei eher Vandalismus das Problem, hat die Besitzerin gesagt und sogar angeboten: »Lad dir gern Freunde ein.«
Aber ich will niemanden einladen. Das ist ja das Schöne: Keiner wird mich in diesem Jahr bitten, eine Gans zuzubereiten, mich skeptisch mustern oder falsch anlächeln. Keiner wird voller Mitgefühl über meine Hand streichen, weil ich unter »irgendeiner Belastungsstörung« leide, einen zweifelhaften Lebenslauf habe, keine Kinder und diese unordentliche Frisur, die man bekommt, wenn man an Weihnachten eine blöde Gans für lauter Leute machen muss, denen man leidtut.
Natürlich kommt Jonas hierher, einen Tag vor Heiligabend, wie besprochen. Hauptsache, ich muss nicht quer durch die Republik juckeln, an keiner Raststätte Blicke tauschen, mit all den anderen, den Vätern, den Müttern, den Nichten und Enkeln, die alle irgendwohin unterwegs sind, wo sie gar nicht hinwollen, oder vielleicht wollen sie dahin, aber doch nicht alle gleichzeitig bei diesem Mistwetter, die wenigsten wollen reisen, das sieht man ihnen doch an.
Ich setze mich auf das weiße Sofa, das im Wintergarten quer vor den breiten Terrassenfenstern steht, und schaue über den Garten aufs Meer. Windflüchter gibt es hier nicht, der Wind bläst aus allen Richtungen.
Wellen werfen sich wie enttäuschte Liebende an die Steilküste. Schon hundert Meter vor dem Strand schaumtosen sie in Zeitlupe, es sind kleine Türme, nein, es sind Turmmauern. Mauertürme rasen schräg aufs Ufer zu, ihre obere Naht zerfasert von den Windböen, die immer wieder über die Gischtkämme wischen und weißen Sprühregen nach vorn peitschen. Und überallhin, durch alle Gänge, dringt das Rauschen des Meeres. Krschhh. Wschsch. Dschtdsch. So klingt es. Als wäre es ein Organismus, als würde der Atlantik bis in die letzte Ecke des Raumes atmen.
Morgen kommt der Hund. Morgen werde ich etwas kochen. Morgen werde ich einen Spaziergang machen. Auf einmal, wird mir klar, habe ich Zeit. Wie soll ich die Stunden füllen? Man denkt ja immer, Leute, die so am Meer rumsitzen und gucken, sind beschäftigt, aber eigentlich ist man schnell damit fertig, mit diesem Sitzen und Gucken. Allmählich wringt der Abend das Licht aus dem Grau. Dann ist es stockfinster.
Als wir noch nicht lange zusammen waren, fragte Jonas: »Warum schreibst du mir nie, dass du mich vermisst? Hast du gar kein Heimweh?«
»Ich finde das Wort Heimweh jammerig«, erwiderte ich.
Jonas schwieg ein wenig verletzt, und ich dachte, dass man nicht immer alles sagen muss, was man denkt. Doch wie sollte ich das erklären? Es war ja nicht so, dass ich noch nie darüber nachgedacht hätte. Im Gegenteil. Fernweh und Heimweh sind Sehnsüchte. Beide fühlen sich an, als habe jemand im Herz ein Fenster offen gelassen, durch das es zieht. Heimweh hat man, wenn man sich nach dem Ort sehnt, an dem man sich geborgen fühlt, gut aufgehoben. Fernweh hat man, wenn man nicht weiß, wo der sein soll, dieser Ort, den alle Heimat nennen oder Zuhause. Fernweh ist Heimweh nach Irgendwo – von mir aus könnte es auch Irgendwohinweh heißen. Oder Wohinweh.
Aber als ich das Jonas erzählen wollte, war er bereits mit etwas anderem beschäftigt.
»Ich vermisse dich«, schreibe ich jetzt an ihn. Seine Antwort kommt prompt: »Ich vermisse dich auch.« Dann gehe ich nach oben, auspacken.
Ich öffne die Zimmertür und weiche zurück. Ich blicke mir selbst entgegen. Das Glas des Spiegels ist alt, überall sind Flecken, der ovale goldene Rahmen ist an manchen Stellen beschädigt. Unheimlich die Vorstellung, dass sich der Spiegel erinnern kann. Erdrückend der Gedanke, dass jemand zurückschaut.
In einem anderen Leben war ich beruflich viel auf Reisen, und es war jedes Mal das Gleiche: Sobald ich meinen Koffer ausgepackt und alles in Regalen und Schränken verstaut hatte, sobald meine Bücher, Stifte und Notizbücher wie Wächter auf den Tischen lagen, breitete sich in mir eine seltsame, aber vertraute Ruhe aus. Auf der einen Seite war da das Gefühl: »Ich kann sofort wieder einpacken und abhauen«, auf der anderen Seite war »ab jetzt alles merkwürdig«. Beide Kräfte waren in Balance, und ich hatte Hände und Sinne frei, den brandneuen Ort zu entdecken. Ich konnte in mich hineinhören, Dingen nachspüren, Bemerkenswertes bemerken, ich musste bloß wie Sterntaler meine Schürze aufhalten. Nur manchmal drohte das Ganze zu kippen. Wenn die Empfindungen in mir drin der Schönheit des Außen nicht gerecht wurden.
Die Malerin Bridget Riley sagte einmal etwas Ähnliches über die rätselhafte Alchemie des Sehens. Eine Landschaft sei mal dumpf, dann wieder vibrierend, aber es ist immer dieselbe Gegend. Man kann nicht rausgehen und sich einen Eindruck abholen, weil er da rumliegt. Ebenso wenig kann man sich eine Geisteshaltung antrainieren, die man aufsetzt wie eine Sonnenbrille, um das Vibrierende zu sehen. Es ist vielmehr die vollkommene Balance aus beidem, aus dem, was man sieht, und dem, wie man es sieht, die für einen Augenblick das Alltägliche ins Wunderbare verwandeln kann.
Ich frage mich manchmal, ob man nicht allein deswegen verreist: wegen dieser ersten, unheimlich schönen Minuten, in denen alles möglich ist.
Vor dem Zubettgehen schaue ich überall nach, ob sich jemand irgendwo versteckt. Das ist ein Fimmel, von dem ich gerne wissen würde, ob andere ihn auch haben. Sie würden es nie zugeben, aber ich könnte sie anzwinkern und sagen: »Hey, jetzt mal unter uns, du guckst doch auch unters Bett, was?«
Hier ist das Nachsehen eine echte Aufgabe, denn die Suite ist für Riesen gemacht. Der Couchtisch hat die Maße einer Sandkiste, die er gewissermaßen auch ist. Unter dem Glas der Tischplatte liegen auf feinstem Sand zahllose Muscheln und Steine. Die weißen Sofas haben das Format mittelgroßer Schlauchboote. Im geschwungenen Kamin könnte man einen ausgewachsenen Eber grillen. Rechts und links daneben stehen überdimensionale beige Lampen, wie knorrige Bäume mit Sonnenhut. Das Schlafzimmer ist ebenso weitläufig, das Bett riesig, im begehbaren Kleiderschrank könnte eine Isetta parken, und in der Badewanne hätte man zu viert ausgestreckt nebeneinander Platz – aber wer kennt schon drei Leute, mit denen er baden will?
Ich öffne die Schranktüren, schaue unter das mit Holzschnitzereien verzierte Bett, ziehe die Vorhänge auf und wieder zu. Dann putze ich mir die Zähne, lege mich hin und mache das Licht aus. Natürlich knurrt in genau diesem Moment mein Magen.
»Nein«, sage ich laut, »wir gehen jetzt nicht die dunkle Treppe runter durch den dunklen Gang zur dunklen Küche, finden die Lichtschalter nicht, frieren uns eine Naht zurecht und suchen nach was zu essen, was wir dann doch nicht finden.«
Mit sich selber zu reden ist gestattet, wenn man allein ist. Das ist der Vorteil des Alleinseins: Man wird beim Denken nicht gestört. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, ist es der Nachteil des Alleinseins: Man wird beim Denken nicht gestört. Schön ist es am frühen Morgen, wenn alle anderen noch schlafen, und man denkt was und merkt, das ist brauchbar. Wofür genau, ist einem vielleicht noch nicht klar, aber es ist schon mal brauchbar. Als wäre die Brauchbarkeit ein kleiner Anker, mit dem man sich in der Wirklichkeit festkrallen kann, eine Art Daseinsgriff.
Es ist zu spät, um Jonas anzurufen. Ich telefoniere allgemein nicht gern, und außerdem will ich nicht gleich in der ersten Nacht jammern. Er würde fragen: Was ist los, warum ist der Hund noch nicht da, hast du alles abgeschlossen, hast du überhaupt was zum Abendbrot gegessen, und ich würde anfangen, mich zu rechtfertigen, und gleichzeitig darüber nachdenken, ob ich wirklich alles abgeschlossen habe, und es würde vielleicht noch mal knacken oder knarzen, und ich hätte dann diese Stimme, der man anhören würde, dass sie Angst hat, und er würde sagen, wärst du mal hiergeblieben. Nein, da liege ich lieber in diesem breiten, bequemen Riesenbett. Schlaf wird kommen. Tut er ja immer. Ich bin doch kein Hasenfuß.
Merk dir, was du träumst, sagen sie einem immer, wenn man die erste Nacht in einer neuen Wohnung schläft oder einem neuen Bett, als wäre man hellsichtig, als wäre man in ersten Nächten besonders durchlässig für Geister oder Gewissheiten, dabei ist das bloß ein Trick, damit man rasch einschläft und nicht bange wird. Und selbst wenn man was träumt, man vergisst es ja doch. Im Traum mitschreiben, das müsste man können.
Ich versuche, mich müde zu lesen. Das ist eine einfache Sache. Man nimmt ein Buch, irgendein Buch, und liest bei schlechtem Licht. Nach wenigen Absätzen schaltet der Geist in den Erschöpfungsmodus, man greift kraftlos nach dem Lichtschalter, um das Zimmer zu verdunkeln, und fällt in einen tiefen Schlaf. Das gelingt mir mit allen Genres, auch mit Nobelpreisträgern. Gerade mit denen.
Jonas benutzt Hörbücher, um besser einschlafen zu können. Ich schlafe fast immer beim Hörbuchlesen ein. Das passiert den meisten. Man sagt dem Regisseur dann: ›Gib mir fünf‹, und wer Minutenschlaf kann, schläft ein bisschen, dann geht es weiter. Einmal aber bin ich eingeschlafen und habe im Schlaf einfach weitergelesen. Der Regisseur erzählte es mir hinterher: »Deine Augen fielen zu, aber dein Mund hörte nicht auf zu reden. Das ging zwei, drei Sätze so.« Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich auch prima vista lesen kann: ein unbekanntes Manuskript sofort einlesen, ohne mir vorher Notizen zu machen oder zu üben. Man kann das angeblich nicht lernen. Man liest den Anfang eines Satzes und hat den Rest schon inhaliert. Man weiß, wo man betonen muss, wo eine Pause hingehört. Es klingt ein bisschen verrückt, aber genau das ist man, verrückt, einen Millimeter nach vorne geschoben. Etwas liest sich durch einen hindurch. Als ich damals einschlief, rief das Gehirn die Informationen wohl noch ab, bis der Speicher leer war. Möglicherweise schalten sich nicht alle Abteilungen gleichzeitig aus. Vielleicht gibt es im Gehirn immer einen, der nicht mitbekommt, dass die Fabrikpfeife tutet und alle anderen längst an der Stechuhr stehen. Ich hoffe, dass man nicht so stirbt, so nacheinander.
Gegen Mitternacht ist es immer noch so laut, dass ich die Vorhänge vor dem Schlafzimmer einen Spalt öffne, um nachzusehen, ob nicht doch irgendein Scherzkeks Lautsprecher auf den Balkon gestellt hat. Im goldenen Dimmlicht der Terrassenbeleuchtung starren drei Palmenköpfe in mein Fenster. Dahinter ist es pechschwarz. Windböen feudeln die Palmblätter hin und her. Ich öffne die Balkontür. Binnen Sekunden bin ich durchnässt. Der Wind zieht und zerrt an meinem Pyjama. Es knarrt und knarzt und rauscht. Dann sehe ich die Plastikeule, die auf dem Dach festgeschraubt ist. Ihr beweglicher Kopf dreht sich im starken Wind immer und wieder hin und her, als wollte sie sagen: Nein, nein, nein.
Jetzt im Winter kämen die Stürme, hat die Besitzerin gesagt. Die Brandung sei unberechenbar. Sie habe aus dem Meer schon einmal jemanden rausgezogen, einen Surfer. »Du musst vorsichtig sein und auch beim Spazierengehen an der Steilküste aufpassen. Das Meer höhlt sie aus. Du darfst dich nicht unter die Vorsprünge setzen oder auf ihnen stehen. Aus heiterem Himmel kann der Boden unter dir zusammenbrechen.« Auf den Klippen vor dem Hotel sei mal eine Strandbar gewesen, O Mar Me Quer. Übersetzt hieß das: Das Meer will mich. Der Name sei an das portugiesische Wort für Gänseblümchen angelehnt: Malmequer. Warum, das wusste die Besitzerin nicht. Aber die Bar, erzählte sie, die war eines Nachts tatsächlich vom Meer verschlungen worden. Sie wachte auf, sah hinaus, und die kleine Bude war weg. Als hätte es sie nie gegeben.
Gab es früher Gewitter, weckte uns mein Vater. Meine Mutter und ich mussten uns anziehen, und dann saßen wir im Keller in seinem Büro im Dunkeln an einem Tisch und warteten, bis das Gewitter vorübergezogen war. Ich wurde oft in eine Wolldecke gewickelt, die ich heute noch besitze. Sie ist dunkelgrünrot kariert, mit weißem Saum, und sie kratzt ein bisschen. Sie ist die Einzige, die sich noch an diese Nächte erinnert. Außer mir.
Ich schrecke aus dem Schlaf. Im Badezimmerspiegel schimmert bläulich kaltes Mondlicht. Es ist zwei Uhr morgens. Etwas stimmt nicht. Das Rauschen klingt anders. Dichter, lebendiger. Eigenartigerweise erinnert es mich an Mengemasse beim Synchronsprechen – diesen Klangteppich, den man mit einer Gruppe von Leuten im Studio erzeugt, um eine Versammlung zu suggerieren. Vor der Zimmertür bleibe ich stehen. Zögerlich lege ich mein Ohr an das Holz und lausche.
Eigentlich liebe ich das Rauschen in den Kopfhörern, das Rauschen zwischen zwei Liedern auf einem Mixtape. Das Rauschen auf einer Schallplatte. Das Rauschen des Verstärkers, wenn sonst nichts läuft. Hinter dem Rauschen warten die Melodien.
Doch hinter dieser Tür, das weiß ich plötzlich, ist jemand. Mein Herz schlägt. Ich spüre es bis in den Hals hinauf, mein Puls donnert durch alle Adern. Er ist laut, so laut, dass ich denke, man muss es im ganzen Zimmer hören.
Was kann ich tun? Jemanden anrufen? Wen? João? Die Polizei? Ich kann kein Portugiesisch. Langsam weiche ich zurück. Meine Füße versinken im weichen Teppich, der mich daran erinnert, wie zerbrechlich alles ist. Mit hämmerndem Herzen schließe ich behutsam die Schlafzimmertür und drehe vorsichtig den Schlüssel im Schloss. Mein Puls krawallt unter meiner Haut. Ich schaue noch mal hinter die Vorhänge, ins Bad und in den Kleiderschrank, unters Bett und lege mich und mein klopfendes Herz ins Bett. Scheiß-Shining. Das ist nicht lustig.
»Eine Bekannte von Martin sucht jemanden, der auf ihr Hotel aufpasst«, sagte Jonas Ende August. Wir saßen auf dem Sofa und sahen einen inhaltsarmen Actionfilm.
»Interessant«, erwiderte ich. »Wo denn?«