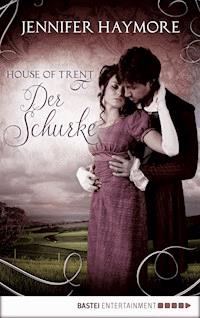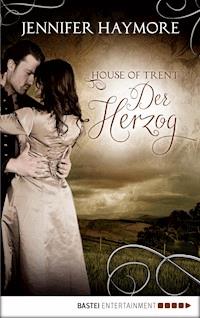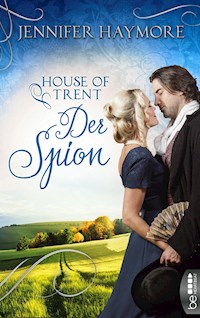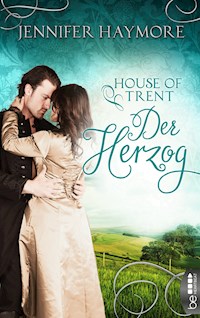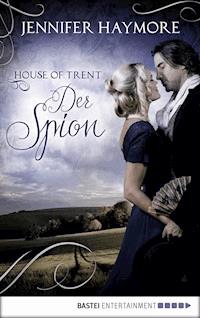
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trent-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
DER FESSELNDE LETZTE BAND DER LIEBESROMAN-TRILOGIE VON USA-TODAY-BESTSELLER-AUTORIN JENNIFER HAYMORE Ein ohrenbetäubender Schuss, ihr Ehemann bricht zusammen, ein riesiger Fremder zieht sie aus ihrem Versteck heraus - Alles geschieht so schnell, dass Élise kaum versteht, was passiert. Sie dachte, sie würde ein konspiratives Treffen belauschen, stattdessen hat sie den Mord an ihrem abscheulichen Ehemann durch einen britischen Spion beobachtet. Ein Spion, der ihr versichert, dass er sie nicht verletzen wird. Und der sie dann gefangen nimmt, weil er sie ebenfalls für eine Verräterin hält. Élise weiß nicht, was sie jetzt tun soll. Nur eines wird in den Tagen ihrer Gefangenschaft immer klarer: Sam Hawkins, der Spion mit den sanften Händen und dem brennenden Blick, ist gefährlich. Für ihre Tugend. Und für ihr Herz - GEHEIMNISSE, SKANDALE UND VERRAT - DER ENGLISCHE ADEL VON SEINER DUNKELSTEN SEITE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Epilog
Über die Autorin
Jennifer Haymore hat als Kind mit ihrer Familie die Südsee in einem selbstgebauten Segelboot bereist. Diese Monate auf See haben den Grundstein für ihre Abenteuerlust und Erzählfreude gelegt. Als Autorin von aufregenden, sinnlichen Liebesromanen lebt sie beides aus. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern hat sie sich inzwischen in Kalifornien niedergelassen.Mehr Informationen unter: www.jenniferhaymore.com
Jennifer Haymore
HOUSEOF TRENT
DER SPION
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Angela Koonen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2014 by Jennifer HaymoreTitel der amerikanischen Originalausgabe: »The Scoundrel’s Seduction«Originalverlag: Forever, an imprint of Grand Central Publishing,a division of Hachette Book Group, Inc.Published in agreement with the author,c/o BAROR INTERNATIONAL, Inc.,Armonk, New York, U.S.A.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Anita Hirtreiter, MünchenTitelillustration: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deunter Verwendung von Motiven von © hotdamnstock;Thinkstock/Matt_Gibson; Thinkstock/kitipol; Thinkstock/kucele; Thinkstock/Leonid TitUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3048-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Lawrence, meine bessere Hälfte.Es waren ein paar harte Jahre, aber du warst stetsan meiner Seite und hast mir die Hand gehalten.
1
Samson Hawkins prüfte die Zündpfanne seiner Pistole, dann senkte er sie auf den Schoß und blickte Laurent an, den Jungen, der neben ihm in der Kutsche saß. Dieser schaute mit gerunzelter Stirn geradeaus, in seinen Augen lag ein Ausdruck, den Sam nicht so recht benennen konnte. Laurent war erst fünfzehn und noch neu im Einsatz.
Sam kniff die Lippen zusammen und sah weg. Den Impuls, ihm etwas Tröstliches zuzuraunen, schob er beiseite. Laurent hatte sich dieses Leben ausgesucht. Das war keins für die Schwachen, sondern für die Harten, Mitleidlosen. Sam vergaß das nie, und Laurent sollte das auch nicht vergessen, wenn er in dem Beruf alt werden wollte.
Sam schaute durchs Kutschenfenster an der Fassade des noblen Stadthauses in Mayfair hinauf. Im zweiten Stock blieb sein Blick an einem Fenster hängen, wo goldener Lampenschein durch die indigoblauen Seidenvorhänge drang und davon abgesehen nichts Verdächtiges zu bemerken war.
Viscount Dunthorpe befand sich jetzt in jenem Raum. Vielleicht las er und trank etwas. Vielleicht ging er einer seiner ruchlosen Beschäftigungen nach, die allesamt heimtückischem Verrat dienten. Auf jeden Fall aber wartete er auf Sam – oder vielmehr auf den, für den sich Sam ausgegeben hatte.
Er wartete auf seinen Tod, was er jedoch noch nicht wusste.
Sam holte tief Luft und schloss die Hand um den Griff der Pistole.
»Gib acht auf mein Signal«, sagte er leise zu Laurent. »Gleich nach dem ersten Schuss. Dreißig Sekunden danach bin ich wieder unten. Sobald ich im Haus bin, beobachtest du die Straße und siehst zu, dass alles frei ist.« Er steckte die Pistole in eine Innentasche des Mantels.
»Wird gemacht.«
Ruhig erwiderte er den Blick des Jungen. »Alles in allem sollte es höchstens fünf Minuten dauern. Wenn ich nach einer Viertelstunde noch nicht zurück bin, wisst ihr beide, was ihr zu tun habt.«
»Verstanden.«
Sam langte zum Türgriff, aber Laurent fasste ihn am Ärmel. »Hawk?«
Sam drehte den Kopf zu ihm, die Brauen erwartungsvoll hochgezogen.
»Viel Glück.«
Sam nickte ihm kurz zu.
»Wir müssen das tun. Wir müssen den Regenten schützen.« Laurent musste sich offenbar gut zureden, dass sie das Richtige taten.
»Ja, Junge«, sagte Sam leise. So war es, sie taten das Richtige. Dunthorpe musste eliminiert werden. Der Mann hatte schon zu viele Tote auf dem Gewissen und war für so viel Leid verantwortlich, und wenn er am Leben bliebe, würde er noch viel, viel mehr anrichten.
Sam stieg aus der Kutsche. Gemessenen Schrittes und ohne Hast ging er zum Hauseingang. Es war spät, die Straßen nicht so belebt wie zur Mittagszeit, aber das war London, eine Stadt, die nie vollkommen schlief. Gründlich schätzte er die Passanten ab: eine Frau mit zwei kleinen Kindern, die sich der Kälte wegen aneinanderdrängten, ein Mann, der die Straße entlangeilte, ein Lumpensammler auf seinem Wagen, eine geschlossene Kutsche und eine Hand voll Reiter. Keiner von denen schenkte ihm die geringste Beachtung.
Er stieg die vier Stufen zur Haustür hinauf und betätigte den Klopfer, als wäre er zu einem Anstandsbesuch gekommen.
Ein Diener öffnete. Der Butler, wie Sam wusste. Richards hieß er.
»Ja?«
»Denis Martin«, sagte Sam mit einem ausgeprägten französischen Akzent. Er hatte die Sprache als Kind gelernt und viele Jahre auf dem Kontinent verbracht, weshalb er sie fließend und fehlerfrei wie ein gebürtiger Franzose sprach. »Seine Lordschaft erwartet mich.«
»Natürlich, Sir.« Richards verzog keine Miene, nur sein Blick ließ kurz eine Regung erkennen. Die Franzosen waren derzeit in England nicht sonderlich beliebt, und dieser Mann billigte es offenbar nicht, wenn sein Herr von einem Froschfresser, wie die Engländer sagten, Besuch erhielt.
Der Butler trat beiseite, um Sam hereinzulassen. Sam hatte sich den Hut tief ins Gesicht gezogen und hielt sich halb abgewandt.
»Darf ich Ihnen Hut und Mantel abnehmen, Sir?«
»Non. Das ist nicht nötig. Ich habe nur eine Nachricht zu überbringen.« Mit einer Drehung des Handgelenks deutete er ins Innere des Hauses und sodann zur Tür. »Ich werde im Nu wieder draußen sein.«
»Wie Sie wünschen. Hier entlang.«
Sam folgte dem Butler die Treppe hinauf, dann einen Korridor entlang, der mit zwei vergoldeten Wandlampen spärlich beleuchtet war. An der eleganten Tür an dessen Ende blieben sie stehen, und Richards klopfte an, bevor er auf das barsche »Ja?«, das von drinnen kam, die Tür öffnete.
Sam wartete mit gesenktem Blick im Halbdunkel zwischen den Wandleuchtern.
»Monsieur Martin ist da, Sir.«
Ein paar Augenblicke lang erfolgte keine Anweisung, lange genug, dass Sam im Nacken ein warnendes Kribbeln verspürte.
»Er soll hereinkommen.«
Richards öffnete die Tür weiter, um den Besucher vorzulassen. Sam betrat einen üppig eingerichteten Salon.
Sowie er dort stand, hob er den Kopf und nahm mit einem raschen Blick die Umgebung in sich auf. Er war schon einmal in dem Raum gewesen, um ihn auszuspähen. Nichts hatte sich verändert. Die zahlreichen Möbel grenzten ans Pompöse, viel Schnitzwerk, Blattgold, Seide und Samtpolster. Das große Fenster mit dem indigoblauen Vorhang befand sich an der gegenüberliegenden Wand. Er stellte sich Laurent vor, der unterhalb des Fensters nervös auf ihn wartete.
Der Junge würde nicht lange zu warten brauchen. In ein paar Minuten würde Sam wieder in der Kutsche sitzen und mit ihm in den dunklen Straßen verschwinden.
Jetzt aber richtete er den Blick auf sein Ziel. Viscount Dunthorpe stand von einem Schreibtisch auf und kam auf ihn zu, ein Mann von Ende vierzig mit vollem grauem Haar und dunklen stechenden Augen, denen nichts entging. Er war bekannt für seinen beißenden Zynismus und seinen kühlen Verstand und galt als der brillanteste Redner im Parlament.
Er war außerdem ein Verräter.
»Lord Dunthorpe«, Sam behielt den französischen Akzent bei und streckte die Hand aus, »es ist mir eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen.«
Mit unbewegter Miene nahm der Viscount seine Hand, drückte sie kurz und sachlich und wandte sich dem Butler zu. »Das ist dann alles, Richards. Sie dürfen sich für heute zurückziehen.«
Nachdem der Butler gegangen war, fasste Dunthorpe seinen Besucher ins Auge, mit kaltem, berechnendem Blick. Sam dagegen setzte ein völlig nichtssagendes Gesicht auf. Er musste Dunthorpe zwei Minuten hinhalten. So lange würde Richards brauchen, um in sein Dachzimmer hinaufzusteigen.
»Haben Sie den Ablaufplan dabei?«, fragte Dunthorpe.
»Oui, wie vereinbart«, antwortete Sam schroff.
Dunthorpe streckte die Hand aus. »Geben Sie her«, befahl er im Ton eines Mannes, der fraglosen Gehorsam gewohnt war.
Sam blickte bedeutungsvoll auf das Teegeschirr, das auf einem runden Tisch in der Ecke stand. »Wollen Sie mir nicht eine Tasse Tee anbieten, Mylord?«
Der Viscount verschränkte die Arme und zog die Brauen hoch. »Ich hatte nichts dergleichen vor.«
Sam rieb sich die kalten Hände. Er trug aus gutem Grund keine Handschuhe. »Es ist sehr kalt draußen. Einen Cognac vielleicht?«
Dunthorpe kniff die Augen zusammen. »Französischen Cognac? Wofür halten Sie mich? Für einen Schmuggler?«
Nein, dieser Mann beging schwerere Verbrechen. Sam schüttelte den Kopf. »Mais non«, erwiderte er ernst. »Natürlich nicht, Mylord.«
Dunthorpe blickte höhnisch. »Sie haben nicht einmal den Hut abgenommen. Sie sehen mir nicht aus wie ein Mann, der sich zu einer Tasse Tee oder einem Schluck Cognac niederlassen will, sondern vielmehr wie jemand, der seine Pflicht erledigt und dann lieber davoneilt, bevor ich noch auf die Idee komme, er wüsste zu viel.«
Sieh an. Schon die erste Drohung. Sam sollte nun wohl Angst bekommen, aber von solchen Bemerkungen ließ er sich nicht einschüchtern. Dafür hatte er schon zu oft mit Leuten wie Dunthorpe zu tun gehabt.
Inzwischen hatte Richards genug Zeit gehabt. Er sollte jetzt in seinem Zimmer sein, sich zu Bett begeben, die Nachtmütze aufsetzen.
»Alors, wenn das so ist, gebe ich Ihnen jetzt den Plan, Monsieur.« Sam griff in seinen Mantel. Seine Finger streiften den kalten Pistolenlauf, schlossen sich jedoch um die zusammengefalteten Papiere. Er zog sie heraus und streckte sie Dunthorpe hin.
Dieser riss sie ihm förmlich aus der Hand und faltete sie gierig auseinander. Sam hätte angewidert die Mundwinkel heruntergezogen, wenn er sich eine Regung gestattet hätte. Der Bastard zeigte entschieden zu viel Enthusiasmus, wenn er etwas vernichten konnte, was den Briten lieb und teuer war.
In Wirklichkeit enthielten die Papiere eine Fülle falscher Behauptungen, bei denen Sam mit den Zähnen knirschte. Die Leiter der Organisation hatten entschieden, es sei »allzu schockierend« für das Volk, die Wahrheit über ihren Nationalhelden zu erfahren, der achtzehn Jahre lang als Offizier der Marine gedient hatte. In Wirklichkeit hatte Dunthorpe nur sich selbst gedient. Er dachte lediglich an seinen eigenen Vorteil. Schon als Jüngling hatte er geheime Informationen an Frankreich verkauft und war nun der Drahtzieher dieser Verschwörung, die seinen eigenen politischen und finanziellen Zwecken diente.
Das Volk zu täuschen ging Sam gewaltig gegen den Strich, seine Vorgesetzten jedoch wollten Dunthorpe, diesen Verräter, zum Schluss als Helden hervorgehen lassen. Die mitgebrachten Schriftstücke würden im Nachhinein den Anschein erwecken, der Viscount sei gestorben, weil er seinen Regenten schützen wollte, nicht weil er einen profitablen Plan zu dessen Ermordung verfolgte.
Sam stand es nicht zu, die Entscheidungen seiner Vorgesetzten infrage zu stellen. Das hatte er noch nie getan und würde es wahrscheinlich auch nie tun. Er war hier, um Befehle auszuführen, und nicht, um nach eigenem Gutdünken zu handeln. Das war sein Leben, er setzte es ein für das übergeordnete Wohl … auch wenn er dabei Zugeständnisse machen musste.
»Was ist das?«
Dunthorpe überflog die Seiten, seine Bewegungen wurden immer hektischer, seine Augen größer – da standen all die schmutzigen Details der Verschwörung, aber mit einem kleinen Dreh, der Dunthorpe von der Liste der Schuldigen entfernte und ihn stattdessen zum Helden machte.
»Sie Bastard. Das ist nicht der Ablaufplan.« Er schleuderte die Blätter von sich. Sie segelten zu Boden, während Dunthorpe ihn finster drohend ansah. »Wer sind Sie?«, knurrte er.
Sam zog die Brauen hoch. Sein Herz schlug so ruhig wie immer. Er hätte ebenso gut an seinem Schreibtisch sitzen und die Times lesen können.
Was sagte das über ihn aus? Vor allem, dass er nicht mehr in der Lage war, wie ein Mensch zu fühlen.
Er zuckte die Achseln und antwortete leise in akzentfreiem Englisch: »Ein besorgter Bürger, der Gott, dem König und unserem Vaterland dient, Mylord. Wir können Ihnen nicht erlauben, Ihr Zerstörungswerk fortzusetzen.«
Er griff in die Manteltasche und zog diesmal die Pistole hervor, die er zugleich spannte. Doch Dunthorpe war flinker, als seine alternde Erscheinung vermuten ließ. Er lehnte sich rückwärts über seinen Schreibtisch, riss die Schublade auf und zog eine Pistole heraus, als Sam auf ihn anlegte.
Sam war im Vorteil, denn er zielte bereits. Sein Herz schlug nicht schneller. Er war die Ruhe selbst. Er drückte ab, als Dunthorpes Lauf noch nach unten gerichtet war.
Der Schuss hallte in Sams Kopf und war laut genug, um die Nachbarschaft zu alarmieren. Dunthorpe brach zusammen und sackte vom Schreibtisch zu Boden.
Jetzt erst schlug Sams Herz heftiger, denn für ihn war Eile geboten. Er musste verschwinden, bevor der Butler angelaufen käme. Sam wollte dem Mann nichts antun, denn bisher deutete nichts darauf hin, dass er in Dunthorpes Machenschaften eingeweiht war.
Sam blickte auf Dunthorpes Leiche. Ein sauberer Schuss ins Herz. Rasch bückte er sich und tastete am Hals nach einem Puls. Der Viscount war tot.
Sofort lief Sam zum Fenster und schüttelte den Vorhang, um Laurent zu signalisieren, dass er jetzt das Haus verließe, dann eilte er zur Tür.
Ein Geräusch ließ ihn innehalten, ein leises, weiblich klingendes Wimmern, das er nicht gehört hätte, wäre er nicht im Zustand höchster Aufmerksamkeit gewesen.
Er horchte, woher das Wimmern kam, und wandte sich dem runden Tisch in der Zimmerecke zu, auf dem er zuvor das Teegeschirr bemerkt hatte. Die Tischdecke reichte bis auf den Teppich.
Mit zwei großen Schritten war er dort und riss die Tischdecke hoch, wodurch die Teekanne umkippte und sich der Inhalt über den Tisch ergoss. Der Tee roch gut – stark und frisch. Er wünschte, Dunthorpe hätte ihm welchen angeboten.
Unter dem Tisch kauerte eine Frau.
Eine kleine, zarte, blonde Dame im weißen Kleid, die sich zusammenkrümmte, sich klein machte, so als könnte er sie dadurch vielleicht übersehen.
Verdammt. Ausgerechnet. Sam biss die Zähne zusammen.
Entsetzt schaute sie zu ihm hoch. »Bitte«, wisperte sie, »bitte nicht schießen.«
Als er ihren französischen Akzent hörte, begriff er, wer sie war. Natürlich. Überrascht von ihrer Anwesenheit und weil er sie in einer ganz und gar ungewöhnlichen Lage – unter einem Tisch versteckt – antraf, hatte er sie nicht gleich erkannt. Vor einem Monat hatte er sie einmal gesehen, während er Dunthorpe beschattete. Da war sie am Arm des Viscounts in die Oper gegangen.
Vor ihm kauerte Lady Dunthorpe, die schöne, elegante, kultivierte französische Gattin des Verräters. Sie war während der Revolution aus Frankreich emigriert, nachdem ihre ganze Familie der Guillotine zum Opfer gefallen war. Um sie vor demselben Schicksal zu bewahren, schickte man sie rechtzeitig zu Verwandten nach England, die dort bereits Zuflucht gefunden hatten, und vor zehn oder elf Jahren hatte sie Dunthorpe geheiratet. Dieser konnte zu jener Zeit auch seine französischen Verbindungen stärken.
Weil sie natürlich mit ihm unter einer Decke steckte. Es konnte nicht anders sein.
Sie hätte heute nicht hier sein sollen. Sie war in ihrem Haus in Brighton gewesen und hätte erst in einer Woche nach London zurückkehren sollen. Dieses Haus hatte seit Tagen unter Beobachtung gestanden, und keiner der Männer hatte berichtet, er habe sie hineingehen oder herauskommen sehen.
Verfluchter Mist.
»Stehen Sie auf«, befahl er schroff.
Ihr Blick schnellte zu Dunthorpe. Um das Loch in seinem grauen Rock hatte sich ein Blutfleck ausgebreitet. Sie holte zitternd Luft, doch sie blieb unter dem Tisch.
Sam erwog seine Möglichkeiten. Sie mit Dunthorpes Pistole zu erschießen war sein erster Gedanke. Aller Wahrscheinlichkeit nach war sie genauso schuldig wie ihr Mann.
Allerdings hatte er sich bei dem, was er für den König und sein Vaterland tun würde, eine Grenze gesetzt: Er würde stehlen, lügen, foltern und töten, aber keinen unschuldigen Bürger kaltblütig umbringen, nicht einmal, um seine eigene Haut zu retten. Er würde nichts tun, was einen seiner Verwandten gefährdete. Und er war nicht bereit, eine Frau zu ermorden.
Diese Grenze war alles, was ihm geblieben war – der dünne Faden, an dem seine Menschlichkeit noch hing, und daran hielt er unter allen Umständen fest.
Sie zu töten schied also aus.
Er könnte sie lassen, wo sie war.
Doch sie wusste bereits zu viel. Aus seinem kurzen Wortwechsel mit Dunthorpe hatte sie genug erfahren, um alles auffliegen zu lassen.
Damit blieb nur noch eins, und das war fast so schlecht wie die anderen zwei Möglichkeiten. Er musste sie mitnehmen.
»Stehen Sie auf«, wiederholte er. Sein Ton war selbst für seine Ohren schroff.
»Ich … will nicht … bitte, ich …«, hauchte sie und bemühte sich ernsthaft, seinem Befehl zu gehorchen, aber vergeblich, denn ihre zitternden Beine trugen sie nicht.
Er steckte die Pistole in seine Manteltasche und ging vor ihr auf ein Knie nieder. Dabei war ihm vollkommen bewusst, dass seine Zeit bereits um war. Sie mussten das Haus verlassen. Sofort.
»Ich werde Ihnen nichts tun«, sagte er und flehte im Stillen, das Versprechen halten zu können. »Aber Sie müssen mitkommen.«
Sie gab einen Laut der Verzweiflung von sich. Seufzend schob Sam die Arme unter sie und stand auf. Sie war ein zierliches Ding, federleicht, doch sie machte sich steif.
»Ich werde Ihnen nichts tun«, versprach er erneut. Sie glaubte ihm nicht, und das konnte er ihr kaum vorwerfen. Wie auch? Sie hatte gerade miterlebt, wie er kaltblütig ihren Mann erschoss.
Die zitternde Lady Dunthorpe fest an sich gedrückt, wandte er sich der Tür zu, dem einzigen Fluchtweg aus diesem Raum, und erstarrte.
Auf dem Holzboden des Korridors erklangen eilige Schritte, und dann flog die Tür auf.
Verdammt. Er hatte zu lange gezögert.
Mit seinen enormen Händen hielt dieser Mann sie fest und unnachgiebig an sich gedrückt. Élise war noch nie von einem Mann getragen worden, und unter anderen Umständen hätte sie es nicht als unangenehm empfunden.
Dieser Mann war gefährlich. Ein Mörder. Er hatte Dunthorpe erschossen.
Dunthorpe. Ihren Mann. Sie hatte keinen Ehemann mehr. Dunthorpe war tot. Sie war … sie war … jetzt Witwe.
Die Arme vor der Brust angewinkelt, krümmte sie sich zusammen. Als könnte sie, wenn sie sich möglichst klein machte, aus diesem schrecklichen Szenario verschwinden. Ihr Atem ging stoßweise, und sie wimmerte leise.
Der Mann blieb abrupt stehen und drückte sie noch fester an sich. Er roch nach frischem Gras und nach Schießpulver.
Die Tür sprang auf. Richards stand halb bekleidet auf der Schwelle und zielte mit einer Pistole auf den Eindringling.
»Was …? Lady … Lady Dunthorpe?«, stammelte Richards.
Der Mann, der sie festhielt, rührte sich nicht. »Die Dame ist verletzt«, sagte er ruhig. »Ich muss sie in Sicherheit bringen.«
Élise holte Luft, um zu widersprechen, doch der Mann drückte sie fester – eine klare Warnung, bei der sie erstarrte.
Sie musste etwas unternehmen, um sich von dem Kerl zu befreien. Aber ihr fiel nichts ein, was sie tun könnte. Wenn sie etwas sagte oder sich von ihm losmachte, würde er ihr wehtun, sie vielleicht sogar umbringen. Schließlich hatte er schon Dunthorpe getötet.
Nein, es war nicht möglich, sich zu befreien.
Jedenfalls nicht im Moment. Sie war nicht so viele Jahre durch die Hölle gegangen und hatte die Ehe mit Dunthorpe tapfer ertragen, weil sie etwa ein einfältig lächelndes Dummchen wäre. Sie würde auf eine passende Gelegenheit warten und sie beim Schopf packen. In der Zwischenzeit würde sie den Schrecken aushalten müssen, der sie ungehemmt durchströmte.
Richards sah sich hastig im Zimmer um und entdeckte den am Boden liegenden Dunthorpe. Élise folgte seinem Blick nicht. Sie wollte den Toten nicht noch einmal anschauen. In ihrem Leben hatte sie schon mehr als genug Leichen gesehen.
Von ihrer Angst übermannt, kniff sie die Augen zu.
»Sie haben ihn umgebracht«, keuchte Richards. »Sie haben meinen Herrn getötet, Sie hinterhältiges Miststück!«
Élise erschrak noch mehr, sofern das überhaupt möglich war. Richards glaubte tatsächlich, sie hätte ihren Mann getötet. Sie und dieser Fremde seien Komplizen … Mon Dieu, non! Sie fing am ganzen Leib an zu zittern.
»Mais non«, widersprach der Fremde höflich. Das war verwirrend. Zuerst redete er mit französischem Akzent, dann akzentfreies Englisch, jetzt Französisch. »Die Dame hat es nicht getan. Es war ein Scharfschütze. Der Schuss kam durchs Fenster.« Und im Ton äußerster Dringlichkeit: »Wir müssen raus. Er könnte noch einmal schießen.«
»Ich sehe keine Glasscherben«, erwiderte Richards misstrauisch.
»Alors, begreifen Sie denn nicht, dass wir in Gefahr schweben? Wir müssen den Salon sofort verlassen.« Der Fremde ließ sie mit einer Hand los, weshalb sie die Augen aufriss. Er stieß den Butler zur Seite, trotz dessen Pistole. Élise spannte sich am ganzen Körper an in Erwartung des Schusses, doch Richards taumelte rückwärts aus der Tür, ohne abzudrücken. »So. Für Ihren Herrn kommt jede Hilfe zu spät, aber Ihre Herrin braucht einen Arzt. Holen Sie einen. Immédiatement!«
»Ich … a-aber …«, stammelte Richards.
»Gehen Sie, Mann!«, rief der Fremde nunmehr verärgert. »Holen Sie den Arzt. Und geben Sie mir die Waffe. Wenn ich den Schützen sehe, werde ich ihn unschädlich machen.« Er wand dem Butler die Pistole aus der Hand.
»Allez!«, brüllte er.
Richards taumelte vor ihnen den Korridor entlang. Der Fremde hielt Élise fest, während er die Treppe hinunterstieg. Unten angelangt blieb er stehen und sah zu, wie Richards die Haustür aufriss und hinter sich zuwarf.
»Verfluchter Mist«, zischte der Fremde, nun wieder in unverfälschtem Englisch.
Den Blick auf die Haustür gerichtet, stand er da und hielt Élise auf den Armen. Sekunden verstrichen.
Élise riskierte einen Blick. Er war eine dunkle, stattliche Erscheinung mit einem schönen, markanten Gesicht, kräftigem Kinn und durchdringenden dunklen Augen, mit denen er sie nun ansah.
»Ich lasse Sie jetzt herunter«, sagte er leise. »Können Sie laufen?«
»Oui …« Sie blinzelte, überrascht, weil sie unwillkürlich Französisch sprach. Es war lange her, seit sie einmal vergessen hatte, Englisch zu sprechen. »Ja.«
Langsam und vorsichtig stellte er sie auf die Füße. Sie zitterte noch immer. Seine Finger schlossen sich um ihren Unterarm, damit sie nicht wegrennen konnte, aber auch die Pistole, die er in der anderen Hand hielt, hinderte sie an der Flucht. »Bleiben Sie dicht bei mir. Und kein Wort.«
»Ja«, hauchte sie.
Wie verlangt schwieg sie, während er mit ihr das Haus verließ. Abgesehen von ihrer Angst gingen ihr tausend Fragen durch den Kopf.
Warum hatte er Dunthorpe getötet? Warum hatte er sie verschont? Wollte er sie entführen? Um Lösegeld zu fordern? Aber wenn ja, wie hatte er wissen können, dass sie heute im Haus war? Niemand wusste von ihrer Fahrt nach London …
Draußen am Bordstein wartete eine schwarze Kutsche ohne Wappen. Ihr Entführer blickte zum Kutscher, der sich die Kappe tief in die Stirn zog und den Kopf wegdrehte, bevor Élise seine Gesichtszüge ausmachen konnte. Sie konnte nur erkennen, dass er schon älter war, denn seine Haare waren grau meliert.
Ihr Entführer öffnete den Schlag, hob sie bei der Taille hoch und warf sie in die Kutsche, als wäre sie ein Stück Fleisch, das er beim Metzger erworben hatte.
Taumelnd griff sie nach einem Halt, fiel aber auf einen Kerl, der im dunklen Innern auf der Bank saß.
»Menschenskind!« Der Mann packte sie bei den Schultern und stieß sie von sich. Dieu, noch so ein Schurke! Vielleicht war es dumm gewesen, keinen Fluchtversuch zu machen, als sie es nur mit einem großen, Furcht erregenden Mann zu tun gehabt hatte. Der zweite war allerdings kleiner und schmächtiger, das musste sie zugeben.
»Wer ist das, Hawk?«, fragte dieser nun.
»Lady Dunthorpe«, antwortete der Große vollkommen ausdruckslos. Er stieg hinter ihr ein und drückte sie dem Komplizen gegenüber auf die in Fahrtrichtung blickende Bank. Dann setzte er sich neben sie, eine bedrohliche Muskelmasse.
Die Kutsche fuhr los. Der Komplize ihr gegenüber musterte sie fasziniert, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Von seinen Gesichtszügen konnte sie ab und zu für einen Moment etwas erkennen, je nachdem, wie das Licht durch den schmalen Vorhangspalt am Fenster des Kutschenschlags fiel. Er war jedenfalls recht jung – fast noch ein Knabe – und hatte ein längliches hübsches Gesicht. Er sah ziemlich … französisch aus.
Sie holte bebend Luft und schloss die Augen.
Dunthorpe ist tot. Dunthorpe ist tot.
Wäre sie eine gute Ehefrau, würde sie jetzt weinen. Aufschreien, wehklagen, tief bekümmert dasitzen, um ihren Gatten trauern. Oder diesen Schurken an die Gurgel gehen, die ihn auf dem Gewissen hatten. Doch sie wusste besser als jeder andere, dass Dunthorpe ihre Tränen nicht verdiente. Überhaupt niemandes Tränen genauer gesagt, obwohl man seinen Tod in England zweifellos als nationale Tragödie betrachtete.
Die Engländer konnten ungeheuer dumm sein.
Es war aufschlussreich: Obwohl sie in der Hand gefährlicher Männer war, empfand sie ihre Situation nicht als so Furcht erregend, wie wenn sie mit Dunthorpe allein gewesen war.
Der Große, Hawk hatte ihn der Junge genannt, hatte versprochen, ihr nichts zu tun. Sie drehte den Kopf zu ihm. Männer versprachen alles, damit eine Frau den Widerstand aufgab, das wusste sie. Sie durfte nicht darauf vertrauen, dass er Wort hielt.
Er begegnete ihrem Blick. Seine Miene verriet keinerlei Regung. Der kühle Ausdruck sandte ihr Schauder der Beklemmung über den Rücken.
»Lady Dunthorpe«, sagte der Junge nachdenklich und ließ seine Überraschung erkennen, »sie hätte gar nicht zu Hause sein sollen.«
»Nein, hätte sie nicht«, bestätigte Hawk düster.
Der Junge holte tief Luft. »Nun ja, was haben Sie mit ihr vor?«
Élise schaute zwischen den beiden hin und her, die über sie redeten, als wäre sie nicht dabei. Jetzt sprach niemand mit französischem Akzent. Vermutlich hatte dieser Hawk diesen nur vorgetäuscht. Aber warum?
Und dann ging ihr ein Licht auf. Das hatte er getan, weil der Eindruck entstehen sollte, Dunthorpes Mörder sei ein Franzose.
Jetzt begriff sie vollkommen. Den Angehörigen eines feindlichen Volkes konnte man viel einfacher als Mörder eines allseits geschätzten Engländers beschuldigen als einen Landsmann.
Hawk schüttelte den Kopf, und sie bemerkte eine leichte Anspannung seiner Lippen. Dieser Mann gab seine Gefühle und Gedanken nicht preis. Wenn sie wissen wollte, was in ihm vorging, würde sie sorgfältig auf kleinste Hinweise achten müssen. Sofern er sie nicht vorher umbrachte, würde sie Gelegenheit haben, seine Beweggründe zu erkennen.
Nun, da ihr Verstand wieder richtig arbeitete, fiel ihr auf, dass sie bereits ein paar Dinge über ihn wusste, und diese zählte sie sich im Geiste auf, während die Kutsche durch eine stille Londoner Straße fuhr. Er war außerordentlich groß und sehr stark. Er war eiskalt und ließ sich nicht das Geringste anmerken. Seine Maske völliger Gleichmut zeigte jedoch feine Risse. Er verstand sich aufs Töten. Er war kein Franzose. Er wusste etwas über Dunthorpes ruchlose Taten, und das jüngste Komplott, was immer es zum Ziel gehabt hatte, war für ihn der Grund gewesen, Dunthorpe zu töten.
Und er hielt sie vermutlich für eine Komplizin ihres Mannes.
Sie schlang die Arme um sich. Sie fror. Es war ein kalter Frühlingsabend, und sie hatte keinen Mantel an.
Trotz allem erfasste sie eine seltsame Ruhe. Sie war bereit, ihr Schicksal anzunehmen, wie immer es aussah. Dunthorpe war tot, und ganz gleich, was nun geschah, es sollte ihr recht sein. Hauptsache, er war nicht mehr am Leben.
Etwas Schweres legte sich auf ihre Schultern, und sie schaute überrascht den großen Mann an. Er legte ihr seinen Mantel um und zog ihn vorne zu, sodass sie warm eingepackt war wie in eine Decke.
Welch fürsorglicher Entführer!
»Sie im Auge behalten«, brummte Hawk seinem Freund zu, nachdem er mit dem Ergebnis zufrieden war, und drehte sich weg – eine späte und unverbindliche Antwort auf dessen Frage, was er mit ihr vorhabe.
»Ah.« Der Junge nickte, und dann schaute er aus dem Fenster. »Wir sind fast da.«
»Ist uns jemand gefolgt?«
»Ich glaube nicht.«
»Hast du den Butler gesehen?«
»Oh ja. Er stürmte aus der Tür und rannte, als wollte ihm der Höllenhund in den Arsch zwicken.« Er warf Élise einen reumütigen Blick zu. »Bitte um Verzeihung, Mylady.«
Sie sah ihn bloß wortlos an, worauf er sich seinem Freund zuwandte und die Brauen hochzog. »Mir scheint, sie ist deinetwegen vor Schreck versteinert, Hawk.«
Dieser musterte sie kurz und zuckte die Achseln. »Das macht es einfacher.«
Trotzig straffte sie die Schultern und verschränkte die Arme vor der Brust. Als ob sie sich damit gegen diese zwei Schurken schützen könnte. »Wer sind Sie?«, wisperte sie. Ihre Stimme klang, als hätte sie eine Woche lang geschwiegen.
»Niemand«, antwortete Hawk ruhig. »Geister. Schemen in der Nacht. Sie haben uns nie gesehen.«
Sie runzelte die Stirn ob dieser absurden Erklärung und setzte gerade zu einer passenden Antwort an, als die Kutsche abrupt anhielt.
»Und da sind wir schon!«, sagte der Junge gut gelaunt. »Willkommen in unserem trauten Heim.«
2
Den Arm fest um Lady Dunthorpes Taille gelegt, betrat Sam ihren geheimen Unterschlupf. Laurent und Carter kümmerten sich um die Pferde und die Kutsche und vergewisserten sich, dass keine heimlichen Beobachter in dunklen Ecken herumlungerten.
Das Haus befand sich zwischen Covent Garden und Piccadilly, in einem sehr belebten Viertel Londons. Sam hatte vor Langem gelernt, dass man sich mitunter am besten unsichtbar macht, indem man vor aller Augen ein scheinbar normales Leben führt.
Er schloss die Tür des Hauses auf und trat ein. Drinnen war es dunkel, doch er war schon oft mitten in der Nacht ohne Licht durch die Gänge gelaufen. Er führte Lady Dunthorpe eine kurze Treppe hinab und lenkte sorgfältig ihre Schritte, damit sie nicht stolperte. Er öffnete die erste Tür rechts und schob sie hinein.
Ins Verlies.
Zumindest nannten Laurent und Carter diesen speziellen Raum so. In Wirklichkeit war es ein recht gut eingerichtetes Schlafzimmer. Für Gefangene vorgesehen, ja, aber Sams Vorgesetzte hielten sich für äußerst zivilisiert und handelten danach, sofern sie nicht gerade einen kaltblütigen Anschlag auf gewisse Personen arrangierten. Sie benutzten keine Ketten und dunkle feuchtkalte Keller oder Kerkerlöcher, wo Ratten hausten und wo man knöcheltief im Schmutz watete. Nein, sie hielten ihre Gefangenen wie hoch geschätzte Gäste. Viele solcher »Gäste« wussten gar nicht, dass sie Gefangene waren.
Dieser Gast weiß es genau, dachte Sam grimmig, als die Tür hinter ihnen im Schloss einrastete und die Dame bei dem Geräusch starr wurde.
Er sagte nichts, um sie zu beruhigen. Was denn auch? Wenn man sie beruhigen musste, dann war er ganz bestimmt nicht der Richtige dafür. Sie würde in ihm nur den Mann sehen, der ihren Gatten getötet hatte.
Stattdessen sagte er: »Einen Moment bitte«, und ließ sie los, um vor dem Kamin in die Hocke zu gehen und Feuer zu machen, was er nach kürzester Zeit bewerkstelligt hatte. Ohne sie anzusehen, zündete er die Lampe an, die auf dem kleinen quadratischen Nussbaumtisch neben dem vergitterten halbhohen Fenster stand, durch das man, wenn die Vorhänge zurückgeschoben waren, auf die Füße der Passanten blickte. Eisenstäbe vor einem Fenster im Erdgeschoss waren in London gang und gäbe und erregten keinerlei Verdacht. Im Gegensatz zu den meisten anderen dienten diese jedoch dazu, Personen am Verlassen des Hauses, nicht am Eindringen zu hindern.
Schließlich schaute er sie an. Sie stand mitten im Zimmer, kerzengerade und angespannt, und sah ihn mit klaren blauen Augen an. Blonde Ringellocken, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatten, hingen ihr ins Gesicht und gaben ihr etwas Wildes, Entrücktes.
Sie war bildschön.
Eine bildschöne französische Verräterin.
Und dabei wirkte sie ungeheuer zerbrechlich. Aber war sie es auch? Vielleicht nicht. Vielleicht hatte dieses zarte Kätzchen bösartige Krallen.
Gegen seinen Willen fand er sie restlos faszinierend.
»Was werden Sie mir antun?«, fragte sie scharf.
»Antun? Nichts.«
Sie blickte ihn an, und ganz offensichtlich glaubte sie ihm nicht. Kluge Frau.
»Sie sollten zu Bett gehen. Morgen früh werden wir uns unterhalten.« Er musste eine Nachricht an Adams schicken. Die Angelegenheit würde sich noch als kompliziert erweisen, da hatte er keine Zweifel. Und er wollte so schnell wie irgend möglich davon befreit sein. Er hatte seinen Auftrag erledigt. Sollte ein anderer sich um Lady Dunthorpe kümmern.
Ihr Blick huschte zu dem großen Bett, das mit Kissen und einer seidenen, mit Silber und Gold bestickten Tagesdecke ausgestattet war.
»Zu Bett gehen«, wiederholte sie ausdruckslos. Als könnte sie den Sinn der Worte nicht so recht erfassen.
»Ja.« Er ging zum Schrank, in dem sie Kleidungsstücke verschiedener Art und Größe aufbewahrten, und nach kurzer Suche fand er ein Nachthemd für sie. Es war ihr gewiss viel zu groß, aber ein anderes gab es nicht. Als er es hervorholte und über die Rückenlehne des chintzbezogenen Lehnstuhls legte, blieb sein Blick an ihrem Kleid hängen. Es entsprach der neusten Mode und erforderte beim An- und Ausziehen die Hilfe einer Zofe.
Sam hätte beinahe gestöhnt, beherrschte sich aber und trat dann scheinbar gleichmütig auf sie zu.
Sie riss die Augen auf und wich erschrocken zurück. »Sie … haben Dunthorpe umgebracht.«
Die Situation war ihm wahrhaft unangenehm. Er konnte von Glück reden, da er bei seinen Taten im Lauf der Jahre wenige Zeugen gehabt hatte. »Ja, das habe ich getan.«
Sie nickte, als müsste sie es sich noch einmal selbst bestätigen. »Ich …« Sie stockte und schien sich eines Besseren zu besinnen. Dann senkte sie den Blick. »Werden Sie auch mich töten?«
Verfluchter Mist. »Nein«, behauptete er fest. »Ich sagte doch, ich werde Ihnen nichts tun.«
»Was ist das Wort eines Mörders wert?«
Nicht viel, das musste er zugeben. »Leider kann ich Ihnen nicht mehr geben.«
Sie blickte auf und sah ihm in die Augen. »Werden Sie sich stattdessen an mir vergehen?«
»Wie bitte? Um Himmels willen, nein!«
»Die anderen denn?« Sie deutete zur Tür und meinte wahrscheinlich Carter und Laurent.
»Nein. Auch darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir sind keine gemeinen Hunde, Mylady«, versicherte er, obwohl er wirklich nicht erwarten konnte, dass sie ihm vertraute.
Sie holte zitternd Luft, und ihre Schultern entspannten sich sichtlich. Offenbar glaubte sie ihm, zumindest mit einem gewissen Vorbehalt.
»Warum sind Sie heute dort gewesen?«, fragte er schroff. »Sie hätten in Brighton sein sollen.«
Ihre Pupillen weiteten sich ein wenig, als er andeutete, dass er einiges über ihr Leben wusste, doch sie kniff die Lippen zusammen und gab keine Antwort.
»Wusste Dunthorpe, dass Sie da sind?«
Sie schüttelte sacht den Kopf. Um ihm Auskunft darüber zu geben oder um ihm die Antwort zu verweigern? Er tippte auf Ersteres. Also war Dunthorpe vielleicht nicht gewahr gewesen, dass seine Frau anwesend war. Interessant.
Sam wollte daraufhin so einiges von ihr erfahren, durfte sie aber nicht drängen. Ihr Mann war gerade gestorben, und sie stand als Frau allein vor seinem Mörder. Es war ein Wunder, dass sie überhaupt noch stand und ihm ins Gesicht sah.
Er sollte Verständnis für ihre Lage haben. Er spürte seiner alten Mitleidsfähigkeit nach und fand eine kleine Scherbe davon, lang vergraben und vergessen inmitten der unbarmherzigen Rücksichtslosigkeit, die er an den Tag legen musste, um geistig einigermaßen gesund zu bleiben.
Keine Fragen mehr. Nicht heute Abend.
Er räusperte sich. »Ich werde Ihnen eine Mahlzeit bringen lassen sowie Waschwasser und eine Haarbürste.« Sie hatte schönes Haar, schimmernde goldblonde Locken, die in bezaubernder Weise zerzaust waren. Er hatte sie mit der Hand gestreift, als er sie festhielt, und sie waren seidenweich gewesen. Es juckte ihn in den Fingern, ihr durch die seidigen Strähnen zu fahren.
Er schob den Gedanken beiseite.
»Und was Sie sonst noch benötigen«, schloss er. Nach kurzem Zögern fragte er: »Darf ich Ihnen bei dem Kleid helfen?«
Wieder wurde sie steif. Er seufzte. Anderenfalls würde sie in Kleid und Mieder schlafen müssen, was sehr unbequem wäre. Ihre Haltung wirkte jedoch so abweisend, dass er davon Abstand nahm, sie zu berühren, damit er ihr Unbehagen nicht noch vergrößerte.
Das Schlimme war, er wollte sie anfassen. Und noch beunruhigender war, er wollte ihr Unbehagen ersparen. Vielmehr wollte er diesen weiblichen Rundungen Lust bereiten, ihre steifen Muskeln lösen. Sie sollte sich an ihn schmiegen, willig in seinen Armen liegen.
Sie ist eine Verräterin, sagte er sich. Eine französische Adlige mit Verbindungen zur französischen Regierung. Und sie war mit Dunthorpe verheiratet gewesen.
Er war müde. Daran musste es liegen. Ihr hübsches Gesicht, ihr zierlicher, kurvenreicher Körper, das schimmernde Kleid, das diesen Rundungen schmeichelte, die glänzenden blonden Locken verfehlten nicht ihre Wirkung. Er hatte die zwei Nächte vor seinem Auftrag nicht geschlafen. Er war müde, und die Erschöpfung brachte seine sorgsam errichteten Bollwerke ins Wanken.
Es war verflucht lange her, seit er eine Frau angefasst hatte. Und wie gern wollte er diese anfassen!
Sie stand da und rührte sich nicht, als wartete sie auf seine Berührung. Fast als wollte sie seine Hände an sich spüren.
Nein, das konnte nicht sein.
»Ich hatte dabei nichts Ungehöriges im Sinn«, sagte er. Das war die Wahrheit. Er hatte tatsächlich nichts dergleichen beabsichtigt. Sosehr er sich auch von ihr angezogen fühlte, fast unwiderstehlich … es durfte keinesfalls passieren. Nicht nur wegen seiner beruflichen Pflicht und Verantwortung. Nicht nur, weil sie vielleicht eine Verräterin war. Nicht einmal, weil er beschlossen hatte, Frauen auf Armeslänge von sich fernzuhalten.
Nein, um Himmels willen, sondern weil er ihren Ehemann getötet hatte. Herrgott noch mal, er musste verrückt sein. Er schüttelte den Kopf.
Sie sah es und zog die Brauen zusammen.
»Verzeihung«, sagte er leise. »Sie werden eine helfende Hand brauchen, um sich das Kleid auszuziehen. Ohne es werden sie besser schlafen. Ich hatte nichts Ungehöriges im Sinn.«
»Also soll ich Ihre Gefangene sein.«
Er nickte mit unbewegter Miene. »Fürs Erste.«
»Wie lange?«
»Bis wir Sie nicht mehr brauchen.« Innerlich zuckte er bei seinen Worten zusammen, denn diese ließen wahrhaftig nichts Gutes ahnen. Überreizte Damen beruhigen hatte bislang selten zu seinen Aufträgen gehört, und er war dabei ein rechter Stümper. Das musste er noch besser hinbekommen.
Er sah sie mühsam schlucken. Sie schaute ihn forschend an. »Ich bin Ihre Gefangene, doch Sie hegen keine Absicht, mir etwas anzutun.«
»So ist es.«
»Was haben Sie denn dann mit mir vor?«
Ohne sie anzusehen, zuckte er die Achseln. Das war genauso ominös. Doch was sollte er sagen? Adams würde Informationen von ihr bekommen wollen. Aber das sollte ein anderer tun. Seine Fähigkeiten lagen beim Eliminieren von Bedrohungen, nicht bei der Kunst des Verhörs.
Wahrscheinlich würde er schon am nächsten Morgen von ihr befreit werden. Gott sei Dank. Diese Frau … Sein Bollwerk hatte Risse bekommen, und sie versuchte auf geschickte Weise einzudringen. Er musste von ihr weg und die Risse schließen, sonst würde sie bald eine Bresche schlagen.
Sie starrte ihn mit großen Augen an. Plötzlich kehrte sie ihm den Rücken zu.
»Bitte helfen Sie mir mit den Knöpfen, Monsieur Hawk.«
Einen Moment lang blickte er wie gebannt auf die weichen Locken, die ihren Nacken kitzelten, auf die dicht gesetzten Knöpfe, die bis zu ihrem Hintern reichten. Wie sähe sie nackt aus? Schön. Makellos. Bilder von weiblichen Kurven und sahneweißer Haut bestürmten ihn.
Er wollte die Stofflagen wegziehen und erkunden, was darunter …
Er holte tief Luft, trat an sie heran und strich die seidigen Haarsträhnen aus dem Nacken. Sie schauderte, als er mit den Fingerspitzen ihre warme Haut streifte. Er wurde hart.
Konzentriere dich, Hawkins!, befahl er sich zähneknirschend. Doch sein Körper war nicht geneigt, der Vernunft zu gehorchen, sich all den Gründen, weshalb er sich jetzt nicht erregen lassen durfte, geschlagen zu geben.
Er richtete seinen Blick auf die schätzungsweise zwanzig winzigen Perlknöpfe an ihrem Rücken. Sie trug ein feines elfenbeinfarbenes, goldbesticktes Seidenkleid, das mit Bändern und Perlen verziert war. Elegant und schön war es und passte wie ein Handschuh, was ihre weiblichen Rundungen auf das Schärfste …
Konzentriere dich auf die verdammten Knöpfe!
Das tat er nun endlich. Von oben angefangen schnippte er einen nach dem anderen aus dem Knopfloch, wodurch der zarte weiße Musselin des Unterkleids zum Vorschein kam. Und mehr blasse Haut ihres Rückens. Sahneweiß und glatt, wie er sie sich vorgestellt hatte.
Ihre Schultern hoben und senkten sich im Takt mit seinen Atemzügen, die in dem völlig stillen Zimmer plötzlich sehr gut zu hören waren. Während seine Finger zwischen Knopfleiste und nackter Haut weiter hinabrückten, gerieten ihre Atemzüge immer ungleichmäßiger. Und er wurde bei dem Geräusch noch härter. Es klang beinahe, aber nur beinahe wie eine Frau in Ekstase.
Er öffnete den untersten Knopf und zog die Säume auseinander, sodass das Kleid aufklaffte. Hastig drehte sie sich herum und hielt es an ihren Busen gedrückt, damit es ihr nicht wegrutschte.
Er musste sich sehr zusammenreißen, um unbeteiligt dreinzuschauen und sie nicht anzustarren wie ein vernarrter Schuljunge, um diesen süßen, bezaubernden Körper nicht förmlich mit den Augen zu verschlingen, sondern einen distanzierten, völlig emotionslosen Blick hinzubekommen.
Sie war eine Schönheit, wie er sehr, sehr lange keine gesehen hatte. Das hatte er schon gedacht, als er sie letzten Monat an Dunthorpes Arm sah, und das dachte er auch jetzt.
Dunthorpe. Allein der Name gab ihm das Gefühl, als hätte man ihm einen Eimer kaltes Wasser übergeschüttet.
Er trat zurück und löste sich von dem Anblick, wie sie das Kleid an die Brust gedrückt hielt. »Nun … brauchen Sie Hilfe beim Mieder?«
»Non.« Scharf und entschieden klang die Antwort, sehr französisch. »Ich komme allein zurecht.«
»Sehr gut. Laurent, der junge Mann, der bei uns in der Kutsche saß, wird Ihnen alles Weitere bringen. Zögern Sie nicht, ihn anzusprechen, wenn Sie noch etwas benötigen.«
Sehr still blickte sie ihn an, die Hand fest am Busen. Das war sein Stichwort, das Zimmer zu verlassen. Doch plötzlich wollte er nicht. Obwohl er Briefe zu schreiben, Anweisungen zu geben, das weitere Vorgehen zu planen hatte. Obwohl er dringend einen klaren Kopf bekommen musste. Und das war nur möglich, wenn er sich entfernte.
»Haben Sie keine Angst vor Laurent«, sagte er sanft. Der Junge hatte strenge Grundsätze, wenn es um Frauen ging – vielleicht strengere als er. »Er wird sich vollkommen anständig verhalten.«
Er sah sie die Schultern straffen. Ihre blauen Augen funkelten trotzig. »Ich habe keine Angst vor ihm.«
Diese Französin, diese englische Viscountess war in reizvoller Weise widersprüchlich, eben noch vor Angst zitternd, dann plötzlich gleichmütig und steif, bevor sie die Krallen ausfuhr.
Er konnte ihr solch schwankendes Benehmen nicht vorwerfen. Sie musste sehr aufgewühlt sein.
Dennoch durfte er kein Mitgefühl für sie entwickeln. Sie hatte sich ihre Lage selbst zuzuschreiben. Sich selbst und Dunthorpe.
»Geht es Ihnen einigermaßen gut?«, fragte er.
Sie nickte knapp. Er nickte ebenfalls, dann deutete er auf den Klingelzug neben dem Kamin. »Läuten Sie, wenn Sie etwas brauchen.«
Sie zog gebieterisch die Brauen hoch, und Ärger leuchtete aus den blauen Augen. »Sie meinen, wenn ich etwas von dem Mann brauche, der meinen Gatten ermordet hat? Der mich entführt hat? Ah ja, gewiss doch. Dann werde ich läuten.« Sie machte eine wegwerfende Geste in Richtung Kamin.
Er runzelte die Stirn. »Ich sagte doch, wir hegen keine Absicht, Ihnen etwas anzutun.«
»Ach, Monsieur Hawk«, begann sie in zynischem Tonfall, doch als sie seinem Blick begegnete, schaute sie klar und aufrichtig, »die ganze Welt hegt die Absicht, mir etwas anzutun. Schon immer.«
Dunthorpe ist tot. Dunthorpe ist tot.
Élise saß in einem fremden Nachthemd in einem fremden Bett, die Arme um die angezogenen Knie geschlungen. Dieser Satz ging ihr immer wieder durch den Kopf, und er war tatsächlich wahr. Dunthorpe war tot, und ihr Leben würde nie wieder so sein wie vorher. Sein Bruder Francis erbte nicht nur den Titel, sondern auch den gesamten Besitz und das Vermögen. Sie war nicht so dumm zu hoffen, ihr Mann hätte ihr auch nur einen Penny hinterlassen.
Nicht dass es von Bedeutung gewesen wäre. Sie entstammte einer reichen Familie, hatte schon einmal alles verloren und schließlich erneut ein Leben in Reichtum geführt. Achtundzwanzig Jahre hatte sie gebraucht, um zu erkennen, dass die ärmsten Jahre die beste Zeit ihres Lebens gewesen waren.
Dunthorpe ist tot.
Sie war frei.
Vielleicht nicht allzu frei. Francis würde versuchen, sie gefügig zu machen. Allerdings hatte er im Gegensatz zu Dunthorpe nicht das Recht, über sie Macht auszuüben. Es würde viel leichter sein, sich von ihm loszumachen, als sich Dunthorpe zu entziehen.
Wenn sie wenigstens die Gelegenheit hätte, Francis zu entkommen. Dazu müsste sie sich erst einmal aus der Gewalt dieser drei Männer befreien.
Wer waren die? Was wollten sie von ihr? Warum hatten sie Dunthorpe umgebracht? Was ihr an Antworten dazu einfiel, war nicht befriedigend. Dunthorpe hatte viele Feinde gehabt, das wusste sie. Diese Männer mochten ihre eigenen Zwecke verfolgen oder auf Befehl eines einzelnen Widersachers handeln oder für eine Regierung arbeiten.
Allerdings waren sie Briten. Gentleman-Spione? Gentlemen waren sie – zumindest Hawk. Das war aus seiner Sprechweise leicht herauszuhören.
Es klopfte leise an der Tür. Sie drehte den Kopf dorthin und zog die Knie bis unters Kinn. Die Tür ging auf, und herein kam Laurent mit einem Tablett, darauf ein Teller mit Essen und ein Glas Rotwein.
Er lächelte sie freundlich an, und sie atmete tief und gleichmäßig, um ihr Zittern zu unterdrücken. Es war so ungewöhnlich, dass ein Mann ihr Zimmer betrat, während sie im Nachthemd im Bett saß. Seit sie das Jugendalter erreicht hatte, war das nicht mehr vorgekommen, abgesehen von den wenigen Malen, da Dunthorpe in ihr Schlafzimmer kam, damit sie ihre eheliche Pflicht erfüllte. Und das war in den vergangenen paar Jahren selten passiert.
»Ich bitte um Verzeihung.« Seine Stimme klang weich, kultiviert und sehr britisch, obwohl er einen französischen Namen hatte. Er war sehr jung. Wenn seine Eltern vor der Revolution geflohen waren, war er vermutlich in England zur Welt gekommen. »Ich wollte Sie nicht stören. Ich bringe nur etwas zu essen – Brot und Käse – und ein Glas Wein.«
Sie schaute ihn an, während er das Tablett auf den Tisch stellte, und wusste nicht, was sie sagen sollte. Es war schwierig, auf alltägliche Weise mit diesen Männern zu reden – wie könnte sie mit den Leuten, die ihren Mann ermordet hatten, freundlich über Nichtigkeiten plaudern?
»Gut«, sagte Laurent, nachdem sie schwieg. »Also, ich gehe jetzt zu Bett, aber wenn Sie etwas brauchen, klingeln Sie bitte. Ich komme dann sofort.«
Sie blieb in ihrer zusammengekrümmten Haltung sitzen, öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber ihr fiel nichts ein, das sie als angemessen empfunden hätte. Danken wollte sie ihm nicht. Darum nickte sie schließlich nur.
Er wünschte ihr eine gute Nacht und zog die Tür hinter sich zu. Sie hörte ihn den Schlüssel im Schloss drehen.
Die Herren mochten schlafen, ihr dagegen würde das nicht möglich sein. Sie würde erst wieder ein Auge zutun können, wenn sie diesen gefährlichen Engländern entkommen war.
Sie hatte sich schon überlegt, nach Hampstead zu Marie zu gehen. Marie war ihre einzige wirkliche Freundin.
Doch diese verfügte nicht über die nötigen Mittel, um Élise vor Francis zu verstecken. Bei Marie war sie letztendlich nicht sicher, und sie wollte ihre Freundin nicht in Gefahr bringen. Daher würde sie dort nur kurz bleiben können, gerade so lange, um sich das Nötigste zu beschaffen, dann würde sie weiterziehen. Sie würde verschwinden. Vielleicht nach Frankreich?
Bei dem Gedanken schnaubte sie höhnisch.
Nein, ganz gewiss nicht nach Frankreich. Lieber irgendwohin, wo niemand nach ihr suchen würde. Ins schottische Hochland vielleicht. Oder nach Irland. Dort würde sie ganz sicher niemand vermuten.
Ein neues Leben. Ein neues Leben würde sie beginnen, wo niemand etwas von einer Élisabeth de Longmont wusste und wo sie niemand als Lady Dunthorpe kannte. Das war Freiheit.
Aber zuerst einmal musste sie aus diesem Haus fliehen.
Sie wartete zehn Minuten, dann schwang sie die Beine aus dem Bett und ließ sich von der Bettkante gleiten. Die Bodendielen waren kalt unter ihren bestrumpften Füßen. Sie ging zum Schrank, der mit Kleidern für Damen und Herren jeder Größe und Gestalt vollgestopft war. Sie wühlte darin, bis sie ein Hemd und ein Paar Breeches gefunden hatte, die offenbar für einen Jüngling in Laurents Alter gemacht waren.
Sie waren dennoch zu groß, aber davon abgesehen genau das Richtige für sie.
Rasch schlüpfte sie aus dem lächerlichen Nachthemd. Mieder und Unterhemd hatte sie anbehalten und zog sie auch jetzt nicht aus. Das Mieder sorgte für eine flache Brust, und obwohl sie sich keine Illusionen machte, sie könnte wie ein Mann aussehen, würden ihre Zierlichkeit, die Verkleidung und die Dunkelheit dafür sorgen, dass sie nicht auffiel.
Sie zog das Hemd über, das ihr bis über die Knie reichte, und band es am Hals zu. Dann stieg sie in die Hose, aber diese war hoffnungslos zu weit und rutschte ihr von den Hüften. Mit einem Gürtel oder Hosenträgern war sie nicht ausgestattet, und auch der Schrank gab nichts dergleichen her.
Auf der Unterlippe kauend hielt sie die Hose in der Taille fest und überlegte. Langsam drehte sie sich im Kreis und schaute durch das schmucklose Zimmer. Es enthielt den Kleiderschrank, den sie schon durchsucht hatte, das Bett mit der Matratze und ein paar weitere Möbel, eine dicke Bettdecke, einen seidenen Bettüberwurf und vier Kissen, aber keinen Bettvorhang. Sie ging zum Schreibtisch und zog die drei Schubladen auf. Alle leer.
Ihr Blick fiel auf das Kleid, das sie heute getragen hatte.
Sie ließ die Breeches fallen und stieg aus den Hosenbeinen. Ohne dem Tablett, das auf dem Tisch lag, die geringste Beachtung zu schenken, nahm sie das Kleid vom Sessel und trug es zum Bett, um es darauf auszubreiten.
Mit einem energischen Ruck riss sie ein Loch in den Rocksaum und bekam das dünne goldene Band zu fassen, das durch die Hohlsaumstickerei gefädelt war. Es ließ sich mühelos herausziehen.
Als das geschehen war, zog sie die Breeches wieder an und schnürte sich das Band um die Taille. Sie blickte an sich hinunter. Der Hosenbund bauschte sich über Unterhemd und Mieder, zusammengehalten von einem albernen damenhaften Zierband. Es sah unbeschreiblich lächerlich aus. Aber wenigstens brauchte sie nicht nackt durch London zu rennen.
In dem Schrank gab es drei Mäntel. Sie wählte den kleinsten aus und hüllte sich darin ein, dann zog sie eine Haarnadel aus ihrem Chignon und setzte sich eine Wollmütze auf, unter der ihre Haare vollständig verschwanden.
So näherte sie sich der Tür und lauschte. Alles war still. Darauf bückte sie sich vor das Schloss und führte die Haarnadel ein.
Es brauchte mehrere Minuten äußerster Konzentration, in denen sie sich die Zuhaltungen und die Position der Nadelspitze vorstellte. Sie war beileibe keine geübte Schlossknackerin, aber in den elf Jahren Ehe mit Dunthorpe hatte sie aus reinem Selbsterhaltungstrieb ein paar Dinge lernen müssen.
Es klickte.
Sie erstarrte. Nach einem Augenblick angespannten Horchens stieß sie erleichtert den Atem aus.
Behutsam zog sie die Haarnadel aus dem Schloss und schob sie unter der Mütze in den Chignon. Dann öffnete sie ganz langsam die Tür.
3
Carter klopfte Sam auf den Rücken. »Hier.« Er stellte ein Glas Portwein vor ihn auf den Schreibtisch. »Der wird dir guttun.«
Sam schaute von dem Portwein zu Carter hoch.
»Du solltest schlafen gehen«, sagte Carter.
Ja, das sollte er. Aber Carter wusste auch, dass er oft nicht einschlafen konnte. »Ich wünschte, ich hätte Laurents Verfassung«, sagte er. »Kaum liegt er da, schnarcht er auch schon.«
»Zweifellos.« Carter deutete auf das Glas und sagte ruhig: »Der wird helfen. Trink aus, Junge.«
Sam zog die Mundwinkel nach unten. Carter war wesentlich älter als er und schon länger in ihrer Organisation tätig. Aber auch Sam war mit seinen zweiunddreißig Jahren kein linkischer Jüngling. Meistens fühlte er sich sogar viel älter. Außerdem war er der Befehlshaber ihrer kleinen Gruppe. Deshalb irritierte es ihn, wenn Carter ihn »Junge« nannte. Dieser wusste das und grinste.
»Ab ins Bett«, sagte er und drückte Sams Schulter. »Morgen früh überlegen wir uns, was zu tun ist.«
»Ich gehe gleich nach unten.« Sein Zimmer lag neben dem von Lady Dunthorpe. Er schlief immer neben dem Gefangenen, falls dieser während der Nacht etwas brauchte oder etwas Dummes anstellte wie zum Beispiel einen Fluchtversuch.
Carter nickte, dann ging er hinaus und steuerte sein Bett in einem der oberen Zimmer an.
Endlich allein, schaute Sam auf den Schreibtisch. Neben dem Glas Portwein lag der Brief mit dem jüngsten Befehl. Laurent hatte seinen Bericht zu Adams gebracht und war innerhalb einer Stunde mit der Antwort zurückgekommen: Halten Sie die Frau bis auf Weiteres fest.
Verdammt.
Er saß in London fest. Musste eine Frau beherbergen, bei deren Anblick sein Herz jedes Mal zu hämmern anfing.
Deren Ehemann er getötet hatte. Die praktisch dabei gewesen war.
Darauf war er nicht im Geringsten erpicht.
Um sich von den Gedanken an Lady Dunthorpe abzulenken, wandte er sich dem zweiten Brief zu, der neben dem Portweinglas lag. Er war von seinem jüngeren Halbbruder, dem Herzog von Trent.
Darin unterrichtete er Sam, wie weit die Suche nach ihrer Mutter gediehen war, die sie seit dem vergangenen Frühling vermissten, also fast ein Jahr nun. Und obwohl sie inzwischen erfahren hatten, dass sie am Leben war und sich in Gesellschaft eines Zigeuners namens Steven Lowell befand, wussten sie noch immer nicht, wo sie sein könnte oder warum sie nichts von sich hatte hören lassen, nachdem sie diesen Roger Morton losgeworden war.
Er faltete den Brief auseinander und las ihn noch einmal.
Sam,die Suche nach Lowell hat endlich etwas ergeben, auch wenn wir seinen Aufenthaltsort oder den unserer Mutter noch nicht kennen. Allem Anschein nach ist er in gewissen Kreisen in und um London wohlbekannt, denn er ist der Kopf einer fahrenden Truppe von Schaustellern.
Sam rieb sich die Nasenwurzel und schüttelte den Kopf. Fahrende Schausteller. Er hatte die Zeile zehn Mal lesen müssen, bis sie in seinem Verstand angekommen war und er sie in ihrer ganzen Tragweite begriff. Seine Mutter, die Herzoginwitwe von Trent, hatte sich zu einer Bande von Jongleuren, Wahrsagern und weiß Gott was für Leuten gesellt. Vielleicht trat sie gar mit ihnen auf. Wie er seine Mutter kannte, war das nicht abwegig.
Er las weiter.
Unsere Mutter ist mit ihnen in Wales zusammengetroffen und mit ihnen nach Lancashire weitergereist. Wohin sie von dort aus gefahren sind, ist jedoch unklar. Sie scheinen planlos von einem Ort zum anderen zu fahren.
Also war sie vermutlich noch in England. Sie war die ganze Zeit über in England gewesen, während die gesamte Familie nach ihr suchte. Natürlich käme niemand auf die Idee, sie könnte bei einer Bande von Schaustellern untergeschlüpft sein, die von einem Zigeuner angeführt wurde.
Ich schicke Theo und Mark nach Lancashire, damit sie mehr in Erfahrung bringen. Du hörst von mir, sobald wir etwas wissen.