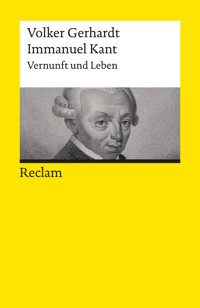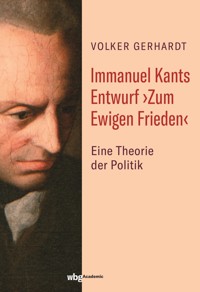24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit der Antike ist "Humanität" ein Leitbegriff für menschliches Handeln und menschliche Würde. Doch die zur Floskel heruntergekommene Formel setzt ein Bild des Menschen voraus, das nur selten hinterfragt wird. Volker Gerhardt, einer der prominentesten deutschen Philosophen, geht dieser Selbstbeschreibung des Menschen nach, überwindet die traditionelle Geringschätzung der Tiere und entfaltet ein radikal neues Verständnis der Beziehung von Natur und Kultur.
Wir sind in einem Zeitalter der globalen Vernetzung angekommen, in dem vom Klimawandel bis zur Genforschung alle Menschen von einer neuen Verwandlung der Welt betroffen sind. Mehr denn je ist deshalb heute die Frage nach der einen Menschheit und dem, was sie verbindet, aktuell, ja überlebenswichtig - denn viele Herausforderungen der Zukunft werden sich nicht isoliert, sondern nur gemeinsam lösen lassen. Auch die Philosophie muss darauf reagieren und ihre althergebrachten Begriffe in Frage stellen. Volker Gerhardt tut das und stellt in seinem Buch den "Geist der Menschheit" auf eine erweiterte, zur Erhaltung von Natur und Kultur verpflichtende Grundlage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Volker Gerhardt
HUMANITÄT
Über den Geist der Menschheit
Zum Buch
Seit der Antike ist «Humanität» ein Leitbegriff für menschliches Handeln und menschliche Würde. Doch die zur Floskel heruntergekommene Formel setzt ein Bild des Menschen voraus, das nur selten hinterfragt wird. Volker Gerhardt, einer der prominentesten deutschen Philosophen, geht dieser Selbstbeschreibung des Menschen nach, überwindet die traditionelle Geringschätzung der Tiere und entfaltet ein radikal neues Verständnis der Beziehung von Natur und Kultur.
Wir sind in einem Zeitalter der globalen Vernetzung angekommen, in dem vom Klimawandel bis zur Genforschung alle Menschen von einer neuen Verwandlung der Welt betroffen sind. Mehr denn je ist deshalb heute die Frage nach der einen Menschheit und dem, was sie verbindet, aktuell, ja überlebenswichtig – denn viele Herausforderungen der Zukunft werden sich nicht isoliert, sondern nur gemeinsam lösen lassen. Auch die Philosophie muss darauf reagieren und ihre althergebrachten Begriffe in Frage stellen. Volker Gerhardt tut das und stellt in seinem Buch den «Geist der Menschheit» auf eine erweiterte, zur Erhaltung von Natur und Kultur verpflichtende Grundlage.
Über den Autor
Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat für sein Werk zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erhalten. Bei C. H.Beck erschien zuletzt von ihm: «Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche» (42017).
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Selbstverständnis ohne Abwertung anderer
Kapitel 1: PhilanthropieIm Menschen die Menschheit lieben
Kapitel 2: Homo quaerensDer Mensch als Problem an sich selbst
Kapitel 3: Animal sociale cum rationaleBewusstsein verbindet
Kapitel 4: Homo sapiens est homo faberDer unterschätzte Anteil der Technik
Kapitel 5: Homo ludens, negans et creatorDas Spiel im Aufbau der Kultur
Kapitel 6: Homo publicusÖffentlichkeit als Instanz der Menschheit
Kapitel 7: HumanitätDie Realität einer Idee
Beschluss: Über den Geist der Menschheit
Anmerkungen
Einleitung: Selbstverständnis ohne Abwertung anderer
Kapitel 1: PhilanthropieIm Menschen die Menschheit lieben
Kapitel 2: Homo quaerensDer Mensch als Problem an sich selbst
Kapitel 3: Animal sociale cum rationaleBewusstsein verbindet
Kapitel 4: Homo sapiens est homo faberDer unterschätzte Anteil der Technik
Kapitel 5: Homo ludens, negans et creatorDas Spiel im Aufbau der Kultur
Kapitel 6: Homo publicusÖffentlichkeit als Instanz der Menschheit
Kapitel 7: HumanitätDie Realität einer Idee
Beschluss: Über den Geist der Menschheit
Literatur
Personenregister
Sachregister
Für Birgit Recki
«Das Wort Humanität bezeichnet nicht schon unsere Natur, sondern das sittliche Verhalten eines Menschen, das seiner Natur würdig ist.»
(Erasmus von Rotterdam, Klage des Friedens, 1516)
Vorwort
Soweit ich zurückdenken kann, war die mich leitende Frage im Werk Immanuel Kants seine eigene Zusammenfassung der drei systematischen Leitfragen allen Philosophierens zu einer einzigen: «Was ist der Mensch?» Meine Dissertation und Habilitation gingen ihr mit Blick auf das Verhältnis von Vernunft und Interesse einerseits und von Macht und Willen andererseits nach. Meine akademische Lehre habe ich mit einer Vorlesung zur philosophischen Anthropologie begonnen. Und alles, was ich in den Jahren seitdem geschrieben habe, lässt sich als Versuch verstehen, der Antwort auf die Frage nach der Natur des Menschen näherzukommen.
Das gilt allgemein für das nur dem Menschen zum Problem werdende Verhältnis von Individualität und Universalität, für die Suche nach dem Zusammenhang von Selbstorganisation und Selbstbestimmung, für die Vereinbarkeit von Freiheit und Natur, für die von Menschen als ihre zentrale Aufgabe verstandene Partizipation sowohl am Ganzen einer Gemeinschaft wie auch am Ganzen der Welt. Dazu schafft sich der Mensch einen singulären Raum des Welt- und Selbstverstehens, den er Öffentlichkeit nennt und der mir erst vollständig erscheint, wenn die erhabene Sphäre des Göttlichen hinzugehört. Insofern ist auch die Suche nach dem Sinn des Sinns eine Bemühung, die uns nur beim Menschen begegnet.
Es hat freilich eine Weile gedauert, bis die Humanität zu meinem ausdrücklichen Thema wurde. Es geschah unter dem Eindruck der Erfolge des Humangenomprojekts, das bedeutende Fortschritte bei der Entschlüsselung des menschlichen Genoms gebracht hat. Doch die Frage nach der Eigenart des Menschen erschien offener als je zuvor, nachdem klargeworden war, dass die menschliche Erbsubstanz sich nur um wenige Prozentpunkte von der der Ackerwinde und um gerade einen Prozentpunkt von der der Primaten unterscheidet. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat daher von 2005 bis 2012 ein Humanprojekt gefördert, das die Einsichten der genetischen Forschung mit Blick auf das Selbstverständnis des Menschen aufnehmen und weiterführen sollte.
Zusammen mit Julian Nida-Rümelin und Detlev Ganten und vorzüglich unterstützt von einer durch Jan-Christoph Heilinger koordinierten Nachwuchsforscher-Gruppe zum Thema Bewusstsein als Mitteilung wurde hier der Frage nach dem Menschen mit interdisziplinärem Anspruch nachgegangen. Die Publikationsreihe des Humanprojekts ist bis heute nicht abgeschlossen. Sie umfasst inzwischen fünfzehn Bände und gibt vielfach Auskunft über die Funktionen des Bewusstseins, die Naturgeschichte der Freiheit, den menschlichen Ausdruck, den Begriff der Person, die Evolution in Natur und Kultur sowie über einige Voraussetzungen der menschlichen Sprache. Auch ein Sammelband mit zeitgenössischen Antworten auf Kants Frage «Was ist der Mensch?» gehört dazu.
Schon vor dem Abschluss der Forschungen im Humangenomprojekt lösten die Fortschritte der medizinischen Technik eine erneute Debatte über den Beginn des menschlichen Lebens aus. War man früher entweder von theologischen Lehrsätzen oder von Erwägungen über den Reifungsgrad des Embryos ausgegangen, so glaubte man nun, in der Zell- oder gar Kernverschmelzung von Ei- und Samenzelle ein objektives wissenschaftliches Kriterium für ein unter Würdeschutz stehendes menschliches Leben gefunden zu haben. Dass auch hier ein Anlass lag und liegt, über die Natur des Menschen nachzudenken, wird niemand bestreiten können, insbesondere dann nicht, wenn er den Menschen für ein soziales Wesen hält, das bereits in seinem embryonalen Werden auf eine symbiotische Beziehung zur werdenden Mutter angewiesen ist. Nachdem neuerdings aber fraglich geworden ist, wie und wann die sogenannte Kernverschmelzung stattfindet, ist die auf ein bloßes mikrologisches Faktum gestützte Antwort fraglicher als je zuvor.
Starkes öffentliches Interesse zieht inzwischen aber das nicht allein durch die Fortschritte der Wissenschaften und ihre Technologien, sondern auch durch das ökonomische und ökologische Verhalten des Menschen zum globalen Skandal gewordene Ungleichgewicht zwischen der Zivilisation des Menschen und seiner Umwelt auf sich. Was ist das für ein Wesen, das sich nicht nur durch unablässige Missachtung seiner Nächsten selbst verächtlich macht, und es auch nicht dabei belässt, sein Leben durch Verbrechen und Kriege zur Hölle zu machen? So hat man noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gefragt. Nun aber kommt das Unverständnis hinzu, wie der Mensch, der Wert darauf legt, animal rationale und homo sapiens genannt zu werden, so leben kann, dass er bald nichts mehr zum Leben hat? Und was macht es dem Menschen, der sich so viel auf sein Mitgefühl zugutehält, möglich, so gleichgültig, ja so schändlich mit anderen Lebewesen umzugehen? Und wie können wir uns erklären, dass er bei einer so geringen genetischen Differenz zu den anderen Tieren in eine derart dominante, sie alle gefährdende Stellung gelangen konnte?
Also weiterhin mit Kant gefragt: Was ist der aus «krummem Holz» geschnitzte Mensch, dass er eine solche Überlegenheit erringen konnte und überdies als einziges Lebewesen den Anspruch auf eine unantastbare Würde erhebt? Die Antwort, die ich darauf geben kann, liegt darin, dass sich der Mensch als ein Naturwesen, das er ist und am Ende immer bleibt, bis heute nicht aus den unbarmherzigen Gegensätzen der Natur befreit hat. Er bleibt ihnen nicht nur ausgesetzt, sondern auch in ihnen befangen, obgleich er sich im Laufe der Jahrtausende mit der Kultur selbst einen Raum eröffnet hat, der ihn vor einem Teil der Widrigkeiten bewahren und sich auch vor sich selber schützen kann. Gleichwohl hat die Kultur mit der Sensibilität für den Schmerz und für feinste Unterschiede auch das Potenzial verstärkt, grausam und gefühllos zu sein.
Mit dem Aufbau der Kultur wuchsen die Einsicht und die Handlungsmöglichkeiten des Menschen. Er hat sie in effektiver Weise auf die Nutzung der Naturkräfte konzentriert, was auch durch die Steigerung der zunehmend auf viele Menschen verteilten Leistungen möglich war. Damit nahmen die Verbindlichkeiten gegenüber seinesgleichen zu, denen er sich zunehmend in ihrer Gesamtheit verpflichtet sah. Darauf waren bislang die Sorge der Ethik und die der Sozialphilosophie gerichtet.
Doch mit dem Anstieg der kollektiven Macht des Menschen stieg nicht nur seine Zahl in beträchtlicher Weise an: Seine lange Zeit nur begrenzten Eingriffe in die Natur weiteten sich mit dem Einsatz wissenschaftlich perfektionierter Techniken aus wie ein Flächenbrand. Sie nahmen globale Ausmaße an und brachten im Laufe zweier Jahrhunderte das seit Jahrtausenden stabile Verhältnis der Lebenskräfte auf der Erde aus dem Gleichgewicht.
Darauf lässt sich nun nicht mehr mit einzelnen Maßnahmen reagieren. Die schon längst zu einer kulturellen Einheit gewordene Menschheit muss endlich lernen, sich als Ganze auf die Verletzlichkeit der Natur, die ihn trägt und der er selber zugehört, einzustellen. Das wissen heute viele, und es gibt nicht wenige, die ein Umdenken und Umlenken fordern. Es fehlt auch nicht an Ideen, die Menschheit vor der drohenden Selbstzerstörung zu bewahren. Doch offenkundig bleibt das ohne nachhaltigen Einfluss auf ihr tägliches Verhalten.
Die Philosophie hat sich durchaus Mühe gegeben, daran etwas zu ändern. Allein im deutschen Sprachraum gibt es bewegende, ja, aufrüttelnde kulturkritische, politische und ethische Schriften, die mit den Namen von Karl Jaspers, Günther Anders, Carl Friedrich von Weizsäcker und Hans Jonas verbunden sind. Deren Impulse stehen im Hintergrund, wenn ich im Folgenden die weitaus bescheidenere Frage stelle, wie denn das Subjekt beschaffen ist, auf das sich die Erwartungen einer Wende im menschlichen Verhalten richten: Was macht den Menschen, was macht die Menschheit aus, an deren Aktivität wir appellieren, wenn eine humanpolitische Wende erfolgen soll? Wen oder was meinen wir, wenn wir von Menschheit sprechen? Und was macht uns dabei so sicher, dass wir glauben, darauf das Menschenrecht gründen zu können? Der «Geist der Menschheit», den Wilhelm von Humboldt zu ergründen suchte, ist in der Form der Grundrechte zum Fundament der freiheitlichen Demokratien geworden, doch in den öffentlichen Debatten ist kaum von ihm die Rede.
Längst ist offenkundig, dass die viel zu eng und sachlich problematisch gewordenen Leitbilder der Nation, der Religion, der Klasse oder der Rasse untauglich sind, weltoffenen Gesellschaften Ziel und Halt zu geben. Sie sind erst recht nicht in der Lage, die existenzielle weltpolitische Wende anzuleiten. Und da es nicht in Zweifel stehen darf, dass alles, was nötig ist, im Interesse und im Namen der Menschheit zu erfolgen hat, liegt es nahe, das ethische und politische Handeln unter das Ideal der Humanität zu stellen. Folglich kann sich die Philosophie der Aufgabe nicht entziehen, ihr Augenmerk auf die Eigenart der Menschheit zu richten, der das Schicksal widerfährt, sich in eine ausweglos erscheinende Lage gebracht zu haben, aus der sie sich gleichwohl selbst zu befreien hat.
Für Kant, der Individualität und Universalität vornehmlich im Begriff des Menschen verbunden wusste, fiel die Frage nach dem Menschen mit der nach der Menschheit in eins. Und so erörtern auch wir die Natur des Menschen mit dem Blick auf den Geist der Menschheit, der jedem Einzelnen die Verantwortung auferlegt, sich in seinem Handeln nach Maßgabe seines humanen Selbstbegriffs zu bestimmen. Nur wenn sich der Mensch seiner Verantwortung im Bewusstsein der schier unglaublichen Schwierigkeiten stellt, die er im Gang seiner geschichtlichen Entwicklung bereits überstanden hat, kann er das Selbstvertrauen gewinnen, die derzeit als unlösbar erscheinenden globalen Aufgaben anzugehen.
Der Mensch braucht heute nicht nur den für die Aufklärung geforderten «Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen». In Kenntnis seiner Herkunft, im Wissen von seiner Bindung an die Natur – damit aber auch an die Technik und an seinesgleichen – kurz: im Bewusstsein seiner Zuständigkeit für seine Welt hat er heute den Mut aufzubringen, ein Mensch zu sein. Dass dazu auch die Chancen gehören, die ihm sein Bewusstsein, seine Freiheit, sein Können und seine Fähigkeit, lebenslang zu spielen, eröffnen, sollte dabei nicht vergessen werden.
Die Paradoxie der Lage des Menschen zeigt sich darin, dass er «nein» sagen kann – und damit allererst die Chance hat, produktiv zu werden. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich wissentlich ins Unglück stürzen kann, und dabei die Chance hat, den definitiven Sturz zu vermeiden. Wann immer ihm dies gelingt, kann er sich zugutehalten, seinem Leben aus eigener Kraft eine beglückende, erhebende und vielleicht sogar Erfüllung bietende Wende gegeben zu haben. Auf diese Dialektik wird der Einzelne in nächster Zukunft nur noch setzen können, wenn es auch der Menschheit gelingt, in ihr zu bestehen.
An drei Vorbemerkungen zum Text ist mir gelegen:
Einiges von dem, was im Buch entwickelt ist, verdankt sich Diskussionen mit Naturwissenschaftlern. Mit ihnen möchte ich weiterhin im Gespräch bleiben. Deshalb habe ich den Anteil philosophischer Terminologie, so gut es ging, reduziert und der Schilderung des Zusammenhangs von Natur und Kultur besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Im Nachhinein hat sich Nietzsche als der wohl einflussreichste Kritiker der Humanitäts-Idee erwiesen. Das rechtfertigt die wiederholte Auseinandersetzung mit seinen Texten, in denen sich zeigt, dass er auch in diesem Punkt perspektivisch verstanden werden muss und wahrhaft mehr bietet als Kritik. Die philosophischen Voraussetzungen für eine Kritik an Nietzsche sind bereits bei Platon und Kant zu finden – den beiden Denkern, denen er am wenigsten gerecht geworden ist.
Das Buch wäre kürzer geworden, wenn ich es zum zweiten Mal hätte schreiben können – doch mit der Behebung der mir dann vermutlich unzumutbar erscheinenden Defizite hätte es mühelos doppelt so lang werden können. In seiner ersten Fassung protokolliert es den anfangs gar nicht abzusehenden Weg zur Einsicht, der für mich nunmehr zu ihrem Verständnis gehört. Vielleicht helfen die Umwege auch dem Leser, das Ergebnis zu verstehen.
Berlin und Hamburg, im September 2018Volker Gerhardt
Einleitung
Selbstverständnis ohne Abwertung anderer
«Unserer großen und mächtigen Mutter Naturgeschähe Unrecht, wenn wir sie mit unseren Künstenvon ihrem Ehrenplatz verdrängten.»
(Montaigne, Essais I, 31)
Blickt man auf die Themenschwerpunkte der Philosophie in den letzten zehn Jahren, stellt sich der Eindruck ein, man könne die Aktualität im Fach gar nicht gründlicher verfehlen als durch ein Buch über den Menschen. Alle Aufmerksamkeit ist derzeit den Tieren und zunehmend auch den Pflanzen gewidmet. Die Autoren sind, vollkommen zu Recht, überzeugt, dass Tiere Bewusstsein haben, und möchten nun genauer wissen, bei welchen Tieren das in welchem Umfang der Fall ist. Die früher vorrangige Frage nach der «Sonderstellung» des Menschen erscheint schon als solche verfehlt. Ein Biologe berichtete kürzlich, noch vor zwanzig Jahren sei es den Studienanfängern selbstverständlich gewesen, den Menschen allen anderen Tieren vergleichend gegenüberzustellen. Heute aber sei es verpönt, von kategorialen Unterschieden zwischen Menschen und Primaten auszugehen.
Doch schon mit der Frage, was es den Bonobos, Schimpansen oder Gorillas bedeutet, dem Menschen so nahezustehen, ist man unversehens allein bei dem, der sich die Frage tatsächlich stellt. Nur Menschen können sagen, was ihnen die durch Anthropologie, Ethologie und Genanalyse versicherte Nähe zu den Tieren bedeutet; nur sie können aus den gewonnenen Einsichten Konsequenzen ziehen; und nur sie haben die Pflicht, das auch zu tun. Freilich genügt allein das Bewusstsein nicht, um aus dem Wissen von den früher nicht erkannten Kompetenzen der Tiere Konsequenzen zu ziehen. Dazu bedarf es besonderer Leistungen des Empfindens, Fühlens, Wahrnehmens und Erkennens, die man den Tieren gewiss nicht absprechen wird, die sich mit ihren spezifischen Ausdrucksformen und den daraus folgenden moralischen und politischen Prinzipien aber nur beim Menschen finden.
Die von den Tieren selbst weder aufgeworfene noch beantwortete Frage muss man dennoch in ihrem Interesse stellen, um angemessen auf sie reagieren zu können und um artgerecht mit ihnen umzugehen. Damit aber ist man erst recht beim Menschen, der, nicht zuletzt weil er der einzige ist, der sich die Frage stellt, auch zu sagen hat, was ihm die Einsichten, die ja immer seine Einsichten bleiben, für ihn bedeuten. Und tatsächlich ist er auch der Einzige, dem die Verantwortung zufällt, daraus Konsequenzen für sein Handeln zu ziehen. Wenn das kein Grund ist, bei all den Fragen nach der Beschaffenheit und Befindlichkeit der Lebewesen überhaupt auch nach dem Menschen selbst zu fragen, kann man alles weitere Fragen lassen.
Gewiss, man kann die Ansicht vertreten, der Mensch habe lange genug nur über sich gesprochen; nun sei es endlich an der Zeit, das Thema zu wechseln und sich primär den anderen Lebewesen zuzuwenden. Und wenn es dem Menschen, der auch hier ausschließlich selber spricht, in seiner philosophischen Betrachtung über die Fähigkeiten der Tiere wirklich gelänge, von sich selber abzusehen, wäre ich der Letzte, der Einwände geltend machen würde.
Doch die Wahrheit ist, dass in allen philosophischen Studien über die Tiere die Menschen nicht nur die alleinigen Adressaten sind, sondern der Mensch letztlich auch das eigentliche Thema bleibt. Denn nur der Mensch kann aus den gewonnenen Einsichten über andere Lebewesen lernen. Also macht man, selbst mit Rücksicht auf die Aktualität, nichts falsch, wenn man den Menschen gleich zum ausdrücklichen Thema erhebt.
Das hat im deutschen Sprachraum eine große Tradition. Dafür stehen die Namen von Herder, Kant, Wilhelm von Humboldt, Hegel und Nietzsche sowie im 20. Jahrhundert die von Scheler, Plessner, Cassirer, Gehlen, Blumenberg und Hans Jonas. Neuerdings gehört auch der Name von Michael Tomasello dazu. Doch das hat nicht verhindert, dass auch innerhalb der Philosophie stereotype Urteile über den Menschen in Umlauf sind, die der Korrektur bedürfen. Dazu Anregungen zu geben, ist das vorrangige Ziel des vorliegenden Buches.
In dieser Absicht werden ältere und neuere Formeln zur Selbstcharakterisierung des Menschen aufgegriffen, nicht, um sie pauschal zu widerlegen, wohl aber, um ihnen eine umfänglichere Bedeutung abzugewinnen und sie in einen engeren Zusammenhang mit dem Leben und mit dem menschlichen Selbstverständnis zu stellen.
Dabei ist es das Selbstverständnis des Menschen, das der vorliegenden Untersuchung die systematische Pointe gibt. So parteilich die Urteile des Menschen über sich selbst auch immer sein mögen: Er kommt nicht daran vorbei, über sich selbst zu sprechen, weil er nun einmal nicht unabhängig davon zu begreifen ist, wie er sich selbst versteht. Also nehme ich die Kriterien, die der Mensch bislang wesentlich zur Abgrenzung seiner Spezies von anderen Spezies verwendet, und prüfe sie im Licht seines notwendig allgemeinen Selbstverständnisses, für das er, nicht ohne Einsicht in seine individuellen und kollektiven Schwächen, hochgestimmte Bezeichnungen gefunden hat.
So schämt er sich bekanntlich nicht, den Namen des Menschen normativ zu wenden und ihn mit den universalen Titeln der Menschheit und der Menschlichkeit zu verbinden. Ja, er geht so weit, sogar den Umgang mit den Tieren dem Anspruch des Menschenrechts und der Wahrung der menschlichen Würde zu unterwerfen. Tiere zu quälen, gilt zu Recht als eine Verletzung der Würde des Menschen. Doch das Motiv und die Gründe für diesen imperial erscheinenden Herrschaftsanspruch sind zu ermitteln. So erklärt sich der Titel des Buches.
Immanuel Kant entschuldigt sich im Vorwort zu den Träumen eines Geistersehers dafür, dass er das vorgelegte Buch überhaupt geschrieben hat. Doch die Publikation sei unvermeidlich gewesen, weil so viel Unsinn in Umlauf sei, dem einfach widersprochen werden müsse – auch wenn dabei eigentlich nur Selbstverständlichkeiten zum Vortrag kommen.
So könnte auch ich einsetzen, denn das, was schon seit geraumer Zeit über die Humanität und den Humanismus verbreitet wird, spottet jeder Beschreibung. Es fordert entschiedenen Widerspruch heraus, obgleich man auch dabei kaum mehr als Selbstverständlichkeiten vorbringen kann.
Doch ich halte die Entschuldigung zurück, weil die umlaufenden Missverständnisse nicht nur auf Unkenntnis, Gedankenlosigkeit und Selbstverachtung beruhen. Vielmehr stehen mit der Idee der Humanität der Mensch und die Menschheit infrage, die man, schon um sich selbst zu schützen, verteidigen muss. Dabei darf man auch den Verdacht, ein «speziesistischer» Egoist zu sein, nicht fürchten. Allein um das in diesem Vorwurf liegende Missverständnis zu klären, lohnt sich die Beschäftigung mit dem Thema.
Doch wenn man schon dabei ist, den Menschen von einer Pauschalverdächtigung zu befreien, sollte man die Gelegenheit zur kritischen Korrektur anderer fehlgehender Selbstaussagen des Menschen nutzen. Bislang hat er zu wenig bedacht, wie sehr er mit seiner von ihm geschaffenen Kultur gleichwohl weiterhin zur Natur gehört. Erst nachdem ihn die Natur in ihrer vom Menschen missachteten eigenen Dynamik in seinem kulturellen Bestand bedroht, dämmert ihm, wie sehr ihn gerade auch seine Kultur zu größtem Respekt gegenüber der Natur verpflichtet. Dabei ist es das Mindeste, dass der Mensch sich um eine Selbstbeschreibung bemüht, in der er der Natur, der er sich verdankt und deren Teil er unter allen Bedingungen bleibt, seine Achtung erweist. Also hat er sich ohne Überheblichkeit um eine Tiere und Pflanzen nicht diskriminierende Selbstauszeichnung zu bemühen. Es ist erkennbar, dass es vielen heute lieber wäre, gar keine Abgrenzung zwischen Tier und Mensch vorzunehmen. Doch das wäre eine Flucht aus der Verantwortung, die der Mensch für seine Umwelt – und insbesondere auch für die ihm nahestehenden Lebewesen – nun einmal hat.
Dem Menschen scheint entgangen zu sein, dass seine intellektuellen Fähigkeiten ihre Produktivität wesentlich darin haben, dass sie Probleme als solche nicht nur erkennen, benennen und arbeitsteilig angehen können; ihre weiterreichende Produktivität besteht vielmehr darin, dass sie mit jeder möglichen Lösung neue und in der Regel größere Probleme schaffen. Schon darin liegt eine Generalbedingung der Natur, die nichts unverwertet lässt und nach Möglichkeit alles, was im Leben vorkommt, von Neuem produktiv zu machen sucht.
Folglich hat die Verkürzung der mit dem Menschen möglich gewordenen Lernprozesse zu einer Beschleunigung der natürlichen Evolution geführt. Das hat seine darauf gegründete kulturelle Evolution begünstigt, sie aber nicht von dem in der Natur allgemein verbreiteten Risiko des Scheiterns befreit. Gegen diese Bedrohung sucht sich das universalistische Selbstverständnis des Menschen abzuschirmen und setzt dabei nicht nur auf die Unterstützung durch seine Erkenntnis, sondern auch auf den Beistand göttlicher Mächte, die ihm die Aussicht auf bleibenden Erfolg, fortdauernde Anerkennung und ein ewiges Leben eröffnen sollen.
Doch mitten im Leben kann das nur eine Hilfe sein, wenn der Mensch die ihm nun einmal zur Verfügung stehende Fähigkeit zur Problemerkennung und Problemlösung auch tatsächlich nutzt. Hier ist primär der homo quaerens gefragt, der nicht nur ständig suchende, sondern auch Probleme allgemein exponierende und zum gemeinsamen Handeln fähige Mensch.
Der Mensch verkennt bis heute die implizite Gesellschaftlichkeit seiner Vernunft und lässt es zu, dass Rationalität und Sozialität wie Gegensätze behandelt werden. Tatsächlich aber kann er im Reich der Lebewesen dadurch als einzigartig gelten, dass er gleichzeitig animal socialeundanimal rationale ist – wobei «rationale» nicht einfach die Tatsache des Bewusstseins meint, sondern die Fähigkeit, aus seinen Einsichten Schlüsse zu ziehen, sie in Gründe zu übersetzen und sie damit, theoretisch wie praktisch, in ihrem sozialen Umfeld zu exponieren.
Die Neigung des Menschen, das, was zusammengehört, nicht nur auf begriffliche Weise auseinanderzuhalten, sondern auch hierarchisch zu ordnen, tritt auch darin hervor, dass er seine geistigen Fähigkeiten von seinem handwerklichen Können abtrennt und sich so in einer Sphäre bloßen Verstehens sogar noch über sich selbst zu erheben sucht. Doch wo immer er sich in seiner disponierenden Intellektualität einen Reputationsgewinn verspricht, verleugnet er sein technisch-praktisches Geschick, auf dem sein Intellekt basiert. Tatsächlich ist er, sowohl in seiner organischen Beschaffenheit wie auch in seinen eigenen Handlungsvollzügen, ein durch und durch auf Technik angewiesenes Wesen.
Ein Techniker bleibt der Mensch auch im Erkennen und Schlussfolgern. Selbst in der Ausübung seiner subtilen Künste kommt er nicht umhin, ein «Macher» zu sein. So ist er homo sapiensundhomo faber in einem. Erst wenn deutlich gemacht ist, worin der geringfügige Vorsprung des homo sapiens liegt, ehe er sich als homo faber um eine Lösung bemüht: nämlich in der Distanz, die er zu allem, einschließlich zu sich selbst, einnehmen kann, ist der Zipfel eines Unterschieds zu fassen. Doch auch der setzt voraus, dass homo erectus und homo habilis erst zum homo faber werden mussten, den der homo sapiens zu seiner Voraussetzung hat.
Der Mensch verkennt überdies, dass er seinen kulturellen Aufstieg wesentlich seiner sich lebenslang bewahrten Fähigkeit zum Spielen verdankt. Sie erlaubt ihm fortgesetzt Neues zu erproben, sich auf Experimente einzulassen und bei vollem Bewusstsein Wagnisse einzugehen. Dabei kann er lernen, seine pure Lebendigkeit und seine geistige Regsamkeit zu genießen. Und wenn das Ende des Spiels nicht auf natürliche Weise erfolgt, hat er gelegentlich selbst durch sein «Nein» für ein Ende zu sorgen. Damit aber hört das Spielen nicht auf, schon deshalb nicht, weil sich durch die Negation völlig neue Optionen für seinen Umgang mit sich und seinem Dasein ergeben.
Im «Ja» wie im «Nein» des Menschen wird seine Intellektualität unmittelbar praktisch. So kann er homo ludens nicht zuletzt deshalb sein, weil er sich als homo negans selbst Grenzen setzt. Die aber fordern ihn von Neuem heraus: Die im Spiel erprobte Phantasie sucht sich weite Räume, die auf dem Weg der Negation beliebig gewechselt, erweitert und ausdrücklich mit anderen verglichen werden können. – Während bei den ersten beiden Begriffspaaren aller Evolutionsgewinn im Miteinander liegt, ist er im contra von homo ludens und homo negans im sich wechselseitig herausfordernden Gegensatz zu finden. Unnötig zu sagen, dass sich jedes contra selbst wieder verneinen lässt und damit zur affirmativen Verstärkung möglicher Optionen führen kann. Im Blick auf die Konstitution des Menschen empfiehlt es sich somit, von einem Einheit stiftenden Zusammenspiel zu sprechen, in dem sich homo ludens et negans schließlich zum homo creator verbinden. Der erst in den letzten Jahrzehnten zur Auszeichnung des eigenständige Schaffens in Umlauf gekommene Ausdruck des homo creator[1] sollte aus Achtung vor dem Menschen – und mit Rücksicht auf ein angemessenes Verständnis des Göttlichen – nicht als homo deus verstanden werden.[2] Hier ist schon die Modernität erschlichen, denn bereits in der Antike wurde der Mensch als Künstler in die Nähe der Götter gerückt.
Schließlich ist der Mensch in seiner Fähigkeit, in sich selbst zu gehen und sich in seinem Selbstbewusstsein kompensatorisch schadlos zu halten, so sehr von sich überzeugt, dass man ihn erst daran erinnern muss, dass er bereits mit seinem Bewusstsein in einer ihn mit seinesgleichen schicksalhaft vereinenden Sphäre der Öffentlichkeit verbunden ist. Er ist homo publicus, ein sogar noch in seinem Inneren der Welt zugewandtes Wesen, das in allen ihm wesentlichen Leistungen, im Denken und Sprechen, im Wissen und Glauben, im Lachen wie im Weinen und vor allem in seiner künstlerischen Produktivität, auf die den Mitvollzug wie den Widerspruch ermöglichende Gegenwart von seinesgleichen angewiesen ist.
Kapitel 1
PhilanthropieIm Menschen die Menschheit lieben
«Die Philanthropie ist aller MenschenPflicht gegen einander, man mag diesenun liebenswürdig finden oder nicht.»
(Kant, Tugendlehre § 27)
1. Den Menschen lieben wie sich selbst. Die Menschen, so heißt es bei Jean Paul, «soll keiner belachen als einer, der sie recht herzlich liebt».[1] Die Wahrheit dieser ironischen Einsicht liegt darin, dass sie auch für die ernste Beschäftigung mit den Menschen gilt: Zumindest in einer philosophischen Betrachtung kommt man nicht umhin, den Menschen, wenn nicht zu lieben, dann doch wenigstens zu schätzen – gerade auch dann, wenn man ihn verstehen, ihm raten und auch verzeihen will.
Der Grund liegt auf der Hand: Man erkennt und beurteilt keinen Menschen unabhängig davon, wie man sich selbst versteht. Also kann das, was über den Menschen im Allgemeinen zu sagen ist, nicht unabhängig von dem sein, was man im Besonderen von sich selbst als Mensch zu wissen glaubt. Und ohne Selbstschätzung kann man auch den Wert, den andere haben, nicht würdigen.
Dass dies nicht ohne Anteilnahme möglich ist, wird niemand bestreiten wollen. Die muss man nicht als «herzliche Liebe» bezeichnen. Aber man kann, auch ohne über Jean Pauls romantische Begabung zu verfügen, feststellen, dass ein Verständnis des Menschen, bei allem Befremden, das unvermeidlich ist, nicht ohne eine von Sympathie getragene Nähe möglich ist.
Dass dabei äußere Bindungen, die der Verstand zu beurteilen hat, eine Rolle spielen, versteht sich von selbst. Kein Mensch kann ohne den Beistand anderer Menschen leben; und die Gesamtheit aller Menschen kann nur bestehen, solange es Individuen gibt, die ihr Leben mit ihrer Erkenntnis, ihrem Verständnis und ihrer Einsicht so führen, dass sie von anderen Menschen verstanden werden. Und solange es um Erkenntnis und Verständnis geht, kommt es, so unwahrscheinlich es klingt und so wenig sich das Leben, die Geschichte und die Gesellschaft darum auch zu kümmern scheinen, auf jeden Einzelnen an!
Das aber ist nicht nur eine Frage des Erkennens. Die Notwendigkeit von Zuneigung, Zugehörigkeit und Vertrauen, damit auch der Wunsch nach emotionaler Nähe, lassen sich nicht leugnen. Doch auch Abneigung ist eine Realität. Sie kann mit der Furcht beginnen und in Hass und Verachtung münden, die uns verständlich machen, warum es auch Gleichgültigkeit geben und Toleranz als Errungenschaft begriffen werden kann.
Ich gestehe, dass es mir persönlich alles andere als leichtfällt, Jean Pauls ironische Bemerkung ernsthaft und nachdrücklich auf die – vornehmlich ja Distanz erfordernde – theoretische Annäherung an den Menschen zu übertragen. Kann denn der Mensch, der Kriege führt, der seinesgleichen bedrängt, belästigt, quält, vertreibt, unterdrückt und tötet, der als einziges Lebewesen auf der Erde in der Lage ist, absichtlich Böses zu tun, so dass Begriffe wie die des Lügners, des Treulosen, des Schänders, des Verräters oder des Verbrechers nur auf ihn anzuwenden sind, überhaupt ein Gegenstand sympathetischer Betrachtung sein?
Die Frage verschärft sich, wenn wir bedenken, dass kein anderes Wesen auf der Welt sich den Titel eines «Ungeheuers» so sehr verdient wie der Mensch. Das Urteil des Sophokles[2] wird durch nichts abgeschwächt, was in den zweitausendfünfhundert Jahren, seit es erstmals auf einer Bühne in Athen gesprochen wurde, bis heute geschehen ist. Weder einem anderen Tier noch einem Gott noch den wie immer beschaffenen «Umständen» ist auch nur die geringste Mitschuld an den Bosheiten anzulasten, die seit dem Anfang der Menschengeschichte begangen wurden und unablässig weiter begangen werden. Und da wir von einem Teufel nichts wissen, muss allein der Mensch als Urheber alles Bösen angesehen werden. Hinzu kommt die fehlende Hoffnung darauf, dass es jemals anders werden könne. Für Kant, dem wir das Motto über diesem ersten Kapitel verdanken, war die «Kürze des Lebens» die dankbar empfundene Bedingung dafür, es darin überhaupt auszuhalten![3]
Wie kann man unter diesen Bedingungen überhaupt von «Liebe» sprechen? Gesetzt, wir wüssten es wirklich nicht, empfehle ich, einfach jene zu fragen, die Liebe entweder in ihrer Kindheit erfahren haben oder die das Glück hatten oder haben, in Liebe zu leben – vor allen aber auch jene, die sich nach Liebe sehnen. Zu den Antworten, die man erwarten kann, dürfte der Hinweis auf das Gefühl gehören, von seinesgleichen (gerade auch in den eigenen Schwächen) verstanden und angenommen zu werden sowie in einer Bindung gleichwohl frei und zufrieden, ja sicher, glücklich und voller Hoffnung zu sein. Wer wollte bestreiten, dass es dies, zumindest als Hoffnung, tatsächlich gibt?
«Tatsächlich Liebe»[4] ist der treffende Titel eines Films, der in spektakulärer Vielfalt das Verlangen der Menschen nach Nähe derart heiter und mitfühlend illustriert, dass man in so gut wie in allen Fällen die Brüchigkeit, den Leichtsinn, die Flüchtigkeit oder die falschen Erwartungen erkennt, die hier die Menschen von «Liebe» sprechen lassen. Man könnte meinen, der Film sei darauf angelegt, seinen Titel zu widerlegen. Doch er zeigt nur die Vielfalt der real gelebten Liebe.
Tatsächlich ist im Leben der Menschen von wenig anderem mehr die Rede als von der Liebe – von der, die man sich wünscht, von der, die man als großes Glück empfindet und die folglich «niemals» missen möchte, und von der, die man verloren hat – sei es durch wechselseitige Enttäuschung, innere Entfremdung, Treulosigkeit oder durch Tod.
Vor diesem Hintergrund erscheint es weniger abwegig, von der Liebe zum Menschen zu sprechen. Denn die Liebe hat auch in der Suche nach dem einen Partner oder nach dem Kreis von Freunden, zu denen man sich hingezogen fühlt und denen man vertraut, etwas durchaus Unwahrscheinliches, Seltenes und rasch wieder Vergängliches; sie ist rar und kostbar; auch deshalb wird sie so beharrlich mit dem Glück assoziiert.
Wenn von Liebe die Rede ist, muss sie nicht notwendig auf das singuläre Paar, die Familie oder den Kreis der verlässlichen Freunde bezogen sein. In der Tradition des Begriffs ist das schon seit der Antike so, auch wenn hier unterschiedliche Termini verwendet werden. Doch so richtig es ist, zwischen eros und agápe, zwischen amor, caritas oder ardor zu unterscheiden, so gut begründet ist zugleich, dass im Deutschen alles mit dem einen Begriff der Liebe benannt werden kann.
Wir werden im Folgenden Gründe für dieses weite Verständnis des einen Worts benennen. Vorab ist nur daran zu erinnern, dass Liebe in ihrem hochindividualisierten Verständnis nicht frei von Erkenntnis vorgestellt werden muss. Zwar kommt es vor, dass man sich «Hals über Kopf» oder «Herz über Kopf» verliebt. Aber ob das gänzlich ahnungslos, ohne Selbstkenntnis und frei von Kriterien geschieht, sei dahingestellt. Zu wünschen ist in jedem Fall, dass auch die Verliebten wissen, was sie tun. Und je größer der Bereich jener ist, denen man sich in Liebe zuwendet, umso größer ist der Anteil der erklärten Gründe, die man für sein Verhalten aufbieten kann.
Dafür steht die Nächstenliebe, die auch dort, wo sie aus Neigung, spontanem Mitgefühl oder ernsthaft angenommener Gesinnung praktiziert wird, immer wieder mit Einwänden und Bedenken zu tun haben wird, gegen die sie sich zur Wehr zu setzen hat. Der Liebe zum Menschen aber stehen so viele innere und äußere Widerstände entgegen, dass man hier, um es deutlich zu sagen, die besten Gründe braucht, um daran festzuhalten. Diese Gründe sind nicht zuletzt so anspruchsvoll, weil sie sich nur in eindringender Selbstkenntnis erschließen und sich allein in dem Bewusstsein festigen können, dass sich Mensch und Menschheit nicht trennen lassen.
2. Selbst- und Nächstenliebe bilden eine Einheit. Obgleich in der Geschichte der Ethik von Cicero bis Nietzsche immer wieder Argumente vorgetragen wurden, die es verbieten sollten, Egoismus und Altruismus als Gegensätze zu behandeln, herrscht im alltäglichen Urteil wie auch in öffentlichen Debatten die Neigung vor, in beiden eine Art ewiger Alternative auszumachen. Das kann und muss man verstehen, wenn man mit den individuellen und kollektiven Erscheinungsformen des persönlichen, ökonomischen und politischen Egoismus zu tun hat. Und wenn man ihn den nur zu oft von jedem Realitätssinn verlassenen altruistischen Meinungsäußerungen gegenüberstellt, dann scheinen sich Egoismus und Altruismus tatsächlich wechselseitig auszuschließen.
Blickt man hingegen auf die Entwicklung einzelner Individuen und stellt sie in Relation zu dem, was wir überhaupt über den Umgang mit Neugeborenen, heranreifenden Kindern und Jugendlichen sagen können, wird man das allgemeine Urteil nicht zurückhalten können, dass ohne den Altruismus der Eltern und ohne den Egoismus ihrer Schützlinge gar nichts geht. Gewiss treten die mit den Begriffen bezeichneten Verhaltensweisen nur selten in Reinform auf; aber durchschnittlich wird sich der Eindruck rechtfertigen lassen, dass es des Gegensatzes zwischen der Sorge für den Anderen und dem opponierenden Eigensinn bedarf, um nicht nur Entwicklung und Erziehung, sondern produktives Leben überhaupt gelingen zu lassen.
Dabei darf man nicht vergessen, dass die gesellschaftliche Rollenerwartung beide Seiten für ihr Verhalten kompensatorisch belohnt: Gute Eltern können, wenn ihre Mühe nicht umsonst ist, auch ihren Egoismus als Eltern belohnt sehen; und gute Kinder haben viele Chancen, in der Liebe zu den Eltern, im Teilen mit den Geschwistern sowie in der Verlässlichkeit gegenüber ihren Freunden Altruismus einzuüben. Von einem diametralen Gegensatz zwischen Fremd- und Selbstliebe kann unter den notwendig sozialen Konditionen des Lebens, vor allem mit Blick auf die Generationenfolge und die Notwendigkeit der Kooperation keine Rede sein.
Es ist nicht überzogen, das so allgemein zu formulieren. Denn Egoismen und Altruismen können sich in Abhängigkeit von jeweiligen Funktionen und Konventionen durchaus bei ein und derselben Person vereinigt finden. Die sich für ihre Kinder aufopfernden Eltern können als Geschäftsleute kompromisslos auf ihren Vorteil bedacht sein. Außerdem kommen Egoismus und Altruismus, wenn man sie überhaupt so nennen kann, in vielen Varianten auch bei anderen Lebewesen vor. Es gibt das Selbstopfer für die eigene Brut: ein Akt, in dem der individuelle «Altruismus» mit einem gattungsspezifischen «Egoismus» zusammenfällt. Es gibt Parasiten, die ihre ganze Existenz in den Dienst ihrer Wirtstiere stellen und dabei dennoch nur ihren eigenen Vorteil verfolgen. Sieht man sie bei der Arbeit (wie etwa die Fische, die den Nilpferden die Zähne «putzen»), kann man von ihrer Hingabe an ihre Aufgabe nur beeindruckt sein.
3. Darwin als Philanthrop. Man darf es als einen wissenschaftsgeschichtlich und philosophisch exemplarischen Akt ansehen, dass der von manchen noch heute als Vertreter, ja als «Erfinder» des durchgängigen Egoismus in der Natur geschmähte Charles Darwin sich gegen Ende seines Lebens zur Philanthropie bekennt. Lassen wir beiseite, dass seine These vom survival of the fittest im strengen Sinn gar nicht als Beleg für den Egoismus angesehen werden kann; denn selbst im rücksichtslosen Überlebenskampf findet stets eine Vermittlung zwischen individueller Selbstbehauptung und möglichen Vorteilen für die Gattung statt. Allein die Rede vom «Sozialdarwinismus» reicht aus, um den Widerspruch kenntlich zu machen, mit dem die Rezeption der Evolutionstheorie bereits zur Zeit Darwins verbunden war. Denn zum «Sozialdarwinismus» gehört nicht nur der Kampf im Außenverhältnis der Klassen, sondern auch der Zusammenhalt in ihrem Inneren. Und so machen uns die Vorurteile gegenüber Darwin besonders empfänglich für das Berührende und zutiefst Menschliche in seinem Bekenntnis zur Philanthropie.[5]
Der auf das Jahr 1879 datierte und 1881, ein Jahr vor seinem Tod, ergänzte Eintrag im erst posthum zugänglich gewordenen Tagebuch Darwins berichtet vom allmählichen Verlust seines bis zum Beginn seiner Reise auf der Beagle für unumstößlich gehaltenen anglikanischen Glaubens. Sein vorher offenbar nie infrage gestellter Kinderglaube geht im Zusammensein mit den anscheinend nur ihrem Glück vertrauenden Schiffsoffizieren allmählich verloren. Am Ende muss sich Darwin eingestehen, dass er zu einem gründlich von allen religiösen Lehren befreiter Agnostiker geworden ist.
Aber nicht zu glauben, genauer: gar nichts zu glauben, gelingt dem genialen Biologen nicht! Mit wenigen Worten beschreibt er das Defizit des bloßen Wissens, um dann in aller Kürze zu schildern, wie er durch die von ihm Jahrzehnte lang als selbstverständlich hingenommene Liebe seiner Frau auf das gestoßen wird, was ihn nicht nur in seiner Arbeit gestützt und gefördert, sondern ihn die vielen Jahre seines Forscherlebens getragen hat. Und augenblicklich ist ihm klar, dass es nicht genügt, die Liebe der Frau einfach nur mit größerer Innigkeit zu erwidern.
Denn er durchschaut die Logik, die dieser Konsequenz zugrunde liegt: dass er sich selbst als ein Mensch unter Menschen versteht und dass er sich und seinesgleichen nur gerecht werden kann, indem er sich zur Philanthropie bekennt! Darin wird Darwin das Minimum des Glaubens bewusst, den sich der Mensch bewahren muss, um überhaupt als Mensch leben zu können.
Auch wenn es manchem heute so erscheinen wird: Das Bekenntnis Darwins folgt keinem auf das 18. und 19. Jahrhundert beschränkten Zeitgeschmack. Vielmehr leitet die Philanthropie die Menschen seit Menschengedenken und heute mindestens dort, wo immer sie ihre Würde in Anspruch nehmen und wo Grund- und Menschenrechte beschworen werden. Dennoch sind Philanthropie und die ihr das begriffliche Gerüst gebende Humanität alles andere als durchgängig anerkannte Ziele des politischen Handelns. Und erschwerend kommt hinzu, dass es nicht wenige Theoretiker gab und gibt, die sich nach Kräften bemühen, die Rede von der Humanität als epochale Selbsttäuschung des Menschen zu entlarven.
Eine Weile lang waren es vornehmlich politische Theoretiker, die meinten auf die Beschwörung der guten Absichten des Bürgertums und ihres Staates keine Rücksicht nehmen zu müssen. So etwa wandte sich der in seiner Jugend auf das Menschenrecht und den Humanismus setzende Karl Marx nach seiner (das Menschen- und das Bürgerrecht verletzenden) Vertreibung aus Preußen vom Ideal der Humanität ab und konzentrierte sich auf den Sieg des Proletariats. In dieser Hoffnung fand zwar die Idee der Humanität eine Zuflucht; aber sie wurde durch den geschichtlichen Auftritt des Kommunismus tatkräftig geleugnet. Dem wiederum folgten Theoretiker, denen mit dem Glauben an den Marxismus auch der an den Humanismus verloren gegangen war. Michel Foucault ist dafür ebenso ein Beispiel[6] wie jene, die heute den Humanismus mit dem Kolonialismus verbinden.[7]
Doch die Diskussion ist längst nicht mehr bloß politisch bestimmt. Sie ist direkt auf das Selbstverständnis des Menschen bezogen und ist dabei wesentlich von Fragen seiner Einstellung zu den leidensfähigen Tieren bestimmt. Bevor davon die Rede sein soll, muss von der historischen Tiefe und vom ethischen Gewicht der Berufung auf Philanthropie und Humanität gesprochen werden. Danach, so denke ich, wird von selber deutlich, welcher beschämende Verlust mit der Kritik an der Humanität und mit dem verbunden ist, was heute, unter vollkommener Verkehrung des Charakters der menschlichen Gattung, unter dem verächtlichen Titel des «Speziesismus» in Umlauf ist.
4. Philanthropie als Universalbegriff. Man kann nicht ausschließen, dass Darwin die geschichtliche Dimension des Begriffs der Philanthropie bewusst gewesen ist. Da er dazu nichts sagt, kann man die Treffsicherheit, mit der er den Ausdruck verwendet, nur bewundern. Denn unabhängig davon, wie angesehen der heute eher randständig gewordene Begriff noch ist: Er gehört zu den wenigen, die über mehr als zwei Jahrtausende im Mittelpunkt des religiösen, politischen und philosophischen Interesses aller mediterranen Kulturen gestanden haben und sich im Wortsinn auch in den frühen Lehren des Konfuzianismus und des Taoismus nachweisen lassen.
Später wird die Philanthropie zur bevorzugten Auszeichnung der oströmischen Kaiser, die durch sie ihre christliche Gesinnung und ihren politischen Großmut rühmen lassen. Im ausgehenden 18. Jahrhundert übernimmt der Terminus eine Leitfunktion in der Gründungsgeschichte der modernen Pädagogik. Und in der Folge kommt ihm eine Rolle in der Entwicklung des liberalen Stiftungswesens, vornehmlich in den Vereinigten Staaten, zu – auch hier, wie in der cäsarischen Tradition in Rom und Byzanz, mit dem Wunsch verbunden, als «Philanthrop» über den Tod hinaus in hohem Ansehen zu stehen.
In der Begriffsgeschichte der Philanthropie kommen alle denkbaren Konstellationen im Verhältnis der Menschen untereinander vor – und zwar sowohl in der Beziehung der Menschen zur Natur wie auch mit Blick auf den möglichen Anteil Gottes. Gewiss: Es ist umstritten, ob das tragende Gefühl in allen Fällen wirklich «Liebe» ist, wie die korrekte Übertragung in andere Sprachen lautet. Fraglich ist auch, wer überhaupt einer solchen Zuwendung würdig ist; ob man vom Erfolg der philanthropischen Aufmerksamkeit selbst etwas wissen sollte, ob der Wohltäter dem Begünstigten bekannt sein darf oder ob die Philanthropie auch den eigenen Ruin in Kauf nehmen kann oder gar soll.
Es gibt so gut wie nichts, was hier in der mehr als zweieinhalbtausend Jahre hin und her wogenden Debatte über die Motive der Wohltätigkeit nicht zur Sprache käme. Die Verwendungsweisen, Deutungen und kritischen Einwände sind so vielfältig, dass man den Begriff der Philanthropie selbst schon als einen Sittenspiegel menschlicher Lebensentwürfe und Verhaltensweisen ansehen könnte.
Mit Blick auf Darwin ist es von besonderer Bedeutung, dass der Natur schon in den antiken Debatten eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aristoteles sieht im wechselseitigen Beistand von Artgenossen einen Naturtrieb, der beim Menschen in der Hilfeleistung gegenüber Fremden zum Ausdruck kommen kann.[8] Die Epikureer betonen die Rückwirkung der Freigiebigkeit auf den Spender und den Kreis der Freunde. Die Stoiker verwenden den Ausdruck selten, weil für sie die Übereinstimmung natürlicher und göttlicher Impulse im Vordergrund steht und der Mensch in seiner Anteilnahme an seinesgleichen nur Ausdruck seiner Einbindung in den universalen Logos ist. Da kann dann die individuelle Anteilnahme am Schicksal anderer sogar als Schwäche ausgelegt werden. Dem kosmischen Naturverständnis der Stoa liegt es dann schon näher, die Philanthropie als die menschliche Variante der Bindungen anzusehen, die bei den Tieren so zahlreich zu beobachten sind.
Von aktueller Bedeutung ist, dass insbesondere die nicht erst in den Zeiten globaler Migration in bedrohliche politische Konflikte verstrickten Religionsgemeinschaften der Juden, der Christen, der Moslems und der Anhänger Buddhas in ihren spezifischen Verpflichtungen zur Mildtätigkeit und sozialen Anteilnahme auffällige Gemeinsamkeiten erkennen lassen. So fordert die Philanthropie bereits in ihrem ersten wirkungsmächtigen Auftritt im Alten Testament die Liebe und Freundschaft gegenüber den «Fremden». Nach dem 3. Buch Mose genügt es nicht, dass jeder seinen «Nächsten» lieben soll.[9] Schon wenige Verse später wird diese Liebe ausdrücklich auch gegenüber dem «Fremdling» verlangt: «Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst.»[10]
Das Gebot geht von der Tatsache aus, dass die Menschen in ihrer Herkunft und in ihrem Glauben verschieden sind und dennoch in Nachbarschaft miteinander leben. Es ist also bereits hier keine im Bewusstsein hegemonialer Überlegenheit gegebene Empfehlung, freundlich mit dem Schwächeren umzugehen. Vielmehr wird mit der Autorität eines göttlichen Gesetzes verlangt, dass die Menschen sich auch im Konfliktfall vertragen. Gewiss kann man hier noch nicht von wechselseitiger Anerkennung gegensätzlicher Überzeugungen sprechen; von ihr kann wohl erst im Zeichen eines neuen Verständnisses des Glaubens mit dem Wirken des Apostels Paulus die Rede sein. Erst mit den aus der Position der Minderheit argumentierenden Christen, die selbst kurze Zeit zuvor das unwahrscheinliche Geschenk der göttlichen Gnade empfangen zu haben glaubten, ist der Boden für das bereitet, was später «Toleranz» genannt wird.[11]
Dass die Reflexion der Erfahrung eigener Schwäche eine Rolle spielen kann, wird schon im Alten Testament offenkundig, wenn an der Parallelstelle des Zehnten Gebots im 5. Buch Mose daran erinnert wird, dass die Juden, die nach ihrer Rückkehr ins Gelobte Land «Fremde» vorfinden, sich daran zu erinnern haben, dass sie selbst in Ägypten «Fremde» gewesen sind![12] Das macht augenblicklich klar, welcher politische Sinn in der Formel: lieben «wie dich selbst» enthalten ist: So wie die Kinder Israels in Ägypten ihr Leben nach eigenen Vorstellungen führen wollten, so haben sie es nun auch jenen zuzugestehen, die ihnen im eigenen Land als «Fremde» gegenübertreten.
Das Gebot der Philanthropie ist aus dem Umgang mit lebensbedrohlichen Konflikten erwachsen. Es würde daher schon in seinem ersten Auftreten unterschätzt, wollte man es lediglich nach Art einer Schön-Wetter-Empfehlung verstehen. Das gilt auch für die Wiederaufnahme des Gebots der Nächstenliebe im Neuen Testament in einem von schwersten politischen, religiösen und kulturellen Gegensätzen zerrissenen Umfeld, das die Verkünder von Philanthropie und Toleranz zugrunde zu richten sucht – freilich ohne sie dadurch widerlegen zu können. Das Selbstbewusstsein der eigenen Stärke, zumindest das der eigenen Gewissheit, gehört dazu, wenn man sich zur Philanthropie bekennt.
5. Humanität als Selbstbegriff. Der Begriff der Humanität kann als lateinisches Pendant zum griechischen Terminus der philanthropia angesehen werden. Cicero hat die Übersetzung erstmals prominent verwendet, und es dürfte schwerfallen, mit Blick auf den durchschnittlichen Gebrauch einen tragfähigen systematischen Unterschied zwischen beiden Termini auszuweisen. Es gibt keine Eigenart der philanthropia, die im Gang der Geschichte nicht auch der humanitas zugeschrieben worden ist – und umgekehrt.
Dennoch kann man eine Differenz bestimmen, die für die nachfolgende Untersuchung maßgebend ist: Während die Philanthropie auf ein Verhalten der Offenheit, der Zuwendung und der Anteilnahme gegenüber anwesenden Anderen bezogen ist – und dabei gern mit konkreten Verhaltensweisen verbunden wird –, setzt die Humanität die Menschheit beim einzelnen Menschen in ihrer Allgemeinheit voraus. Zwar muss auch sie sich zeigen. Sie muss in der Lebensführung, im tätigen Eintreten für seinesgleichen und in der Rücksicht auf die Eigenart anderer Lebewesen hervortreten; dabei muss sie auch in der Gesinnung eines Menschen verankert sein. Aber sie ist nicht auf bestimmte Gefühle, Verbindlichkeiten oder Leistungen festgelegt. Für die Humanität kann es genügen, dass eine (oder einer) sich einfach nur als Mensch erweist – und darin schätzens- und liebenswert erscheint. Die unter Beweis gestellte Humanität zieht Anerkennung, ja Achtung auf sich, vor allem dann, wenn sie sich in der Standhaftigkeit gegenüber Versuchungen und Gefährdungen behauptet.
Ebendarin liegt der systematische Vorzug der Humanität: In ihr tritt das sich praktisch ausweisende Selbstbewusstsein des Menschen hervor und gibt dabei in ausdrücklicher Exposition der eigenen Individualität ein Beispiel für die idealisierte Form der Gattung. Das aber ist die Menschheit, die im Begriff der Humanität ihren Ausdruck erhält. Das, was man als Theoretiker der Individualität, der jeder sein muss, der etwas Wesentliches am Menschen erfassen will, stets erst mit aufwändig beigezogenen Gründen erweisen muss, wird im humanen Handeln eines Einzelnen vorgeführt: Dass er vollständig – und das heißt: sowohl innerlich wie auch in seinem nach außen gerichteten Handeln als ein sich selbst zur Menschheit rechnender Mensch verstanden werden kann.
Welche Debatten man damit nicht führen muss, zeigt die Begriffsgeschichte der Philanthropie, die nicht erst heute in den USA, sondern bereits in der Nachfolge des Konfuzius, bei Epikur oder in der Schulphilosophie der Aufklärung utilitaristische Deutungen nach sich gezogen hat. Die führen schon als solche von dem ab, was uns am Menschen Achtung abverlangt. Da geht es dann darum, wie viel man unter welchen Bedingungen welchen Bedürftigen gibt und inwieweit man sich dabei verausgaben muss oder darf. Die Freiwilligkeit, die, spätestens mit dem Übergang zum modernen Begriffsgebrauch, die philanthropische Großzügigkeit auszeichnet, wird hier missachtet. In ihren realen Exponenten scheint sich die Philanthropie gut mit kluger Berechnung und der Empfänglichkeit für sozialen Druck zu vertragen.
Die Humanität hingegen erlässt uns die Fragen, die mit der peniblen Auswahl der Bedürftigen, der möglichen Ruhmsucht der Spender und der definierbaren Grenzen ihrer Wohltätigkeit verbunden werden können. Für die Humanität genügt die Auszeichnung der einzelnen Person als Mensch, der sich menschlich verhält.
Was damit gewonnen sein kann, illustriert eine Anekdote, in der Aristoteles die Position Ciceros vorwegzunehmen scheint: Als man ihm vorwarf, er habe in seiner Großzügigkeit einen unwürdigen Menschen begünstigt, soll er geantwortet haben, er habe nicht dem begünstigten Individuum eine Wohltat erwiesen, sondern «dem Menschen» (anthropos).[13] Überliefert ist auch, dass er bei dieser Begebenheit von der Auszeichnung «des Menschlichen» (to anthrópinon) gesprochen haben soll.
Es ist genau diese in der anekdotischen Überlieferung zum Ausdruck kommende Abstraktion, die Cicero in seiner Rede von der humanitas exponiert: Human ist das, worin sich die Menschlichkeit des Menschen zeigt. Das erscheint zirkulär und folglich wenig aufschlussreich. Doch wer glaubt, damit Ciceros Umgang mit dem Begriff der humanitas bloßstellen zu können, der verkennt die diesem Begriff innewohnende Rationalität: Er enthält die gegenüber allen logischen oder semantischen Einwänden unbelastete Anweisung, in beispielgebender Weise ein Mensch zu sein.[14]
Die Cicero bereits von übelwollenden Zeitgenossen entgegengehaltene Kritik, er schmeichle als Parvenue nur der Senatsnobilität, der er sich durch glückliche Umstände zurechnen durfte, hält weder dem Sinn noch dem Wortlaut seiner Schriften stand. Denn Cicero bezieht den Begriff auch auf Angehörige anderer Völker und Klassen. Überhaupt verwendet er ihn in Verbindung mit dem Begriff der menschlichen Würde (dignitas), so dass klar ist: Hier ist ein Merkmal, das dem Menschen so zukommt, wie das in der anekdotischen Äußerung des Aristoteles ausgesprochen wird.
Das Menschliche liegt in der Tätigkeit des ganzen Menschen – auch unabhängig davon, was daraus wird. Der auf Humanität setzende Mensch ist aus seiner Gesinnung heraus auf Wahrhaftigkeit gegründet. Ihm geht es nicht darum, einen guten und großzügigen Eindruck zu machen, sondern um einen überzeugenden Ausdruck seiner selbst, durch den er sich als mit anderen ursprünglich verbunden zeigt.
Gewiss kann dieser Ausdruck täuschen. Humanität steht, wie alles Gute, gewiss nicht selten in Gefahr, missbraucht zu werden. Ihre Rationalität liegt im Begriff von sich selbst: Der Mensch möchte von sich aus einem Ideal entsprechen. Also entzieht sich der zweifellos auf Wirkung auf seinesgleichen angelegte Begriff dem Kalkül bloßer Nützlichkeit und ist dennoch weit davon entfernt, in den Bereich bloßer Theorie oder guter Absicht zu gehören. Vielmehr ist er der Realität des erlebten sozialen Zusammenhangs verbunden. Seine Wirksamkeit beruht auf der Gegenseitigkeit des menschlichen Verstehens, die zwar zu Missverständnissen führen kann, aber doch weit davon entfernt ist, bloßer Gedanke oder reine Idee zu sein.
Ich wiederhole, dass in der Selbstreferenz des Begriffs der Humanität auf den Menschen (und damit auf einen ihn allein für sich selbst und gleichwohl vor anderen auszeichnenden Habitus des humanen Individuums) ein systematischer Vorzug liegt, der dem Begriff eine moralische Umfänglichkeit und Tiefe gibt. Diesen Vorzug sollte man nicht abwertend gegen den Begriff der Philanthropie ausspielen; denn die Philanthropie hat ihren eigenen Wert, indem sie ein gesellschaftliches Handeln rühmt, das allemal Anerkennung verdient.
Das Fehlen äußerer Anzeichen hat es den modernen Kritikern des Cicero leicht gemacht, die begriffliche Konzentration der humanitas auf den aus sich selbst heraus zu verstehenden Menschen als versteckten Klassenvorbehalt zu deuten. Dem so originellen wie produktiven römischen Anwalt der Platonischen Akademie wird daher der Vorwurf gemacht, er habe gar nicht die Menschheit als ganze gemeint, sondern lediglich das Patriziat der römischen Senatoren. Also sei die Humanität bei ihm noch nicht, wie in der heutigen Rede vom Menschenrecht oder von der Würde des Menschen, wirklich auf alle Menschen bezogen. Um seine spezielle Karriereabsicht zu verdecken, habe Cicero mit der humanitas einen Begriff vorgeschoben, den es so in der Antike noch gar nicht gegeben habe. Doch das ist eine Unterstellung, die sich, wie wir im Kapitel noch sehen werden, durch Ciceros Gebrauch des Begriffs erledigt.
Wichtiger scheint mir der Hinweis, dass es keiner Mühe bedarf, Äquivalente zum Terminus der humanitas bereits in den vorgriechischen und vorrömischen Kulturen aufzuspüren. So könnten wir schon die den sumerisch-babylonischen Mythen zugrunde liegende Unterscheidung zwischen unsterblichen Göttern und sterblichen Menschen nicht verstehen, wenn nicht bei allen damaligen Hörern die Kenntnis von einem grundlegenden Unterschied zwischen den Göttern und Menschen unterstellt werden kann. Vom Bewusstsein dieser Differenzen ist auch die biblische Schöpfungsgeschichte getragen, die in der Reihenfolge der Erschaffung der Geschöpfe ebenfalls keinen Zweifel daran lässt, dass der Mensch zwar als Geschöpf den Tieren besonders nahesteht, aber durch die besondere Aufmerksamkeit Gottes als Einheit ausgezeichnet ist.
Es gibt also einen markanten Begriff der Menschheit, der vor allem anderen durch besondere Verantwortlichkeiten ausgezeichnet ist. Das macht die auf einem ausgeführten vorbiblischen Narrativ beruhende Geschichte von der Sintflut anschaulich: «Der Mensch» kann mit seinem neuen Stammvater Noah überleben, der dafür sorgt, dass von allen Tieren je ein Paar in der Arche vertreten ist und nach der Flut weiterleben kann. Das Alte Testament macht überdies durch die Unterscheidung zwischen dem Volk Gottes und allen anderen Völkern bewusst, dass die Menschheit sich ihrerseits vielfältig gliedern und bewerten lässt.