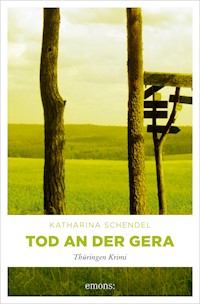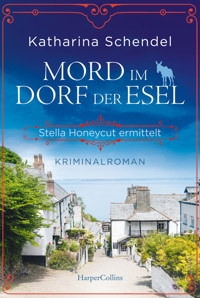4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bea von Maarstein ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die Ankunft der exzentrischen Bea von Maarstein im beschaulichen Örtchen Hummelstich stellt das Leben der Dorfbewohner gehörig auf den Kopf: Bea behauptet, ihre Freundin Henrietta sei keines natürlichen Todes gestorben. Als dann noch zwei Wirtsleute ermordet werden, ist es endgültig vorbei mit der Dorfidylle. Gemeinsam mit dem Halbtagspolizisten Sven Grüneis und ihrem Papagei Dr. Jekyll beginnt Bea zu ermitteln und gerät dabei selbst in größte Gefahr ...
"Ein Mord kommt selten allein" ist der erste Roman der neuen Regio-Krimi-Reihe "Hummelstich" von Katharina Schendel.
Zur Serie: In Hummelstich scheint die Welt noch in Ordnung zu sein: Die Dächer der niedlichen Fachwerkhäuser funkeln und glitzern unter strahlend blauem Himmel und die Bewohner gehen emsig ihrem Tagewerk nach. Aber der schöne Schein trügt - denn hinter der Bilderbuchfassade tun sich mörderische Abgründe auf ... Aber zum Glück ist die energische Hobbydetektivin Bea von Maarstein vor Ort! Zusammen mit ihrem persönlichkeitsgestörten Papagei Dr. Jekyll und dem Dorfpolizisten Sven Grüneis löst sie jeden noch so verzwickten Fall.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
HUMMELSTICH – Die Serie
Über diese Folge
Die Charaktere
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Ein Dorf irgendwo in Deutschland
2. Zwei schräge Vögel
3. Drei mörderische Gedanken
4. Viererlei Gesprächsstoff
5. Nur fünf Minuten
6. Wie ein Sechser im Lotto
7. Ein Buch mit sieben Siegeln
8. Bea macht’s
9. Neun spanische Tapas
10. Für eine Zehntelsekunde
11. Wenn nur noch Fragen helfen
12. Harte Kekse zur zwölften Stunde
13. Buch Nummer dreizehn
14. Vierzehn Prozent
15. Fünfzehn rosige Schweinchen und andere Zwischenfälle
16. Das sechzehnte Infanterie-Regiment
17. Siebzehn auf einen Streich
18. Eins Komma acht Promille
19. Der Kommissar in neunzehn Stücken
20. Mordermittlung 2.0
21. Zwei Kragarme für einen schiefen Kirchturm
22. Zweiundzwanzig Megahertz
23. Dreiundzwanzig Sekunden Todesangst
24. Formular Nummer vierundzwanzig
25. Fünfundzwanzig Kisten und Koffer
26. Sechsundzwanzig Möpse
27. Siebenundzwanzig Karat
28. Achtundzwanzig Wochen später
Rezept für Bunte Papageien-Spieße
In der nächsten Folge
HUMMELSTICH – Die Serie
In Hummelstich scheint die Welt noch in Ordnung zu sein: Die Dächer der niedlichen Fachwerkhäuser funkeln und glitzern unter strahlend blauem Himmel und die Bewohner gehen emsig ihrem Tagewerk nach. Aber der schöne Schein trügt – denn hinter der Bilderbuchfassade tun sich mörderische Abgründe auf … Aber zum Glück ist die energische Hobbydetektivin Bea von Maarstein vor Ort! Zusammen mit ihrem persönlichkeitsgestörten Papagei Dr. Jekyll und dem Dorfpolizisten Sven Grüneis löst sie jeden noch so verzwickten Fall.
Über diese Folge
Die Ankunft der exzentrischen Bea von Maarstein im beschaulichen Örtchen Hummelstich stellt das Leben der Dorfbewohner gehörig auf den Kopf: Bea behauptet, ihre Freundin Henrietta sei keines natürlichen Todes gestorben. Als dann noch zwei Wirtsleute ermordet werden, ist es endgültig vorbei mit der Dorfidylle. Gemeinsam mit dem Halbtagspolizisten Sven Grüneis und ihrem Papagei Dr. Jekyll beginnt Bea zu ermitteln und gerät dabei selbst in größte Gefahr …
Die Charaktere
Bea von Maarstein, 63 Jahre, kosmopolitische Hobbydetektivin, verwitwet, schrill, exzentrisch, lebensfroh, erbt in Hummelstich das Haus ihrer besten Freundin Henrietta von Eichhorn, fährt einen Bücherbus.
Dr. Jekyll, Beas persönlichkeitsgestörter Papagei, ein hellroter Ara, smart und kratzbürstig, hält sich aufgrund einer Fehlprägung als Jungvogel für einen Menschen.
Sven Grüneis, 30 Jahre, Dorfpolizist und Landwirt, naiv und unerfahren, pflichtbewusst und stets korrekt, hat das Herz am rechten Fleck.
Borwin Wandelohe, 56 Jahre, Halbspanier, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Friseurkunst, quirlig, fröhlich, verbreitet stets gute Laune, exzellenter Hobbykoch, begeisterter Theater- und Zirkusfan, liebt es sich zu verkleiden.
Kurt Pfeiffer, 55 Jahre, Kommissar der Bad Frankenberger Mordkommission, leitet die Ermittlungen, leidet unter zahlreichen Phobien, möchte am liebsten nichts mit dem Fall zu tun haben.
Über die Autorin
Katharina Schendel wurde an der Küste geboren, hat fränkische Vorfahren und mag alles, was schief ist. Nach ihrer Schulzeit verbrachte sie mehrere Jahre in Metropolen wie Tokio und London. Heute lebt sie mit ihrer Familie in einer thüringischen Kleinstadt und geht mit Leidenschaft dem Schreiben von Kriminalromanen nach.
Ein Mord kommt selten allein
beTHRILLED
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dorothee Cabras
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © gettyimages: artJazz | Scharfsinn86 | GlobalP | Mike Bentley und © istockphoto: Pere Sanz | Yuliya | Davros | Pedro Neves
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0150-1
www.luebbe.de
www.lesejury.de
1. Ein Dorf irgendwo in Deutschland
Es war ein ganz normaler Sonntagnachmittag in Hummelstich. Die milde Maisonne strahlte auf das kleine Dorf herab und ließ die Dächer der niedlichen Häuser funkeln und glitzern. Der Himmel war strahlend blau, und die unverhohlene Glückseligkeit der Dorfbewohner schwebte wie ein frühsommerliches Hochdruckgebiet über der Gemeinde.
In den Vorgärten und Hinterhöfen herrschte, anders als in den Nachbardörfern, kein sonntäglicher Frieden, sondern emsige Betriebsamkeit. Fröhliches Geklimper von allerlei Werkzeugen mischte sich mit dem Muhen, Gackern und Blöken von Kühen, Hühnern und Schafen. Hier klopfte ein Hammer im Einklang mit einer Bohrmaschine, dort erklang ein Duett von Winkelschleifer und Schweißgerät, wieder woanders heulte ein Motor auf. Die frische Landluft roch nach Schmieröl und Benzin.
Wohin man auch blickte, das ganze Dorf war auf den Beinen. Jeder Bewohner, ob jung oder alt, ging mit emsiger Betriebsamkeit an sein Tagwerk. Sie schraubten, bastelten und montierten, friemelten und lackierten. Das taten sie mit solcher Leidenschaft, dass es beinahe unheimlich war. Kein Zweifel, die Hummelstichler trugen wieder einmal untereinander einen Wettstreit aus, und dabei waren sie unerbittlich.
Tatsächlich waren es nur noch wenige Tage bis zum alljährlichen Mopsrennen, einer heiß geliebten lokalen Tradition, die so gar nichts mit Hunden, Heringen oder weiblicher Oberweite zu tun hatte. Nein, beim Mopsrennen ging es um selbst gebaute Fahrzeuge, die zum einen schnell wie ein geölter Blitz sein sollten und zum anderen das größtmögliche Maß an Originalität vorweisen mussten.
Dabei kamen oft die abenteuerlichsten Gefährte zum Vorschein, und es gab kaum ein Haushalts- oder Gartengerät, das beim Bau eines Gabel- oder Gelenkmopses noch nicht Verwendung gefunden hatte. Die ausgefallenen Kreationen zeugten von handwerklichem Geschick und Einfallsreichtum.
Natürlich wurde es über die Jahre immer schwieriger, etwas ganz und gar Neuartiges zu konstruieren. Deshalb spähte in diesen Tagen so manch einer argwöhnisch über den Zaun zu seinem Nachbarn, horchte an Türen, linste durch Schlüssellöcher oder versuchte, mithilfe vermeintlich beiläufiger Fragen an nutzbringende Informationen über die Konkurrenzfahrzeuge zu gelangen. Je näher der Tag des Rennens rückte, desto stärker wurde der Spionagetrieb. Kurz vor dem Wettkampf war ganz Hummelstich stets ein einziger Horch- und Guckverein.
In den umliegenden Dörfern und Städten eilte den Hummelstichlern der Ruf voraus, verschroben und kauzig, ja bisweilen etwas weltfremd zu sein. Man erzählte sich allerlei skurrile Geschichten über die Dorfbewohner, munkelte sogar von Füchsen und Hasen, die sich hier Gute Nacht sagten. Oft belächelte man die Hummelstichler. Doch das kümmerte sie wenig. Sie mochten ihren Ort und waren stolz darauf, sich mit ihrem Wetteifer von den Bewohnern anderer Ortschaften zu unterscheiden.
Zugegeben, etwas naiv waren sie schon. Denn sie ahnten nicht, welch gefährdete Spezies sie waren. Wären sie Nasenaffen gewesen, hätte man sie längst auf die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten gesetzt. Die Hummelstichler waren nämlich hoffnungslos überaltert. Von insgesamt sechshundertneunundvierzig Einwohnern waren zwei Drittel bereits jenseits der fünfzig. Auf eine Taufe kamen sechsunddreißig Begräbniszeremonien, ein Umstand, der gleich zwei Bestatter und deren Familien ernährte und den Pfarrer regelmäßig in Depressionen stürzte. Mit dem Nachwuchs sah es in Hummelstich nämlich tatsächlich nicht sehr rosig aus, und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die erste spitze Zunge das Wort »Greisendorf« nicht mehr verkneifen können würde.
Laut einer statistischen Erhebung gab es in Hummelstich nur noch dreiundvierzig Kinder und eins Komma fünf Säuglinge. Der sechs Wochen alte Knirps, der die dörfliche Altersstruktur so schamlos nach unten drückte, hieß Jonathan Krummbein, war kerngesund und konnte weder ein Komma noch eine Fünf vorweisen. Es gab auch nirgendwo sonst im Ort einen schauerlichen halben Säugling, doch das war den Behörden, die die Zahlen in regelmäßigen Abständen veröffentlichten, bisher noch nicht aufgefallen. Überhaupt waren Gewalttaten und kapitale Verbrechen im Dorf gänzlich unbekannt. Selbst die Ältesten der Ältesten konnten sich nicht an Mord oder dergleichen erinnern.
Aus diesem Grund war der junge Dorfpolizist Sven Grüneis Inhaber einer halben Arbeitsstelle geworden, womit er es zu einem Kuriosum innerhalb des deutschen Polizeiapparates geschafft hatte. Besonders zufrieden war er damit nicht, schließlich drehte er nicht gern dienstlich Däumchen, sondern verbrachte seine Zeit lieber mit Brautschau und Landwirtschaft. Er besaß einen großen baufälligen Hof mit Fuhrwerken und allerlei Getier, dazu Wiesen, Äcker, Felder und einen großen Garten. Was ihm aber am meisten fehlte, war eine treu sorgende Ehefrau.
Auch der Montag war in Hummelstich ein Tag wie jeder andere. Metzgermeister Erwin Meuselböck wetzte fleißig seine Messer und kam bei seinen Bemühungen, den immensen Fleischkonsum der Dorfbevölkerung zu decken, wie immer mächtig ins Schwitzen. Unbeschwert drehte er Fleischstücke durch den Wolf, würzte die zerhäckselte blassrote Masse nach einem streng gehüteten Rezept und stopfte sie in meterlange Därme. Das Endprodukt wurde von seiner Frau Brunhilde im angrenzenden Laden verkauft.
In der Gunst der Bewohner stand auch der Apotheker Carl Feigenbaum, der zwar kein echter Arzt, aber der Einzige mit Doktortitel im Dorf war. Da er in einem früheren Leben einmal Medizin studiert und dieses Studium sogar abgeschlossen hatte und es in unmittelbarer Entfernung niemanden gab, der über mehr humanmedizinisches Fachwissen verfügte, wurde er bei allen kleinen und großen Wehwehchen um Rat gefragt.
Gegenüber der Apotheke sprühte der Friseur Borwin Wandelohe wie jeden Tag fast über vor Energie und guter Laune. Sein apfelförmiger Körper tänzelte auf schlanken Beinen graziös von Frisierstuhl zu Frisierstuhl, und während er aus voller Kehle das O sole mio trällerte, ondulierte er die Haare zweier Damen, frischte bei einer Dritten die Farbe auf und verpasste einem ergrauten Herrn einen modischen Kurzhaarschnitt.
Borwins ansteckende Fröhlichkeit hätte vor allem der Pfarrer des Dorfes, Theodor Klingbein, dringend nötig gehabt. Am morgigen Dienstag stand eine Beisetzungszeremonie an, und er steckte mitten in den Vorbereitungen. Wie innig hatte er für eine Taufe, eine Konfirmation oder eine Hochzeit gebetet! Doch sosehr er sich auch einen heiteren Anlass wünschte, sein oberster Dienstherr erhörte ihn nicht. Es war eine Beerdigung, die er vorbereiten musste. Schon die sechste in diesem Monat. Nach Feierabend schleppte er sich ins Wirtshaus »Zum Goldenen Lamm« und versuchte, seine Niedergeschlagenheit in dunklem Bockbier und einem doppelten Korn zu ertränken.
Der Wirt, Lutz Schimmelpfennig, klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter, bevor er an eine große Tafel trat und die ersten Wetten für das bevorstehende Mopsrennen entgegennahm.
So weit war, wie gesagt, alles ganz normal und unspektakulär. Erst am Dienstag geschah etwas, was das Leben der Hummelstichler gehörig auf den Kopf stellen sollte.
2. Zwei schräge Vögel
Der Bus, der mit fast neunzig Stundenkilometern die frisch geteerte Landstraße entlangbretterte und mit quietschenden Reifen vor dem kleinen Dorffriedhof zum Stehen kam, war in der Tat alles andere als gewöhnlich. Er besaß eine fast schon Furcht einflößende Überlänge und war zudem gänzlich mit bunten Graffitis bemalt. Aber nicht solche primitiven Schmierereien, wie man sie oft an Hausfassaden oder Zugwaggons sah, sondern ein fabulöses Kunstwerk, das den Betrachter in Staunen versetzte. Unter den hell leuchtenden Scheinwerfern, die sich wie feurige Augen in den morgendlichen Frühlingsdunst bohrten, offenbarte ein riesiger Kühlergrill metallisch glänzende Zähne und erweckte den Eindruck, als blickte man in das Antlitz eines Dämons.
Auf den beiden Seiten der Karosserie war das weit weniger unheimliche Bild eines vierstöckigen Holzregals aufgedruckt worden, das bis auf den letzten Zentimeter mit großen und kleinen, dicken und dünnen Büchern bestückt war. Einige der so dargestellten Buchrücken waren mit einem einzigen großen goldenen Buchstaben versehen. BÜCHER AUF RÄDERN, stand in der einen Reihe, darunter BEAS LEIHBIBLIOTHEK.
Einen solchen Bus hatte ganz Hummelstich noch nie gesehen. Jeder, dem er auf der Fahrt durchs Dorf begegnet war, war wie angewurzelt stehen geblieben. Und auch die kleine Menschengruppe, die sich auf dem Friedhof um ein offenes Grab versammelt hatte, rührte sich nicht vom Fleck und starrte das in der Nähe parkende Ungetüm an.
Pfarrer Theodor Klingbein bekreuzigte sich. Borwin Wandelohe, der Friseur, griff nach Brunhilde Meuselböcks Hand, und der Bestatter Ferdinand Ruhe hielt sich verkrampft an einer weinroten Urne fest. Einen Moment lang hörte man nur die monotone Trauermusik, die aus einem tragbaren CD-Spieler dudelte. Dann rissen alle verdutzt die Augen auf, denn die Tür des riesigen Ungetüms öffnete sich, und eine kleine drahtige und jugendlich wirkende Frau mit kurzen feuerroten Haaren sprang heraus.
Sie war auffällig bunt gekleidet, hielt einen Seesack in der rechten Hand, und auf ihrer linken Schulter saß, so selbstverständlich wie ein gut gewähltes Accessoire, ein munter vor sich hin krächzender und keck in die Welt schauender Papagei.
Scarabea von Maarstein steuerte zielsicher auf die Gesellschaft zu und entsprach dabei weder dem abendländischen Ideal eines Trauergastes noch dem landläufigen Bild einer Bibliothekarin. Außer dem Papagei, dessen scharlachrotes Federkleid ebenso leuchtete wie ihre Haare, trug sie eine zitronengelbe Leinenhose, ein azurblaues Top mit Korallenriff-Print und grasgrüne Lackballerinas mit aufgesticktem Perlenornament. Ein orangeroter Seidenschal, den sie um Schultern und Oberarme geschlungen hatte, und ein breiter Bambusarmreif am linken Handgelenk verdeckten geschickt mehrere Tätowierungen. Winzige Lachfältchen schmückten ihr hübsches Gesicht, und unter den wuscheligen roten Haaren, die wie wild lodernde Flammen in alle Richtungen züngelten, funkelten neugierige smaragdgrüne Augen.
Schon auf den ersten Blick sah man ihr an, wie exzentrisch und ausgeflippt sie war. Die Lust am Leben guckte ihr sprichwörtlich aus jedem Knopfloch. Was man ihr nicht ansah, war ihr Alter. Scarabea von Maarstein war dreiundsechzig Jahre alt.
Zu den abenteuerlichen Besonderheiten, die Bea pflegte, zählte zweifellos ihre Lebensgemeinschaft mit einem persönlichkeitsgestörten Papagei. Der hellrote Ara, dessen Bürzelfedern in Blau und Gelb erstrahlten, war ihr vor zwei Jahren in Castrop-Rauxel zugelaufen und hatte sich ihr als Dr. Jekyll vorgestellt. Aufgrund einer Fehlprägung als Jungvogel hielt er sich für einen Menschen. Wie sein akademischer Titel es vermuten ließ, war er gebildet und außerordentlich sprachbegabt. Nur mit seinen Flügeln wusste er nicht viel anzufangen.
Der Pfarrer war der Erste, der sich aus der Erstarrung löste. Er fragte sich, was um alles in der Welt diese sonderbare Person hier wollte und weshalb sie die Beisetzung störte. Eine Angehörige der verstorbenen Henrietta von Eichhorn konnte sie wohl kaum sein, wenn man sich ihr Outfit so ansah.
»Entschuldigen Sie die Verspätung, ich bin Henriettas Freundin, Bea von Maarstein«, sagte Bea, als hätte sie seine Gedanken gelesen. »Zum Glück bin ich noch rechtzeitig gekommen.«
Was genau sie damit meinte, wurde klar, als sie an den CD-Player herantrat, die leise vor sich hin plätschernde Musik abstellte, die silberne Scheibe entnahm und eine eigene einlegte.
Friseur und Metzgersfrau wechselten irritierte Blicke, der Bestatter räusperte sich. »Leider war uns der Musikgeschmack von Frau von Eichhorn nicht bekannt. Sie hatte hier ja niemanden.« Er sah hastig zu den anderen. »Bis auf unsere kleine Fangemeinde natürlich«, fügte er lächelnd hinzu.
Bea nickte flüchtig und schob den Regler auf volle Lautstärke, woraufhin erst ein lang gezogenes metallisches Fiepen und dann ein fulminantes Gitarrensolo zu hören waren. Die Erde bebte im Rhythmus der rockigen Riffs.
Der Pfarrer war mittlerweile dunkelrot angelaufen. Fassungslos nach Luft ringend, hätte es ihn auch nicht mehr gewundert, wenn Henrietta von Eichhorn in voller Pracht aus der Urne gestiegen wäre. Seine mühsam verfasste Trauerrede hatte er vor Schreck gänzlich vergessen. Frau Meuselböck blickte sich Hilfe suchend um, und der ohnehin schon blasshäutige Bestatter war noch eine Spur fahler geworden. Nur der dickbäuchige Friseur versuchte vergeblich, hinter seinem gezwirbelten Schnurrbart ein Schmunzeln zu verstecken.
Bea ergriff nun das Wort. »Hetty war mit Abstand der fröhlichste und lebenslustigste Mensch, den ich gekannt habe. Sie hätte gewollt, dass wir es auch sind. Gerade an diesem Tag. Ihr stand nie der Sinn nach Trübsal. Also weg mit den Leichenbittermienen!«
Sie nahm eine Flasche edlen Jahrgangssekt aus dem Seesack und ließ den Korken knallen. Dann schenkte sie sich etwas in einen Tonkrug ein, den sie ebenfalls aus der Tasche gezogen hatte, und prostete der Urne zu, die noch immer in den Armen des Bestatters lag. »Auf dich, Hetty! Anstatt dich mit Erde zu bewerfen, wollen wir mit Sekt auf dich anstoßen.«
Sie zauberte weitere Tonkrüge hervor, schenkte ein und teilte aus. Immer noch völlig perplex und überrumpelt, folgte die kleine Beerdigungsgesellschaft ihrem Vorbild.
Als alle einander zugeprostet und getrunken hatten, zwinkerte Bea dem Bestatter schelmisch zu. »Es hätte Henrietta sehr gefallen, wenn sie gewusst hätte, dass die Männer sie immer noch auf Händen tragen.«
3. Drei mörderische Gedanken
Natürlich empfand Bea eine tiefe Trauer über den Tod ihrer besten Freundin. Sie würde Hetty für eine ganze Weile nicht wiedersehen. In diesem Leben zumindest nicht.
Das wurde ihr in dem Moment bewusst, als sie die Tür zu dem Häuschen aufschloss, das Hetty vor einigen Jahren gekauft und bezogen hatte. Das Häuschen, das nun ihr gehörte und von dem sie gar nicht richtig wusste, ob sie es überhaupt haben wollte. Sie liebte es, unterwegs zu sein, neue Orte zu erkunden, frei und unabhängig die Welt zu bereisen. Konnte sie sich wirklich vorstellen, noch einmal sesshaft zu werden?
Das Haus lag unweit der Dorfkirche am Ende einer gewundenen Straße. Nur wenige Meter entfernt begann ein dichter dunkler Wald, dessen alte Bäume die Äste kraftvoll in den Himmel reckten. In dem pittoresken Vorgarten, der sich vor dem Haus erstreckte, wuchsen Pfingstrosen und Vergissmeinnicht. Zwei Birken schwangen sanft im Wind. Es sah aus, als schunkelten sie.
Wie alle anderen Gebäude im Dorf war auch Henriettas Haus klein und niedlich. Es besaß zwei Stockwerke, ein hübsches Spitzdach sowie einen niedrigen Dachboden, den man geraden Hauptes nur dann betreten konnte, wenn man ein Zwerg, ein Hobbit oder ein Andamaner war. Die Fassade war weiß gestrichen, Tür und Fenster erstrahlten im allerschönsten Himmelblau.
Als Bea die Haustür öffnete, strömte ihr ein vertrauter Geruch entgegen. Eine Mischung aus frischen Sägespänen, karamellisiertem Popcorn, Staub, wilden Tieren, Motorenöl und Schminke. Zirkusluft.
Mehr als fünfzig Jahre lang war das fahrende Volk Henriettas Zuhause gewesen. Nach der Zeit im Internat hatte sie sich einem bekannten Wanderzirkus angeschlossen und sich unsterblich in Johann, den Entfesselungskünstler und Messerwerfer, verliebt. Neben der großen Liebe hatte sie im Zirkus auch den Ort gefunden, wo sie am glücklichsten war: auf einem dünnen Drahtseil in zehn Metern Höhe.
In Henriettas Häuschen erzählten Hunderte von Postern und Fotografien von dieser glanzvollen Zeit. Sie zeigten eine elegante junge Frau von natürlicher Schönheit mit goldblonden Engelslocken und der Ausstrahlung einer glamourösen Filmdiva. Auf einigen Bildern war auch Johann, der Messerwerfer, zu sehen, ein stattlicher Hüne voller Tatendrang und Leidenschaft.
Bea durchstreifte die einzelnen Zimmer und lächelte. Das Häuschen war innen wesentlich geräumiger, als es von außen den Anschein hatte. Hettys Liebe zum Zirkus war nicht zu übersehen. Schwere Tierskulpturen säumten die Fenster, Tapeten und Vorhänge trugen das blau-rote Streifenmuster eines Zirkuszeltes. Alles war liebevoll gestaltet, voller origineller Details, und strahlte angenehme Behaglichkeit aus. Hier würde sie sich wohlfühlen, keine Frage.
Die Möbel im Wohnzimmer waren aus dunklem Holz gefertigt. Bea setzte Dr. Jekyll auf die Lehne eines plüschigen, mit purpurrotem Samt bespannten Ohrensessels und wanderte gedankenverloren durch den Raum. Neben dem Kamin stand auf einem zierlichen alten Hocker ein nostalgisches Trichtergrammofon. Mehrere alte Schellackplatten lagen darum verstreut, einige Dutzend weitere waren in der untersten Reihe eines großen Bücherregals ordentlich gestapelt. Im Zimmer gab es außerdem ein bequemes Sofa, einen niedrigen Couchtisch, der an ein rundes Zirkuspodest erinnerte, sowie mehrere blaugraue Zinnvasen mit getrockneten Hortensien darin. Kerzen in allen Größen, Formen und Farben zierten Regale, Tische und Fensterbretter.
In einer kleinen Nische zeichneten sich zwei menschliche Konturen ab. Es waren kopf- und gliedlose Torsos aus Keramik, mit wunderschönen Kostümen bekleidet. Links ein kurzes Kleid aus schneeweißen Federn, das Henrietta bei ihren spektakulären Auftritten getragen hatte. Rechts ein violetter, mit Pailletten bestickter Frack. Johanns Kostüm. Die Arbeitskleidung des Messerwerfers.
Bea trat an das Bücherregal und ließ den Blick über die bunten Buchrücken schweifen. Instinktiv griff sie nach der Mausefalle, einem Kriminalroman von Agatha Christie, den sie Henrietta vor vielen Jahren geschenkt hatte. Krimis waren schon immer Hettys literarische Leidenschaft gewesen, und fast zwei Drittel ihrer Bücher gehörten diesem Genre an.
Als Bea das Buch gerade zurückstellen wollte, bemerkte sie, dass etwas aus den Seiten hervorlugte. Erst dachte sie, dass sich einige Buchseiten gelöst hatten, dann sah sie jedoch, dass es ein Brief war. Auf dem blütenweißen Umschlag war mit kobaltblauer Tinte Für Bea und darunter der Zusatz Erst nach meinem Tod zu öffnen geschrieben. Es war die Handschrift ihrer Freundin.
Bea setzte sich auf das Sofa und betrachtete den Brief eine Weile. Drehte und wendete ihn. Wog ihn in der Hand. Zögerte. Derweil trippelte Dr. Jekyll ungeduldig auf der Sessellehne hin und her und warf energisch den Kopf nach vorn.
Sie atmete tief ein. Dann fasste sie sich ein Herz, öffnete das Kuvert, entfaltete ein elfenbeinfarbenes Papier und las:
Liebe Bea,
bitte ängstige dich nicht, wenn du dies liest. Post von den Toten bekommt man nicht alle Tage, und ich weiß, wie schreckhaft du sein kannst. Doch das geschriebene Wort ist nun mal die einzige stilvolle Möglichkeit, mich dir auch nach meinem Ableben noch mitzuteilen.
Zuerst möchte ich dir für unsere lange und wunderbare Freundschaft danken. Ich weiß, ich habe immer einen Platz in deinem Herzen, und genauso hast du einen Platz bei mir. Wenn ich in der Vergangenheit schwelge, dann denke ich immer auch an dich, denn du hast mein Leben stets bereichert.
Wie du weißt, habe ich dir mein kleines Haus in Hummelstich samt seinem gesamten Inhalt vermacht. Das meiste ist wohl sentimentaler Krimskrams, und es steht dir frei, damit zu tun, was du für richtig hältst. Ich hoffe, ich bürde dir damit keine allzu große Last auf.
Ich vermache dir jedoch auch etwas von finanziellem Wert. In der indischen Schatulle, die neben unseren Kostümen im Wohnzimmer steht, findest du fünf silberne Messer. Ein Maharadscha, der vor vielen Jahren einmal unsere Vorstellung besuchte, war von Johanns Können so begeistert, dass er ihm dieses Geschenk machte. Jedes der Messer ist mit kostbarsten Juwelen besetzt. Den genauen Wert kenne ich nicht, aber es handelt sich wohl um ein kleines Vermögen. Johann ist oft mit ihnen aufgetreten, und er hat gesagt, es seien die besten Wurfmesser, die er je in Händen halten durfte.
Zu meinen Lebzeiten konnte ich mich nie davon trennen. Zu viele Erinnerungen hängen daran. Dir aber, liebe Freundin, möchte ich mit Nachdruck raten: Solltest du dich je in einer finanziellen Notlage befinden, so zögere nicht und verkaufe die Messer. Sie werden einen guten Preis erzielen. Sollten sie dir einen unbeschwerten Lebensabend ermöglichen, so haben sie die beste aller Verwendungen gefunden.
Nun denn, liebste Bea, lebe wohl, bis zu dem Tag, an dem wir uns wiedersehen.
Deine Hetty
Für eine Weile verharrte Bea schweigend auf dem Sofa und ließ den Tränen freien Lauf. Dann, als ihre Augen schon ganz gerötet waren, setzte sie sich ihren Papagei auf die Schulter und sah sich um.
Lange suchen musste sie nicht. Die mit kostbarem indischem Seidenstoff bespannte Schatulle hatte die Form und Größe eines handelsüblichen Umzugskartons. Das türkisfarbene Gewebe schimmerte und glänzte und war mit silbernen Fäden bestickt. Der Riegel war nicht verschlossen und ließ sich leicht öffnen. Bea hob den Deckel an und blickte hinein. Die Schatulle war leer.
»Oh-oh«, rief Dr. Jekyll. »Gar nicht gut. Gar nicht gut.«
Merkwürdig, dachte Bea. Sehr merkwürdig.
Hatte Hetty eine andere indische Schatulle gemeint? Nein, das war ausgeschlossen. Hier gab es sonst nichts, was auch nur entfernt indisch aussah. Hatte sie die Messer vielleicht woanders aufbewahrt? Doch warum sollte sie? Hetty hatte es in ihrem Brief doch eindeutig formuliert. Nein, das war nicht ihre Art. Es blieb nur eine Möglichkeit: Das Messerset war verschwunden. Konnte es sein, dass dies mit Henriettas Tod in Verbindung stand? Hatte jemand die kostbare Hinterlassenschaft gestohlen? Wenn jemand gewusst hätte, wie wertvoll die Messer waren, hätte er einen Grund gehabt, sie zu beseitigen.
Das war das erste Mal an diesem Vormittag, dass Bea an Mord dachte.
Später ging sie zum Kamin, um ihn zu reinigen und zu neuem Leben zu erwecken. In der dunklen Asche lagen halb verbrannte Holzstücke. Sie sah genauer hin. Da war auch noch etwas anderes, irgendetwas Silbernes. Mit einer Pinzette bewaffnet, kauerte sie sich auf den Boden und zog das kleine glänzende Etwas heraus. Es war ein rundes Stückchen Folie mit einer Aufschrift. Digitoxin, stand da in winzigen Buchstaben. Offensichtlich der Rest eines Tablettenblisters.
Digitoxin? Das klingt nicht nach einem harmlosen Mittel gegen Husten, überlegte Bea.
Warum sollte Hetty überhaupt Tablettenverpackungen verbrennen?, grübelte sie weiter. Doch wenn sie es nicht getan hatte, wer dann? Ein Fremder? Ein Gast? Aber wieso? Die Frage dehnte sich aus wie ein Echo. Hier soll etwas vertuscht werden!, kam ihr plötzlich in den Sinn. Das war das zweite Mal an diesem Tag, dass sie der Verdacht beschlich, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging.
In der Küche brühte sie sich einen starken Bohnenkaffee auf. Dazu verkostete sie Henriettas selbst gemachten Blutwurzschnaps, den sie im Dielenschrank gefunden hatte. Ein edles Tröpfchen. Dr. Jekyll bereitete sie einen Imbiss aus einem halben Apfel und einer Handvoll Sonnenblumenkerne zu. Zärtlich kraulte sie sein bunt gefiedertes Köpfchen.
»Was ist hier bloß geschehen?«, murmelte sie vor sich hin, mehr zu sich selbst als zum Papagei.
»Das ist doch klar«, krächzte Dr. Jekyll und beäugte sie, als wollte er ihre Reaktion abwarten und sichergehen, dass er ihre volle Aufmerksamkeit bekam.
Sie blickte ihn fragend an. Zwar war sie es gewohnt, dass er zu allen passenden und vor allem unpassenden Gelegenheiten seinen Senf dazugab. Hellseherische Fähigkeiten hatte sie bei ihm bisher jedoch eher selten beobachtet.
»Eiskalter Mord«, verkündete er. »Die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern.«