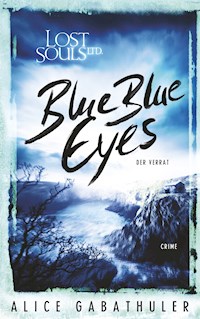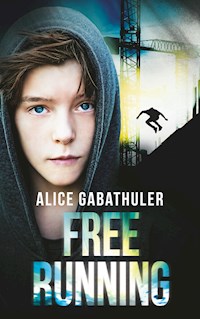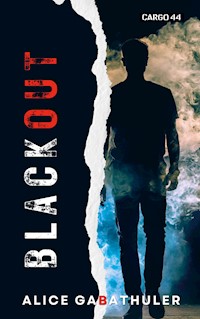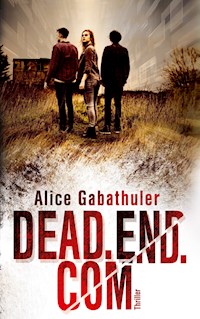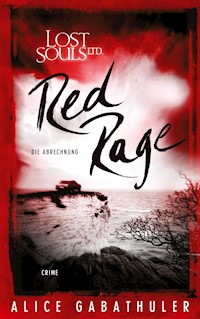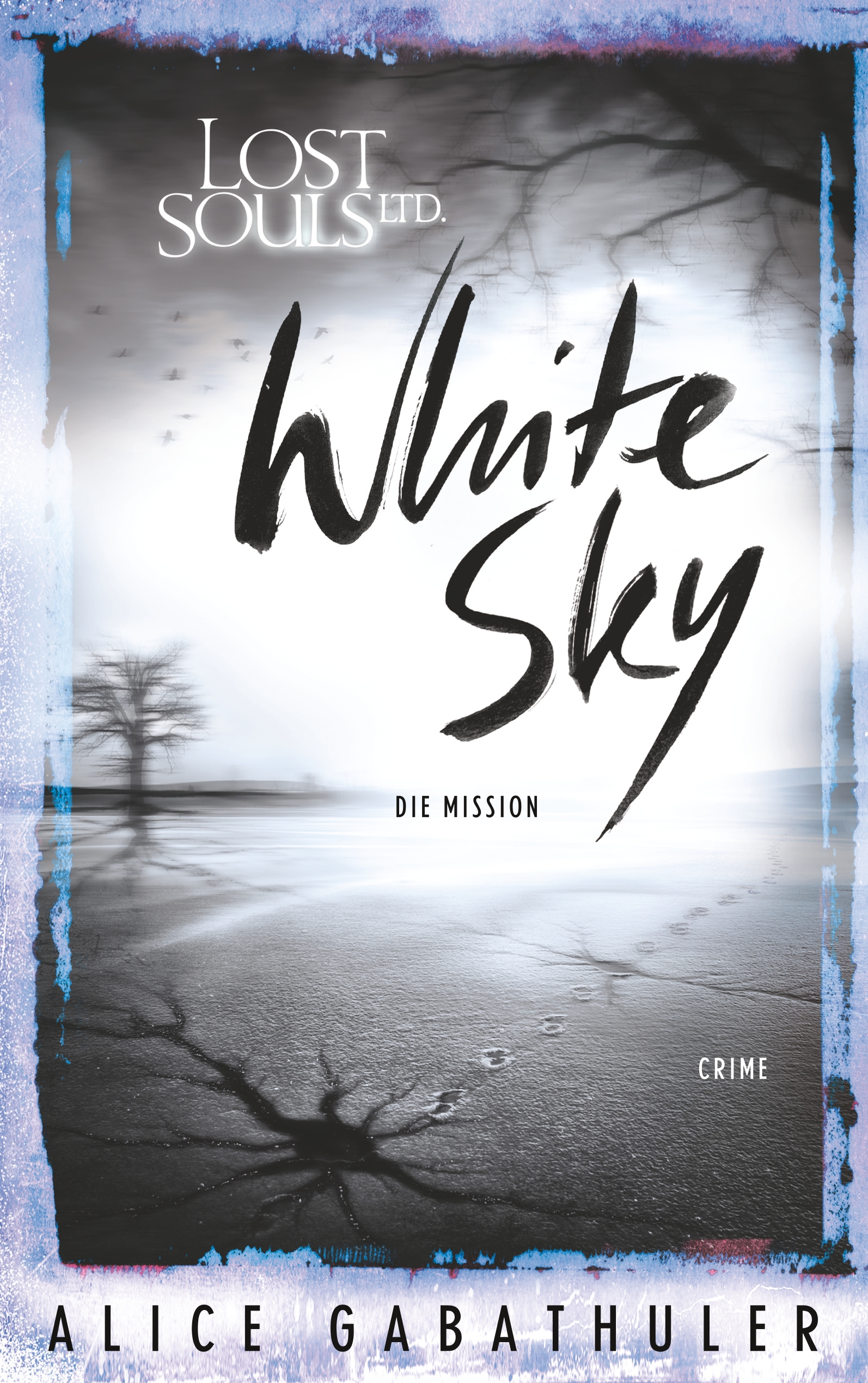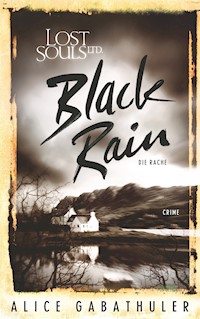Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wie viele Lügen haben in zehn Jahren Platz? Hundert? Tausend? Hunderttausend? Zu viele. Die Geschwister Manon und Kris waren unzertrennlich. Bis ein Sommercamp ihre unbeschwerte Kindheit brutal beendete. Ihre Familie zerbrach, ihre Leben drifteten auseinander. Drohbriefe an den Vater bringen die beiden wieder zusammen - aus den Spielen von einst wird blutiger Ernst. Verdächtigungen, Anschuldigungen. Lügen. Und am Ende aller Lügen wartet unbarmherzig die Wahrheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich war fünf, als das Unheil seine Schwingen ausbreitete und Kris wegen mir beinahe starb. Die Schwingen legten sich um Mama und umschlangen sie, bis etwas in ihr zerbrach. Sie verließ uns. Kris weinte wochenlang. Ich fror. Es gab keinen einzigen Tag, seit sie weg war, an dem ich nicht gefroren hatte. Ich fror auch an dem Tag, an dem ich Kris wiedersah.
Manon
Manon hatte sich neu erfunden. Kein Schwarz mehr, keine zerrissenen Klamotten, keine Rastas, keine Million Ketten und Armbänder, keine meterdicke Schminke. Sie sah aus, wie eine Luxusausgabe von Happy-Miss-Durchschnitt. Ich wusste es besser. Manon würde immer die Fucked-up-Princess sein, zu der ich sie gemacht hatte.
Kris
a hundred ways
a hundred lies
a hundred cries
a hundred times
down in the rain
the show goes on
The Beauty of Gemina - »Ghost Prayers«
für Michael Sele mit unendlichem Dank
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
1. KRIS
2. MANON
3. KRIS
4. Manon
5. KRIS
6. Manon
7. Kris
8. MANON
9. KRIS
10. MANON
Teil 2
11. KRIS
12. MANON
13. KRIS
14. MANON
15. KRIS
16. MANON
17. KRIS
18. MANON
19. KRIS
20. MANON
21. KRIS
22. MANON
23. KRIS
24. MANON
25. KRIS
26. MANON
27. KRIS
28. MANON
EPILOG
Teil 1
and the dragon I am
and the princess you are
and I’m wearing a scar
1. KRIS
Wir kreisten seit einer halben Stunde über Zürich. Turbulenzen schüttelten die Maschine durch. Vor den Fenstern schossen Nebelschwaden vorbei. Der Anzugträger neben mir hatte seine lässige Coolness längst verloren und krallte seine Finger in die Armlehnen. Schweiß auf der Stirn, den Blick geradeaus gerichtet, saß er da und murmelte etwas vor sich hin. Es klang wie ein Gebet. Vielleicht waren es auch nur die Börsenkurse. Was weiß ich. Es war egal. Unter uns öffnete sich ein Luftloch. Wir sackten ins Endlose. Einige Passagiere schrien. Ich lachte.
»Das ist nicht lustig«, zischte mein Sitznachbar.
Wahrscheinlich nicht. Weder für ihn noch die schluchzende Frau ein paar Reihen hinter mir. Bestimmt hatten die beiden etwas, für das es sich zu leben lohnte, selbst wenn es bei dem Typen neben mir nur der nächste Gewinn im Spiel um noch mehr Gewinn war.
Sie hatten etwas zu verlieren. Ich nicht.
Du lügst , meldete sich Murphy in meinem Kopf.
Seit Wochen klebte dieser verdammte Irre in meinen Gedanken wie eine Fliege an einem Fliegenfänger. Sogar jetzt, auf diesem Höllenritt zwischen Himmel und Erde, dessen Ausgang völlig offen war.
»Elliot Murphy.«
Mehr sagte er bei unserer ersten Begegnung nicht. Er drehte mir den Rücken zu und nahm auf einem der beiden braunen Ledersessel Platz.
Sein vorgetäuschtes Desinteresse langweilte mich genauso wie sein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug einer Rockband aus den Siebzigern. Ich drehte mich um und ging. Murphy hielt mich nicht zurück. Er folgte mir nicht. Er setzte nicht einmal seine Vorzimmerdame auf mich an. Er ließ mich einfach gehen. Ich schloss eine Wette mit mir ab, wer sich zuerst bei mir melden würde. Murphy oder Dad. Ich tippte auf Murphy. Aber der rief nicht an. Mein Vater auch nicht. Entweder hatte Murphy ihm nicht gesagt, dass ich den Termin platzen lassen hatte, oder die beiden verbündeten sich mit einer neuen Masche gegen mich.
Zur nächsten Sitzung erschien ich gar nicht erst. Wozu auch? Murphy war nur ein weiterer Name auf einer langen Liste von Seelenklempnern, die versuchten, in meinen Kopf zu sehen. Alle anderen vor ihm hatte ich ausgetrickst und abgeblockt. Ich würde auch diesen Möchtegern-Freak austricksen. Für irgendetwas war mein hoher IQ also doch gut, wenn er mich schon nicht zu einem gesellschaftstauglichen Menschen machte.
Auch nach meinem zweiten verpassten Termin bei Murphy geschah nichts. Keine Anrufe, kein Sperren meiner Kreditkarte, kein diskreter Besuch von Alex, Dads Mann für heikle Angelegenheiten.
Ich ließ zwei weitere Termine sausen. Wieder geschah nichts. Vielleicht hatte Dad aufgegeben. Oder Murphy verheimlichte ihm, dass ich nicht auftauchte, und kassierte einfach die Kohle. Hätte ich ihm glatt zugetraut.
Nach ungefähr einem Monat wurde mir klar, dass sich Murphy in meinem Hirn eingenistet hatte, ohne dass wir eine einzige Therapiestunde zusammen verbracht hatten. Ich musste auf andere Gedanken kommen. Also legte ich mich mit Rodriguez an. Das war der einfachste und sicherste Weg, mir einen Knockout mit nachfolgenden Höllenschmerzen einzufangen. Als Rodi mich beim Sport anrempelte, zischte ich ihm eine Beleidigung ins Ohr. Er wartete bis nach dem Training. In der Umkleide knallte er meinen Kopf gegen einen Spind. Es gab ein hässliches Geräusch, meine Stirn platzte auf und Blut rann über mein Gesicht. Ich wirbelte herum und schlug zurück. Rodi war so überrascht von meiner Gegenwehr, dass er zu Boden ging. Benommen stützte er sich auf seine Ellbogen und spuckte Blut auf den Boden. »Macht ihn fertig«, befahl er.
Ich konnte nicht sehen, wer sich von hinten gegen mich warf, aber es gab genügend Leute, die nur auf eine Gelegenheit wie diese gewartet hatten. Was danach geschah, weiß ich nicht. Nur, dass ich aufwachte, weil es eiskaltes Wasser auf mich regnete.
»Was ist los, Mortensen?«, schnarrte die Stimme meines Trainers durch das Rauschen der Dusche.
Ich rollte mich auf den Rücken.
»Nichts, Trainer.«
»Nichts?«
»Muss beim Duschen ausgerutscht sein.«
»Du duschst in deinen Klamotten?«
»Sieht so aus.«
Der Trainer gab sich damit zufrieden. Rodriguez war sein bester Mann. Er brauchte ihn. Mich nicht. Aber er wusste, wer mein Dad war, und deshalb brachte er mich vorsichtshalber zum Arzt. Anschließend begleitete er mich aufs Sekretariat, wo ich meinen Unfall meldete und betonte, dass ich wegen so einer Kleinigkeit keine Benachrichtigung meines Vaters wünschte.
Ich schluckte keine der Tabletten, die mir der Doc gegeben hatte. Es sollte richtig heftig wehtun. Nicht nur am Kopf, sondern auch dort, wo mich die Tritte meiner Mitschüler getroffen hatten. Ich glaube, ich dachte wirklich, dass ich mit dieser sinnlosen Aktion Murphy aus meinem Schädel bekommen konnte. Tatsache ist, dass Murphy dadurch erst recht in meinem Kopf drinsteckte und mein IQ mal wieder völlig für den Arsch war.
In der elften oder zwölften Woche ging ich hin, um Murphy zu sagen, dass ich nicht kommen würde. Weder jetzt noch irgendwann.
»In Ordnung«, antwortete er.
Ich starrte auf das T-Shirt mit dem ewig gleichen Schriftzug und fragte mich, ob er davon einen ganzen Stapel im Kleiderschrank hatte.
»Kennst du Stormbringer?«, wollte er wissen.
Der Typ war genauso krank im Kopf wie ich. Ich schenkte ihm und mir die Antwort und zog Leine. Murphy hielt mich nicht auf.
Zurück in meinem Zimmer, googelte ich Stormbringer . Es war ein Song der Band auf dem T-Shirt. Da drin gab’s eine Songzeile, in der’s ums Bluten ging. Verdammt. Ahnte Murphy, was ich getan hatte? Was wollte er? Rennen sinnlos! Eine weitere Songzeile. Doch genau das tat ich. Ich lud den Song runter und rannte. So schnell und so weit, wie ich noch nie gerannt war.
Als es Zeit für den nächsten Termin war, trat ich über die Schwelle und setzte mich in den Sessel. Murphy nahm den anderen. Ich sagte eine Stunde lang kein Wort. Er auch nicht. Das zogen wir drei Wochen durch. Wir saßen da und schwiegen. Zwischen den Terminen rannte ich. Dabei lief immer nur dieser eine Song. Stormbringer . Ich ritt auf dem Regenbogen, starrte Risse in den Himmel, tanzte auf dem Donner und entkam trotzdem nicht.
»Scheißsong«, sagte ich bei der nächsten Sitzung.
»Du lügst.«
Da wir schon mal mit dem Sprechen angefangen hatten, redete Murphy weiter und erzählte mir von der Band. Er hatte sie mehr als dreißig Mal live gesehen.
»Sie sind verrückt.«
»Sind wir das nicht alle?«
Nun, zumindest wir beide waren es definitiv. Ich begann, mir andere Songs der Band anzuhören. Child in Time brachte mich zum Heulen. Ich hatte seit beinahe zehn Jahren nicht mehr geweint. Ich meine, so richtig. Nicht, weil mir etwas körperlich wehtat, sondern weil sich die Worte durch die dicke Schutzschicht bohrten, unter der der kleine Junge von damals den Drachen verborgen hatte.
Ich hielt nicht alle Termine ein. Aber ich rannte immer noch. Schneller als je zuvor. Mittlerweile war ich so fit, dass mir der Trainer vor versammelter Klasse vorschlug, mich fürs Laufteam zu melden. Rodriguez schnappte nach Luft. Ich lehnte ab.
Und dann kam Dads Anruf.
»Ich will, dass du nach Hause kommst.«
Ich hatte kein Zuhause. Längst nicht mehr.
»Du mich auch«, antwortete ich und drückte Dad weg.
Seine Textnachricht folgte keine fünf Minuten später. Flug gebucht . Mir blieben zwei Möglichkeiten: abhauen oder mich dem Befehl meines Vaters beugen.
Ich platzte bei Murphy rein. Ohne Termin.
»Ich muss nach Hause.«
Keine Ahnung, warum ich ihm das verriet. Und schon gar keine, worauf ich wartete. Dass er mir widersprach? Mir empfahl, mich der Konfrontation zu stellen?
»Kennst du Murphys Gesetz?«, fragte er.
»Das mit dem Brot, das mit der Butterseite auf den Boden knallt?«
»Ja. Vergiss es.«
»Was?«
»Das Gesetz mit dem Butterbrot. Es taugt nicht.«
»Ich nehme dann mal an, Sie haben Ihr eigenes.«
Er grinste. »Hab ich. Elliot Murphys Gesetz.«
»Schön für Sie.« Ich stand auf.
»Du kannst es bezwingen«, sagte er.
»Was? Das Butterbrot?«
»Das Monster in dir.«
Ich wusste genau, wovon er sprach. »Nein.«
Er kannte den Drachen nicht. Er kannte mich nicht. Er wusste nicht, was ich getan hatte.
»Doch. Aber das geht nur, wenn du dich deiner Angst stellst.«
»Netter Versuch, Murphy.« Und dann schob ich diesen Worten tatsächlich ein »Danke« nach. Ich nehme an, weil er der Erste war, der gar nicht erst versuchte, mir das Monster auszureden.
»Wir stürzen nicht ab«, sagte ich zu dem Typen neben mir.
»Woher willst du das wissen, du Klugscheißer?«
»Murphys Gesetz.«
»Murphys Gesetz?« Sein Gesicht war grau vor Angst. »Nach diesem Gesetz wird es schiefgehen. Wir stürzen ab.«
Ich lehnte mich im Sitz zurück. »Das mit dem Butterbrot können Sie vergessen. Sie müssen sich Ihrer Angst stellen. Dann können Sie sie bezwingen.«
Er stöhnte. »Halt bloß die Klappe.«
Wir stürzten nicht ab. Was natürlich weder an Elliot Murphy noch an seinem Gesetz lag, sondern am Piloten. Er zog die Maschine zweimal kurz vor dem Aufsetzen hoch. Beim dritten Mal landete er. Hart, aber sicher.
»Murphys Gesetz«, sagte ich zu meinem Sitznachbarn. »Ich hab’s Ihnen ja gesagt.«
»Idiot«, murmelte der Anzugträger und ich wusste, dass ich den irren Murphy wiedersehen würde. Irgendwann. Vielleicht erzählte ich ihm dann sogar von dem Drachen. Und der Prinzessin, die längst keine mehr war.
Alex wartete am Ausgang des Terminals auf mich. Dort, wo eigentlich niemand parken darf. Er war nicht allein. Neben ihm standen zwei Männer in dunklen Anzügen. Teuer. Maßgeschneidert. Das elegante Aussehen täuschte. Die breiten Schultern und die leicht angespannte Haltung verrieten sie. Genauso wie ihre Blicke, die unauffällig mein Umfeld abscannten.
»Schön, dass du kommen konntest«, empfing mich Alex.
Angesichts der Tatsache, dass hinter diesem Kommen keine Freiwilligkeit lag, und in Anbetracht der Anzahl Leute, die mein Vater aufgeboten hatte, um mich abzuholen, war diese Begrüßungsfloskel ein schlechter Witz.
»Hast du die Kavallerie mitgebracht, weil Dad Angst hat, dass ich im letzten Moment abhaue?«
Alex antwortete nicht. Er öffnete die Tür hinter dem Beifahrersitz und bedeutete mir einzusteigen. Ich stellte einem der beiden Aufpasser mein Gepäck vor die Füße und ließ mich auf die Rückbank fallen. Keine zwei Minuten später war meine Tasche im Kofferraum verstaut und wir saßen zu viert im schwarzen BMW. Alex startete den Motor.
Ich wartete mit meiner Frage, bis wir das Flughafengelände hinter uns gelassen hatten und auf die stark befahrene Autobahn eingebogen waren.
»Spuck’s aus, Alex. Was ist los?«
Ich sah, wie er in den Rückspiegel schaute. Unsere Blicke trafen sich. »Wir haben ein Problem.«
Da ich nicht mehr als meine üblichen Probleme hatte und in den Augen meines Dads vor allem welche machte, musste er das Problem haben. Ich fand das einigermaßen erstaunlich, denn Dad behauptete bei jeder Gelegenheit, es gebe keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Er nannte sie allerdings nicht so, sondern benutzte das englische Wort dafür. Challenges. Er suchte sie. Weil er sie brauchte. Sie waren mehr als sein Job. Sie waren sein Leben. Je größer die Challenge, desto besser. Deshalb war er in der Schweiz gelandet. Bei der ultimativen Herausforderung. Einer Rohstofffirma, die am Abgrund stand. Was ich bei einem Firmennamen wie Clear Blue Horizon ziemlich witzig fand. CBH konnte also nicht das Problem sein, um das es hier ging. Mano, fuhr es mir durch den Kopf. Diesmal hatte sie es geschafft. Mein Herz krampfte. Blockierte die Blutzufuhr. Mir war von null auf hundert schwindlig.
»Manon ist auch da.«
Alex war der Einzige, der ihren Namen so aussprach, wie ihn unsere Mutter für sie ausgesucht hatte. Französisch. Ich merkte, dass ich die Luft angehalten hatte, und atmete langsam aus. Mano. Die gefallene Prinzessin. Meine Schwester.
»Sie ist nicht tot?«, presste ich aus meinem völlig trocken gewordenen Mund.
»Nein«, antwortete Alex ernst, als wäre das tatsächlich eine Option gewesen.
Ich atmete ein. Mein Herz tat trotzdem immer noch weh.
»Was ist dann der Grund dafür, dass Dad die Familie zusammentrommelt und uns zwei Aufpasser mitgibt?«, fragte ich, nachdem ich mir das Sprechen wieder zutraute.
»Es gibt massive Schwierigkeiten.«
»Die gibt es überall, wo Dad hinkommt.«
Unter den Sanierern von maroden Firmen gehörte Dad zu den härtesten und skrupellosesten. So was lief nicht ohne Folgen ab. Entlassene Mitarbeiter, die schreiend die Büros ihrer Vorgesetzten stürmten, weinend von der Security zum Ausgang eskortiert wurden oder sich in ihrer Verzweiflung still und leise umbrachten. Ausgebootete Manager, die nach Rache dürsteten. Politiker, die Köpfe rollen sehen wollten. Medien auf der Suche nach der ultimativen Story.
Alex seufzte hörbar. »Du hast wirklich keine Ahnung, stimmt’s?«
»Wie immer, Alex.«
»Nichts vom Einsturz der Goldmine in Tansania gehört?«
»Nein.«
»Zweihundertfünfzig Tote.«
»Lass mich raten: ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Schlechte bis gar keine Sicherheitsvorkehrungen. Kein Flucht-, kein Notfallplan. Chaos. Unterirdische Kommunikation. Schäbige Entschädigungen für die Angehörigen der Opfer. Irgendein korruptes Staatsoberhaupt, das in Panik ist und wilde Drohungen ausstößt, weil es seinen Arsch retten will.«
Alex schwieg.
»Das kostet einen Rohstoffkonzern doch selten mehr als eine verlogene Entschuldigung und ein wertloses Versprechen, neue Sicherheitsstandards einzuführen«, setzte ich noch einen oben drauf. »Und natürlich eine Stange Geld für das korrupte Schwein von Staatsoberhaupt.«
»Bist du etwa unter die Satiriker gegangen?«, fragte Alex.
Ich ignorierte den bissigen Unterton in seiner Stimme. »Und?«, bohrte ich nach. »Was ist da noch?«
»Sag bloß, du hast die Schlagzeilen und die Fotos nicht gesehen. CBH und damit dein Vater stehen seit Tagen im Kreuzfeuer einer Medienschlacht.«
Irgendwo in meinem Gedächtnis regte sich etwas. Ich sah Bilder vor mir. Bilder von Kindern mit leer geweinten Augen auf Aushängen der Zeitungsstände, an denen ich vorbeigerannt war. Ich erinnerte mich sogar an eine der Schlagzeilen. Die gnadenlose Gier der Manager. Alltag für Dad. Schlagzeilen wie diese war er gewohnt. Die Shitstorms auch. Afrikanische Kinderaugen hatten eine Halbwertszeit von ein paar Tagen. So was kostete ihn höchstens ein kurzes Schulterzucken.
»Tansania ist weit weg«, sagte ich.
»Aber der Sitz des Konzerns ist hier. Die Mine in Tansania ist nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Presse wirbelt seit Wochen Schlamm auf, weil irgendwelche Hacker Offshore-Konten aufgedeckt haben.«
Und damit wohl auch verschachtelte Firmenkonstrukte samt Steuerhinterziehung. Das katapultierte Dad zwar weit nach oben auf der Skala der unbeliebtesten Wirtschaftsfuzzis, erklärte jedoch die zwei Gorillas in Anzügen nicht, die schweigend bei uns im Wagen saßen und so taten, als ginge sie dieses Gespräch nichts an.
»Rohstoffkonzerne stehen in der Schweiz seit Längerem unter der Beobachtung von Globalisierungsgegnern und Gerechtigkeitsfanatikern«, klärte mich Alex auf. »Eine kleine Aktivistengruppe zettelt gerade so etwas wie einen öffentlichen Aufstand an.«
Der Gedanke belustigte mich. »Der letzte Schweizer Aufständige hieß Wilhelm Tell, und von dem ist noch nicht mal sicher, ob es ihn gab. Wenn’s Geld bringt, ist denen doch egal, woher es kommt und ob da Blut dran klebt.«
Die Bemerkung trug mir einen gehässigen Blick meines Sitznachbarn ein. War wohl ein Schweizer. Sein Problem. Wahrscheinlich hatte Alex vergessen, ihm gegenüber zu erwähnen, dass ich die Sozialkompetenz und das Einfühlungsvermögen eines Einzellers hatte.
»Du vergisst die humanitäre Schweiz«, erinnerte mich Alex.
»Ah, ja. Die Schweiz, der das Boot im Krieg zu voll war. Weshalb sie die Juden über die Grenze nach Deutschland zurückschickte. Direkt in den Tod. Sehr humanitär.«
Der Kopf des Typen neben mir lief knallrot an.
»Und was hat dieser öffentliche Aufstand mit mir zu tun?«, fragte ich genervt, weil ich immer noch keine Erklärung dafür hatte, weshalb ich hier war.
»Es gibt massive Drohungen gegen die Familie.«
»Die gibt es seit Jahren.«
»Noch nie solche wie dieses Mal.«
Mir fiel der Wagen ein, der mich vor ein paar Wochen beim Rennen beinahe erwischt hatte. Tief in mir drin regte sich der Drache. Ein grummelndes Donnern in einer verschütteten Höhle, das meinen Magen zum Vibrieren brachte.
»Kehr um und bring mich zurück zum Flughafen«, sagte ich zu Alex.
»Das kann ich nicht.«
»Dann fahr mich zum nächsten Bahnhof.«
»Du weißt –«
»Schon gut. Halt einfach an und lass mich aussteigen.«
»Wir sind auf der Autobahn.«
»Halt verdammt noch mal an!«
Der Typ neben mir rückte näher an mich ran. Ein metallenes Klicken verriet mir, dass Alex die Türen verriegelt hatte. Für den Fall, dass ich auf die verrückte Idee kommen könnte, aus dem fahrenden Wagen zu springen. Ich hätte es vielleicht tatsächlich getan. Erklären hätte ich es nicht können, denn ich verstand nicht, was die Drohungen gegen unsere Familie mit dem Erwachen des Drachen zu tun hatten. Ich wusste nur, dass mir das, was da tief in mir losging, die Angst meines Lebens einjagte. Es gab Monster, die man nicht besiegen konnte. Nicht einmal mit Elliot Murphys Gesetz. Ich merkte, wie ich zu zittern begann und drückte mich gegen die Rückenlehne. Regentropfen klatschten aus dem Nichts gegen die Scheiben. In meinen längst verheilten Narben pochte der Schmerz im Gleichtakt mit meiner Angst.
Alex folgte den Schildern weg von der Autobahn in Richtung Zug. Zug. Synonym für Eisenbahn und Steueroase, Sitz von CBH und neuster Einsatzort meines Vaters. Wir fuhren durch ein undefinierbares Nichts aus Kreisverkehren, gesichtslosen Industriegebäuden und fantasiefreien Wohnblöcken, in das irgendwelche Außerirdische mitten hinein zwei wuchtige Türme geworfen hatten, ohne genau zu zielen. Nach einer Abzweigung änderte sich das Bild schlagartig, zumindest, was die Öde betraf. Rechts von mir lag der See, aus dem ein unsichtbarer Pumpmechanismus eine Wasserfontäne in die Luft spie, umgeben von Hügeln und Bergen. Alex steuerte den Wagen an einer Reihe alter Stadthäuser entlang, bis zu einer Kreuzung. Ich erhaschte einen kurzen Blick auf die Altstadt, und dann ging es schon wieder stadtauswärts. Wir fuhren parallel zum See, bis Alex den Blinker setzte und den Wagen über eine kurvige Straße hangaufwärts steuerte.
Ich wettete mit mir selber auf den Stil von Dads neuem Wohnsitz und tippte auf einen terrassenförmigen Beton-Glaspalast. Ich lag falsch. Zumindest, was den Beton anging.
Das Haus war ein verschachteltes Gebilde aus hölzernen Würfeln, wie beliebig aneinandergereiht und aufeinandergestellt. Beim Glas hatte ich recht. Es gab jede Menge davon. Das Haus verwirrte mich. Erstens, weil ich nicht wusste, wie die Wette nun ausgegangen war. Und zweitens, weil es mir tatsächlich gefiel.
Elektronische Zugangscodes und Kameras an allen Ecken und Enden machten sämtliche Illusionen von Freiheit, Leichtigkeit und Ungezwungenheit zunichte. Nur die fröhlichen Kinderstimmen, die ich beim Aussteigen aus dem Wagen hörte, katapultierten mich für einen Augenblick in ein anderes Leben. Eins, in dem es noch so etwas wie Unschuld gegeben hatte. Ich roch Gras, hörte das Lachen meiner Schwester, fühlte den leichten Stups, den sie mir gab. Fang mich, Drache, fang mich doch. Ich blinzelte und wischte mit diesem einen Wimpernschlag die Erinnerungen an eine Vergangenheit weg, in der alles gut gewesen war, damals, an einem anderen Ort, in einem anderen Garten.
Alex brachte mich in ein Zimmer im obersten Würfel. Er ragte schräg über die Würfelkombinationen unter ihm, ein bisschen wie ein Adlerhorst. Drei Wände und eine Fensterfront, durch die ich den See und die Berge sehen konnte. Vor den Fenstern ein Balkon mit einem schlichten Metallgeländer, die Einrichtung karg: ein breites Bett, ein Schrank, riesige Schwarz-weiß-Bilder an den Wänden, eine Tür zum eigenen Bad.
»Dein Vater ist in der Firma«, sagte Alex. »Die Küche ist unten. Wenn du Hunger hast, hol dir was aus dem Kühlschrank oder drück auf die Drei.« Er zeigte auf ein Haustelefon auf dem Schreibtisch. »Eins ist die Verbindung zu mir, zwei die zur Security und unter der Drei erreichst du Frida.«
Klar doch, dachte ich. Ein direkter Draht zu den Angestellten, keiner zur Familie.
»Frida ist immer noch da?«, fragte ich.
Alex nickte. »Ich lass dich dann mal allein.«
»Okay.«
Ich wollte niemanden in meiner Nähe haben, gleichzeitig hatte ich eine Heidenangst davor, allein in diesem Würfel zu sein, zusammen mit einem Drachen, der sich einen Weg ins Freie suchte.
Kaum war Alex weg, riss ich die Tür zum Balkon auf. Von unten drangen Kinderstimmen zu mir hoch. Keine aus der Vergangenheit, sondern die Stimmen der neuen Kinder meines Vaters. Ich verkeilte meinen Blick in den Wolken am Horizont. Sog die Luft in mich ein. Verfluchte all die Stunden bei Murphy, in denen ich nichts gesagt hatte. Eine verpasste Chance, mit dem Drachen klarzukommen.
Eine Kinderstimme rief nach Mano. Nichts hätte mich weiter daran hindern können, nach unten zu schauen. Ein Mädchen mit wilden blonden Locken zeigte zu mir hoch. Die junge Frau mit dem elegant gebändigten Haar neben ihr drehte sich um und legte den Kopf in den Nacken.
Mano hatte sich neu erfunden, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Kein Schwarz mehr, keine zerrissenen Klamotten, keine Rastas, keine Million Ketten und Armbänder, keine meterdicke Schminke. Sie sah aus wie eine Luxusausgabe von Happy-Miss-Durchschnitt. Ich wusste es besser. Mano würde immer die Fucked-up-Princess sein, zu der ich sie gemacht hatte.
2. MANON
Ich war fünf, als das Unheil seine Schwingen ausbreitete und Kris wegen mir beinahe starb. Die Schwingen legten sich um Mama und umschlangen sie, bis etwas in ihr zerbrach. Sie verließ uns. Kris weinte wochenlang. Ich fror. Ich glaube, es gab keinen einzigen Tag, seit sie weg war, an dem ich nicht gefroren hatte. Ich fror auch an dem Tag, an dem ich Kris wiedersah, obwohl sich die Wolken nach einem regnerischen Morgen öffneten und einer warmen Sommersonne Platz machten. Ihre Strahlen spielten mit den goldenen Locken einer neuen Prinzessin und erinnerten mich an das, was ich verloren hatte.
Ich wäre lieber drinnen gewesen, im Dunkeln bei meinen Toten und ihrer Musik, aber Frida hatte darauf bestanden, dass ich auf die Kleinen aufpasste, wahrscheinlich auf Anordnung von Stig. Weil ich keine Lust hatte, mir beim Abendessen gereizte Bemerkungen meiner Stiefmutter Robyn anzuhören, stand ich bei der Schaukel und spielte die nette große Schwester.
»Schubsen«, quengelte Timmy.
Ich gab ihm einen Stoß, der ihn eine Weile in Bewegung halten würde.
»Schau!« Joy zeigte nach oben, viel weiter hoch als Timmy je schaukeln würde. Ich dachte, sie wolle mir eine weitere Wolke zeigen, so wie vorher schon den Hut, die Gabel, die Schlange und das Raumschiff, die alle über uns hinweggeglitten waren. Doch auf dem Balkon über uns stand Kris. Ihn zu sehen, tat mehr weh als das Leben. Ich schaffte es nicht, meinen Arm zu heben und ihm zuzuwinken. Meine Lippen klebten aufeinander. Kein Laut kam aus meinem Mund. Wir starrten uns an. Dann wich er zurück, genau in dem Augenblick, in dem sich meine Lippen endlich voneinander lösten. Das Wort, das vielleicht etwas geändert hätte, blieb in meiner Kehle stecken.
Joy zupfte am Saum meines Kleides. »Ist das unser großer Bruder?«
Ich presste mein Mund zusammen, um nichts zu sagen, was mir später von Robyn gnadenlos um die Ohren gehauen werden konnte. Kris war mein Bruder! Joy hatte nie mit ihm im Garten gespielt, nie mit ihm gegen Ritter und böse Könige gekämpft, nie die zweiköpfigen Schlangen besiegt und auf dem Rücken liegend die Sterne mit ihm gezählt.
»Ella!«, kreischte Timmy.
Ich dachte, er sei gestürzt, und fuhr erschrocken herum. Timmy saß nicht mehr auf der Schaukel, denn er hatte Ella gesehen und rannte mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Sie wirbelte ihn herum, stellte ihn behutsam wieder hin und wuschelte mit der Hand durch seine Haare. Danach schlenderte sie zu mir.
Ella war etwas Besonderes, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sehen konnte. Mit ihren mausfarbenen Haaren, die sie zu einem Pferdeschwanz band, spielte keine Sonne, sie stach nicht von Weitem aus allen anderen hervor. Ihr Aussehen schien ihr egal. Sie schminkte sich kaum und trug sportlich-praktische Kleidung in langweiligen Farben. Deshalb hatte ich sie bei unserer ersten Begegnung am Flughafen beinahe übersehen. Neben dem attraktiven Typen mit den dunklen Haaren und den Augen mit der Tiefe und Unergründlichkeit eines Bergsees, den Alex mir als Andrin vorstellte, ging sie glatt unter. Doch dann hielt sie mir ihre Hand hin. »Ich bin Ella. Fahrerin und Personenschützerin.«
Noch vor einem Jahr hätte ich demonstrativ über die Hand hinweggesehen, aber zu meinem neu geschaffenen Ich gehörte Anstand. Also griff ich nach der Hand. Ellas Haut war angenehm warm, ihr Händedruck kräftig. Sie schaute mich an und ich hatte das Gefühl, sie sehe durch all das durch, was ich nicht war, hinein in mein wahres Ich. Trotzdem lag in ihren Augen weder Ablehnung noch Verachtung. Ich mochte sie auf Anhieb, etwas, das ich von den allerwenigsten Menschen sagen konnte.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie nun.
Nichts war in Ordnung. Ich nickte trotzdem. Ella konnte ich damit nicht täuschen. Sie legte ihren Kopf leicht schief und schaute mich an.
»Kris ist da«, sagte ich.
»Ich weiß. Joy muss zum Ballett. Möchtest du mitfahren?«
Es war das erste Mal, dass sie mich einlud, mit ihr zu fahren. Ich war sicher, dass sie es tat, um mich von Kris abzulenken. Ablenkung war genau das, was ich jetzt brauchte.
Zehn Minuten später saß ich neben Ella im Wagen, einem geräumigen SUV. Hinter mir saßen Joy und Timmy. Kaum hatte Ella den Motor gestartet, begann das Geschrei.
SchereSteinPapier --- SchereSteinPapier --- Schere…
Ohne Pause. In der Endlosschlaufe. Bereits nach wenigen Metern Fahrt bereute ich meinen Entschluss, Ella und die Kinder zu begleiten. Ich schaute zu ihr hin. Konzentriert lenkte sie den SUV über die kurvige Straße in Richtung See. Der Lärm schien an ihren Ohren abzuprallen. Ich zog mein Handy aus der Tasche und gab mir die volle Dröhnung Kurt Cobain. Selbstmordmusik. So hatte Stig die Songs meiner Lieblingsbands verächtlich genannt, mit einer Mischung aus Unverständnis und herablassender Belustigung auf seinem Gesicht. Bis ich es tatsächlich versucht hatte, das mit dem Selbstmord. Danach nahm Stig das Wort nicht mehr in den Mund, doch der Gesichtsausdruck blieb.
Später, als mir die Polizei all die Fragen zum Angriff stellte, wusste ich keine Antworten. Ja, ich hatte nach vorn geschaut. Und nein, ich hatte nichts gesehen. Falsch. Ich musste das Auto gesehen haben, aber ich nahm es nicht wahr, weil ich an Kris dachte. Er war schlanker geworden in den letzten beiden Jahren, beinahe zu dünn, und er trug seine Haare jetzt schulterlang. Blond und leicht gewellt, ein wenig rebellenhaft. Wie er dagestanden hatte! So verloren. Ich sah nur ihn. Nicht das Auto, das uns den Weg abschnitt. Ich muss die Schreie gehört haben, den Knall. Gleichzeitig schleuderte mich der Aufprall gegen Ella. Sicher bin ich mir jedoch nicht.
Das Erste, das ich bewusst wahrnahm, waren Ellas Befehle. »Köpfe runter! Festhalten!«
Von da an erinnerte ich mich. Ella griff nach dem Schalthebel. Es knirschte laut. Der Motor unseres Wagens heulte auf. Wir schossen nach hinten, schlingerten über die Straße, prallten seitwärts gegen eine Mauer und blieben stehen. Ein Vermummter rannte auf uns zu. Auf dem Rücksitz wimmerten die Kinder. Ella öffnete das Handschuhfach, zog eine Waffe heraus, stieß die Tür auf und ließ sich aus dem Wagen fallen.
Der Vermummte kam näher. Hob den Arm. Zielte. Ich zerrte an meinem Sicherheitsgurt. Viel zu hektisch. Er ging nicht auf. Ich schloss die Augen.
Es knallte erneut. Mehr als einmal. Wie oft, das weiß ich nicht. In meinen Ohren pfiff es. Ich wartete auf den Schmerz. Oder darauf, dass uns der Vermummte aus dem Wagen riss. Keins von beidem geschah. Irgendwo hinter dem Pfeifen röhrten Motoren, quietschten Reifen. Dann wurde es still.
Ich hob meinen Kopf und betätigte mit zitternden Händen den Türöffner auf der Fahrerseite. Durch einen Spalt sah ich Ella. Sie lag auf dem Boden und bewegte sich nicht. Über den Asphalt rann Blut. Ganz in der Nähe heulten Sirenen. Die Kinder weinten und riefen Ellas Namen. Ich konnte mich nicht rühren, ich konnte nicht sprechen und ich konnte meinen Blick nicht vom Blut nehmen. Ich stieg nicht aus. Ich half nicht. Weder Ella noch den Kindern. Ich sah nur das Blut.
»Das ist der Schock«, erklärte mir die Rettungssanitäterin, die mich untersuchte. Es war nett gemeint, doch es entschuldigte nichts. Ein normaler Mensch lässt einen anderen nicht in seinem Blut liegen. Ein normaler Mensch versucht, verängstigte Kinder zu beruhigen. Ein normaler Mensch steigt aus und hilft. Irgendwie. Ich hatte lange vor diesem Überfall aufgehört, ein normaler Mensch zu sein. Aber das war keine Entschuldigung für mein Verhalten.
»Was ist mit Ella?« Meine Stimme krächzte so sehr, dass ich mich selber kaum verstand.
»Ist das die junge Frau, die geschossen hat?«
Ich nickte und würgte gleichzeitig meine Angst und mein schlechtes Gewissen hinunter.
»Sie ist am Arm getroffen worden.«
Die Worte krochen langsam in mein Hirn und kamen irgendwann am richtigen Ort an. Am Arm. Niemand stirbt an einer Wunde am Arm. Außer … außer man verblutet, weil einem keiner hilft. Die Angst drückte wieder nach oben.
Hinter das nette Gesicht der Rettungssanitäterin schob sich das von Alex.
»Bring mich weg von hier«, bat ich ihn.
»Du stehst unter Schock. Mir wäre lieber –«
»Mir geht es schon besser«, unterbrach ich ihn.
Neben Alex trat eine Frau. »Alexander Larson«, begrüßte sie ihn.
»Katharina Beck«, erwiderte er ihren Gruß. »Was ist passiert?«
»Wir sind dabei, das zu klären.« Die Antwort der Frau klang kühl, leicht genervt. »Können Sie mir sagen, wieso die Fahrerin des Unfallfahrzeugs bewaffnet war und vor allem, warum sie die Waffe benutzt hat?«
»Wo ist sie?«
»Würden Sie bitte meine Frage beantworten?«
»Ella Walder ist zuständig für die Sicherheit der Kinder der Familie Mortensen.« Alex legte eine kurze Pause ein, in der er die Frau aus kalten Augen anschaute. »Sie wird ihre Waffe benutzt haben, weil Sie und Ihre Kollegen zu spät kamen.«
Es gibt nicht viele Menschen, die von Alex‘ Blick nicht eingeschüchtert sind. Diese Polizistin gehörte zu den wenigen, die ihm standhielten. »Meine Kollegen waren ganz in der Nähe«, entgegnete sie unbeeindruckt. »Sie hätten den oder die Täter stellen können, wenn die junge Frau nicht wie im Wilden Westen losgeballert hätte.«
»Ich nehme an, sie handelte in Notwehr.«
»Das wird sich zeigen.«
»Wo ist Frau Walder?«, fragte Alex die Beamtin gereizt.
»Im Krankenhaus. Sobald sie vernehmungsfähig ist, werden wir mit ihr sprechen.«
»Sie vergessen bei diesem Gespräch hoffentlich nicht, wer Täter und wer Opfer ist.«
»Zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf.«
Ich hielt das gehässige Gespräch nicht länger aus.
»Ella hat uns das Leben gerettet!«, rief ich.
»Schon gut, Manon«, beschwichtigte Alex. »Frau Beck macht nur ihre Arbeit.«
Macht nur ihre Arbeit . Das ist einer dieser hohlen Sprüche, bei denen mir speiübel wird. Ausrede Nummer eins. Der Klassiker für alle, die einem gerade das Leben vergeigen. Die Ladendetektivin, die dir mit verkniffenem Mund erklärt, warum sie den Diebstahl des verfluchten Scheiß-Lippenstifts melden muss. Die Schulleiterin, die dich in ihrem Büro schmoren lässt, bevor sie dir mit gefaktem Bedauern mitteilt, dass für dich an ihrer Schule leider kein Platz mehr ist. Der Psychiater, der durch deine Seele trampelt, und dabei das letzte Heile kaputtredet. Sie alle machten nur ihre Arbeit . Ich hätte mir verflucht noch mal einfach gewünscht, sie wären arbeitslos.
»… Frau Mortensen.«
Meinte sie mich? Hatte sie mit mir gesprochen?
»Was?«, zischte ich.
»Dazu gehört, dass ich auch mit Ihnen sprechen muss«, sagte Frau Beck ruhig.
Natürlich. Sie musste ja ihre Arbeit machen. Gründlich. Jetzt, wo Ella im Krankenhaus lag. Jetzt, wo es zu spät war. Ich drückte mit meinem Arm heftig gegen meinen Magen, bevor ich Dinge aussprach, die ich besser für mich behielt.
»Nicht jetzt.« Ich griff mir an den Kopf. »Mir ist schwindlig und schlecht. Ich glaube, ich brauche doch einen Arzt.«
Ich brauchte keinen Arzt. Ich wollte einfach nicht mit der Frau reden. Meine Lüge schenkte mir eine kleine Schonfrist. Mehr nicht. Nachdem mir ein Arzt bescheinigt hatte, mit dem Schrecken davongekommen zu sein, saß ich Frau Beck gegenüber. Nicht in ihrem Büro, sondern in einem Krankenzimmer, in das man mich zur Beobachtung gebracht hatte. Alex hatte darauf beharrt, bei der Befragung dabei zu sein.
Ich erzählte das, was ich wusste. Dass Ella uns gerettet hatte, indem sie unseren Angreifer in die Flucht geschlagen hatte. Frau Beck reichte das nicht. Sie wollte Informationen zum Wagen, der uns gerammt hatte, zum Vermummten, zu den Schüssen. Ich konnte sie ihr nicht geben und sah, dass sie mir nicht glaubte. Ich müsse den Wagen doch kommen sehen haben, hakte sie nach. Und zum Vermummten könne ich bestimmt mehr sagen, als dass er vermummt gewesen war.
Irgendwann gab Frau Beck auf und wechselte das Zimmer. Alex begleitete sie. Er wollte dabei sein, wenn sie mit Ella sprach.
»Warte auf mich.« Er sagte es sanft und dennoch lag in seinem Befehl eine versteckte Drohung. Verständlich. Das letzte Mal, als ich auf ihn warten sollte, war ich in einen Zug gestiegen und ihm davongefahren. Stig hätte ihn dafür beinahe gefeuert.
Stig. Mein Vater. Ich hoffte gegen jede Vernunft, dass er kommen würde, denn diesmal war es nicht meine Schuld, dass ich im Krankenhaus lag! Er kam nicht. Wozu auch? Stig hatte sich ein neues Königreich aufgebaut. Mit einer neuen Königin, einer neuen Prinzessin und einem neuen Prinzen. Da war kein Platz für mich und heimliche Träume, wie es sein könnte, wenn er mich nur einmal anschauen würde wie früher.
Früher war vorbei. Für immer. Seit ich fünf war. Damals hatte ich keine Worte für das, was ich fühlte. Und selbst wenn ich sie gehabt hätte: Es war niemand da, der mir zugehört hätte. Am Anfang hoffte ich, Mama würde zurückkommen, wenn ich ein braves Mädchen war. Doch Mama kam nicht zurück. Dass ich in ein Internat geschickt wurde, empfand ich als gerechte Strafe. Ich hatte jeden Tag Heimweh nach Kris, nach Mama, nach Papa, nach dem Haus mit dem verwunschenen Garten. Wenn ich mir Mühe gab und alles richtig machte, so redete ich mir ein, würde vielleicht alles wieder gut.
Die ersten Ferien waren ein Schock. Papa hatte einen neuen Job in den Staaten angenommen und wohnte jetzt in einem riesigen Gebäude aus Stahl, Beton und Glas. Dort gab es keinen Platz für Drachen und Prinzessinnen. Die Königin war fort und der König hatte keine Zeit. Ich gab mir noch mehr Mühe. Im Jahr darauf fuhr Papa an seinen freien Tagen lieber mit einer schönen blonden Frau weg als mit mir. Frida kümmerte sich um mich. Sie verwöhnte mich mit gutem Essen, Ausflügen und viel Zuneigung. Aber sie war anders als früher. Ich wusste, dass sie mir die Schuld an Mamas Weggehen gab.
Kris kam in den Ferien nicht mehr nach Hause. Er verbrachte sie lieber in Sommerkursen, bei anderen Kindern. Die blonde Frau war jetzt die neue Königin, aus Papa wurde Stig. Weder mein gutes Betragen noch meine guten Noten brachten mir mein altes Leben zurück. Ein braves Mädchen zu sein half nicht. Ich hörte auf, mir Mühe zu geben. Ich hörte auf, brav zu sein. Meine Noten sausten nach unten. Meine Lehrer waren ratlos. Stig auch. Er schickte mich in Therapie. Ich weigerte mich, über den Sommer zu sprechen, der alles verändert hatte. Die Internate wechselten, in allen war ich das seltsame Mädchen ohne Freunde.
Mit zwölf stieß ich in einem Vintage-Laden auf ein Poster von Jim Morrison. Seine Augen waren ein Fenster zur Seele. Seiner und meiner. Dass er gut aussah, machte ihn interessant. Dass er tot war, noch viel mehr. Ich kaufte das Poster und hängte es an die Wand meines Zimmers im Internat. Die Musik, die der Typ mit seiner Band machte, gab mir die Worte, die ich nicht hatte. Seine Stimme streichelte mich, hüllte mich ein, deckte mich zu. Seine Texte gingen direkt in mein Herz. Bevor ich in den ewigen Schlaf sinke, möchte ich den Schrei des Schmetterlings hören. Das war so unendlich schön und gleichzeitig so unendlich traurig.
Ich färbte meine Haare, trug in meiner Freizeit jede Menge Kajal und abgefuckte Klamotten, stülpte meine innere Verletzlichkeit nach außen und hörte Musik von Toten, dem Club 27, einer Gruppe von Wahnsinnsmusikern, die alle mit 27 Jahren starben. Janis Joplin sang von der Freiheit. Dass sie nur ein anderes Wort dafür war, nichts mehr zu verlieren zu haben. Kurt Cobain machte mir klar, was mit mir los war. I must have died alone, a long time ago. Und über allem schwebte der Schmetterling von Jim Morrison. Ich begriff: Wer tot ist, kann nichts mehr verlieren. Der war frei. Ich war innerlich längst tot, allein gestorben in einem unheimlichen Verlies in jenem Sommer, in dem alles kaputtging.
Am Anfang war die Vorstellung, wirklich zu sterben, total beängstigend. Aber je mehr Liedzeilen ich in ein Buch mit blutrotem Einband schrieb, desto mehr verlor der Tod seinen Schrecken. Bis er mich irgendwann einlud, mich ihm zu ergeben. Ich schluckte Tabletten, legte mich in die Wanne und wartete darauf, den Schrei des Schmetterlings zu hören. Ich hörte nur das Tropfen des Wasserhahns. Weil weder der Schlaf noch der Tod kamen, zählte ich die Tropfen. Bis ich mich im Zählen verlor und einschlief. Ich wachte im Krankenhaus auf und fühlte mich furchtbar kindisch und doof, weil ich das mit den Tabletten nicht hinbekommen hatte.
Alle redeten von einem Hilfeschrei . Ich hatte nicht um Hilfe geschrien! Ich hatte sterben wollen. Nur interessierte das keinen, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte.
Immerhin war der Hilfeschrei für Stig laut genug. Er tat das, was ich mir als kleines Mädchen so sehr gewünscht hatte. Er holte mich nach Hause. Zu sich und seiner neuen Familie, mit der er jetzt in Deutschland lebte. Er redete davon, wie alles anders und besser werden würde, aber statt sich Zeit für mich zu nehmen, delegierte er mich wie eine lästige Arbeit an Robyn. Diese glückliche Strahlefrau konnte mit einer wie mir nichts anfangen. Vor ihrer Heirat mit Stig war sie ein amerikanisches Traumgirl gewesen, jetzt war sie eine Traummutter von zwei kleinen Traumkindern, die sie total süß fand. Ich war kein Kleinkind, ich war nicht süß, ich war kein Traumgirl. Wenn ich in den Spiegel schaute, sah ich eine schwarz gekleidete Unbekannte mit dem blassen Gesicht eines Zombies. Ich hatte überlebt, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich leben sollte.
Um fair zu sein, muss ich sagen, dass Robyn es versuchte. Sie schleppte mich mit auf Shopping-Touren, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Sie redete mit mir, aber ich nicht mit ihr. Es gab nichts zu sagen. Freiheit war nur ein Wort. Schmetterlinge schrien nicht.
Frida wusste das. Nur sagte sie es anders. In Redewendungen und Glückskeksweisheiten. Das Leben ist kein Ponyhof. Jeder ist seines Glückes Schmied. Kommt Zeit, kommt Rat. Sie meinte es gut, aber ich konnte ihr nicht verzeihen, dass sie mit Stigs neuen Kindern all die Dinge tat, die sie schon mit Kris und mir getan hatte.
Keine sechs Wochen nachdem ich bei Stig und seiner Familie eingezogen war, brach alles auseinander, und wieder war ich schuld. Stig warf mir vor, es gar nicht zu versuchen. Robyn redete von Überforderung und professioneller Hilfe. Beide waren sich einig, dass ich eine neue Umgebung brauchte, wo ich noch einmal ganz von vorn anfangen konnte. Also suchte Stig ein passendes Internat für mich. Er fand eins im Norden von Deutschland, genügend Fahrtstunden entfernt, um mich auf Distanz zu halten. Ich hörte nicht hin, als er mir die Vorzüge anpries, sondern konzentrierte mich darauf, ihm nicht völlig hysterisch meine Gefühle vor die Füße zu kotzen.
Am Tag meiner Abreise geschah etwas Seltsames. Frida bat mich in die Küche, um mir meine Lieblings-Schokoplätzchen mitzugeben. Als sie mir die Dose hinhielt, fassten ihre Hände nach meinen. Sie öffnete den Mund, doch genau in dem Augenblick kam Stig in die Küche. Und so erfuhr ich nicht, was Frida mir sagen wollte.
Das Internat war gar nicht so übel. Ich hatte ein Einzelzimmer, meine Mitschüler waren zumindest keine Idioten, die Lehrer waren gut, der Unterricht interessant, ganz besonders der Englischunterricht bei Mr Sanders, der meine Leidenschaft für die Musik des 27-er Clubs teilte. Die Schule wurde zu meiner neuen Heimat.
Ich beobachtete die Mädchen um mich herum und merkte schnell, dass es darum ging, von nichts zu viel zu haben oder zu sein. Also: Nicht zu girly, nicht zu teeny, nicht zu erwachsen. Nicht zu auffällig, nicht zu bieder. Nicht zu billig, nicht zu teuer. Nicht zu elegant, nicht zu schlampig. Ich verwandelte mich langsam in jemanden, der ich gar nicht war. Was ich trug, hatte nichts mit mir zu tun. Was ich sagte, auch nicht. Doch ich funktionierte. Das war, was für alle um mich herum zählte.
Es hätte auf seine Art gut sein können. Deshalb wollte ich nicht fahren, als nach beinahe zwei Jahren der Heimkehr-Befehl von Stig kam. Genau das schrieb ich ihm. Zwei Tage später wurde ich ins Büro der Schuldirektorin zitiert. Dort wartete Alex auf mich.
Das Gespräch lief, wie Gespräche unter sechs Augen laufen, wenn vier davon Autoritätspersonen gehören, denen man nicht wirklich widersprechen kann. Alex redete von ernst zu nehmenden Drohungen gegen die Familie. Ich verstand nicht, warum ich dann ausgerechnet zu dieser bedrohten Familie ziehen sollte, die nicht wirklich meine war, und in der wir uns spätestens nach zwei Wochen gegenseitig zerfleischen würden. Die Schuldirektorin erklärte, dass ich im Internat in Gefahr sei, da sie Gelände und Gebäude nicht komplett abschirmen könne. Ihr Bedauern war echt. Ich erkannte, dass ich keine Wahl hatte. Trotzdem versuchte ich es.