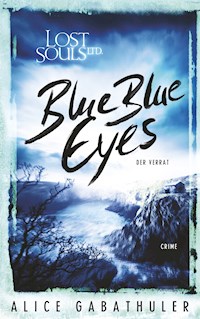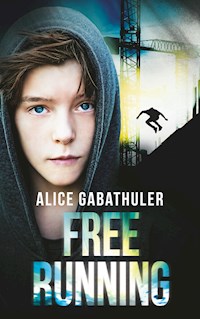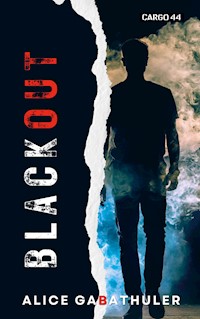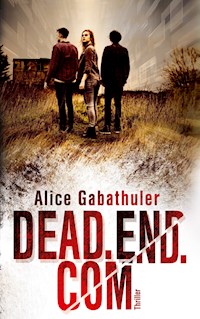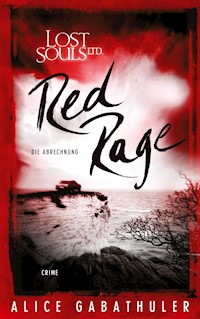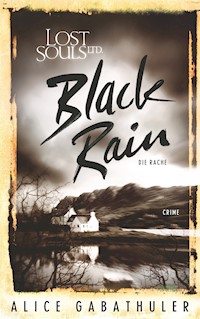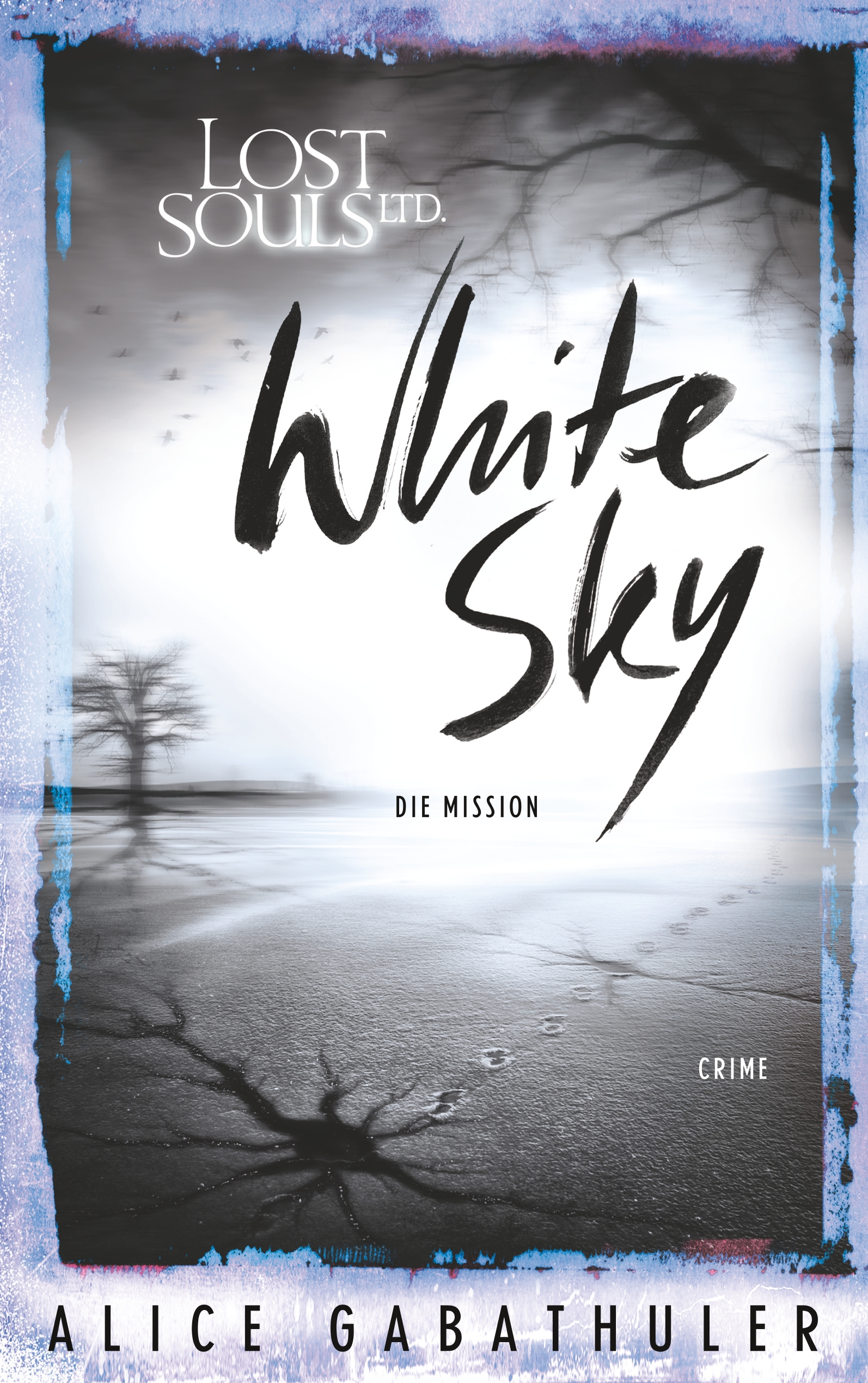
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
LOST SOULS LTD. - So nennt sich die Untergrundorganisation um den jungen Fotografen Ayden, den Rockstar Nathan, den charmanten Verwandlungskünstler Raix und Kata mit den eisblauen Augen. Sie alle haben als Opfer schwerer Verbrechen überlebt und dabei einen Teil ihrer Seele verloren. Nun verfolgen sie nur ein Ziel: Jugendliche in Gefahr aufspüren und versuchen, sie zu retten. Dabei kämpfen sie gegen Entführer, Mörder, das organisierte Verbrechen und gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit. RAIX will leben! Seine letzte Hoffnung ist der Arzt, der sein Leben zerstört hat. Gemeinsam mit Nathan checkt er in einer abgelegenen Luxusklinik in den Schweizer Bergen ein – zwei, die alles riskieren, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Ohne ihre Freunde von Lost Souls Ltd. zu informieren. Doch Kata und Ayden nehmen ihre Spur auf. Während in einem geheimen Trakt der Klinik Menschen Gott spielen, verfangen sich Kata und Ayden in ihren Gefühlen. Dabei entgleitet ihnen die Mission, an deren Ende die Freiheit wartet. Oder der Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
For Eric. Your head, your heart, your soul.
May they forever be free.
Thanks to Ernst Eggenberger for the song »White Sky«.
If it’s the last I’m gonna do
Paint three angels in the snow
White Sky
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Der Schnee fiel in großen, weichen Flocken. Sie legten sich auf die Kleider und verwandelten Nathans düsteres Schwarz in ein vergängliches Weiß. Belustigt schaute er zu, wie Raix seine Zunge aus dem Mund streckte und damit die kühlen Kristalle auffing. DeeDee drehte sich mit ausgebreiteten Armen im Kreis. Wie zwei Kinder, dachte Nathan. Er griff in seine Manteltasche und holte eine Flasche seines Inselwhiskys heraus. Hinter den Kliniktoren wartete trostlose Nüchternheit auf ihn.
Nathan setzte die Flasche an und genoss jeden einzelnen Schluck der goldbraunen Flüssigkeit. Noch einmal war er der Insel im Norden von Schottland so nah, wie er nur sein konnte. Vielleicht ein letztes Mal, doch der Entzug war sein geringstes Problem. Das Innere der Mountain Clinic Valgronda barg Geheimnisse, die tödlich sein konnten.
»Willst du die ganze Flasche austrinken?«, fragte DeeDee.
»Wenn es sein muss.«
Schließlich war er der kaputte Rockstar, der sich wegen massiver Alkoholprobleme selber eingeliefert hatte. So etwas musste glaubhaft gespielt sein. Am besten mit einer Fahne und leicht ramponiert. Wie vorher DeeDee breitete er seine Arme aus, wirbelte herum, taumelte ein paar Schritte und ließ sich in den Schnee fallen.
DeeDee half ihm hoch. »Steigt ein. Fünf Kilometer noch.«
»Die letzte Chance, es sich anders zu überlegen«, sagte Nathan zu Raix.
»Nein.«
Alles Unbeschwerte wich aus Raix’ Gesicht. Ernst schaute er Nathan an. »Das gilt auch für dich. Du musst das nicht für mich tun.«
»Ich wollte schon immer mal in eine dieser noblen Schweizer Kliniken.« Nathan grinste. »Wir werden den Laden aufmischen und auf den Kopf stellen!«
Einen Augenblick lang hüllte sie diese spezielle Stille ein, wie sie nur der Winter hervorbringt, wenn der Schnee alle Geräusche schluckt. Nathan fühlte sein Herz schlagen und wusste, dass es Raix auch so ging. Nur schlug Raix’ Herz für Menschen, die er liebte, während das von Nathan einfach schlug.
»Leute, ich will euch ja nicht drängen, aber wir sollten weiter.« DeeDee öffnete die Vordertür des schwarzen Mercedes, den Nathan am Flughafen in Zürich gemietet hatte. »Und klopft euch vorher den Schnee aus den Kleidern.«
Nathan legte den Kopf in den Nacken. Aus einem weißen Himmel schwebten unzählige Sterne auf ihn herab. In seinem Kopf erklang eine Melodie, die nur er hören konnte. Ein neuer Song. Ein Anfang. An das Ende wollte er nicht denken. Vorsichtig bewegte er seinen rechten Arm. Er schmerzte immer noch. Der Baseballschläger hatte den Knochen zertrümmert, die Heilung schritt nur langsam voran.
»Nate?«
»Bin so weit.«
Er strich den Schnee von seinem Mantel und stieg hinten zu Raix in den Wagen.
Die Mountain Clinic Valgronda lag in einem weiten Tal in den Bergen. Eine einzige Straße verband die kleinen Dörfer und Weiler, reihte sie auf wie Perlen an einer Kette. In der Hochglanzbroschüre der Klinik zeigten sie sich von ihrer schönsten Seite. Eingebettet zwischen zwei Gebirgszügen mit massiven Gipfeln, die Dächer der alten Holzhäuser unter einer glitzernd weißen Schneedecke, erinnerten sie Nathan an eine perfekte Welt aus einer anderen Zeit. Aber nichts war perfekt, nie, nicht einmal diese Idylle, die sich hinter dem dichten Flockentreiben nur erahnen ließ.
DeeDee lenkte den Wagen vom Parkplatz zurück auf die Straße. Die Scheibenwischer arbeiteten auf Hochtouren, genauso wie die Lüftung, und trotzdem beschlugen die Fenster, nasse Schlieren trübten die Sicht. Links und rechts von ihnen türmten sich weiße Massen, von Schneepflügen in einem fast aussichtslosen Kampf zur Seite geschoben.
Das GPS gab den Befehl, nach hundert Metern links abzubiegen.
»Witzig«, murmelte DeeDee. »Wohin denn?«
»Jetzt links abbiegen«, meldete die Frauenstimme wieder, die sie zuverlässig von Zürich bis hierher ans Ende der Welt gelotst hatte, zumindest DeeDee und Nathan. Raix war später dazugestoßen, genau nach Plan.
Direkt vor ihnen tauchte ein Hinweisschild auf. Es lag unter einer riesigen Schneehaube. Die fast gänzlich verdeckten Buchstaben konnte man nur lesen, wenn man wusste, was dort stand. Mountain Clinic Valgronda.
DeeDee setzte den Blinker. Die Nase beinahe an der Windschutzscheibe, drehte er am Lenkrad und manövrierte sie auf eine schmale Nebenstraße. Der Mercedes scherte in der Kurve leicht aus.
»Keine Panik«, beruhigte sie DeeDee. »Ist alles im grünen Bereich.«
Raix lachte nervös. »Du meinst im weißen Bereich.«
Verfahren war unmöglich. Wie in einer Bobbahn folgten sie der Spur zur Klinik, die sich etwas außerhalb eines Dorfes hinter einem Waldstück an einem kleinen See befand. Eine verwunschene Märchenlandschaft aus tief verschneiten Bäumen glitt an ihnen vorbei. Dort, wo das GPS den See anzeigte, erstreckte sich jetzt eine weiße Fläche. Das riesige, schmiedeeiserne Tor bei der Einfahrt der Klinik öffnete sich wie von Geisterhand, als sie darauf zufuhren. Nachdem sie es passiert hatten, drehte sich Nathan um und sah, dass es sich wieder schloss.
Eine schnurgerade Linie, gesäumt von wundersamen Baumformationen, führte sie zum Hauptgebäude des Anwesens, ein dreistöckiger Bau mit viel Glas, kaltblau schimmernd wie die Winterwelt um sie herum. DeeDee parkte den Wagen direkt vor dem Eingang. Er stieg aus und öffnete die Türen für seine Freunde. Nathan klammerte sich daran fest, ganz der Betrunkene, der erst seinen Körper unter Kontrolle bringen musste. Er überließ es DeeDee, das Gepäck aus dem Kofferraum zu holen, und torkelte auf den Eingang zu, ohne auf Raix zu warten. Ein Mann in einem dunkelblauen Anzug mit mattsilbernen Knöpfen und einem rot aufgenähten Streifen über der Brusttasche der Jacke kam ihm entgegen. Nathan scheuchte den Uniformierten mit einer ungeduldigen Handbewegung zur Seite und stolperte durch die Drehtür in die Eingangshalle.
Ein weiterer Uniformierter eilte auf ihn zu, griff ihn am Arm und brachte ihn zum Empfang, wo er von einer Frau mit strenger Hochsteckfrisur, strenger blauer Kleidung und einem strengen Gesicht ohne den kleinsten Anflug eines Lächelns erwartet wurde.
»Mr MacArran«, begrüßte sie ihn. »Willkommen.«
Ihre Stimme war wärmer als ihr Aussehen. Trotzdem klang sie wie eine Lehrerin, die zu einem unartigen Schuljungen sprach. Nathan hatte solche Lehrerinnen nie gemocht. Er lehnte sich vor und hauchte ihr ein heiseres »Hallo« entgegen. Sie musste den Alkohol riechen, ließ sich jedoch nichts anmerken.
Hinter Nathan rumpelte es. Langsam drehte er sich um. DeeDee stand mitten in der Halle, umgeben von Nathans Gepäck. »Hättest wenigstens deine Gitarre selber reintragen können«, brummte er.
»Dein Job«, schnauzte ihn Nathan an.
Wortlos stapfte DeeDee zurück zur Drehtür, wo ihm Raix entgegenkam, ein unauffälliger junger Mann mit an den Kopf gegeltem Haar in einem teuren grauen Anzug, der so perfekt an ihm saß, als wäre er darin zur Welt gekommen. Um sein Gepäck kümmerte er sich nicht selber; das erledigte der Uniformierte, den Nathan an sich vorbeigewedelt hatte wie eine lästige Fliege. Obwohl unscheinbar, ging von Raix die Selbstsicherheit eines Menschen aus, der wusste, was man alles mit Geld kaufen konnte. Unter vielem anderen auch den kostspieligen Aufenthalt in der Mountain Clinic. Dass man sein Problem hier lösen würde, schien er vorauszusetzen, schließlich hatte er dafür bezahlt. Er musterte die Eingangshalle wie eine Immobilie, die er sich zu kaufen überlegte. Ein leichtes Kopfnicken drückte seine Zustimmung aus. Weniger wohlwollend war der Blick, mit dem er Nathan bedachte. Sichtbar widerwillig kam er auf ihn zu. »Wie viel schulde ich Ihnen für die Fahrt?«
Nathan puffte ihn gönnerhaft in die Seite. »Lass stecken, Kumpel.«
Die Frau hinter dem blank polierten Empfangstresen zeigte keine Regung, doch Nathan sah die Neugier in ihrem Blick. Weder er noch Raix würden sie mit einer Erklärung befriedigen.
DeeDee brachte als letztes Gepäckstück die Gitarre. »Ich hau dann mal ab. Ruf mich an, wenn du einen ordentlichen Drink oder einen Fluchtwagen brauchst.«
Die Empfangsdame ignorierte DeeDee. »Markus wird sich um Sie kümmern, Mr MacArran.« Sie winkte einen weiteren Uniformierten heran. »Er zeigt Ihnen Ihr Zimmer.«
Während Nathan Markus ignorierte und sich schwer über den Tresen beugte, wandte sich die Frau Raix zu. »Sie müssen Mr Ormond sein. Hatten Sie eine angenehme Reise?«
»Nein.«
Nathan grinste in sich hinein.
»Das tut mir leid, Mr Ormond. Roman wird Sie in Ihr Zimmer geleiten. Danach haben Sie …«
Raix brachte sie mit einem Blick zum Schweigen.
Eine Hand legte sich auf Nathans Arm.
»Mr MacArran?«
»Höchstpersönlich«, nuschelte Nathan. Er wippte ein paarmal vor und zurück, rutschte vom Tresen und ließ sich auf die Knie fallen.
»Wenn ich Ihnen behilflich sein kann?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, half Markus Nathan hoch und führte ihn diskret vom Empfang weg.
So kalt das Gebäude von außen gewirkt hatte, so warm war es im Inneren eingerichtet. Über einen weichen roten Teppich gelangten sie zu Nathans Zimmer im ersten Stock. Der Raum mit dem dunklen, auf alt getrimmten Dielenboden roch nach Holz. Durch ein großes Glasfenster flutete Licht, selbst jetzt, wo keine Sonne schien. Nathan trat in den schmalen Eingangsbereich zwischen Garderobe und Bad. Markus blieb unter der Tür stehen.
»Wenn Sie etwas brauchen …«
»Danke. Sie können sich jetzt verpissen.«
Als hätte er Nathan nicht gehört, folgte Markus ihm in das Zimmer, das zusammen mit der Therapiebehandlung pro Tag über zweitausend Schweizer Franken kostete. »Ihren Mantel«, bat er. »Ich muss ihn durchsuchen. Genauso Ihr Gepäck.«
»Wenn Sie meinen.« Nathan ließ Markus im Eingangsbereich stehen und sah sich um.
Auf der rechten Seite ragte ein breites Bett in den Raum. Ihm gegenüber hing ein Flachbildschirm an der Wand, auf dem über dem Foto einer verschneiten Bergidylle der Schriftzug Herzlich willkommen, Nathan eingeblendet war. Links vom Fernseher befand sich ein zweitüriger Schrank, rechts von ihm ein Schreibtisch. Bis auf einen Notizblock und eine Broschüre war er leer. Zwischen dem Fenster und dem Bett standen auf einem lindgrünen Teppich wie auf einer Insel ein kleiner runder Tisch und zwei Armsessel. Mit Ausnahme der schwarzen Sessel waren sämtliche Möbel im Zimmer aus hellem Holz. Für Farbkontraste sorgten rote Kissen auf dem Bett und eine Schale mit verschiedenen Früchten auf dem Tisch. Bunte Akzente. So hätte es der Innendesigner wohl genannt, wenn er hier gewesen wäre. Passend zur Wohlfühlstimmung in einem einzigartigen Ambiente, wie es auf der Webseite versprochen worden war. Zu dieser Wohlfühlstimmung gehörte offenbar auch die Illusion, dass man hier zu zweit schlafen und wohnen konnte. Dabei verboten die Hausregeln jeglichen Besuch, sowohl tagsüber als auch nachts.
Nathan öffnete die Tür zum Balkon. Er setzte seinen Fuß in die weiße Masse und versank bis fast zu den Knien darin. Der beinahe unwirkliche Zauber um ihn herum fing ihn ein. Er vergaß, weshalb er hier war. Wie Raix auf dem Parkplatz streckte er seine Zunge aus dem Mund und fing mit ihr die Schneeflocken auf. Er fühlte ihre Kälte, das Prickeln, wenn sie schmolzen, kostete ihren Geschmack. Eine Erinnerung drängte nach oben. Nathan schloss die Augen und stand neben Zoe. Er glaubte, ihre Hand spüren zu können, die sich in seine schob. Winterurlaub in der Schweiz, in einer anderen Zeit, als die MacArrans noch eine Familie gewesen waren und keine auseinandergerissenen Partikel, die nie mehr zu einem Ganzen werden konnten, weil Zoe für immer fehlte. Nathan öffnete die Augen. Tief in Erinnerungen versunken watete er zum Geländer, schob den Schnee von der Brüstung und schaute ihm zu, wie er nach unten auf eine weiße Fläche fiel, aus der kahle, verschneite Bäume in den Himmel ragten.
»Sie sollten sich etwas anziehen, wenn Sie an die frische Luft gehen«, sagte Markus hinter ihm.
»Nun, Sie wollten meinen Mantel«, antwortete Nathan.
»Sie können ihn wiederhaben. Allerdings ohne die Flasche.«
»Kein Bedarf.«
Nathan beugte sich über die Brüstung. Wetten, dass du dich nicht traust?, hörte er Zoes Stimme.
Er beugte sich weiter vor.
»Was machen Sie denn …«
Nathan ließ sich fallen. Weicher Schnee fing ihn auf. Er tauchte hinein wie in eine Wolkendecke. Du Irrer. Zoe lachte. Komm, wir spielen Schneeengel.
Nathan rollte sich auf den Rücken. Fluffiges Weiß hüllte ihn ein, während er unter Zoes Lachen mit Armen und Beinen einen Engel für sie zeichnete. Als Markus nach einer Ewigkeit auf ihn zukam und ihn hochzog, war Zoe verschwunden und Nathan liefen die Tränen über das Gesicht. Wie kalt ihm war, merkte er erst später, im Büro der Klinikleiterin.
»Sie hätten sich verletzen können.«
Die elegant gekleidete Frau mit dem perfekt frisierten blonden Haar und dem dezent geschminkten Gesicht erinnerte Nathan an Grace, aber während seine Managerin die gelassene Sicherheit eines Menschen ausstrahlte, der in sich ruhte, flüchtete sich Ursina Derungs in Posen. Sie faltete bedächtig ihre Hände und wartete darauf, dass er etwas sagte. Nathan nahm die Herausforderung an. Einer von ihnen würde das Schweigen brechen, und er würde es nicht sein.
Auf seinen Kleidern schmolz der letzte hartnäckige Schnee, der sich nicht abschütteln lassen hatte. Der feuchte Stoff lag klamm auf der Haut, löste die Taubheit. Nasse Kälte drang durch die Poren, breitete sich aus und erreichte das Herz, das von der Erinnerung an Zoe immer noch brannte. Eis traf auf Feuer, löschte es und überzog alles mit einer harten Schicht. Nathan spannte die Muskeln an, um das Zittern zu unterdrücken, das seinen Körper zu erfassen drohte. Er zwang seine Konzentration weg von sich, hin zu den Bildern, die an der Wand hingen. Die Fotografien hätten Ayden gefallen. Feinste sprühende Wassertropfen über schwarzem Fels. Sich aufrollender sattgrüner Farn zwischen mächtigen Baumstämmen. Ausgeblichenes Schwemmholz auf vom Fluss geschliffenen Steinen.
»Alles bei uns im Tal aufgenommen«, sagte Frau Derungs.
Nathan nahm seinen Blick von den Bildern und schaute nach draußen. Es hatte aufgehört zu schneien. Durch die Wolken brach die Sonne und brachte eine Million Eiskristalle zum Glitzern. Wäre Nathan nicht aus einem bestimmten Grund hier gewesen und hätte er nicht so grausam gefroren, hätte er sich in dieser Natur verlieren können.
Frau Derungs schien zumindest einen Teil seiner Gedanken lesen zu können. »Rund um die Klinik gibt es vierzig Kilometer Winterwanderwege. Sie werden sich wohlfühlen bei uns.«
Sie machte eine Pause, die Nathan mit Schweigen füllte.
»Es wird natürlich auch harte Arbeit für Sie werden.« Der Gesichtsausdruck der Klinikleiterin zeigte deutlich, dass sie genug gesagt hatte, und die Reihe nun an Nathan war. Er wollte sie provozieren, aber nicht den Bogen überspannen.
»Natürlich«, antwortete er.
»Sie sind hier wegen Ihrer Alkoholabhängigkeit, verbunden mit unkontrollierten Aggressionsschüben und Gewaltausbrüchen. Normalerweise kommen unsere Gäste durch ihren Arzt zu uns. Sie haben sich selber angemeldet.« Sie setzte ein professionell-warmes Lächeln auf. »Ich nehme an, weil Sie wirklich etwas in Ihrem Leben ändern wollen.«
»Ja.« Seine Hände zitterten. Falls Frau Derungs es bemerkte, würde sie es seiner Sucht zuschreiben.
»Dann sollten Sie mit uns zusammenarbeiten.«
»Klar.«
»Sich aus dem ersten Stock fallen zu lassen, ist nicht der beste Anfang.«
»Es wird nicht wieder vorkommen.«
»Gut.« Frau Derungs stand auf. »In einer halben Stunde treffen Sie Doktor Claus van der Velden, den Leiter unserer therapeutischen Abteilung. Er wird mit Ihnen Ihren Therapieplan besprechen. Markus, einer Ihrer beiden persönlichen Betreuer, wird Sie auf Ihren Gängen durch das Haus begleiten.«
Beinahe hätte Nathan gefragt, ob er wenigstens alleine zur Toilette dürfe, doch Frau Derungs sah nicht aus, als ob sie für solche Scherze empfänglich wäre. Er erhob sich und ging zur Tür.
»Ach, da wäre noch etwas«, hörte er die Stimme der Klinikleiterin in seinem Rücken. »Ihre Gitarre haben wir auf Ihr Zimmer gebracht. Das darin versteckte Handy bewahren wir bis zum Tag Ihrer Abreise bei uns auf. Alles Gute.«
Markus erwartete ihn im Flur. Auf dem Weg zum Zimmer zählte Nathan acht Überwachungskameras und keinen einzigen toten Winkel. Sein Informant hatte nicht übertrieben.
Der Wind rüttelte an den Dachziegeln, Regen peitschte gegen die Fenster. Meterhohe Wellen brachen krachend an den Klippen. Im Hafen schlugen sie weit aufschäumend gegen die Mole, schwappten ins sonst ruhige Becken, hoben die Boote an und ließen sie knirschend gegeneinanderprallen.
Kata mochte die Winterstürme, die seit fast einem Monat immer wieder über Quentin Bay zogen, doch seit ein paar Tagen wüteten sie beängstigend stark. Sie saß im Wohnzimmer am knisternden Kaminfeuer und schaute über die Bucht. Ronan legte sein Buch weg, in dem er die letzten paar Stunden schweigend gelesen hatte. »Möchtest du auch einen Tee?«
Kata hielt ihm ihre leere Tasse hin.
»Hast du Sam von den Rosen erzählt?«, fragte er, während er danach griff.
In der Zeit nach den Geschehnissen in der Kirche auf der Insel hatte Kata viel mit Sam gesprochen und den Kontakt nie ganz abgebrochen. Zum letzten Mal hatte sie ihn vor ein paar Tagen am Telefon gehabt.
»Noch nicht.«
Die roten Rosen aus John Owens Garten kamen regelmäßig, jeweils am achten des Monats, dem Geburtstag ihrer Mutter. Es war stets derselbe Junge wie beim ersten Mal, der sie ihr brachte. Längst betrachtete er das Übergeben der Blume nicht mehr als Mutprobe. Er klopfte an die Tür, wartete, bis Kata öffnete, und drückte ihr eine Secret Beauty in die Hand. Es lag keine Nachricht bei und der Junge wusste nur, dass die Blumen seiner Familie per Express in einer Schachtel geliefert wurden, zusammen mit einem Scheck über jeweils hundert Pfund.
Kata hatte herausgefunden, weshalb ihr John die Rosen nicht direkt schickte, sondern von dem Jungen überbringen ließ. Er hieß Jeremia, so, wie ihr Bruder geheißen hätte, wenn er nicht zusammen mit ihren Eltern umgekommen wäre, bevor er überhaupt geboren war.
»Jeremia?«, hatte sie Ronan gefragt.
»Deine Mutter mochte den Namen.«
Das war alles, was Ronan dazu sagte. Kata hörte auch das, was er nicht sagte. Sie wusste, wie sehr er darunter litt, dass sie sich weiterhin Kata nannte und nicht Caitlin, wie ihre Eltern sie getauft hatten. Für ihn war sie Cat. Die streunende Katze, die zwar nach Hause gefunden hatte, wo sie sich zurückzog und verkroch, jedoch regelmäßig für ein paar Stunden oder Tage verschwand und Dinge tat, über die sie nicht sprach. Ronan hatte das Fragen aufgegeben, genauso, wie er es aufgegeben hatte, zwischen ihr und ihrer Großmutter Olivia zu vermitteln zu versuchen.
Er ahnte wohl von den fremden Männern in Katas Leben, bei denen sie für ein paar Stunden alles vergaß. Von ihrem Besuch bei Gerry in London, zusammen mit Gemma, wusste er, nicht aber, dass sie sich dort Universitäten angeschaut hatte. Sie wollte verstehen, was Menschen wie Owen und Jenkinson antrieb, und interessierte sich für ein Studium in Psychologie und Kriminalistik. London schien ihr dafür der richtige Ort, denn wenn man irgendwo völlig in der Anonymität versinken konnte, dann in dieser schier endlos großen Stadt. Ronan wusste auch nichts von ihren Ausflügen nach Lynton, wo sie stundenlang Johns Anwesen Secret Garden beobachtete. Einmal hatte sie Esther abgefangen, eine gebrochene Frau mit leeren Augen.
»Schickst du mir die Rosen?«
»Welche Rosen?«
»Ist John tot?«
»Das weißt du doch. Und jetzt lass mich in Frieden.«
Antworten, die keine waren. Kata musste sie selber finden.
In endlosen Nächten tauchte sie in Henrys Informationen ein, aber sie fand nichts, das ihr weiterhalf. Die Dateien bestanden aus Auszügen aus Polizeiakten, Berichten, Zeitungsartikeln, unzähligen Mails und Schriften, deren Ursprung oft unklar war. Sie waren weder vollständig noch in einen chronologischen Ablauf gebracht. Vor allem hörten sie vor dem Attentat auf Stefan und Brigitta auf. Kata war sicher, irgendetwas zu übersehen, denn es musste einen Grund geben, weshalb Henry den Stick auf der Flogging Molly versteckt hatte.
»Hör auf damit«, bat Ronan sie immer wieder. »Schau nicht zurück. Schau nach vorn, in die Zukunft.«
Sie konnte nicht. Wenn John überlebt hatte, gab es für sie keine Zukunft, selbst wenn sie das Studium in London begann. John würde sie umbringen. Irgendwann. Bis dahin blieb sie die lebende Tote, zu der sie geworden war. Ohne Seele, mit dem Herz einer Mörderin. John sorgte auf seine Art dafür, dass sie das nicht vergaß. Er schickte ihr seine Rosen und nistete sich in ihren Gedanken ein wie ein Computervirus. Sie war eine Getriebene auf der Suche nach Ruhe. Vergebung gab es keine.
Sam konnte ihr nicht helfen. So, wie er Nathan nicht helfen konnte. Niemand konnte Nathan helfen. Er redete nicht. Auch nicht mit Kata. Nachdem die Ermittlungen im Fall Jenkinson abgeschlossen waren, hatte er sich wochenlang auf der Insel verkrochen. Kurz vor Weihnachten tauchte er plötzlich in den Schlagzeilen auf. Er war in London, wo er sich mit einer selbstzerstörerischen Intensität ins Nachtleben stürzte. Alkohol, wechselnde Frauen, Schlägereien, Pöbeleien mit der Polizei: Er tobte sich aus, als wolle er sich bestrafen. Kata hatte ihn angerufen, doch seine Nummer war außer Betrieb. Und dann, von einem Tag auf den anderen, wurde es wieder still um ihn.
Das Pfeifen des Teekessels holte Kata aus ihren Gedanken. Wenig später kam Ronan ins Wohnzimmer zurück. Er stellte die Tasse vor sie hin. »Ich hoffe, dem Boot geht’s gut.« Seufzend schaute er aus dem Fenster. »Werden schlimmer, die verdammten Stürme.«
»Gehen wir nachher noch einmal raus?«, fragte Kata.
Im Moment war es unmöglich, aber wenn die Unwetter jeweils etwas abgeflaut waren, machte sie zusammen mit Ronan und anderen Männern einen Rundgang durch das Dorf und den Hafen. Sie begutachteten die Schäden, reparierten, was sie konnten, halfen beim Räumen von überschwemmten Kellern, Erdgeschossen und Garagen. Kata mochte die stundenlange harte Arbeit, während der nur das Nötigste gesprochen wurde. Im Augenblick jedoch konnten sie nichts anderes tun, als zu warten und zu hoffen, dass ihnen der Wind nicht die Ziegel vom Dach riss.
Der Sturm hielt die Kunden fern. In Plymouth war es nicht ganz so schlimm wie weiter im Westen, aber sogar Ayden, der die Stimmung an regnerischen Tagen gerne mit der Kamera einfing, wurde es zu viel. »Wir könnten den Laden für ein paar Tage schließen und in den Süden fliegen«, schlug er vor.
»Keine schlechte Idee«, murmelte Joseph, der an einer uralten Nikon herumwerkelte. »Wie wär’s mit Marokko? Oder Lanzarote, die Lavainsel? Einzigartige Landschaft, wunderbares Licht, herrliche Kontraste.«
Verdutzt schaute Ayden seinen Boss und Freund an. »Du würdest tatsächlich den Laden schließen und mit mir wegfahren?«
»Warum nicht?«
»Soll ich mich mal schlaumachen?«, fragte Ayden, bevor Joseph seine Meinung ändern konnte.
»Kannst du denn überhaupt weg?«
Ayden wusste, worauf Joseph anspielte. Er hatte ihm erzählt, dass Owen wahrscheinlich noch lebte. Die Angst um Kata war schwer auszuhalten, doch nicht einmal Tag und Nacht in ihrer Nähe zu sein, konnte sie schützen. Sie wollte das auch nicht. Sie hatte Ronan und würde jeden, der ihr Hilfe anbot, zum Teufel schicken.
»Ja«, antwortete er knapp.
Joseph nickte und bohrte nicht weiter nach. Er widmete seine Konzentration wieder der Nikon. Ayden verzog sich ins Büro, wo er im Internet nach günstigen Last-Minute-Angeboten suchte. Der Gedanke an ein paar Tage in der Sonne hob seine Stimmung; die Bilder, die er fand, versetzten ihn endgültig in Ferienlaune.
Das Klingeln des Telefons unterbrach seine Suche.
»Josephs Fotoladen«, meldete er sich.
»Ayden?«
Die gute Laune löste sich beim Klang von Graces Stimme auf und wich einer beklemmenden Vorahnung. »Ist etwas mit Nate?«
»Ich dachte, das könntest du mir sagen.«
»Ich habe seit Wochen nicht mit ihm gesprochen.«
Er hatte es versucht, aber Nathan hatte weder seine Anrufe entgegengenommen, noch auf seine Nachrichten auf der Mailbox reagiert.
Grace atmete hörbar durch. »Du weißt also nicht, wo er ist?«
»Nicht, seit er aus London verschwunden ist.«
Das war vor zwei Wochen gewesen. Ayden hatte angenommen, Grace habe Nathan zu seinem eigenen Schutz entweder in einen Entzug verbannt oder ihm eine Therapie verordnet.
»Wahrscheinlich ist er auf seiner Insel und schottet sich ab.«
»Sam ist hochgefahren. Das Haus ist verschlossen. Der Wagen weg. Der Farmer, der nach Calebs Schafen schaut, hat ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen.«
In den Tagen und Wochen nach der Geschichte mit Jenkinson war Sam zu einem wichtigen Vertrauten von Grace geworden. Sie mochte seine ruhige, besonnene Art und schätzte seine Anteilnahme an Nathans Schicksal. Er war für sie der neutrale Freund, bei dem sie keine Angst haben musste, dass er notfalls für Nathan log, wenn es die Situation erforderte oder Nathan es so wollte.
»Was ist mit DeeDee?«
Grace seufzte. »Er hat sich wie ihr alle zu Nates Beschützer und Verbündetem gemacht und behauptet, keinen Kontakt mit ihm zu haben.«
»Hast du Nate eine Nachricht hinterlassen?«
»Eine?« Grace lachte bitter. »Unzählige. Die Band hat ein Angebot erhalten, das wir unbedingt besprechen sollten.«
»Er wird sich melden, wenn er so weit ist.«
»Diesmal nicht, Ayden.« In der Stimme von Grace schwang dieselbe Traurigkeit, die während Nathans letztem Konzert auf ihrem Gesicht gelegen hatte. »Wir verlieren ihn. Er kommt da alleine nicht mehr raus. Ayden, was ist in dieser Kirche passiert?«
Er konnte es ihr nicht sagen. »Das, was die Medien berichtet haben, Grace.«
»Du lügst. Es war keine Notwehr, nicht wahr?«
Ayden schwieg. Grace verstand. Genauso, wie es Sam und Burton verstanden hatten, aber nicht beweisen konnten und vielleicht auch gar nicht wollten. Ayden, Kata und Gemma waren die einzigen Zeugen. Ayden und Kata hatten übereinstimmend ausgesagt, dass Nathans tödlicher Angriff auf Jenkinson Notwehr gewesen war, Gemma hatte geltend gemacht, bewusstlos gewesen zu sein, um nicht gegen Nathan aussagen zu müssen.
»Ich wusste es«, flüsterte Grace. »Oh, mein Gott. Er braucht Hilfe.«
»Er will keine.«
Zumindest nicht von Ayden. Sonst hätte er ihn zurückgerufen.
»Und du hast keine Ahnung, wo er ist?«, hakte Grace nach. »Oder lügst du für ihn, wie DeeDee?«
»Ich weiß es wirklich nicht.«
»Gib mir Bescheid, wenn er sich mit dir in Verbindung setzt, ja?«
»Mach ich.«
Es war ein sinnloses Versprechen, denn Nathan würde sich nicht melden. Er hatte seinen Weg gewählt und sich entschieden, ihn alleine zu gehen. Einmal mehr.
Nachdem sie das Gespräch beendet hatten, starrte Ayden auf einen schwarzen Strand auf der Insel Lanzarote. Schwarz wie Nathans Welt, in die er sich zurückgezogen hatte. Grace hatte recht. Sie verloren ihn.
Von Sorge und Unruhe getrieben, ging Ayden nach oben in sein Zimmer unter dem Dach. Er loggte sich in einen Mailaccount ein, den nur ganz wenige Leute kannten, und schickte eine verschlüsselte Nachricht an Igor. Die Antwort kam ein paar Stunden später. Sie trug nichts dazu bei, Ayden zu beruhigen.
Keine Aktivitäten. Seit Wochen. Nicht auf seinen üblichen Kanälen. Er muss sich neue aufgetan haben. Werde danach suchen. Kann eine Weile dauern.
Ayden fuhr seinen Computer herunter, rief Sam an und kam ohne Umschweife zur Sache. »Hast du Nate gefunden?«
»Er ist nicht auf der Insel.«
»Komm schon, Sam!«
»Was willst du von mir wissen? Ob das eine gute Nachricht ist oder eine schlechte?«
»Es ist keine gute. Das weißt du! Wo ist er?«
»Keine Ahnung. Und wenn er nicht einmal dir gesagt hat, wo er ist, ist das eine verdammt schlechte Nachricht.«
»Er könnte die Suche wiederaufgenommen haben«, sprach Ayden aus, was er befürchtete.
»Nach Zoes Mörder? Ich werde mich umhören.«
Ayden wusste, dass Sam das längst getan hatte.
»Und wie geht es dir?«, holte Sam die Frage nach, für die ihm Ayden am Anfang des Gesprächs keine Zeit gelassen hatte.
»Joseph und ich machen zusammen Urlaub.«
»Klingt nach einer guten Idee.«
Nach der zweitbesten. Die beste gab es nur in Aydens Träumen.
Der Nächste, den Ayden anrief, war DeeDee. Obwohl das schlechte Gewissen in seiner Stimme nicht zu überhören war, erfuhr Ayden nichts von ihm. Er versuchte es bei ein paar anderen Mitgliedern der Lost Souls Ltd. Ohne jegliches Resultat. Am Ende blieb eine Person, die wissen konnte, wo Nathan war. Kata. Sie nahm den Anruf nicht entgegen. Ayden hinterließ eine Nachricht auf ihrer Mailbox. Eine mehr. Während er sprach, sah er bläulich-weißes Eis vor sich, mit einem Riss, durch den eine dunkelrote Blume wuchs. Kata würde, genau wie Nathan, nicht zurückrufen. Vielleicht, weil sie nach dem letzten Konzert von Black Rain in ein neues Leben aufgebrochen war, in dem nichts, auch Ayden nicht, sie an die Vergangenheit erinnern sollte. Sie richtete sich in einer Gegenwart ein, in der der Tod auf sie lauerte. Ayden hatte keine Ahnung, wie sich das anfühlte, doch er konnte sich vorstellen, dass Kata die Angst ausblendete und einfach den Augenblick lebte.
Ein Kellner in schwarzen Hosen und einem weißen Hemd empfing Raix an der Tür zum Speisesaal und führte ihn an einen Tisch in einer kleinen Nische. Er bot Platz für zwei Personen, war jedoch nur für eine gedeckt. Dieser Spezialservice in Sachen Privatsphäre hatte extra gekostet. Ziemlich viel extra. Raix setzte sich auf die gepolsterte Sitzbank. Froh um den umfassenden Einführungskurs in die Welt der Nobelunterkünfte, den Nathan ihm gegeben hatte, ignorierte er das beeindruckende Arsenal an Besteck, Tellern und Gläsern vor sich, und schaute sich um.
An Zweier- und Vierertischen täuschten vornehm gekleidete Frauen und Männer Normalität vor, aber irgendetwas verriet die meisten von ihnen. Der leere Blick, eine verkrampft lockere Körperhaltung, Hände und Finger, die sich an etwas klammerten, fahrig über das Tischtuch strichen oder leise gegen Gläser trommelten. Raix tat nichts von alledem. Er war Richard William James Felix Ormond, Spross einer unvorstellbar wohlhabenden Familie aus dem Lake District in England, intelligent, sportlich, selbstbewusst. In dieser Klinik war er nur, weil er nach einer nie publik gewordenen Entführung mit anschließender Lösegeldzahlung unter Angstzuständen und Panikattacken litt.
Raix besaß Papiere auf den falschen Namen. Wer Richard William James Felix Ormond im Internet suchte, fand nur wenige Hinweise auf eine sehr diskrete, öffentlichkeitsscheue Familie, jedoch genug, um nicht an ihrer Existenz zu zweifeln. Nathan hatte all das eingefädelt und organisiert, unter Umgehung von Igor. Weder er noch Raix wollten jemanden der Lost Souls Ltd. in die Geschichte hineinziehen. Einzig DeeDee war eingeweiht, und der würde schweigen wie ein Grab.
Derselbe Kellner, der ihn an seinen Platz gebracht hatte, näherte sich Raix’ Tisch und stellte eine bauchige Schale vor ihn hin. »Karottensuppe mit Ingwer, Petersilie und einem Hauch Sahne. Wenn Sie mehr Brötchen brauchen, lassen Sie es mich wissen. Guten Appetit.«
Beinahe hätte Raix über die Förmlichkeit des Mannes gelacht, der ihn an einen Pinguin erinnerte. Er kniff die Lippen zusammen und nickte leicht. Sorgsam darauf bedacht, die Ellbogen nicht aufzustützen, das Brötchen auf den dafür vorgesehenen Teller zu legen, den richtigen Löffel zu erwischen und vor allem nicht zu schlürfen, machte er sich an seine erste Mahlzeit in der Klinik. Die Suppe schmeckte köstlich. Genussvoll schloss Raix die Augen.
»Ich will aber zu dem Typen da sitzen!«, unterbrach eine aufsässige Stimme seinen Ausflug in die Welt der Feinschmecker.
»Das geht nicht, Mr MacArran. Mr Ormond wünscht alleine zu speisen.«
»Wünscht er?«
Raix öffnete die Augen. Vor ihm stand Nathan mit blassem Gesicht und blutunterlaufenen Augen. »Ja, wünscht er«, zischte er in reinstem Oxford-Englisch.
»Hey, Kumpel, ich hab dir den Arsch gerettet.« Nathan wankte. »Hab dich in dieser verdammten Scheißkälte aufgelesen und bei mir mitfahren lassen. Ist das jetzt der Dank?«
Der Kellner stellte sich zwischen Nathan und Raix. »Keine Sorge, Mr Ormond, ich regle das.«
Nathan schob ihn beiseite. »Was soll das? Wir sind Landsleute, Mann.«
Raix musterte Nathan wie ein lästiges Insekt. »Wir mögen aus demselben Königreich stammen, Mr MacArran, aber wir leben in verschiedenen Welten. Belassen wir es dabei.« In einer gezierten Geste bedeutete er dem Kellner, ihn von Nathan zu befreien.
»Snob«, flüsterte Nathan.
Raix tat, als habe er ihn nicht gehört.
Der Kellner führte Nathan zu einem Tisch an der Wand. Kurz danach kam er zurück und entschuldigte sich für den Zwischenfall. »So etwas wird nicht mehr vorkommen, Mr Ormond.«
»Das will ich hoffen.« Raix tupfte sich mit der Serviette den Mund ab. »Ein grässlicher Mensch. Vulgär, schlecht angezogen und ohne Manieren.«
Das Gesicht des Kellners zeigte keine Regung.
»Ich wäre dann bereit für den nächsten Gang.«
»Selbstverständlich.«
Während der Kellner sich mit der Suppenschale entfernte, schaute Raix zu Nathan hinüber. Sein Freund saß alleine am Tisch. Raix wusste, dass Nathan für diesen Spezialservice nicht bezahlt hatte. So, wie er sich aufführte und kleidete, wäre er für jeden anderen Gast eine Zumutung. Als Einziger trug er verblichene, zerrissene Jeans und ein schwarzes Sweatshirt. Seine weißblonden Haare standen ihm so wirr vom Kopf ab wie eh und je. Er hatte sich weder die Mühe gemacht, sein Aussehen anzupassen, noch unter einem fremden Namen einzuchecken, wie er das sonst immer tat. Er war hier als Nathan MacArran. Alles andere wäre verwegen gewesen, denn wenn es einen Ort gab, an dem man Prominente sofort erkannte, dann diesen.
Raix entdeckte noch ein oder zwei Gesichter, die ihm vertraut vorkamen, doch er konnte sie nicht zuordnen. Die Welt der Berühmten interessierte ihn nicht im Geringsten. Nathan würde ihm früher oder später verraten, wer sie waren. Im Moment war er damit beschäftigt, das Essen in sich hineinzuschaufeln. Viel zu schnell und viel zu achtlos. Er tat so ziemlich alles, um sich schon am ersten Abend von seiner schlechtesten Seite zu präsentieren.
Raix erntete ein paar neugierig-mitleidige Blicke, aber das Interesse an ihm flaute schnell ab. Niemand kannte ihn, und um ihn kennenlernen zu wollen, war er zu kalt, zu arrogant und zu unsympathisch. Er schob seine Wasserkaraffe auf die rechte Seite des Tisches und widmete seine Aufmerksamkeit wieder den anderen Patienten, die selbstverständlich nicht so genannt wurden. Sie waren Gäste einer Luxusklinik, die zu den diskretesten der Welt gehörte. Wer über die richtigen Beziehungen verfügte, wusste, dass die Diskretion noch viel weiter ging als es die Informationen auf der Webseite der Mountain Clinic Valgronda versprachen. Raix fragte sich, wer zum Kreis jener zählte, die von dem geheimen Trakt im Untergeschoss wussten, der offiziell nicht existierte, und in dem Dienstleistungen angeboten wurden, die keine Krankenversicherung der Welt bezahlen würde.
Als er nach dem Nachtisch aufstand, befand sich auch Nathans Karaffe auf der rechten Seite des Tisches. Alles in Ordnung. Alles genau nach Plan.
Raix und Nathan hatten sich lange überlegt, wie sie keinen Verdacht auf sich lenken würden. Am Ende entschieden sie sich für die unwahrscheinlichste Strategie, die jemand wählen würde, der nicht miteinander in Verbindung gebracht werden möchte: Für die gemeinsame Ankunft und das gleichzeitige Einchecken, allerdings nach einer unfreiwilligen Fahrgemeinschaft, entstanden aus einer Notsituation. Genau wie Raix’ falsche Identität hielt auch die Geschichte ihrer Anreise jeder Überprüfung stand.
Sie waren in verschiedenen Flugzeugen in die Schweiz gekommen und am Flughafen Kloten in verschiedene Fahrzeuge gestiegen. Raix’ Maschine landete am Morgen, Nathans kurz nach dem Mittag. Raix hatte unterwegs in einem Café einen Stopp eingelegt. Auf der Weiterfahrt hatte sein Fahrer eine Panne vorgetäuscht und Raix war von Nathan und DeeDee aufgelesen worden. Es waren die Wege zweier völlig inkompatibler Unbekannter, die sich zufällig gekreuzt hatten, eine üble Laune des Schicksals, die es so schnell wie möglich zu korrigieren galt.
Nicht Roman, der ihn nach seiner Ankunft durch die Gänge geführt hatte, sondern ein anderer Uniformierter, der sich als Antonio vorstellte, empfing Raix beim Ausgang des Speisesaals. Er begleitete ihn in sein Zimmer im dritten Stock. Kaum war Raix allein, brach die Sehnsucht nach Chesil mit solcher Macht über ihn herein, dass er glaubte, sein Herz höre gleich auf zu schlagen. Er legte sich auf das Bett und versuchte sich abzulenken, indem er den riesigen Flachbildschirm einschaltete. Es gab nur einen hauseigenen Kanal. Auf dem liefen farbenprächtige Naturbilder, unterlegt mit klassischer Musik. Eine Weile ließ sich Raix berieseln, in der Hoffnung, damit seine Schmerzen betäuben zu können. Es half nicht. Die Schmerzen in seinem Kopf waren längst zu ständigen Begleitern geworden, der Schmerz in seinem Herz würde anhalten, bis er wieder mit Chesil vereint war. Raix schaltete den Fernseher aus. In seiner Vorstellung legte er die Hand auf Chesils Bauch. Dort, wo sich ihr kleiner Strickspringerstiefler eingenistet hatte. Raix wollte ihn aufwachsen sehen. Oder sie. Es spielte keine Rolle. Für Chesil und dieses Kind wollte er leben. Deshalb hatte er Nathan vor ein paar Wochen angerufen.
»Ich werde Vater, Nate.«
»Du bist neunzehn, du Idiot«, war das Erste, was Nathan dazu zu sagen hatte. »Mit neunzehn wird man nicht Vater.«
»Ich schon. Und ich bin fast zwanzig.«
»Verdammt, Raix, ein Kind hast du ein Leben lang an der Backe!«
»Ich nicht.«
Daraufhin war Nathan ganz still geworden. So lange, dass Raix dachte, er hätte die Verbindung zu ihm verloren. »Es ist dein Kopf«, hörte er ihn schließlich sagen. »Er gibt auf. Du stirbst.«
»Ja.«
Diesmal war die Stille noch länger gewesen.
»Was kann ich für dich tun?«
Raix hatte es Nathan erklärt.
»Halt durch. Ich melde mich.«
Das war alles gewesen. Kein Zaudern, kein Zögern, kein Versuch, Raix seinen verrückten Plan auszureden. Nur die Bedingung, ihn nicht allein durchzuziehen. Einen knappen Monat später hatten sie alles in die Wege geleitet. Niemand außer Chesil und DeeDee wusste Bescheid. Was sie vorhatten, war zu gefährlich. Zu aussichtslos. Aber Raix’ einzige Chance.
»Jeu carezel ti«, flüsterte Raix. »Ich liebe dich.«
Die Worte, die er bei seinem ersten Abschied von Chesil gesagt hatte. Sie würden ihm Glück bringen. Das wusste er, denn beim letzten Mal hatten sie es auch. Dank Nathan. Diesem irren, seelenlosen Typen, der nichts mehr hatte, wofür es sich zu leben lohnte. Er brauchte den Gebrochenen nicht zu spielen, er war es. Darüber sprechen mochte er nicht. Jede Frage, die ihn auch nur in die Nähe seiner Gefühle brachte, blockte er ab. Genau wie Raix musste er während seines Aufenthalts in der Klinik an einem Therapieprogramm teilnehmen. Es mochte zur Tarnung sein, doch Raix hoffte, es würde seinem Freund helfen.
2.
Nathan starrte auf die schlanken Beine seiner Psychologin. Sie waren nicht nur übereinandergeschlagen, sondern schienen sich beinahe umeinander zu wickeln. So verkrampft, wie die Frau dasaß, musste sie mindestens ebenso viele Probleme haben wie er. Dass ihr die Klinik ein wahrscheinlich hohes Gehalt dafür bezahlte, ihm zu helfen, betrachtete Nathan auch in seiner dritten Sitzung immer noch als ziemlich schlechten Witz.
Sie setzte ihr falsches Lächeln auf. »Wie geht es Ihnen heute, Nathan?«
»Gut, Marissa«, antwortete er.
In den Therapien sprach man sich mit Vornamen an. Das sollte Nähe suggerieren und Vertrauen schaffen. Auch das ein Witz, wenn man bedachte, wie lückenlos man auf Schritt und Tritt überwacht wurde.
»Ich meine, wie geht es Ihnen wirklich, Nathan?«
Er lehnte sich im Sessel zurück. »Sie meinen, so wirklich wirklich, Marissa?«
Ihre Beine krampften sich noch etwas mehr zusammen, während sie ihn weiter anlächelte. »Ja. Dieses Gefühl, wenn Sie tief in sich hineinhorchen. Was sagt es Ihnen?«
Nathan setzte eine todernste Miene auf. »Dass ich Sie nie flachlegen werde. Nicht bei dieser Beinstellung.«
Ihre Augen flackerten, die Mundwinkel zogen sich zusammen, aus dem Lächeln wurde ein verkniffener Mund. »Ich glaube, Sie sollten den Psychologen wechseln.«
Das glaubte Nathan auch.
Vor der Tür wartete Markus auf ihn. »Ist die Sitzung schon zu Ende?«
»Ja.«
Marissa winkte Markus zu sich hinein. »Bringen Sie ihn zu Claus van der Velden.« Ihre Stimme war um eine Oktave nach oben gerutscht. »Er weiß Bescheid.«
Nathan hätte auch gerne Bescheid gewusst. Nicht über seine Nichtfortschritte bei den diversen Therapien, die ihm dieser van der Velden nach einem recht einseitig geführten Eintrittsgespräch mit anschließender ärztlicher Untersuchung und einem noch viel einseitiger geführten Vertiefungsgespräch verschrieben hatte, sondern über das Ausmaß der persönlichen Überwachung.
Die Mountain Clinic Valgronda war ein getarntes Bootcamp für Reiche. Ein überdimensionierter Big-Brother-Container mit Bewohnern, die alles hatten und trotzdem irgendwann als seelische Mängelexemplare in dieser Klinik gestrandet waren. Hier war man unter sich und dennoch allein. Verglich seinen Mangel mit den Mängeln der anderen, froh, wenn der eigene weniger schlimm war. In schweren Fällen dankbar um den geheimen Trakt, von dem man im Vertrauen gehört hatte. Eingeteilt in Kategorien, versehen mit individuellen Therapieplänen, bewegte man sich durch die Tage, zu zivilisiert, um nicht ein wenig miteinander zu reden, allerdings ohne dabei etwas von sich preiszugeben. Man redete sich seinen Zustand schön und vertraute darauf, die Klinik als der Mensch zu verlassen, den man vorgegeben hatte zu sein, sozusagen die Fassade zum wirklichen Gesicht werden zu lassen.
Raix war in die Kategorie G eingeteilt worden, G wie Gruppe, wahrscheinlich weil die Klinikleitung fand, einem Sonderling wie ihm täten zwischenmenschliche Kontakte gut. Nathan hatte es mit seinem Sprung vom Balkon und mit seinem rüpelhaften Benehmen wie geplant in die Kategorie P geschafft, P für Privat, unzumutbar für andere. Anti-Aggressions- und Suchttherapie mit psychologischer Betreuung. Die medizinische Abteilung im Erdgeschoss hatte er genau einmal betreten: Nach seinem ersten Gespräch mit van der Velden. Für einen Gesundheitscheck in einem Praxisraum, in dem an jeder Wand Kameras angebracht waren, begleitet von Markus. Keine Sekunde unbeaufsichtigt. Durch verschiedene Kontrolltüren. Ohne Chance, einen Lift oder eine Treppe zum Untergeschoss ausfindig zu machen.
Während Nathan seine Zeit in Therapiesitzungen, einem aufbauenden Fitnessprogramm oder verordneten Ruhestunden in seinem Zimmer verbrachte, kämpfte er gegen Entzugserscheinungen an, die heftiger waren, als er es sich vorgestellt hatte. Das Zittern. Die Schweißausbrüche. Die Übelkeit. Die Angstattacken. Die traurige Leere, die ihn von einem Augenblick zum nächsten überfiel, ihn müde machte, aber nicht schlafen ließ. All das setzte ihm heftig zu. Trotzdem versteckte er die ihm verschriebenen Medikamente unter seiner Zunge und spuckte sie wieder aus. Er brauchte einen klaren Verstand, denn er und Raix hatten keinen konkreten Plan, nur eine Vielzahl an Möglichkeiten und ein vorher ausgeklügeltes Kommunikationssystem, um das sie froh waren, denn die dichte Überwachung machte vertrauliche Gespräche unmöglich. Sie mussten jene Chancen ergreifen, die sich ihnen boten, und dann improvisieren. Marissa war eine dieser Chancen.
In seiner ersten Sitzung bei ihr war Nathan eingeschlafen, in der zweiten hatte er großspurig erzählt, wie er in Bars Frauen aufriss und dabei die Frage nach dem Warum auf vielfältigste Art und Weise umschifft. Mit einem aufgesetzten Lächeln aber sichtlich entnervt, hatte sie ihn nach der Stunde entlassen. Und nun die Sache mit ihren Beinen. Ihre Reaktion war so vorhersehbar gewesen, dass Nathan sich fragte, ob Marissa das Beste war, was die Klinik zu bieten hatte.
Die Antwort kannte er eine halbe Stunde später, als er nach einem sehr kurzen Gespräch, in dem fast nur van der Velden geredet hatte, Gion gegenübersaß, einem Bär von einem Mann, mit wallendem Haar, Vollbart und struppigen Augenbrauen. Er steckte in Kleidern, die ihm eine Nummer zu groß waren, und hatte Füße, die es mit einem Yeti aufnehmen konnten.
»Gion, ausgesprochen wie John«, erklärte der Bär mit den Yetifüßen. »Ist ein einheimischer Name. Genauso häufig wie bei euch John.«
Während Nathan sich auf den unbequem aussehenden Stuhl setzte, auf den der Bär mit einer lockeren Handbewegung deutete, seufzte er innerlich. Noch einer dieser Psychoheinis, die nichts taugten. Sein Namensvetter John Owen hätte nicht einmal ein mitleidiges Lächeln für diesen Verlierer übrig gehabt.
Schon nach weniger als einer halben Minute war Nathan klar, dass der Stuhl nicht nur unbequem aussah, sondern auch höllisch unbequem war, und nach einer weiteren halben Minute begriff er, dass er sich in Gion geirrt hatte.