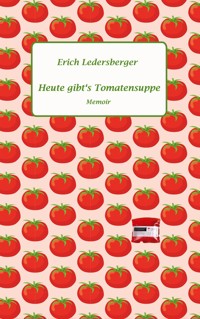Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erich Ledersberger, Kolumnist, Satiriker und Geschichtenschreiber, mag den (fast) normalen Alltag. Und erzählt sieben Geschichten, die nicht alltäglich enden. Da ist der Mann, der nach seiner Scheidung auf so vielen Plattformen sich anbietet, dass er nicht mehr weiß, welches Ich er eigentlich ist. Da ist die gestresste und erfolgreiche Tochter, die Arbeit und Fürsorge für ihre Mutter lange unter einen Hut bringt. Da ist die Frau, deren Sexualität von ihrem Mann ignoriert wird. Immer wieder verliebt sie sich in andere Männer und hofft, dass sich das mit zunehmendem Alter legen wird. Und da ist der Lehrer, der ein Attentat auf seine Schule plant und diesen Plan konsequent durchzieht … aber lesen Sie selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.kakanien.eu
„Ich liebe ihn. Ja, ich liebe ihn. Er ist ein wunderbarer Mann. Nicht gerade der aktivste, aber man kann nicht alles haben. Er ist treu. – Naja, bei seinem Temperament kein Wunder. Und er sieht gut aus. Für sein Alter jedenfalls. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Schluss, aus.“
Sieben Kurzerzählungen von Menschen, deren Leben sich verändert. Manchmal mit großen, manchmal mit kleinen Auswirkungen.
Der Autor
Erich Ledersberger, geboren 1951 in Wien
Studium der Wirtschaftspädagogik
Lehrer und Schriftsteller
lebt derzeit in Tirol und Wien
zahlreiche Veröffentlichungen
Zum Beispiel
Ein Autor sieht rot, Theaterstück, Bunte Bühne, 1985
Wiener Brut, Satiren, rororo, 1986
Schnitzel mit Beilage, Satiren, BoD, 2001
Maria fährt, Erzählung, 2004
Filzbuch 01, Satiren, entertainyoumedia, 2008
Inhaltsverzeichnis
Das Attentat
Schöne Tage noch
Für immer jünger
Tante Gerti
Eigenkapital
Wahre Gefühle
Ich bin so viele
Der Zufall ist kein Wunder
Ein Kleingärtner sieht rot
Ein Dankeschön an die geduldigen Menschen, die mich unterstützt und korrigiert haben und Fehler fanden, als ich schon längst sicher war, dass alles seine inhaltliche und grammatikalische Ordnung hatte: Klaudia, Nina und Reinhard.
Danke an Uschi und Didi, die mich immer wieder ermuntern zu schreiben – und damit nicht aufzuhören.
Danke an Ines und Hubert, die noch kurz vor „Betriebsschluss“ Anregungen für das Cover gaben.
Das Attentat
Hartmut Weniger war selten zufrieden mit sich, sah man von den Zeiten ab, in denen er Wein trank. Weil er dies regelmäßig tat, könnte man auch sagen, dass Hartmut ein nahezu glücklicher Mensch war.
Das war ihm zu gönnen, denn er hatte es nicht leicht in seinem Leben. Das lag nicht nur an seiner Mutter. Auch sein Vater Wolfram war ein Problem. Dieser war Universitätsprofessor für internationales Recht und hatte sich nebenbei in Philosophie habilitiert. Während er im juristischen Bereich eine beinahe internationale Karriere startete, blieb ihm dieser Erfolg in der Philosophie versagt. Das stand in krassem Gegensatz zu den Zielen, die er sich gesetzt hatte. Er wollte der Welt nicht nur etwas geben, er wollte ihr etwas hinterlassen. Ihm war bewusst, dass Juristen dieser Wunsch verwehrt bleibt. Mit der Kenntnis von Gesetzen ließ sich Geld verdienen, aber kein Lorbeer. Leider war er als Philosoph weit weniger begabt.
Als Hartmut zur Welt kam, hatte sein Vater gerade seinen 54. Geburtstag gefeiert, denn er hatte sich sehr spät von der Juristerei und der Philosophie dem realen Leben zugewendet. Eine späte Studentin, die bereits mehrere Abschlüsse in den Bereichen Medizin, Psychologie und Gesangsausbildung – Sopran – vorzuweisen hatte, erinnerte ihn daran, dass etwas in seinem Leben fehlte.
Eilig widmeten sich beide ihren aufwallenden Gefühlen und landeten – nach einem kurzen Imbiss in einer Sushi-Bar – in des Herrn Professors Bett, wo er heftig zeugte und sie freudig empfing. Neun Monate später waren sie Eltern und konnten es nicht fassen. Welch wunderbares Kind war entstanden, als geniale weibliche Gene auf geniale männliche getroffen waren! Und das alles auf natürliche Weise, ohne medizinische Unterstützung.
Unter diesen erwartungsvollen Bedingungen wuchs Hartmut auf. Bereits im Mutterbauch wurde er von der Sopranstimme der Mutter beschallt, damals noch weitgehend wehrlos. Sein heftiges Strampeln wurde als Freudentaumel interpretiert, worauf seine Mutter noch lauter zu singen begann. Irgendwann wird auch der kräftigste Embryo müde und ruhig.
„Jetzt schläft er“, flüsterte die Mutter dann beseligt, denn es war klar, dass das Kind ein Junge würde.
Der Tag rückte näher, an dem der kleine Hartmut aus dem mütterlichen Paradies vertrieben wurde. Von einer Hausgeburt sahen die Eltern vernünftigerweise ab, denn die Mutter war in jenem Alter, in dem selbst stundenlanges Bodenbeckentraining und gemeinsames tiefes Atmen und Hecheln mit dem werdenden Vater nicht alle Gefahren für Leib und Leben ausschließen konnten. Wie jedes Neugeborene brüllte auch Hartmut wie am Spieß, als er das wohlig-warme Nest verlassen musste. Die aus dem Nebenzimmer herbeieilende Krankenschwester gab allerdings zu bedenken, dass sie solche Laute nie zuvor gehört hatte. Die Mutter dachte sofort an die großen Opernhäuser dieser Welt, auf denen ihr Kleiner Karriere machen sollte. Noch war es nicht so weit.
Die Kleinkindjahre vergingen wie im Flug. Der kleine Hartmut schlief, so viel und so lange er konnte, damit er die Laute seiner Mutter nicht hören musste. Sie sang inbrünstig Arien von Mozart und, wenn ihr Mann nicht zu Hause war, von Richard Wagner. Bei letzterem schrie der Kleine allerdings so laut, dass Mutter Weniger unwillkürlich an Günter Grass und seine Figur Oskar Matzerath denken musste. Bei Mozart beruhigte sich das Kind wieder und wimmerte nur mehr leise vor sich hin, bis es wieder eingeschlafen war.
Der zweisprachige Kindergarten verlief unspektakulär. Wahrscheinlich empfand Hartmut dessen Anforderungen als Erleichterung gegenüber seinen vorigen Lebensjahren.
Erste Konflikte in den familiären Beziehungen zeigten sich in der Volksschulzeit. Wie das Gras zwischen Betonritzen hervorkriecht, so machte sich ein vorpubertäres Rumoren bei Hartmut bemerkbar. Seine täglichen Klavierübungen wurden von einem Moll-Ton begleitet, erst leise, schließlich so, als würde er einen Hang zur 12-Ton-Musik in sich spüren.
Mutter Weniger hielt das anfangs für einen avantgardistischen Charakterzug des Kleinen und stimmte sich innerlich bereits auf eine glanzvolle Pianistenkarriere ein. Leider machten ihr weder der Klavierlehrer noch später hinzugezogene Künstler aus dem Konservatorium Mut. Noch heute hat Mutter Weniger die Aussage eines ungestümen Musikers in den Ohren, der meinte:
„Der Junge hat ein Gehör wie ein Maulwurf und seine Finger sind beweglich wie die eines Krokodils. Und wenn Sie im Ernst glauben, dass er ein berühmter Klavierspieler wird, sollten Sie einen Psychologen konsultieren.“
Glücklicherweise war ihr Mann nicht anwesend, so konnte sie den Provokateur mit einer adeligen Bewegung des Hauses verweisen, um danach in herzzerreißendes Weinen zu verfallen. Selbst ihr Sohn konnte sie nicht trösten, so heuchlerisch er es auch versuchte. Immerhin wurde ein Teil des Förderprogramms daraufhin gestrichen. Vater Weniger war ohnehin kein Anhänger der musikalischen Bildung, die seiner Meinung nach die Vernunft so lange mit Notennebel umhüllt, bis sie in Ohnmacht fällt.
„Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ So hatte seine Frau einmal ihr Engagement begründet, worauf er entgegnete, dass seines Wissens niemals so viel gesungen worden sei wie unter den Nazis. Diesem Argument konnte sie nicht widersprechen.
Nachdem das Kind den musikalischen Angriff auf seine Persönlichkeit erfolgreich abgewehrt hatte, blieb Hartmut noch viel zu tun. Je älter er wurde, desto zahlreicher wurden die Förderprogramme und aus kleinen Gefechten wurden allmählich große.
Vater Weniger schob währenddessen die drohende Pensionierung, die im universitären Betrieb vornehm „Emeritierung“ genannt wurde, durch Ansuchen um Weiterverwendung vor sich her wie Sisyphos seinen Stein. Er begann das gemeinsame Haus zu meiden und widmete sich nahezu ausschließlich der Wissenschaft. Die war leichter zu handhaben als dieser kleine Mensch, der sein Sohn sein sollte.
Sein letzter pädagogischer Eingriff war kläglich gescheitert, auch juristisch. Als bekennender Atheist hatte er darauf bestanden, dass seinem Sohn der Anblick des gekreuzigten Jesus in der Volksschulklasse erspart bliebe. Die Behörden hatten das abgelehnt, er war daraufhin siegessicher zu Gericht gezogen, schließlich kannte er die Gesetze des Landes.
Was er nicht kannte, war die phantasievolle Praxis der Behörden und Gerichte. Sie beriefen sich auf Kultur und Sitten einer christlichen Gesellschaft. Das klang wie Hohn in den Ohren des Professors, bestand doch das Land überwiegend aus so genannten Taufscheinchristen. Das aber war kein juristisches Argument und nach vielen Jahren wurde seine Forderung in allen Instanzen zurückgewiesen.
Dass sein Sohn – die Jahre verflogen – ihm bereits in der Unterstufe des Elitegymnasiums ankündigte, er wolle nach Schulabschluss Theologie studieren, war ein weiterer Stein des Anstoßes, sich von der Familie zu entfernen. Allmählich kamen ihm Zweifel, ob dieser Sohn wirklich SEIN Sohn war. Er fand keine Ähnlichkeiten, weder äußerlich noch innerlich. War seine Frau womöglich vor der ersten Nacht bereits? Er mochte diesen Gedanken nicht denken. Aber er war da. Und die neue Sekretärin sehr hübsch.
Hartmut hatte es also nur mehr mit einem Gegner, also einer Gegnerin zu tun. Er wehrte sich konsequent, wiederholte zwei Mal eine Klasse und stand drei Mal vor dem Schulausschluss. Endlich gab seine Mutter – der Vater war in der Zwischenzeit ausgezogen – auf und ließ ihn die Abendmatura machen.
Nun konnte Hartmut endlich tagsüber schlafen und sich abends gelangweilt in die Schule setzen. Auch dort schlief er häufig ein, was nun nichts mehr machte. Neben ihm büffelten Handwerker Goethe, Infinitesimalrechnung und Latein: Hartmut konnte ihnen alles erklären, schließlich hatte er früher eine Eliteschule besucht.
Die anderen staunten über sein Wissen, er fand es lächerlich. Nach Abschluss der Schule begann er, wie angedroht, mit dem Studium der Theologie. Es war ein angenehmes Studium, vor allem, weil es keine überfüllten Hörsäle gab. Hartmut ging sogar zu Prüfungen und bestand sie, bisweilen mit Auszeichnung. Die Zeugnisse zeigte er dann seinem Vater, der sie kopfschüttelnd betrachtete.
Im Gegensatz zu seinem Vater und der eigenen Studienrichtung war Hartmut vom Leben angetan. Er widmete sich transzendentalen Erfahrungen und nahm zu diesem Zweck alle angebotenen Drogen zu sich, abgesehen von Wein und Nikotin. In jener Zeit radikaler Opposition gegen sein Elternhaus offenbarte ihm sein Vater, knapp vor seinem 79. Geburtstag, dass er im Voralpengebiet einen Bauernhof gekauft hätte und sein restliches Leben als ökologischer Schafzüchter verbringen würde und zwar in Begleitung seiner ehemaligen Sekretärin. Da wurde Hartmut klar, dass er diesem Gegner nicht gewachsen war. Sein Widerstand gegen elterliche Autoritäten war zwecklos, weil er nicht mehr wahrgenommen wurde.
Er brach sein Theologiestudium ab und begann ein Lehramtsstudium. Welches, war ihm gleichgültig, aber Germanistik erschien ihm zumindest einigermaßen interessant. Vielleicht war das die perfideste Rache an seinen Eltern: Er beschloss, ein Kleinbürger zu werden und nahm die Stelle eines Lehrers an.
Als solcher war er in der Schule nach kurzer Zeit beliebt, zumindest bei den Schülern. Sie schätzten seine Notenskala, die von „Sehr gut“ bis „Gut“ reichte – und sein umfassendes Wissen. Jugendliche haben dafür ein sehr feines Gespür. Und Hartmut wusste nicht nur viel, er wurde im Laufe der Jahre sogar klug, auch wenn er an dieser Eigenschaft langsam verzweifelte.
Je älter er wurde, desto mehr ekelte ihn die Welt an: das Schultor, an dem er den besoffenen Schulwart traf; die Konferenzen, in denen Probleme diskutiert wurden, die außerhalb der Schule nicht existierten; die Klassenbücher, in denen Fehlstunden eingetragen werden mussten, die niemanden interessierten; die Notengebung, diese Verurteilung von Menschen, die sich nicht wehren konnten.
Schon lange war er – als pragmatisierter Beamter – von illegalen Drogen auf legale umgestiegen. Er trank und rauchte, was das Zeug hielt. Die Anordnung, dass das Rauchen innerhalb der Schule verboten sei, auch im Lehrerzimmer, steigerte seinen Missmut zu unbestimmter Wut. Immer häufiger nützte er die Pausen, um zum nahe gelegenen Café zu sprinten und dort ein Glas Wein, bald zwei bis drei Gläser, in sich hineinzuschütten.
Nicht einmal das bescheidene Ziel, ein aufrechter Kleinbürger zu werden, hatte er erreicht. Er war nicht aggressiv, hatte keine Abneigung gegen Minderheiten und interessierte sich für neue Literatur und Philosophie. Es kam sogar so weit, dass er seinen greisen Vater auf dessen Bauernhof besuchte und eine Spur von Verständnis für ihn entwickelte.
So viel Güte konnte an seinem Arbeitsplatz auf Dauer nicht übersehen werden: Hartmut wurde Betriebsrat. An sich ein Sprungbrett für höhere Ehren, einen Posten als Direktor oder gar als Landesschulinspektor, aber er zeigte keine Ambitionen. Er scheute Konflikte, war für niemanden eine Gefahr, auch nicht für seine Vorgesetzten. Ein dummer Mensch wäre damit zufrieden gewesen, in Hartmut glühte es.
Immer öfter musste er beobachten, dass engagierte Menschen die Schule verließen, manche, indem sie geistig das Weite suchten und bloß körperlich anwesend blieben, manche, indem sie das auch körperlich, also ganzheitlich machten. Zurück blieben jene, deren Horizont selten über ihren Gegenstand hinausging. Immer deutlicher fühlte er, dass er den Großteil seines Lebens in einer geschützten Anstalt zubrachte, die sich für den Nabel der Welt hielt.
Vielleicht hätte er heiraten sollen und Kinder bekommen? Dann wären ihm diese Beobachtungen nicht wichtig gewesen, weil Kinder bekocht und gewickelt werden müssen, weil ihre Probleme hinausgehen über den Kleinkram einer krebsartig wuchernden Bürokratie, die längst nicht mehr wusste, wozu sie da war, aber diese Frage nie stellte.
Solche Gedanken dröhnten mitunter in seinem Kopf. Aber wo war die Frau, die seine Gedanken teilte, zumindest verstand? Er sah sie nicht und setzte sich intensiv mit Jan-Carl Raspe auseinander. Der Mann war Mitglied der RAF, der Roten Armee Fraktion, jener Gruppe von Menschen, die idealistisch begann und terroristisch endet. Raspe gefiel ihm. Sein Geburtsort war entweder Seefeld in Tirol oder Berlin, schon diese Unsicherheit begeisterte Hartmut. Noch dazu galt Raspe als introvertiert und grüblerisch, es gab kaum Informationen über ihn im Internet. Irgendwann, so erinnerte sich Hartmut, hatte er Gespräche mit den Terroristen in einem deutschen Wochenmagazin gelesen. Sie waren merkwürdig platt und einfach geraten, nur Raspe, mit all seinen Zweifeln, überzeugte ihn. Er beschloss ein Zeichen zu setzen.
Helga, seine Kollegin und der einzige Mensch, der seinen Zustand einigermaßen akzeptierte, sorgte sich im Lauf der Zeit immer mehr. Hartmut verhielt sich merkwürdig. Hatte sie anfangs seine Scherze über das Anzünden der Schule noch lustig gefunden, kamen ihr seine präziser werdenden Gedankenspiele zum Bau einer Bombe und ihrer Fernzündung mit einem Handy immer realistischer vor.
Helga hatte keine Ahnung von Internet und all diesen neumodischen Dingen, die ihre Schüler vom Lernen abhielten. Sie war Lehrerin für Geschichte, hatte Schulbücher und brauchte all das nicht. Aber selbst ihr war klar, dass der Bau einer Bombe für jeden halbwegs intelligenten Menschen mit Internetanschluss kein Problem darstellte.
Hartmuts Vorträge in den Klassen nahmen düstere Formen an. Er forderte die Jugendlichen auf, ihren Verstand zu benutzen und sich zu wehren gegen ihre Eltern. Jesus habe das ebenso empfohlen wie die meisten anderen Religionsgründer. Vor kurzem wollte er eine Klasse einen Aufsatz schreiben lassen zu dem Thema: „Jesus Christus und Jan-Carl Raspe: ein Vergleich“ Helga konnte ihn mit Mühe davon abhalten.
In den Gesprächen mit Helga ging er noch weiter. Er empfände nicht nur Mitgefühl und Verständnis für idealistische Terroristen, wiewohl ihm klar sei, dass diese Bezeichnung ein Widerspruch sei. Nein, er habe Sympathie für sie. Ihm persönlich fehle bloß der Mut, diesen pädagogischen Irrsinn namens Schule in die Luft zu sprengen. Noch fehle er ihm, fügte er schelmisch hinzu und lachte fröhlich. Da lachte auch Helga erleichtert auf.
Dennoch zog sie ihn mitunter auf die Seite und ermahnte ihn unter vier Augen. Auch wenn er das alles nicht ernst meinte, so müsste ihm klar sein, dass viele das anders sehen könnten. Bald würden Eltern sich womöglich beschweren. Es bestünde die Gefahr, dass seine Phantasien öffentlich würden. In Zeiten der politischen Korrektheit eine Katastrophe für die Schule, ja für den Berufsstand als Ganzes.
An Hartmut perlten die wohlmeinenden Ratschläge ab wie Nieselregen an imprägnierten Jacken. Sein Weinkonsum hatte mittlerweile solche Dimensionen angenommen, dass ein täglicher Gang zum Flaschencontainer nötig war, um die Ordnung in der Wohnung aufrecht zu erhalten. Zufällig fand er ein Geschäft, das Wein in Schläuchen verkaufte. Schon die Analogie zur Bibel erfreute sein Herz, mehr noch die Qualität des französischen Rotweins.
„Jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, will anschließend neuen. ‚Der alte ist besser’, wird er sagen.“ Lukas, Kapitel 5.