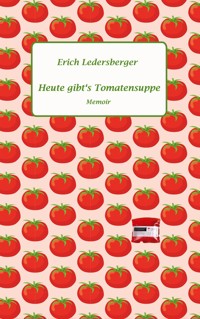
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den letzten zwei Jahren gab es eine Aneinanderreihung von kleinen bis größeren Entzündungen. Unerklärlich. Unbegründet. Mein Körper, bis dahin nahezu unempfindlich für Keime, zog sie an wie in Bauernhäuser der klebrige Sreifen Fliegen. Nun wurde dieses Etwas konkret, stieg aus der Dunkelheit empor, verdichtete sich zu dem Satz: Du hast ein Ende. Jedes Leben wächst mit diesem Todesurteil auf. Meistens verdrängen wir es. Plötzlich ist es da. Wir leben in einer Welt, in der alles geht und die ewiges Leben verspricht. Jugendliches Aussehen bis ins hohe Alter und auch beim Sex ist nicht tote, sondern volle Hose bis ins Greisenalter angesagt. Das klingt nach Inkontinenz, ich meine aber ausschließlich den genitalen Bereich. Trotz aller Verdrängungen: Die Existenz des Todes lässt sich auf Dauer nicht verleugnen. Irgendwann ist Schluss mit Sex und anderen Problemen. Wir werden sterben! Wie schafft es das? Ohne Medikamente? Er liegt neben mir, schläft wie ein Baby, das von der Welt nichts weiß. Wenn ich ihn streichle, lächelt er. Er wacht nicht auf. Er träumt wohl. Ich beneide ihn. Ich habe ihm viel zu selten gesagt, dass ich ihn liebe. Ich muss das nachholen. Jeden Tag ein Mal. Mindestens. Das wird nicht helfen gegen die Krankheit, würde er wohl sagen. Das ist mir egal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.kakanien.eu
Der Autor
Erich Ledersberger, 1951 in Wien geboren.
Lebt in Innsbruck und Wien.
Veröffentlichungen
Kakanien 2000 – 2006, Band 1, BoD, 2023
Der aufgelöste Mann, Stück für einen Mann, BoD, 2020
Fünf. Sieben. Fünf. 34 Haikus, BoD, 2019
Als mein Ich verschwand, Kurzgeschichten, BoD, 2018
Ich bin so viele, Kurzgeschichten, BoD, 2014
Filzbuch 01, Satiren, entertainyoumedia, 2008
Schnitzel mit Beilage, Satiren, BoD, 2001
Wiener Brut, Satiren, rororo, 1986
Alles im Lot, Gedichte und Kurzgeschichten FF&LM, 1984
Ende der Salzstreuung, Gedichte, Eigenverlag, 1982
Dass alles vergeht ist vielleicht nicht das Schlimmste. Aber warum ich?
Inhaltsverzeichnis
Leukozyten und Co
Einfach gehen?
Die große Zufriedenheit
Er schläft
Gewohnheiten
Vom Ende der Scham
Unser Engel
Die zweite Runde
Weihnachten
Es geht uns gut!
Die Feier
Vom Lügen
Zweite Meinung
Los geht’s!
Endlich!
ZVK – Zentraler Venen Katheter
Corona
Verführung im Spital
Spitalsküche
Isolation
Die große Reinigung
Heimkehr
Bernhard
Es geht los! - Klaudia
Chemo Teil 2
Pfingsten
Major Tom
Heute gibt‘s Tomatensuppe
Begräbnisse
Klaudia
Endlich daheim
Und wieder im Spital
Der Sorgenfuchs
Ich bin gesund
Neue Ziele
Ebreichsdorf
Auf der Suche
Der Flug der Zeit
Als das Denken noch geholfen hat
Erfrischender Anruf
Hochzeitstag
Attacke!
Der gute Tod
Leukozyten und Co
„Ich habe für morgen einen Termin ausgemacht. Zehn Uhr in der Hämatologie bei Doktor M.“
„Morgen geht es bei mir nicht. Ich muss zu einer Besprechung.“
„Die musst du absagen.“ Iris duldet keinen Widerspruch.
Manche Telefongespräche lassen nichts Gutes ahnen. Iris ist meine neue Hausärztin. Wir kennen uns seit einem Gesuch an die Innsbrucker Stadtverwaltung. Die lokalen Politiker hatten sich etwas ganz Neues einfallen lassen, nämlich die direkte Beteiligung des Volkes am politischen Leben. Digital und jederzeit könne man Anliegen der Verwaltung nahebringen, die dann sogleich zur Tat schreiten würde.
Iris hatte das getan und auf eine Engstelle an einem Gehweg hingewiesen, die weder Rollstuhlfahrer noch Menschen mit Kinderwagen oder Rollatoren bewältigen können. Ich fand die interessante Plattform ‚Bürgerbeteiligung‘ eher zufällig. Offensichtlich wollten die Politiker nicht so genau darauf hinweisen, vermutlich, um nicht zu viel Bürgerbeteiligung zu riskieren. Ich schrieb also einen Beitrag, in dem ich ebenfalls darauf aufmerksam machte, dass die Höttinger Gasse ein Problem darstelle. Der ‚Fußgängerbeauftragte‘ der Stadt antwortete, dass man bestrebt sei, das ‚subjektive Angstgefühl‘ zu beseitigen.
Die Beschreibung ‚subjektiv‘ löste bei einigen Besuchern der Plattform heftige Reaktionen aus, sie bestanden darauf, dass die Angst in der Höttinger Gasse objektiv nachvollziehbar sei. Daraufhin schwieg der Fußgängerbeauftragte so lange, bis er in Pension gehen konnte, es war eine glücklicherweise sehr kurze Frist.
In der Zwischenzeit gab es Wahlen und Innsbruck hatte den ersten grünen Bürgermeister Österreichs. Nun würde alles anders werden, die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner würde aktiv unterstützt und gefördert werden. Zwei neue Rad- und Fußgängerbeauftragte erblickten das Licht der Politik und tatsächlich: Bald darauf fügte der oder die neue Beauftragte ein Hakerl unter die Diskussion im digitalen Netz. Das bedeutete, dass die Sache seitens der Stadtverwaltung erledigt sei.
„Wenn du einen Termin beim Bürgermeister bekommst, bin ich gerne bereit, dich zu begleiten und die Situation zu beschreiben“, schrieb Iris, die das Hakerl für einen Hinweis auf weitere Gespräche hielt. Ich bekam selbstverständlich keinen Termin, schon gar nicht beim Bürgermeister, aber Iris und ich trafen uns in einem Café und verstanden uns wunderbar. Iris ist eine für mich – ich nähere mich dem siebzigsten Geburtstag – junge Frau mit drei Kindern, ausgebildete Anästhesistin und Allgemeinmedizinerin, die sich auch sonst den Dingen des Lebens mit Engagement widmet – kurz: Sie ist ein Mensch, dessen Kenntnisse und Fähigkeiten ich bewundere und der mich unweigerlich zur ab und zu aufsteigenden Frage führt, warum ich zu derartigen Leistungen Zeit meines Lebens nicht fähig gewesen bin.
Wie auch immer, wir erreichten in der Sache Höttinger Gasse nichts, aber ich hatte eine neue Hausärztin. Sie nahm mir im Herbst 2019 zum ersten Mal Blut ab.
Mein früherer Hausarzt war mir bei einer Vorsorgeuntersuchung abhandengekommen. An sich verstand ich mich mit G. bestens. Er war nicht nur Schulmediziner, sondern hatte auch in China eine Ausbildung in Traditioneller Chinesischer Medizin gemacht. Das beeindruckte mich nicht aus medizinischen Gründen, sondern weil ich in meiner Jugend gerne die weite Welt bereist hätte, es aber nur bis Bonn und Berlin geschafft habe. Außerdem war er Mitglied einer Tiroler Band gewesen, die es mittlerweile zwar nicht mehr gab, aber er spielte immer noch sehr schöne Lieder. Er war ein Mensch, dem ich vertraute. Ihm gegenüber erwähnte ich bei einer Untersuchung Probleme mit kleinen, roten Flecken auf der Haut und andere Kleinigkeiten wie Müdigkeit und diverse Entzündungen.
Er diagnostizierte das als Alterserscheinung, ebenso das Thema eventuell vorhandener Hämorrhoiden. Auch die schienen ihm eine Frage des Alters zu sein. Ich nahm das erfreut – wenn man vom Hinweis auf das Alter absieht – zur Kenntnis. Wenn der Fachmann meint, alles ist in Ordnung: Warum sollte ich widersprechen?
Im Frühjahr kam ihm allerdings meine Leukozytenzahl verdächtig vor, worauf er mir im Mai nochmals Blut abnahm und mir versicherte mich anzurufen, sollte etwas nicht passen.
Glücklicherweise, dachte ich damals, rief er nicht an.
Meine sehr ordnungsliebende ALF (AllerLiebsteFrau) bestand aber darauf, dass ich den neuen Befund wenigstens in Händen halten sollte. Sie zeichnet sich fortwährend dadurch aus, dass Probleme möglichst rasch geklärt werden, damit man sie ‚abhaken kann‘, wie sie das nennt – allerdings nicht im Sinne der Radfahrbeauftragten, sondern tatsächlich.
Ich meinerseits bin ein Anhänger der Verschiebethese, ich nenne sie vornehm Transaktionsthese. Viele Probleme lösen sich, indem man sie auf die Seite legt und abwartet. Ich bin mit dieser Arbeitsweise bisher recht gut gefahren, weil viele Probleme nach einiger Zeit sich auflösen wie Zucker im Kaffee.
In Teilbereichen meines Lebens mache ich ihr allerdings erhobenen Kopfes Konkurrenz. Was die Anzahl der Aktenordner und Hängemappen anlangt, macht mir so schnell niemand etwas vor. Eine dieser Hängemappen trägt die Bezeichnung, ‚demnächst erledigen‘. Sie wird im Laufe des Jahres immer dicker, aber am 31. Dezember, wenn ich einen Schlussstrich unter die vergangenen zwölf Monate ziehe und schaue, was ich tatsächlich ‚demnächst erledigen‘ muss, haben sich etwa 90 Prozent bereits von selbst erübrigt. So ist es gut.
Der Verlag, dem ich einen Text zum Thema ‚Alleinerzieher – was jetzt?‘ schicken wollte, ist in Konkurs gegangen.
Die Satire über einen größenwahnsinnigen Obmann eines Schrebergartenvereins mit dem Namen ‚Neurosental‘ hat sich nach der Wahl von Donald Trump erledigt.
Und mein Science-Fiction-Stück ‚Wie ein Virus die Welt verändert‘ ist aus bekannten Gründen auch kein Thema mehr.
Wenn es allerdings um meine Gesundheit geht, kennt Klaudia keine Gnade. Meine Verschiebethese findet sie schlicht idiotisch. Ich forderte also den neuen Befund, der vor zwei Monaten in der Ordination angekommen sein musste, bei meinem Arzt und Alternativmediziner an. Leider war er gerade auf Urlaub und meine Nachricht auf seiner Box, dass mich die Anzahl meiner Leukozyten irgendwie doch interessierte und er mich zurückrufen sollte, wurde nicht beantwortet, auch als sein Urlaub längst beendet war.
Irgendwann erreichte ich die Ordinationshilfe und meine ALF durfte den Befund abholen. Es war allerdings jener Befund, den ich schon hatte – und nicht der neue. Ich rief also wieder an und bat um den neuen Befund, man möge ihn an meine Mailadresse schicken, ich sei gerade in Wien.
Das ginge leider nicht, weil es gegen die Datenschutzverordnung sei, man werde den Befund per Post schicken. Tatsächlich kam er am übernächsten Tag an. Da war er, der alte, bereits bekannte Befund. Die Geschichte erinnerte irgendwie an Franz Kafka und ich weiß nicht mehr so genau, wann es meinem Ex-Hausarzt gelang, den neuen Befund zu finden. Er kam per Post, meine Leukozyten, die ich inzwischen als gute Bekannte empfand, hatten sich weiter vermehrt.
Beim nächsten Anruf wollte ich von meinem Arzt wissen, was das bedeutet. Er hätte meine Befunde gerade nicht vor sich, er werde mich am nächsten Tag aus der Ordination anrufen. Fünf Wochen später hatte ich zwar noch keinen Rückruf erhalten, war aber selbst und andernorts aktiv geworden. Glücklicherweise kenne ich einige Ärzte. Einer von ihnen, mein Freund Pauci, mit dem meine verstorbene Frau Betina studiert hatte und dem wir die Befunde geschickt hatten, riet mir, sofort eine weitere Blutuntersuchung zu machen.
Ein paar Tage später fuhr ich nach Innsbruck und ließ mir von Iris Blut abnehmen. Die zögerte nicht.
Einfach gehen?
Spitäler ab einer gewissen Größenordnung erinnern an eine kleine Stadt. Es gibt eine Bank, ein Lebensmittelgeschäft, ein Espresso, eine Trafik, eine in Tirol natürlich christliche Kapelle. Jedes Haus hat einen Concièrge, der hier noch Portier genannt wird. Man nähert sich einem mit Glasscheibe gesicherten Kabäuschen und wartet, bis sich ein unbekannter Mensch von der anderen Seite nähert und nach dem Begehr fragt. Man erfährt, wohin man gehen, welchen Aufzug man nehmen und wo man sich anmelden soll. ‚Leitstellen‘ heißen jene Orte, an denen man sich registriert und darauf wartet, aufgerufen zu werden.
An der Innsbrucker Klinik arbeiten etwa 7.000 Menschen, was im Vergleich zu den 110.000 Menschen des größten Spitals der Welt ein Klacks ist. Die Vorstellung, sich auf einem Gelände mit 20.000 Ärzten und jährlich sieben Millionen Patienten aufzuhalten, erscheint mir monströs. Mit unüberschaubaren Größen hatte ich immer schon Probleme.
Ich sollte mich konzentrieren.
Meine ALF hatte Dr. Google befragt, welche Ursache erhöhte Leukozyten haben können und war auf merkwürdige Hinweise gestoßen. Ehrlich gesagt, hatte ich das auch getan, aber so geheim wie möglich. So waren wir beide, ohne dass es der oder die andere das wissen sollte, auf eine Krankheit mit unangenehmen Namen gestoßen: Leukämie.
Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering, suggeriert mir meine innere Abwehr. Andererseits bin ich ein optimistischer Realist, also nahe an einem Pessimisten und fand selbst die geringe Wahrscheinlichkeit als unangenehm.
Die Nacht vor dem Spitalsbesuch war keine gute. Erinnerungen kamen hervor wie zarte Keime, deren Bedeutung man noch nicht kennt. Wurden sie zu Früchten? Waren sie Unkraut?
In den letzten zwei Jahren gab es eine Aneinanderreihung von kleinen bis größeren Entzündungen. Unerklärlich. Unbegründet. Mein Körper, bis dahin nahezu unempfindlich gegenüber Keimen, zog sie an wie der klebrige Leimstreifen in Bauernhäusern die Fliegen.
Schmerzen in den Beinen.
Eine schlaflose Nacht mit einem heißen Vollbad.
Ein Blutsturz nach dem Zahnarztbesuch.
Ich bemerkte die blutbefleckte Hose, die an meinen Beinen klebte, erst daheim.
Im Sommer eine Lungenentzündung.
Zahlreiche Besuche bei Zahnärzten wegen Kieferentzündungen. Kleine, rote Flecken an den Armen. Schweiß-feuchte Nächte in kalten Wintertagen.
Nun wurde dieses Etwas konkret, stieg aus der Dunkelheit, verdichtete sich in dem Satz: Du hast ein Ende. Jedes Leben wächst mit diesem Todesurteil auf. Meistens verdrängen wir es. Plötzlich ist es da.
Wir warten in der Ambulanz. Und mir fallen Werbesprüche ein: Du schaffst alles. Lebe deinen Traum. Alles ist möglich. Wir schaffen das. Ich schaffe das.
Wir leben in einer Welt, in der alles geht und die ewiges Leben verspricht, zumindest aber ein jugendliches Aussehen und Beweglichkeit bis ins hohe Alter. Der betagte Mensch hat heute aktiv zu sein, mit Enkelkindern oder Hunden oder Hobbys. Wenn etwas weh tut, gibt es Salben und Tabletten dagegen und schwupps, schon sind die Alten wieder jung.
Auch beim Sex ist nicht tote, sondern volle Hose angesagt. Naja, das klingt nach Inkontinenz, ich meine ausschließlich den genitalen Bereich. Angeblich ist die Hälfte aller 60 bis 70Jährigen sexuell aktiv. Habe ich in einer Zeitung gelesen. Wie oft und wie lange stand in dem Artikel nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Leistungsdruck nimmt mit zunehmendem Alter nicht ab, sondern zu.
Trotz aller Ablenkungen und Verdrängungen: Die Existenz des Todes lässt sich nicht leugnen. Irgendwann ist Schluss mit Sex und anderen Problemen.
Wir werden sterben. Aber wie? Angehängt an Schläuche, unfähig, ein Wort zu sagen? Langsam dahinsiechend, um Luft ringend, bis endlich ein paar Organe gleichzeitig ihren Geist – und uns – aufgeben?
Oder einfach gehen?
*
Gerhard war mein erster Vorarlberger gewesen. Es war die Zeit, als man mit dem Zug nach Großbritannien fuhr, weil der Flug zu teuer war. Auf diese Weise hatte ich einst London erreicht, Bregenz war nicht so anziehend. Ich arbeitete bei einem Meinungsforschungsinstitut, das der sozialdemokratischen Partei nahestand. Es gab auch ein zweites, das wiederum für die konservative Volkspartei forschte. Die Leiter beider Institute waren tatsächlich Experten ihres Berufsfeldes, sie verstanden sich blendend, dienten bloß unterschiedlichen Ideologien. Im Österreich der 1970er Jahre war das Land gewissenhaft aufgeteilt in Rot und Schwarz. Es gab zwei Meinungsforschungsinstitute, zwei Autofahrervereinigungen, ja sogar zwei Schriftstellervereinigungen, die jeweils der einen oder der anderen Reichshälfte zugeordnet werden konnten.
Auch Gerhard arbeitete hier, der kleine Mann mit der großen Glatze. Er war etwa zehn Jahre älter als ich und ich bewunderte seine Bildung auf musikalischem und politischem Gebiet. Eigentlich war Gerhard Journalist, aber er hatte keine Aussicht auf eine Anstellung. Das war kein Wunder, er war ein kritischer und linker Geist, was im öffentlichen Leben Österreichs auf Arbeitslosigkeit hinauslief. Die Medienlandschaft ähnelte in ihrer Vielfalt eher dem kommunistischen Rumänien als einer westlichen Demokratie.
Gerhard träumte von einer demokratisch-linken Zeitung, die er, gemeinsam mit anderen, demnächst gründen würde. Od‘r? Er beendete viele Sätze mit diesem Wort. Anfangs glaubte ich, er erwartete eine Antwort, bis mir klar wurde, dass es sich beim Wort ‚od‘r‘ um so etwas Ähnliches wie ‚net‘, ‚nich wah‘ oder ‚vastehst, Oida‘ handelte. Ein Anhängsel ohne Bedeutung. Gerhard jedenfalls wurde mir zu einer Art Freund, auch als wir das Meinungsforschungsinstitut längst verlassen hatten, blieben wir verbunden.
Gerhard arbeitete mittlerweile als Erzieher im Voralpengebiet, ich unterrichtete widerspenstige Schülerinnen und Schüler. Jeder war auf seine Weise unglücklich, mir ging es bloß ökonomisch besser. Alle paar Monate tauchte Gerhard bei mir auf. Er hatte ein paar Tage Urlaub genommen und wanderte von Freund zu Freund. Bei jedem blieb er ein paar Tage, ausgestattet mit einer großen Tasche, in der sich Zeitungen und Bücher befanden und einem kleinen Koffer, in dem er seine Kleidungsstücke mitführte.
Anfangs freute ich mich. Gerhard war lustig und klug, erzählte von den neuesten Theater-Aufführungen, berichtete über die politische Lage entfernter Nationen. Mit der Zeit ermüdete er. Kaum aufgestanden, erzählte er mir schon beim Frühstück, wie die Welt anders sein könnte. Am Nachmittag, wenn ich vom Unterricht nach Hause kam, überfiel Gerhard mich mit weiteren Neuigkeiten. Am Abend fiel ich erschöpft in einen tiefen Schlaf. Nach wenigen Tagen, die mich allmählich mehr erschöpften als die Vormittage mit meinen Schülern, wechselte er den Gastgeber und verschwand für einige Zeit wieder aus meinem Leben.
Irgendwann bemerkte ich, dass er nicht mehr auftauchte. An seinem Arbeitsort, einem Lehrlingsheim am Semmering, wusste man nur von seiner Kündigung. Telefonnummer gab es keine. Über Umwege erfuhr ich von seiner Adresse. Er lebte nun offenbar in Bregenz. Ich schrieb ihm einen vorwurfsvollen Brief. Nach einigen Wochen kam der zurück. Absender verstorben, stand auf dem Umschlag.
Das hielt ich für einen Irrtum.
Auch mein Schriftstellerkollege Günther, ich hatte ihn durch Gerhard kennengelernt, bemühte sich, die Wahrheit herauszufinden. Er folgte Gerhards Spuren, fuhr von Salzburg nach Bregenz, nach Berlin, quer durch Deutschland.
„Er hat sich umgebracht“, erzählte ihm endlich ein Polizeibeamter in Hamburg. „Er hat den Kopf auf die Schienen gelegt. Sehr ordentlich. Die Rettungsmänner haben gesagt, die meisten Selbstmörder lägen ja stückchenweise verstreut und unkenntlich in der Gegend rum. Er aber war nahezu unversehrt, wenn man vom Kopf absah. Im Gebüsch fand man eine Aktentasche mit Zeitungen und Büchern und seinem Ausweis. Sonst nichts. Nein, auch keinen Abschiedsbrief.“
Was übrigens ganz normal ist. Die meisten Selbstmörder hinterlassen keinen Abschiedsbrief. Wozu auch? Sie haben von der Welt genug, was sollen sie ihr mitteilen? Niemand hatte sie je verstanden, warum sollte sich das nun ändern? Und was hätten sie davon?
Als Günther mir mitteilte, dass Gerhard tatsächlich tot war, betrank ich mich so heftig, dass ich bald alles wieder in einen Kübel erbrach. Der säuerliche Geruch erfüllte die Wohnung und half nicht weiter.
*
Während all das durch meinen Kopf geistert, halten Klaudia und ich uns an den Händen, die kälter werden und kälter. Bis vor kurzem wussten wir nicht einmal, was Hämatologie ist, nun sitzen wir in einer Ambulanz mit diesem Namen.
Wikipedia hatte uns mitgeteilt, dass es sich um die ‚Lehre von der Physiologie, Pathophysiologie und den Krankheiten des Blutes sowie der blutbildenden Organe‘ handelt. ‚Sie umfasst bösartige Erkrankungen des Blutes, Bildungsstörungen des Knochenmarks, Blutveränderungen durch immunologische Prozesse, Störungen der Blutstillung und Übergerinnbarkeit des Blutes. Die wichtigsten Blutkrankheiten sind die akute und chronische Leukämie (Blutkrebs), bösartige Veränderungen der Lymphknoten (umgangssprachlich ‚Lymphknotenkrebs‘), Anämie (Blutarmut) und die Hämophilie (Bluterkrankheit).‘
So genau wollte ich es gar nicht wissen. Nun sitzen wir hier, einen Tag nach dem Anruf von Iris, meiner Ärztin. Die Räume sind in einem Gebäude untergebracht, das vermutlich aus den 1960er Jahren stammt. Die Damen – noch ist kein Mann in Sichtweite – sind sehr freundlich, das soll vermutlich aufkommende Panik zurückhalten.
Mich beunruhigt diese Freundlichkeit, sie ist hierzulande nicht sehr verbreitet. Ist das bereits der Übergang in die vollständige Ruhe des Grabes? Noch ist keine Zeit, den Gedanken auszuweiten, die bürokratischen Formalitäten beschäftigen uns.
E-Card vorweisen, Daten eingeben, dann ein Lächeln und der Satz: ‚Setzen Sie sich bitte und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden‘.
Er wird mir im Laufe der Monate sehr vertraut werden.
Dem ersten Aufruf folgt eine Blutabnahme, dann warten wir wieder. Klaudias Hände frieren weiterhin, ich beobachte die anderen Patienten. Noch habe ich keinen Befund, noch bin ich gesund, noch kann ich mich wie ein Besucher fühlen. Die Kranken sehen unterschiedlich aus. Manche sind abgemagert und bleich, manche werden im Rollstuhl hereingebracht, manche sehen gesund aus. Sind das überhaupt Patienten? Oder handelt es sich um Begleitpersonen? Ich spüre, wie bei Klaudia Panik hochkommt, je länger das dauert. Wir tätscheln beruhigend unsere Hände.
Mein Blut wird untersucht, einfaches Blutbild, differenziertes Blutbild, ich kenne den Unterschied nicht. Noch nicht. Gegen Mittag werden wir aufgerufen, Doktor M. wird uns über das Ergebnis unterrichten.
In einem kleinen Zimmer mit Computer, Bett und einigen Zusatzgeräten erklärt er uns meine mögliche Erkrankung. Er spricht langsam und deutlich. Ich verstehe Subjekt, Prädikat und Objekt. Und den Inhalt. Der ist nicht so schön wie die Grammatik.
„Ihre Blutbefunde sind in Teilen nicht in Ordnung. Wir müssen uns das noch genauer ansehen, aber einiges deutet auf eine Erkrankung des Blutes hin.“
Klaudias Hände sind Eiswürfel geworden. Ich wärme sie, während etwas in mir hinunterrieselt. Mein Gewicht sammelt sich in den Füßen. Nichts deutete auf eine schwere Erkrankung hin. Warum hatte es Iris so eilig gehabt, mich an diesen Ort zu bringen?
„Ihre Leukozyten sind erhöht. 80.000, normal sind etwa 10.000. Außerdem gibt es noch andere Hinweise. Wir brauchen eine Entnahme des Knochenmarks, um mehr zu wissen.“
„Leukämie?“, zittert Klaudias Stimme. Der Arzt reagiert kaum. Er kennt die Situation.
„Wir müssen noch abwarten.“
Dann erklärt er uns, wie kompliziert diese nahezu unwahrscheinliche Krankheit ist. Es gibt eine chronische Form, die mit Tabletten behandelbar ist. Wenn sie nicht in eine akute Form umschlägt. Die wiederum ist sogar heilbar. Zumindest manchmal. Es fallen viele medizinische Begriffe, die uns nicht beruhigen. Als er fertig ist, versuche ich das vorläufige Ergebnis zusammenzufassen, um nicht in Ohnmacht zu fallen.
„Es gibt also eine nahezu gute Leukämie, die lebenslang behandelt werden muss und ungefähr drei ziemlich böse, die geheilt werden können. Manchmal.“ Das Wort ‚selten‘ vermeide ich.
Der Arzt nickt. Allerdings kann jede ‚gute‘ in eine akute Leukämie kippen, ergänzt er. Dann müsse man schnell handeln.
Ich spüre, wie bei Klaudia der Boden unter den Füßen wegklappt, wie bei zu Tode Verurteilten, die danach der Strick am Fallen hindert. Sie aber fällt und fällt. Ich werde tapfer sein. Ich halte ihre Hände, sie hält meine. Ich werde nicht fallen. Wir werden nicht fallen.
„Wie wahrscheinlich ist eine chronische Leukämie?“
„Derzeit sehr wahrscheinlich, aber das ist keine sichere Aussage. Wir müssen die Analyse abwarten. Dazu brauchen wir das Knochenmark.“
Er blättert in seinem digitalen Kalender. Der ist dicht besiedelt mit unterschiedlichen Farbmarkierungen, als hätte Mondrian dort seine kleinen Rechtecke gemalt. Doktor M. findet eine freie Stelle.
„Mittwoch, 11 Uhr 30?“
„Ja. Und wie lange dauert es für den Befund?“
„Montag, Dienstag danach.“
„Geht es früher?“ Meine ALF bleibt trotz ihrer Panik am Ball. Ich bewundere ihre Schnelligkeit und ihr Auffassungsvermögen. Während ich noch ‚Ja‘ sage oder ‚Nein‘ oder gar nichts, ist sie gedanklich schon unterwegs, macht Pläne, um etwas zu erledigen oder in eine Handlung einzugreifen.
*
Ich erinnere mich an eine Szene in einer Schulklasse. Wir unterrichteten eine Zeitlang in derselben Schule – was ich übrigens nicht empfehlen kann – und hatten sogar je eine Gruppe der gleichen Klasse. Bei der Projektvorstellung – die Jugendlichen produzierten Radiosendungen – waren beide Gruppen beisammen. Meine Gruppe tat sich durch große Lautstärke und wenig Konzentration hervor, was mir ein bisschen auf die Nerven ging. Während ich noch überlegte, wie ich pädagogisch sinnvoll und möglichst demokratisch für Ordnung sorgen könnte, erhob Klaudia ihre Stimme ein wenig und sagte:
„Ich vertrage Lärm ganz schlecht. Könnt ihr bitte etwas leiser sein?“
Zu meinem Erstaunen sahen ‚meine‘ Schülerinnen, deren aufgeregtes Lärmen zu meinem Unterricht gehörte wie zu viel Chili in einen Eintopf, zwar verwundert zu Klaudia, schwiegen aber plötzlich. Bevor ich etwas hinzufügen konnte, rief Klaudia die erste Gruppe zur Präsentation auf.
Irgendwie, dachte ich, ist sie die bessere Lehrerin. Sie hatte diese seltsam natürliche Autorität, die ich nicht hatte und auch nicht erklären konnte. Mir war der Witz von der Autorität eingefallen. Was ist der Unterschied zwischen konsequenter Erziehung und nicht konsequenter? In der konsequenten Erziehung ist es heute so und morgen so. In der inkonsequenten heute so und morgen so.
Es kommt nur auf die Melodie des Satzes an.
*
Doktor M. sieht uns fast liebevoll an.
„Ich versuche es. Ich kann nichts versprechen.“ Er wird mich am nächsten Tag anrufen und den Termin vorverlegen. Jetzt aber erklärt er mir noch den Vorgang der Knochenmarkentnahme.
Er nimmt ein Blatt mit skizzierten Knochen und fährt mit einem Stift Linien entlang. Schritt für Schritt werden wir in die Geheimnisse der Knochenmarkentnahme eingeführt. Ein Loch am Rücken, dann wird eine Nadel Richtung Hüftknochen geschoben, ein Stück rausgeschnitten. Im Prinzip kein Problem, aber es könne immer etwas passieren, es gibt Nebenwirkungen, darüber müsse er aufklären. Und ich muss mein Einverständnis für den Eingriff mit Unterschrift bestätigen.
*
„Daran sind wir Juristen schuld“, wird Ruth später sagen. „Seit gegen alles Mögliche und Unmögliche, sogar gegen Noten in der Volksschule, geklagt wird, sichern sich alle ständig ab. Das ist der Tod jeglichen Zusammenlebens.“
Ich musste ihr beipflichten. Juristen tummelten sich auch an der Bildungsfront. Im zuständigen Ministerium, dem österreichischen Mysterium, wie Edwin es nennt, war die Juristerei nahezu Voraussetzung für pädagogische Tätigkeiten. Darum gab es im hiesigen Bildungsbereich auch keinen Fortschritt, denn sobald eine entscheidende Veränderung durchgeführt werden sollte, zeigte ein juristischer Sektionschef oder dessen Stellvertreter auf und zitierte Gesetze und Verordnungen, von deren Existenz niemand etwas ahnte, um das zu tun, was die Aufgabe jeder Bürokratie ist: verhindern.
Bis man sich auf einen gesetzlichen Kompromiss geeinigt hatte, vergingen Jahre und Jahrzehnte, sodass niemand mehr wusste, worum es ursprünglich gegangen war. Um den Anschein von Aktivität zu erwecken, erließen Ministerinnen und Minister immer wieder Verordnungen, die keines Gesetzes bedurften. Unzählige dieser verbindlichen Empfehlungen kamen im Wochenrhythmus in den Schulen an, wurden in Ordnern abgelegt und sorgten bei den wenigen, die sie gelesen hatten, für Kopfchaos.
*
Die möglichen gesetzlichen Nebenwirkungen von kreativem Unterricht, der womöglich gegen irgendeine lächerliche Verordnung verstieß, waren mir als Lehrer egal gewesen. Was sollte ich jetzt mit den Nebenwirkungen einer notwendigen medizinischen Untersuchung anfangen?
Entweder lasse ich sie machen.
Oder.
Oder was?
Aufstehen und nach Hause gehen? Glauben, dass alles ein Irrtum ist? Etwa ein nicht verarbeiteter Konflikt, wie jener Arzt behaupten würde, der eine Neue Germanische Medizin gegründet und Menschen in den Tod getrieben hatte?
Ich nicke und unterschreibe.
„Wie halten Sie das aus, ständig Menschen solche Nachrichten zu übermitteln?“, frage ich den Arzt nebenbei.
Er lächelt.
„Weil die Aussichten für eine Heilung in unserem Bereich vorhanden sind. Die Onkologen haben es da schwerer. Selbst wenn auch dort die Überlebensdauer immer länger wird.“
Es ist also nicht zu Ende?
Es gibt eine Zeit zu leben?
Zumindest die Möglichkeit?
Wir vergewissern uns nochmals, ob wir richtig gehört haben.
„Ja. Leukämie ist kein Todesurteil. Wir haben gute Therapien. Aber ich kann Ihnen nichts versprechen.“
Immerhin, eine gute Nachricht zum Schluss. Wir verabschieden uns und gehen hinaus. Die Wände stehen, die Menschen grüßen, wir halten uns aneinander fest. Wir haben eine Stunde mit dem Arzt gesprochen. Seine Sätze waren klar und verständlich. Nun sind wir auf uns gestellt.
Die Diagnose ist die Krankheit, hat eine Krebspatientin gesagt. Sie ist der lucky punch, der dich ohnmächtig werden lässt, nur ohne Sternchen vor den Augen.
Wir wissen nicht, was wir reden sollen. Schweigen ist manchmal nicht Gold, sondern Trauer. Klaudia fingert an ihrem Taschentuch herum, nur jetzt nicht weinen. Nicht zusammenbrechen wie in schlechten Filmen, in denen Schauspieler Entsetzen mimen, einander um den Hals fallen oder zu weinen beginnen.
Es ist alles ganz anders.
Die große Zufriedenheit
Die nächsten Tage vergehen, ohne dass wir sie wahrnehmen. Wir klammern uns an die angenehmer klingenden Diagnoseteile. Chronische Leukämie etwa klingt recht harmlos. Chronisch krank ist man lange Zeit, vermutlich auch mit Leukämie. Wir setzen unsere Hoffnung auf sie. Rot oder schwarz? Rien ne va plus? Oder geht noch etwas?
Von Untersuchung zu Untersuchung verdüstert sich die Aussicht. Nach einer Woche lautet die endgültige Diagnose AML, Akute Myeloische Leukämie. Im Knochenmark befinden sich Blasten, jene Zellen, die sich nicht zu freundlichen Leukozyten entwickeln, sondern alle Abwehr zunichtemachen. Die Lebenschancen, die Überlebenschancen werden geringer.
Klaudia bekommt Panik, ich kann ihr nicht helfen. Ich starre auf die Hortensien und weiß nicht, ob ich sie wieder blühen sehen werde. Klaudia organisiert einen Termin beim Psychiater. Sie zittert. Weint im Wartezimmer, bei der Assistentin. So kenne ich sie nicht. Nur beim Streit mit ihrer Mutter begann sie manchmal vor Wut zu weinen. Diesmal ist es Trauer. Verzweiflung.
Der Arzt ist ruhig und freundlich. Er erkundigt sich, ob sie diese Attacken kennt. Ja. Wann sie auftreten. Wenn der Tod nahe ist. Später wird eine Therapeutin feststellen, dass sie den Tod ihrer Schwester, die jahrelang an Multipler Sklerose litt, wohl nicht verarbeitet hat. Der Arzt verschreibt ihr Medikamente.
„Wir versuchen es erstmal konventionell, damit Sie diesen Zustand überwinden. Keine Angst, Sie werden davon nicht abhängig.“
Er versteht Klaudias Blick ohne nachzufragen.
„Es hat keinen Sinn, in dieser Starre zu verharren. Sie stecken in einer schwierigen Phase fest. Wir müssen sie daraus befreien. Dann sehen wir weiter.“
Die Tabletten wirken. Klaudia wird ruhiger, abends schläft sie müde neben mir ein, ein kleines Häufchen Elend. Ich denke beim Einschlafen über mein Leben nach. Was ich gemacht habe. Was mir fehlt. Welche Wünsche ich noch habe.
*
Am Anfang stand die Rettung der Welt. Das bekannte Jesus-Syndrom. Ich bewunderte den Mann, der die Händler und Geldwechsler, also die Spekulanten, aus ihren Geschäftshäusern, den Tempeln, den heutigen Kirchen, vertrieb, die Menschen liebte, gleichgültig, wer sie waren. Nur die Reichen kamen nicht in sein Himmelreich, eher gelangt bekanntlich ein Kamel durchs Nadelöhr.
Und was hatten seine Nachfolger aus seiner Lehre gemacht? Inquisition, Hexenverfolgungen, Raubzüge, Bereicherung, Machtspiele im Namen des Herrn. Die Rettung musste anders ablaufen. Mit ihr begann ich während des Studiums.
Bildung ist die Basis für Bewusstsein und Vernunft, glaubte ich. Hier musste angesetzt werden, in Kindergärten und Schulen sollte eigenständiges Arbeiten und Denken gefördert und gefordert werden. Die Regierenden hatten andere Pläne. Es dauerte Jahrzehnte, bis ich meinen Irrtum akzeptierte. Oder war es Einsicht? Resignation? Noch immer glimmt Wut in mir auf, wenn ich das Bildungssystem meiner Heimat beobachte.
Damals schrieb ich pädagogische Texte, beteiligte mich in einer engagierten Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, bei der ich meine geistige Heimat fand. Wir strotzten vor Optimismus, eine bessere, soziale, friedliche Welt war möglich. Die SPÖ mit Kreisky ließ ein Parteiprogramm erstellen, darunter – heute unvorstellbar – eines zum Thema Bildung.
Vier Mal im Jahr produzierten wir im Eigenverlag ein Taschenbuch für Pädagogik. Alles wird gut. Die Vernunft wird siegen. Wir werden Generationen mündiger Menschen hervorbringen.
Als ‚Junglehrer‘ wurde ich im Konferenzzimmer mit einer anderen Wirklichkeit konfrontiert. Sie glich der Karikatur von Lehrer Lämpel und Co. Ich habe das Bild meiner ersten Konferenz noch vor Augen. Während die Direktorin Verordnungen referierte, strickten die Damen zierliche Pullover für ihre Kinder und Enkel. Die wenigen Herren lasen in Zeitungen und Büchern. Hustenbonbons wurden herumgereicht, Nebengespräche immer lauter, bis die Frau Direktor mit dem Schlüsselbund auf den Tisch klopfte und die Stimmen für Minuten sich senkten. Danach stieg der Pegel allmählich wieder an, so wie die Flut die Ebbe vertreibt und immer mehr Wellen ans Ufer bringt. Bevor sie das Ufer überschwemmen konnten, erklang wieder das Scheppern der Schlüssel. Augenblicklich wurde es still. Das Spiel wiederholte sich, bis die Konferenz zu Ende war.
An eine der vielen Richtlinien erinnere ich mich noch heute, es ging um das richtige Durchstreichen von leeren Seiten im Klassenbuch. Die Landesschulinspektorin, in der Rangordnung eine Stufe über der Schulleiterin stehend und einiges mehr verdienend, hatte sich dieser Problematik angenommen. Keinesfalls durfte eine leere Seite von links oben nach rechts unten durchgestrichen werden, sondern immer von links unten nach rechts oben! Es kann auch umgekehrt gewesen sein.
Ich ging deprimiert nach Hause.
Das also geschah an einem ganz konkreten Ort der Bildung, während wir an der Universität über gerechte Bildungschancen und Sozialismus diskutierten. Es gab damals übrigens eine große Vielfalt an Sozialismen. Da waren die glühenden Maoisten, die sich an ihrer roten Bibel festhielten wie die Katholiken an ihrer, die Karrieristen, die in sozialdemokratischen Zirkeln ihren Weg nach oben vorbereiteten und gewitzte Schnösel, die von klein auf ihre Tage in diversen katholischen Cartellverbänden verbrachten. Dazwischen immer wieder Engagierte, die irgendwann das gleiche Schicksal ansteuerten: Raus aus der Politik.
Mitte 30 verlor ich die Rettung der Welt allmählich aus den Augen. Ich war Vater einer Tochter geworden. Ihre Geburt war wohl der glücklichste Moment meines Lebens. Ich meine Glück im Sinne eines Augenblicks. Glück hält ja nicht lange an, es kann allerdings in Glückseligkeit oder Zufriedenheit enden. Dieses Gefühl ist selten, weil es Geduld erfordert.
Zwei Jahre nach Ninas Geburt war ich Alleinerzieher und weder glücklich noch glückselig. Oder doch? Jedenfalls hatte ich keine Zeit mehr, über die Rettung der Welt nachzudenken. Irgendwie ganz angenehm.
Meine Karriere als Schriftsteller verlief auch nicht so, wie ich dachte. Meinen Freund und Kollegen Günther wunderte das nicht. Er warf mir mangelnde Konsequenz vor.
„So kommst du nie weiter. Bei mir kommt ganz oben die Kunst, dann die Kunst, dann lange nichts und dann kommt meine Familie.“
Er hatte in seinem Weltbild recht. Wer Erfolg haben will, darf keine Rücksicht nehmen auf Gefühlsduseleien wie Liebe, Elternschaft oder Freundschaft. Er muss Prioritäten setzen. Ich fand seine Reihenfolge allerdings unmenschlich. Wie konnte Arbeit oder Kunst wichtiger sein als Menschen? Diesem Programm wollte ich nicht folgen. Ich wollte auch nicht jährliche Feste für Journalisten, Mäzene und andere Investoren des Kunstbetriebs veranstalten, wie er es zähneknirschend tat.





























