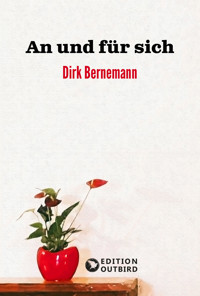Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unsichtbar Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ich hab die Unschuld kotzen sehen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Krieg von früher mit den Waffen von heute gegen die Feinde von immer. Der Versuch, in all dem Schrecken Hoffnung zu finden, gleicht zuweilen dem Bestreben, im Auge des Taifuns ein Schaf zu streicheln, um es zu beruhigen. Es gibt keine Ruhe, es gibt keine Sicherheit, nach diesem Buch erst recht nicht. Teil 4 der Bestsellerreihe, wieder anders, wieder neu und doch gleich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage 2017
©opyright 2017 by Autor
Lektorat: Miriam Spies
Coverbild: Liú Quara
Satz: Fred Uhde (www.buch-satz-illustration.de)
ISBN: 978-3-957910-69-1eISBN: 978-3-957910-70-7
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.
Hat Dir das Buch gefallen? Schreib uns Deine Meinung unter: [email protected]
Mehr Infos jederzeit im Web unter www.unsichtbar-verlag.de
Unsichtbar Verlag | Diestelstr. 1 | 86420 Diedorf
Dirk Bernemann
Ich hab die Unschuldkotzen sehen 4
Inhalt
Geburt
Die Kastanie
Der unauffällig Fallende
Neu, teuer und respektlos
Und endlich fängst du an zu weinen
Silvester
Revolution und Obst
Die religiöse Verpeilung des wundersamen Knaben
Schmutts Augen
Das Pferd
Apokalypse ist was du draus machst
Tod
Geburt
Jede Geburt ist eine Krise. Meine Mutter meinte während meiner Kindheit zu mir, ich wäre die perfekteste Niederkunft gewesen. Schmerzfrei und schnell. Fast hygienisch wie ein Stück Arztseife, das durch die Handinnenflächen eines Chirurgen gleitet. Es gibt Menschen, die sind innen so schön, dass man, schriebe man über sie, als Autor nicht glaubwürdig wäre. Und es gibt mich.
Der Grund meiner Existenz ist das Vergehen meiner Eltern, über das ich nie mit ihnen gesprochen habe, aber ich mutmaße Folgendes: Zwei junge, triebhafte Menschen verschiedenen Geschlechts mit dem Plan einer gemeinsamen Zukunft und bereits einem gemeinsamen genetischen männlichen Ableger in einem Kinderzimmer, trafen sich in absoluter, katholischer Dunkelheit in einem Eicherustikalschlafzimmer. Sie hat sich auf den Rücken gelegt, er hat sich gefühlt wie ein Zuchtbulle und 15 Sekunden später war dieser Typ, der mal ich werden sollte auf dem Weg vom Hodeninneren meines Vaters in das zu befruchtende Eiland meiner Mutter. Etwas später war Dezember, es war kalt und windig und ich sah aus wie alle organischen Blutpfützen, die durch die vaginale Ausgangstür ins Leben gerissen werden. Frohe Weihnachten, liebe Eltern, dachte ich kurze Zeit später, ohne zu wissen, was Weihnachten ist.
Überall waren Luftballons. Auf Kinderfotos sieht man, wie ich als ziemlich hilfloser fleischgewordener Stolperstein durch einen Raum krieche, in dem sich mindestens 200 aufgeblasene Luftballons befinden. Meine stolzen Eltern hatten einen Fotoapparat, so hieß das damals, als es noch nicht Kamera hieß. Es war 1975, alle Fotos von damals weisen so einen Orangestich auf, der bei heutigem Betrachten eine seltsame Flauheit in meinem Magen auslöst. Aber meine Mutter und mein Vater schienen diese Szenerie, in der ich mich durch einen Ozean von bunten Ballons wühle, scheinbar dergestalt interessant zu finden, dass sie diesem Ereignis mindestens 15 Bilder widmeten. Sie ließen mich krabbeln, also krabbelte ich. Ich sollte also ein ernstzunehmender Mensch werden.
Irgendwo war immer Liebe, irgendwo war immer Langeweile. Es gab keine Handys, es gab einen ersten Kuss auf den Stufen vor einem Haus mit einem Mädchen, das nach Pfirsichen roch und auch ein bisschen so aussah, es gab Zustimmung, Abgrenzung und Krawall. Meine Eltern waren Haushalt, korrektive Schläge und Baustelle, irgendwie traditionell alles, wenig Spaß im Alltag, außer Playmobil. Man weiß nicht mehr genau warum, aber ab irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben bin ich traurig geworden.
Ich war zwölf und plötzlich war Dagmar tot. Ich weiß noch, wie morgens die Lehrerin in die Klasse kam, es war November, die Jahreszeit der Schals, Mützen und Handschuhe hatte gerade begonnen. Irgendwas im Blick von Frau Hagen war anders als sonst. Sie schien geweint zu haben. Etwas blockierte ihren sonstigen Schwung. Stellte ihre Tasche nicht wie gewohnt neben den Stuhl, sondern auf das Pult. Ließ ihren langen, beigen Mantel an, so als wolle sie nur kurz bleiben, um dann schnell wieder zu verschwinden. Wie eine Zugreisende an einem Bahnsteig, dachte ich damals. Jemand auf der Durchreise.
Sie begrüßte uns, wir begrüßten sie. Es gab dieses Ritual, bei dem alle Schüler aufstehen mussten, um mit einer Stimme den eingetretenen Lehrkörper zu begrüßen. Es waren die 80er Jahre, man hatte noch Angst vor Disziplinlosigkeiten aller Art. Drei Plätze waren leer. Erkältungswetter. Frau Hagen begann zu reden und in ihre Worte mischten sich Tränen. Dagmar, sagte sie, sei tot. Lange Pause. Langes, zitterndes Schluchzen. Ansonsten Stille. Ein paar Mitschüler kramten in ihren Sachen. Unbeholfen. Dann kam der nächste Schlag. Kerstin fragte mit zitternder Stimme, was genau passiert sei und anstatt mit den Schultern zu zucken, sagte Frau Hagen in einer Kälte, die ich ihrer Stimme nicht zugetraut hatte: »Selbstmord.«
Da hing nun also dieses Wort in unserem Klassenraum. Schwebte zwischen Vokabelheften und Atlanten, tänzelte verwegen zwischen Mathebüchern und Kinderzeichnungen an den Wänden, kletterte in vereinzelte, hilflose Kinderhirne, um dort melancholische Vorstellungen anzurichten, die niemand hier wirklich verbildlichen konnte. Blicke huschten über Dagmars leeren Stuhl und über Martha, ihre daneben sitzende Freundin, die zu einem Klumpen Unaussprechlichkeit eingefroren war und erst nach ungefähr fünf Minuten ein Weinen entäußern konnte. Die meisten Jungs kramten weiter unruhig mit Stiften oder Heften, während sich die meisten Mädchen hilflos schreiend und laut weinend umarmten.
Ich spürte in mich rein, wie eben ein Zwölfjähriger in sich reinspüren kann. Begrenzt emotionsfähig. Da war ein Regal in mir, darauf standen ein paar Erinnerungen, geordnet wie aneinandergereihte Bücher. Daneben stand eine Vitrine mit emotionalen Kostbarkeiten, die ich mir aus dem Fernseher geholt hatte. Tod durch Selbstmord war irgendwie immer Inszenierung, war immer Theater. War irgendwas, was irgendwie gut aussah und doch zu einem traurigen Ergebnis zu führen schien. Tristtassigkeit und Trübtess. Ich schaute aus dem Fenster. Wolken. Dagmar. Dagmar in den Wolken? Es war die Zeit, in der ich Gott viele Fragen stellte, keine Antworten bekam und dann ihn infrage stellte. Nicht mal darauf ließ er von sich hören, der arrogante Sack. Aber Blitze vom Himmel schicken, die Angst machen, oder Kindern eine Welt errichten, in der sie nicht leben wollen.
Am übernächsten Tag erfuhren wir dann von Martha Details. Dagmar war aus dem Fenster gesprungen. 3. Stock. Ihre Todessehnsucht: unerklärlich. Es gab auch einen Abschiedsbrief, in dem sie versucht hat, irgendwie zu erklären, was Sache ist. Unpassend in der Welt hätte sie sich gefühlt, so schrieb sie. Schon länger wäre es Dagmar so gegangen, dass sie sich die Frage gestellt habe, warum sie eigentlich lebe und nicht das verhungerte Kind in Äthiopien oder das geschlachtete Schwein im Schlachthof. Was gerade genau sie ausgezeichnet hätte, weiterzuleben, fragte Dagmars Brief. Gerade noch von der rhythmischen Sportgymnastik zurück und 20 Minuten später zerscheppert auf dem Parkplatz. Neben dem Passat ihres Vaters. Muss schlimm ausgesehen haben, meinte Martha. Ich versuchte mir das vorzustellen. Also den Willen zu haben, aus dem 3. Stock zu springen mit dem vollen Bewusstsein, unten nur noch ein lebloser Körper zu sein, den jemand Schreiendes auffindet. Vielleicht kotzen. Ja, kotzen war bestimmt auch dabei. »In sechs Tagen ist die Beerdigung«, flüsterte Martha.
Die ganze Klasse ging hin. Trüb hing Nebel rum. Dagmars Eltern sahen aus wie Dagmars Großeltern und Dagmars Großeltern sahen aus, als hätten sie den Krieg nicht überlebt. Alle hinkten irgendwie. Jeder sollte eine Blume und ein Schäufelchen mit Mutterboden in das Loch werfen, in das man Dagmars Sarg gegeben hatte. Ich stand da, warf eine Blume, warf etwas Erde und versuchte was zu fühlen. Aber es stellte sich keine Trauer, sondern eine große Erleichterung ein, wegen der ich mich etwas schämte, aber die unaufhaltsam wie der Inhalt einer umgekippten Tasse warmen Kakaos über das Bild der Trauer um Dagmar floss. Scheinbar hatte sie nur getan, was zu tun war.
Dagmars Todestag wurde für mich so etwas wie ein Feiertag für das Leben. Ein Statement für selbstgewählte Entscheidungen. Mein Leben wurde nicht mehr richtig gut. Verglichen mit anderen Leben, die neben meinem emporschossen und manchmal am Himmel explodierten wie chinesische Feuerwerkskörper, fand meine Existenz eher am Boden statt. Die einfachen Verhältnisse, aus denen ich gekommen war, die blieben einfach bei mir. Aus allen Schwierigkeiten konnte ich mich nicht entwinden, manche klebten an mir wie Dagmars Todesnachricht. Trotzdem war ich manchmal glücklich. Mein Leben driftete aber im Allgemeinen in eine Belanglosigkeit ab, gegen die ich keine Macht hatte. Sie war einfach da und staubte alles zu und irgendwann, nach ein paar Versuchen, jemand Besonderes zu sein, ließ ich einfach alles zustauben. Ich glaube Dagmars Tod ist neben meiner Geburt das Durchdringendste, was mir jemals passiert ist.
Warum finden eigentlich alle dieses Geborenwerden so normal? Das ist doch eines der brutalsten Geschehnisse, das überhaupt ein Menschenleben treffen kann. Sowohl als Gebärende, als auch als zu Gebärender. Warum tut keiner was dagegen? Es ist falsch, dass das Produkt der Liebe ein kleiner, hilfloser Klumpen Fleisch ist, der zappelnd und unfunktionell in die Welt gegeben wird. Für den man dann, woher auch immer dieser Auftrag kommt, plötzlich Verantwortung hat und für dessen unkoordiniertes Herumzappeln man sogar haftbar gemacht wird. Und ich glaube, das Allerschlimmste daran ist, dass man jemanden, den man gar nicht kennt, der nur aus der eigenen Arroganz heraus, seine Genetik in die Welt zu spülen entstanden ist, dass man diesen jemanden zwingt, zu leben. Auch bei Nichtwollen und Nichtkönnen. Da ist dieses Geschöpf und man ballert es mit Liebe, Bildung, Schulchinesisch, rhythmischer Sportgymnastik und Kinderyoga zu, nur um noch jemanden zu haben, den man mit seiner Unerschöpflichkeit und kraft seines universellen Einkommens an die Wand lieben kann. Nur damit da was ist und man nicht in ein leeres Kinderzimmer geht, das genauso gut ein schönes Bücherzimmer sein könnte. Mit einer freundlich grunzenden Kaffeemaschine und einem Ohrensessel, der immer gut zuhört, aber nie dazwischenredet, damit man auch mal einen Gedanken ganz zu Ende denken kann.
Jeder Mensch erkennt im Verlauf seiner Biografie mal früher, mal etwas später, seine eigenen Grenzen und das ist ebenso brutal wie das Mitansehenmüssen brennender Ferkelwelpen nach einem LKW-Unfall auf der A2 kurz vor Hannover. Man quiekt wie verrückt, weil einem sonst nichts mehr bleibt, aber das ist sinnlos. Man wird verrecken und wenn man einmal registriert hat, dass man nur ein Zahnrad in der Maschinerie der Kurzangebundenheit des Lebens darstellt, was soll einen dann noch retten. Das Leben macht nur Smalltalk und nicht jeder von uns kann ein Gesprächsthema sein. Manche von uns fallen einfach bei der Arbeit oder auf dem Schlachtfeld oder beim Versuch sich oder andere zu ernähren und am Leben zu halten um. Und dann liegt man da und versucht zu verstehen, was eigentlich in den paar Stunden zwischen Geburt und Tod passiert ist. Resümieren und krepieren, nichts Anderes ist scheinbar dieses Ganze mit scheinbarer Wichtigkeit aufgeladene Leben, ist scheinbar alles, was jetzt noch passieren wird. Egal, was kommt, immer unterwegs Richtung Schlachthof. Wir sind alle quiekende, brennende Ferkelwelpen, die orientierungslos über Autobahnen laufen.