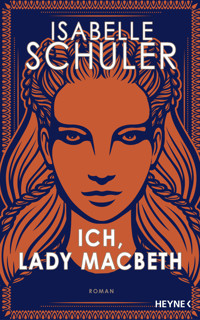
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Lady Macbeth, wie niemand sie kennt: ein erfrischendes, feministisches Debüt
Schottland, 11. Jahrhundert: Mächtige Männer kämpfen um den Thron. Daher wagt das Mädchen Gruoch kaum zu hoffen, was ihre Großmutter, eine Druidin, prophezeit: Als spätere Königin wird Gruoch die christliche Welt ihres Vaters und das heidnische Erbe ihrer Mutter miteinander versöhnen – und selbst zur Legende werden. Jahre später verlässt sie ihre Heimat und ihren Jugendfreund Macbeth, um sich mit dem auserwählten Thronfolger, Duncan, zu verloben. Doch am königlichen Sitz in Scone wird ihr Traum schnell zum Albtraum. Sie tut, was sie tun muss, um zu überleben. Denn eines Tages soll sich ihr Schicksal erfüllen. Nur mit der Liebe hat sie nicht gerechnet.
»Spannend, atmosphärisch und voll unerwarteter Wendungen.« Jennifer Saint
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DASBUCH:
Schottland, 11. Jahrhundert: Mächtige Männer kämpfen um den Thron. Daher wagt das Mädchen Gruoch kaum zu hoffen, was ihre Großmutter, eine Druidin, prophezeit: Als spätere Königin wird Gruoch die christliche Welt ihres Vaters und das heidnische Erbe ihrer Mutter miteinander versöhnen – und selbst zur Legende werden. Jahre später verlässt sie ihre Heimat und ihren Jugendfreund Macbeth, um sich mit dem auserwählten Thronfolger, Duncan, zu verloben. Doch am königlichen Sitz in Scone wird ihr Traum schnell zum Albtraum. Sie tut, was sie tun muss, um zu überleben. Denn eines Tages soll sich ihr Schicksal erfüllen. Nur mit der Liebe hat sie nicht gerechnet.
»Spannend, atmosphärisch und voll unerwarteter Wendungen.« Jennifer Saint
DIEAUTORIN:
Isabelle Schuler ist eine schweizerisch-hawaiianisch-amerikanische Autorin, Schauspielerin und ehemalige Buchhändlerin. Sie hat einen Bachelor in Journalismus und schreibt preisgekrönte Drehbücher für Film und Theater. »Ich, Lady Macbeth« ist ihr Debüt. Isabelle Schuler lebt in Hertfordshire, England.
ISABELLE SCHULER
ICH, LADY MACBETH
ROMAN
Aus dem Englischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel LADYMACBETHAD bei Raven Books/Bloomsbury Publishing, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 Isabelle Schuler
by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarker Str. 28, 81673 München
Redaktion: Friederike Arnold
Herstellung: Mariam En Nazer
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
unter Verwendung von Shutterstock.com
(Vectorpocket, Zvereva Yana, Dalhazz)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-30286-3V001
www.heyne.de
Kapitel 1
Picti bedeutet die Bemalten, hat mir meine Großmutter einmal gesagt. Meine Vorfahren, die Pikten, bemalten ihre Haut in Blau-, Rot- und Grüntönen. Nur wenn sie verwundet wurden verriet ihr Blut, dass sie Menschen waren.
Meine Großmutter konnte sich an all das erinnern, sie gehörte zu dieser aussterbenden Art – eine Tochter von Druiden, die einst im Königreich der Pikten Königen und Prinzen gedient hatten, bevor das Königreich Schottland entstand und diese alte Kultur verdrängt wurde. Der Untergang ihrer Kultur war sehr schmerzlich für sie. Besonders, als sie und meine Mutter Ailith nach Scone an den Hof meines Vaters, des großen Prinzen Boedhe, gebracht wurden. Als junges Mädchen hatte Ailith den Hof meines Großvaters König Coinneach besucht und war seinem Sohn versprochen worden. Zwar war Coinneach ein Anhänger der neuen Religion, doch er versuchte jene Schotten zusammenzubringen, die sich nicht dem Christengott zugewandt hatten; es war ein Akt großen Wohlwollens, eine Heidin neben seinem Sohn auf den Thron zu setzen.
Malcolm, der Vetter meines Großvaters, bereitete diesen Hoffnungen ein Ende, als er König Coinneach ermordete und ihm die Krone raubte. Viele hielten meinem Großvater jedoch auch noch nach seinem Tod die Treue, und so machte König Malcolm meinen Vater zum Earl von Fife, um diejenigen zu beschwichtigen, die sich vielleicht andernfalls mit ihm zusammen gegen den neuen König erhoben hätten.
Mein Vater verabscheute König Malcolm, aber seine Angst, das wenige, was ihm geblieben war, zu verlieren, war noch größer. Und als im Namen der neuen Religion das Druidentum verboten wurde, zwang er Ailith, ihrem Glauben abzuschwören. Meine Großmutter dagegen ließ sich nicht so leicht zum Schweigen bringen.
Und so zerstörte mein Vater jedes Amulett und jeden rituellen Gegenstand, den sie mitgebracht hatte. Wenn er sie dabei erwischte, dass sie ein geweihtes Feuer angezündet hatte, trat er es wortlos aus. Jedes Mal, wenn sie irgendwo einen Vorrat an heiligen Kräutern anlegte, schickte er mit grimmiger Miene seine Leute los, um ihn zu vernichten, so schnell, dass meine Großmutter zu der Überzeugung gelangte, dass er sie beobachten ließ.
Erst als sie darauf bestand, mir einen piktischen Namen zu geben, machte Vater seiner Wut Luft. Später erzählte Großmutter mir die Geschichte gern mit der Inbrunst der Märtyrerin.
»Boedhe, sie muss Groa heißen! Sieh dir ihre Augen an! Es sind tiefe Quellen der Weisheit, genau wie die der großen Seherin selbst!«, beschwor sie ihn.
»Sie ist zwei Tage alt! Von welcher Weisheit sprichst du?«
»Sie heißt Groa«, erwiderte Großmutter, ohne auf seine Frage einzugehen.
»Es ist schon schlimm genug, dass König Malcolm argwöhnt, meine Frau sei eine Druidin«, fuhr Vater fort. »Ich werde nicht noch mehr Verdacht auf mich ziehen, indem ich meiner Tochter einen heidnischen Namen gebe.«
»Wenn du Pläne schmieden würdest, um dir die Krone zurückzuholen, anstatt dir ewig die Wunden zu lecken, bräuchtest du dich nicht auf solche Feigheit zu verlegen«, fauchte meine Mutter, womit sie seine Wut nur noch mehr anstachelte.
»Hör auf Ailith«, sagte meine Großmutter. »Gib ihr den Namen Groa zum Beweis, dass du niemandem untertan bist.«
»Genug!«, brüllte Vater. »Solches Gerede bringt uns den Tod! Der Krieg ist vorbei. Wir haben ihn verloren. Sie wird Gruoch heißen.« Das war sein letztes Wort.
Aber Großmutter nannte mich Groa.
Zur Strafe wurde sie auf eine Insel in einem See verbannt, der am äußersten Rand von Fife lag, und ihr wurde nur eine Handvoll Bedienstete zugestanden. Aber die Leute pilgerten zu ihr, baten sie um geheime Heilmittel gegen ihre Leiden und Segen für ihre Häuser, und so mangelte es ihr nie an Gesellschaft und gutem Essen.
Mutter und ich durften sie einmal im Jahr besuchen, wir nannten es unsere heidnische Pilgerfahrt. Ich liebte die Besuche bei meiner Großmutter und lauschte fasziniert ihren Geschichten von meinen piktischen Vorfahren. Gemeinsam mit den Einheimischen begingen wir das Mondfest Imbolc. Dabei brachte Großmutter meiner Mutter neue Zauberformeln bei, die sie flüsternd über dem Boden raunten, um die Kraft der Erde zu beschwören, die uns schützen und uns Glück bringen sollte. Am besten war immer der letzte Abend bei Großmutter, wenn sie den wunderschönen Wandbehang ausbreitete, den sie im Lauf des vergangenen Jahres gewebt hatte. Ihre Wände waren bedeckt mit diesen Bildteppichen, von denen jeder eine ruhmreiche Geschichte aus den Zeiten der Druiden und Pikten-Götter erzählte.
Ich saß zwischen Mutter und Großmutter und aß weiches, in Butter getränktes Rosmarinbrot, und im Kamin knisterte ein Feuer. Auf unseren Knien wurde der Teppich ausgebreitet, und wenn meine Mutter sich darüberbeugte, um das Bild zu betrachten, hätte ich ihr am liebsten mit beiden Händen in ihre lange rotbraune Mähne gegriffen, während ihre Finger über das kunstvolle Gewebe fuhren und ihre goldenen Armreifen, die im Feuerschein glitzerten, mich verzauberten.
Großmutters tiefe Stimme erfüllte den Raum, wenn sie Geschichten erzählte von gewonnenen Schlachten und dem Streben nach Liebe und Wahrheit. Die gewebten Bilder schimmerten vor meinen Augen, und wenn sie das uralte Lied vom Abschied anstimmte, spürte ich die Energie unserer Vorfahren in meiner Brust.
Cuin a choinnicheas sinn a-rithist?
Ann an dealanach tàirneanaich no uisge?
Nuair a tha am mi-òrdugh air tighinn agus air falbh
Nuair a thèid am blàr air chall agus bhuannaich.
Auch wenn ich die Bedeutung der Wörter nicht verstand, erfüllten sie mich mit Wärme und Magie und dem Gefühl von Freiheit. Diese eine Woche bei meiner Großmutter gab mir Kraft für ein weiteres Jahr im Schatten von König Malcolm, der über Fife und über meinem Vater lag.
Für meinen Vater war es schwer, so weit weg von Scone und dem Thron zu leben, der eigentlich ihm zustand, aber mir gefiel Fife von Jahr zu Jahr besser. Unsere Burg, die zwischen einem tiefen Tal und dem Meer stand, war ein Bau aus Holz und Stein. Es gab Stallungen und Wohnquartiere, die meistens unbewohnt waren. Als Earl stand Vater zwar direkt unter dem König, aber er durfte nur wenige Soldaten beschäftigen, die ausschließlich seinem persönlichen Schutz dienten und dem Bischof von St. Andrews unterstanden, einem Mann von König Malcolms Gnaden. Die Wohnquartiere dienten der Unterbringung von Gästen. Zu unserem Schutz war die Burg von Palisaden umgeben, die aber nur von einem einzigen Wachmann patrouilliert wurden.
Ich hatte nicht viel von der Welt gesehen, und in meiner Naivität hielt ich unsere Burg mit der Großen Halle für das prächtigste Gebäude, das je errichtet worden war. Meine Mutter und ich verwandten viel Mühe darauf, die Glücksbringer, die Großmutter uns mitgab, nicht nur überall im Haus, sondern auch in der Siedlung zu verstecken. Unser Land und unsere Leute mithilfe der alten Riten zu schützen, gab mir das Gefühl, eine wichtige Rolle zu spielen.
All das änderte sich an einem Sommernachmittag, als ich fünf Jahre alt war.
Ich hatte meine Mutter überredet, mit mir Selkies zu spielen; wir waren während der wärmsten Stunden des Tages in den Wellen herumgesprungen und hatten so getan, als wären wir Selkies, mythische Frauen, die sich in Robben verwandeln und sowohl an Land als auch im Wasser leben konnten. Das kalte Wasser raubte uns fast den Atem, aber wenn wir uns in den Sand sinken ließen, wurden wir schnell von der Sonne gewärmt.
Damit wir auch wie richtige Selkies aussahen, hatte meine Mutter die blaue und grüne Farbe aus dem Versteck in ihrer Kammer geholt und unsere Arme und Bäuche zu Ehren des Meeresgottes Lir mit verschlungenen Symbolen bemalt. Wir strahlten wie Fabelwesen, und meine Mutter sah aus wie eine richtige Meeresgöttin mit ihrer langen Mähne, den leuchtenden Augen und ihrer bunt bemalten Haut, die im Sonnenlicht glänzte.
Ich dachte, wir würden uns die Farbe abwaschen, bevor wir in die Halle zurückkehrten, aber meine Mutter war in verwegener Stimmung. Wir zogen unsere Kleider bis zur Taille herunter und marschierten stolz nach Hause. Vater kam uns entgegen, um uns zu begrüßen, sein goldener Halsreif, das Herrschaftszeichen eines Earls, glänzte in der Sonne. Es fühlte sich an wie eine Szene aus einer von Großmutters Geschichten – ein schottischer Prinz, der seine Frau, die Meeresgöttin, begrüßt.
Doch als er unsere stolze Haltung bemerkte, beschleunigte er seinen Gang. Meine Mutter breitete liebevoll die Arme aus, ihre nackten Brüste und ihre Hüften wiegten sich im Takt ihrer Schritte. Erst als wir näher kamen und seinen stählernen Blick gewahrten, zögerte sie.
Er trat auf uns zu und schlug sie so hart, wie ich noch nie einen Mann eine Frau hatte schlagen sehen.
Ich schrie auf, als sie zu Boden ging.
Unsere Männer schlugen ihre Frauen ständig. Die Thanes, die uns besuchen kamen, ebenso wie ihre Diener. Sogar die Küchenjungen schlugen ihre Schwestern und fluchten dabei wie ihre Väter. In dem Alter schlugen die Mädchen allerdings noch zurück.
Aber noch nie ich hatte erlebt, dass mein Vater meine Mutter schlug.
Er packte meine Mutter am Arm, als sie sich aufrappelte, und zog sie dicht an sich, um sie vor den Blicken der Wachmänner zu schützen, die am Tor zu unserer Halle standen. Ich klammerte mich an seinen Arm, doch er schüttelte mich mühelos ab.
»Was treibst du?«, zischte er meiner Mutter ins Ohr. »Möchtest du etwa, dass wir aus Schottland vertrieben werden? Möchtest du, dass wir das wenige, das uns geblieben ist, auch noch verlieren?«
Meine Mutter schaute ihn nur mit unergründlicher Miene an.
Als ich aufblickte, sah ich hoch über den Palisaden mehrere Gesichter in den Fenstern der Burg, die das Geschehen neugierig verfolgten. Schamvoll zog ich mir das Kleid über die Schultern, doch die schändliche Farbe schien durch das dünne Leinen zu quellen. Meine Wangen brannten, als wäre auch ich geschlagen worden. Ich wollte meiner Mutter helfen, aber sie fixierte meinen Vater mit einem derart furchterregenden Blick, dass ich mich nicht zu rühren wagte.
Ich rechnete damit, dass sie ihn anschreien würde, aber sie murmelte nur etwas vor sich hin in einer Sprache, die ich als die meiner Vorfahren erkannte. Die Wut meines Vaters verwandelte sich in Entsetzen, aber sein Griff wurde noch fester.
»Nimm deine Verwünschungen zurück, Frau, sie können mir nichts anhaben«, knurrte er. Es sollte bedrohlich klingen, doch seine Stimme zitterte. Meine Mutter hörte es auch.
Sie redete immer weiter in der alten Sprache, wurde mit jedem Wort lauter. Als ihre Stimme bis zu den Fenstern der Burg zu hören war, ließ er sie los. Erst da schwieg meine Mutter.
Ihre Gelassenheit beeindruckte mich. Auf der blassen Haut ihres Arms zeichneten sich rot Vaters Fingerabdrücke ab, aber als ich seinen Gesichtsausdruck sah, wusste ich, wer gewonnen hatte.
Meine Mutter ließ ihren Sieg in der Stille wirken, die Luft war so schwer und drückend, dass ich beinahe etwas gesagt hätte, nur um mich von ihrem Gewicht zu befreien. Schließlich zog meine Mutter sich ihr Kleid über die Schultern und ging, ohne sich noch einmal umzusehen. Vater wandte sich mir zu, und zu meiner Verblüffung sah ich Tränen in seinen Augen. Mein Vater war vor meiner Mutter in die Knie gegangen, und ich war überwältigt.
Vater schlug sie zwar nie wieder, aber als der Winter sich näherte, waren die Streitereien meiner Eltern überall im Haus zu hören. Als ich einmal an der Kammer meiner Mutter vorbeiging, hörte ich, wie sie sich wegen Großmutter stritten.
»Ich schicke dich aus gutem Grund zu ihr zurück«, schrie Vater.
»Du schickst mich zu ihr, weil du weißt, welche Macht wir haben«, entgegnete Mutter.
»Und wo ist die große Macht, von der du sprichst? Fünf Jahre sind vergangen, seit Gruoch geboren wurde. Ein stärkerer Mann würde seine Liebe begraben, zugeben, dass seine Frau verflucht und unfruchtbar ist, und sie verstoßen.«
»Vielleicht bist du ja derjenige, der verflucht ist, weil du die Religion unseres Volkes ablehnst.«
»Wo ist mein Stammhalter? Wo ist mein Sohn?«, brüllte Vater
Ehe Mutter darauf etwas erwidern konnte, stürmte er aus dem Zimmer. Ich stolperte aus dem Weg, doch er bemerkte mich vor lauter innerem Aufruhr gar nicht.
»Es gibt noch andere Möglichkeiten«, knurrte mein Vater auf dem Weg den Flur hinunter. Neugierig schlich ich durch die offene Tür in Mutters Kammer. Sie kniete auf dem Boden, nahm Amulette und Kräuter aus ihrer Truhe und warf sie ins Feuer. Tränen der Wut liefen ihr über die Wangen. Der Duft nach Lavendel erfüllte die Kammer, als die Kräuter verbrannten – ein beruhigender, friedvoller Duft, der in krassem Gegensatz zu ihren fieberhaften Bewegungen stand.
Ich sog scharf die Luft ein, als sie den Beutel mit Holunderblüten, den sie an einem Lederriemen um den Hals trug, abriss und ebenfalls ins Feuer warf.
Sie fuhr herum.
»Raus«, sagte sie.
Ich erstarrte, hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, sie zu umarmen und zu trösten, und dem Impuls, vor ihrer dumpfen, tonlosen Stimme zurückzuweichen.
Sie holte zum Schlag aus, und ich flüchtete aus der Kammer.
Als kurze Zeit später das Gerücht aufkam, ihr Mann habe sich eine Geliebte genommen, gab meine Mutter ihre alte Religion endgültig auf – seine Missachtung war schlimmer als seine Wut – und verwendete fortan alle Energie darauf, die treue und gehorsame Ehefrau zu spielen. Vater war erleichtert und konnte oder wollte nicht sehen, wie schwer es ihr fiel, ihre Pflicht zu erfüllen. Sie versprach ihm so lange einen Erben, bis er ihr glaubte.
Ob es an seinen Schuldgefühlen lag oder ob es echte Zuneigung war, jedenfalls änderte sich sein Verhalten ihr gegenüber. Er zeigte sich sanft und liebevoll, er kaufte ihr sogar neuen Schmuck, als ein Händler aus St. Andrews kam, um an seinem Hof sein Glück zu versuchen.
Ich sehnte mich nach meiner Großmutter und der Freiheit, die ich auf ihrer Insel genossen hatte. Ich fürchtete, dass meine Mutter unsere jährlichen Besuche dort aufgeben würde, aber als der Frühling sich ankündigte, begann sie mit den Reisevorbereitungen. Noch mehr überraschte mich, dass mein Vater seinen Segen dazu gab.
»Ich verspreche es«, sagte meine Mutter zu ihm, als er mich zu ihr auf das Pferd hob. »Diesmal verspreche ich es.«
Zum Abschied gab Vater ihr einen langen Kuss.
Nachdem wir eine gute Strecke geritten waren, versuchte ich mein Glück in der Hoffnung, dass meine Mutter im Verlauf der Reise wieder so entspannt und verspielt werden würde wie früher.
»Bringst du mir ein paar von den Zauberformeln bei, die Großmutter dich gelehrt hat?«, fragte ich vorsichtig.
»Nein«, erwiderte sie, und ihr Gesichtsausdruck verhärtete sich. »Deine Großmutter zieht ihre Macht aus dem Land, aber seine Göttlichkeit ist vergangen. Es gehört jetzt den Männern.«
»Jetzt gehört es Vater?«
»Ein Teil davon, aber nicht mehr so viel wie zu der Zeit, als wir geheiratet haben.« Sie verzog trotzig den Mund, und obwohl ihre Worte mich schmerzten, machte es mich froh zu sehen, dass ihr Widerspruchsgeist wieder zu erwachen schien.
»Wird es später einmal mir gehören?«
Sie schaute mich an. Der Soldat, der mit uns ritt, straffte die Schultern.
»Nein, es wird einmal meinem Sohn gehören.«
»Aber du hast doch gar keinen Sohn«, entgegnete ich gereizt.
»Aber ich werde einen haben«, sagte sie. »Ich werde deinem Vater viele Söhne schenken.« Gedankenverloren spielte sie mit den Zügeln.
»Und was ist mit mir?«, fragte ich. Immerhin war ich ihre Erstgeborene, da stand mir doch auch etwas zu, fand ich.
»Wir werden einen Earl für dich finden«, beruhigte mich meine Mutter. Sie konnte es nicht leiden, wenn ich aufbegehrte.
»So einen wie Vater?«
»Einen besseren. Einen, der mehr Charakter besitzt«, sagte sie nachdrücklich.
Ich dachte über ihre Worte nach.
»Und wenn der stirbt? Oder sich eine Geliebte nimmt? Gehört das Land dann immer noch mir?«
Meine Mutter seufzte und machte eine Handbewegung, als würde sie ein Insekt verscheuchen.
»Deswegen brauchst du männliche Erben. Um dir deine Position im Land zu sichern. Deine Macht liegt in den Männern, in deinem Ehegatten, in deinen Söhnen. Wenn du die Männer beherrschst, beherrschst du das Land. Wenn du sie nicht beherrschen kannst, taugst du zu nichts, dann ist es besser, du stirbst jung.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust und zog die Brauen zusammen. Ich wollte lieber sein wie meine Großmutter und über Kräutern und Steinen Zauberformeln flüstern. Das interessierte mich viel mehr als Männer. Trotzdem entging mir nicht, dass meine Mutter meinen Vater neuerdings ganz gut in der Hand hatte.
Großmutter würde wissen, was ich zu tun hatte.
Als unser Boot die Insel erreichte, begrüßte Großmutter uns mit ausgebreiteten Armen, doch meine Mutter ging wortlos an ihr vorbei ins Haus. Großmutter zog mich beiseite und wollte wissen, was los war. Ich wusste genau, was sie wissen wollte, auch wenn in dem Jahr, seit wir uns zuletzt gesehen hatten, viel passiert war.
Als ich ihr berichtete, was mein Vater getan hatte und dass meine Mutter alle Spuren ihrer alten Religion vernichtet hatte und ihre Zeit nur noch mit Vater und seinen Gästen verbrachte, funkelten ihre Augen vor Wut wie die einer Wölfin.
»Wann wird dein Vater begreifen, dass er sein Land und seine Leute mit der Abkehr von unseren Traditionen nicht zurückgewinnt?«
»Und Mutter? Macht sie es auch falsch?«
Großmutter schaute mich traurig an.
»Sie ist auf dem Irrweg. Sie glaubt, ihr Einfluss auf deinen Vater sei immerwährend, aber Männer sind veränderlicher als das Meer.«
Großmutter zeigte in den Himmel, der sich bereits verdunkelte.
»Siehst du, wie die Wolken dort oben ziehen?«
Ich nickte.
»Sie sieht die sich stets verändernde Natur und hält ihre Macht für unbeständig. Dabei hat sie nur vergessen, wo sie suchen muss.«
Meine Großmutter kniete sich auf den Boden und vergrub ihr Gesicht im kühlen Gras wie zum Gebet. Sie atmete tief ein.
»Komm«, sagte sie und bedeutete mir, es ihr gleichzutun.
Ich kniete mich neben sie und begrub mein Gesicht ebenfalls im Gras.
»Spürst du das Vibrieren der Macht, Groa? Einer Macht, die viel größer ist als die, die von Männern ausgeübt wird?«, fragte sie.
Ich lauschte, um etwas zu erspüren, aber ich fühlte nur den Abendtau an den Wangen und roch den Duft des feuchten Grases.
»Nein«, antwortete ich verlegen.
»Du wirst sie mit der Zeit spüren. Brighde möchte, dass du …«
»Was machst du da?« Die Stimme meiner Mutter zerriss die abendliche Stille.
Großmutter richtete sich auf. Ich brannte darauf zu erfahren, was Brighde von mir wollte, aber in Gegenwart meiner Mutter wagte ich nicht zu fragen.
»Ich habe zu dem neuen Gott gebetet und ihn um Kraft gebeten.«
Meine Mutter schnaubte verächtlich.
»Es ist reine Zeitverschwendung, einen Gott um Kraft zu bitten, der sich nicht mal gegen eine Handvoll Priester und Soldaten verteidigen kann.«
Großmutter lachte.
»Na, dann gibt es ja wenigstens eine Sache, in der wir uns einig sind«, sagte sie und umschloss meine kalten Finger mit ihren warmen Händen. »Lasst uns mit den Vorbereitungen für das Imbolc-Fest beginnen.«
Kapitel 2
Während früher die Bewohner ganzer Ortschaften das Imbolc-Fest gemeinsam begangen hatten, waren nur noch wenige Familien mutig genug, sich trotz drohender Strafen an entlegenen Orten des Königreichs zu den Festlichkeiten zu versammeln. Einer dieser wenigen Orte war die Insel, auf der meine Großmutter lebte.
Zuerst kamen die jungen Frauen mit ihren Kindern. Ihre Aufgabe bestand darin, Großmutters Haus nach dem harten Winter zu säubern und es bereit zu machen für die Ankunft von Brighde, Göttin der Weissagung, der Heilung und des Neubeginns. Dann kamen die Männer, die meisten von ihnen Bauern, und brachten Vorräte für das Festmahl. Und zum Schluss wurden die alten Töchter der Druiden auf die Insel gebracht. Ihnen gebührten die Ehrenplätze an der Festtafel, wo sie miteinander schwatzten, während sie die Vorbereitungen verfolgten.
Diesmal wurde viel darüber geredet, dass die neue Religion das Imbolc-Fest gestohlen und für ihre eigenen Zwecke umgewandelt hatte – jetzt gerade wurde ein Reinigungsritual durchgeführt, bei dem die Frauen ganz in Weiß gekleidet waren, es wurden Gebete zu dem neuen Gott gesprochen, und alles wurde von einem tiefen Ernst überlagert. Ich konnte nicht verstehen, warum König Malcolm sich keine eigenen Riten ausdachte, statt noch mehr Schande über uns zu bringen, indem er unsere alten Riten verdarb. Und obwohl es mir eigentlich hätte Angst machen müssen, an einem verbotenen Fest teilzunehmen, erfüllte es mich nur mit Stolz, dass wir uns so starrköpfig den Wünschen des Königs widersetzten.
Mir fiel die Aufgabe zu, alle Ankömmlinge am Ufer der Insel willkommen zu heißen. Am nervösen Lächeln der Gäste konnte ich ihre Anspannung ablesen. Vor ihrer Abreise würde Großmutter ihnen allen Tinkturen mitgeben, die ihnen zum Schutz dienen und ihren Wohlstand sichern sollten, und vielen würde sie Prophezeiungen mit auf den Weg geben, die sie durch das kommende Jahr geleiten sollten.
Sogar meine Mutter taute im Lauf des Tages ein bisschen auf, auch wenn sie Großmutter aus dem Weg ging, so als würde Nähe zu sehr schmerzen. Umso mehr klebte ich an meiner Großmutter, um ihr zu zeigen, dass ich sie so lieb hatte wie immer. Falls ihr das auffiel, so sagte sie nichts dazu.
Als die Sonne hinter den Hügeln unterging, bauten Großmutter und ihre Dienerinnen am Ufer ein heiliges Feuer. Diejenigen, die gekommen waren, um am Festessen teilzunehmen und Kräuter und Tinkturen von Großmutter zu erhalten, aber sich nicht trauten, an diesem ältesten Ritual der Weissagung teilzunehmen, ruderten zum Seeufer zurück, als das Feuer angezündet wurde. Nur wenige – wesentlich weniger als im Jahr zuvor – waren geblieben, hauptsächlich Druidentöchter wie Großmutter. Ich schaute zu ihr hinüber und fragte mich, ob ihr aufgefallen war, dass so viele abgereist waren, aber sie war voll und ganz auf die vor ihr liegende Aufgabe konzentriert.
Wir versammelten uns um das Feuer, um an der Beifußzeremonie teilzunehmen, und zu meiner Überraschung war sogar meine Mutter dabei. In ihrem Blick meinte ich so etwas wie Begierde zu sehen, und da wusste ich, dass sie bei der Zeremonie Brighde um einen Sohn bitten würde.
Ich saß neben Großmutter, während sie die rotbraune Pflanze in einem Topf zerdrückte, Wasser dazugab und das Ganze unter Rühren auf dem heiligen Feuer kochte, bis es eine schlammige Farbe hatte. Dabei sang sie eine Zaubermelodie – ein uraltes Lied von Wiedergeburt, Neubeginn und Glück.
Ich spürte, wie mich das Lied tief im Herzen berührte, wie es mich zu sich hinzog, auch wenn ich nicht hätte sagen können, was es von mir wollte. Der Boden unter mir murmelte leise, als würde er auf das Lied meiner Großmutter antworten.
Nachdem sie geendet hatte, schaute sie in den Topf. Anscheinend war sie zufrieden mit dem, was sie sah, denn sie goss den Inhalt in einen Becher, der herumgereicht wurde, bis alle Frauen einen Schluck daraus getrunken hatten. Und so ging es weiter – es wurde im Topf gerührt, der Becher wurde erneut gefüllt und herumgereicht, es wurde gesungen.
Nachdem der Becher zum zweiten Mal herumgegangen war, stimmten einige Frauen ein eigenes Lied an, bei dem Brighde ihnen erschien und sie mit ihren Visionen bedachte. Ihre klagenden Stimmen, schwer von den Qualen der Prophezeiungen, wurden vom Wind emporgehoben und über das dunkle Wasser getragen. Ich bekam eine Gänsehaut, als die Frauen begannen, wild zu springen und zu tanzen; ihre Schatten huschten über die Wände von Großmutters kleinem Haus, während der Feuerschein über den Sandstrand flackerte.
Es war zugleich wunderschön und furchterregend.
Ich war noch zu klein, um von dem Zaubersud zu trinken, und ich tat so, als würde ich mich fürchterlich darüber aufregen, aber insgeheim war ich froh, nicht von diesem dunklen Gebräu trinken und meinen Körper den Göttern überlassen zu müssen. Obwohl mir das alles nicht geheuer war, rührte ich mich nicht, ja ich wagte nicht einmal zu atmen vor Angst, den dünnen Schleier zwischen diesem und dem nächsten Leben zu zerstören, durch den Brighde mit ihren Getreuen kommunizierte. Großmutter saß da, reglos und mit leerem Blick, während sie in der Dunkelheit mit der Göttin kommunizierte.
Auch wenn ich nichts von dem Beifußtrank abbekommen hatte, nahm ich auf meine eigene Weise an der Zeremonie teil. Ich drückte meine Hände ins Gras, das sich kühl und frisch anfühlte, und versuchte die Macht zu spüren, von der Großmutter gesprochen hatte. Ich konnte jedoch nur ein Summen in der Luft hören.
»Was versuchst du mir zu sagen?«, flüsterte ich.
Ich wusste, dass ich keine Antwort erhalten würde, aber einen Augenblick später kitzelte mich eine Brise im Nacken, und ich spürte Großmutters Blick auf mir. Ich hob den Kopf. Ihre Augen waren ganz schwarz geworden, und sie hatte die Fäuste geballt, doch sie saß immer noch reglos da – ein ruhender Fels der Kraft in einem bewegten Meer aus Stimmen und Schatten. Ich wand mich unter der Intensität ihres Blicks.
»Hab keine Angst, Groa, Tochter von Boedhe, Sohn des Coinneach, des rechtmäßigen Königs von Schottland.« Die Stimme meiner Großmutter klang tief und sonor wie das Summen eines Bienenschwarms.
»Du wirst die Größte von uns allen sein. Dein Ruhm wird sich in ganz Schottland und bis nach England verbreiten. Alles Land, das deine Füße berühren und das deine Augen sehen, ist dein, und du gehörst zu ihm.«
Mein Herz klopfte, und ein Schauer lief mir über den Rücken, als das Murmeln der Erde die Worte meiner Großmutter bestätigte.
Das … Das ist es, was ich dir sagen will.
Großmutter hatte noch nie eine Prophezeiung für mich ausgesprochen, und eigentlich durfte ich sie während des Rituals nicht ansprechen, aber das Murmeln der Erde ließ mir keine Ruhe.
»Werde ich eine Königin sein?«, fragte ich und schämte mich für meine Stimme, die im Vergleich zu Großmutters ganz dünn klang.
»Du wirst viel mehr sein. Du wirst unsterblich sein.«
Ich dachte an Großmutters druidische Macht, die von ihren Vorfahren auf sie übergegangen war. Ich dachte daran, wie meine Mutter meinen Vater jetzt mit der Aussicht auf einen Sohn in der Hand hatte. Ich dachte daran, wie Vater sich der Herrschaft von König Malcolm unterwarf, ohne dass der König jemals einen Fuß nach Fife gesetzt hatte. Und ich sollte noch berühmter werden als die alle zusammen?
»Werde ich einen König heiraten?«, fragte ich.
Meine Großmutter lachte.
»Ich prophezeie dir Ruhm und ein Vermächtnis, das nie untergehen wird, und du sprichst von Heirat!«
»Aber wie soll ich denn Königin werden, wenn …«, setzte ich an, doch Großmutter fiel mir ins Wort.
»Genug der Fragen, mein Kind, ich bin noch lange nicht fertig.«
Als ich vor ihr zurückwich, nahm Großmutter meine Hand.
»Du musst überleben, kleine Groa. Du bist diejenige von uns, die unbedingt überleben muss«, sagte sie, während sie mir in die Augen sah, und diesmal lag eine tiefe Sehnsucht in ihrer sonoren prophetischen Stimme.
Sie drückte zärtlich meine Hand und wandte sich wieder dem Feuer zu, dessen Flammen tanzende Schatten auf ihr Gesicht warfen. Ich schaute mich um, neugierig zu erfahren, wer etwas von dieser unglaublichen Prophezeiung mitbekommen hatte, aber niemand schien etwas bemerkt zu haben. Alle waren mit ihren eigenen Visionen beschäftigt. Meine Mutter tanzte. Ich hätte so gern geglaubt, dass sie frei und glücklich war, aber ihre Bewegungen wirkten gezwungen, so als versuchte sie, Brighde mit schierer Willenskraft herbeizurufen, anstatt darauf zu warten, dass die große Göttin sich ihr zeigte.
Großmutters Worte gingen mir nicht mehr aus dem Kopf.
Unsterblich
Königin
Überleben
Als ich die Augen öffnete, war die Morgenröte schon dem blauen Himmel gewichen. Die alten Druidentöchter tauschten sich aufgeregt über ihre Visionen aus, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Eine würde im Herbst noch einmal Großmutter werden, eine andere würde ihren Sohn endlich wiedersehen.
Jemand hatte mir ein Schaffell um die Schultern gelegt, und ich kuschelte mich wohlig in seine Wärme. Von meinem Platz neben dem heruntergebrannten Feuer aus konnte ich sehen, wie meine Großmutter und meine Mutter die anderen verabschiedeten. Die kleinen Boote stießen eins nach dem anderen ab, bis nur noch eins übrig war. Einer unserer Soldaten saß am Bug, und ich verstand nicht, warum die wenigen Sachen, die wir mitgebracht hatten, bereits ins Boot geladen worden waren.
Ich setzte mich auf, und die kühle Morgenluft wehte mir ins Gesicht. Plötzlich war ich ganz wach und erinnerte mich wieder an die Prophezeiung meiner Großmutter. Ein Kribbeln lief mir über den Rücken.
Tief in Gedanken versunken hatte ich gar nicht bemerkt, dass sie zu mir herübergekommen war. Sie sah älter aus, als ich sie je gesehen hatte. Sie zog mich auf die Beine und wickelte das Schaffell fester um mich.
»Es ist Zeit, uns zu verabschieden, Groa«, sagte sie und gab mir einen Kuss auf die Wange.
»Verabschieden?«, fragte ich verwirrt. »Wir sind doch gerade erst angekommen.«
»Deine Mutter hat bekommen, was sie wollte«, sagte Großmutter leise, nahm mich an der Hand und führte mich zum Boot.
»Nein«, schrie ich und versuchte mich loszureißen. »Was ist mit deinem Wandteppich?«
»Dieses Jahr habe ich keinen gemacht.« Doch ich sah das Zucken in ihren Mundwinkeln und ihre angespannten Kiefermuskeln, und da wusste ich, dass sie log. Sie versuchte ihre Gefühle zu verbergen. Aber so stark wie sie war ich nicht. Müde und fröstelnd und enttäuscht darüber, dass ich um die schönen Tage mit meiner Großmutter gebracht wurde, brach ich in Tränen aus.
»Gruoch«, rief meine Mutter ärgerlich vom Boot aus, doch Großmutter bedachte sie mit einem so kalten, Furcht einflößenden Blick, dass sie zurückwich, obwohl sie so weit weg war. So hatte Großmutter sie noch nie angesehen. Etwas hatte sich zwischen den beiden verändert, vielleicht für immer.
Großmutter hockte sich vor mich, sodass wir auf Augenhöhe waren.
»Erinnerst du dich an das, was ich dir letzte Nacht gesagt habe?«, flüsterte sie.
Ich nickte und wischte mir die Nase an dem Schaffell ab.
»Du musst überleben«, sagte sie. »Du musst stark sein.«
»Du fehlst mir«, sagte ich verzweifelt und brach erneut in Tränen aus.
Großmutter stand auf, hob mich hoch und drückte mich fest an sich. Sie trug mich zum Boot, aber als meine Mutter die Arme nach mir ausstreckte, blieb sie noch einmal stehen. Sie streichelte mir übers Haar, bis mein Schluchzen nachließ. Sie roch intensiv nach Beifuß, und als ich versuchte, den Geruch tief einzuatmen, wäre ich beinahe an meinem Rotz erstickt. Das brachte Großmutter zum Lachen, was mir das Herz ein bisschen leichter machte.
»Vergiss meine Worte nicht, meine Kleine«, sagte Großmutter, und ich nickte.
Dann gab sie mir noch einen Kuss auf die Wange.
»Gib dich nach außen wie die unschuldige Blume und sei innerlich die Schlange«, flüsterte sie mir ins Ohr.
Es war ein alter Piktenspruch, den ich schon oft aus ihrem Mund gehört hatte, aber diesmal klang er wie ein göttlicher Befehl, wie der Grund für meine Geburt – ich war auf die Welt gekommen, um eine solche Schlange unter einer solchen Blume zu sein.
Und dann saß ich auch schon im Boot, und wir legten ab. Ich konnte den Blick nicht von meiner Großmutter abwenden, die im dichten Morgennebel allein am Ufer der Insel stand, ihren Umhang fest um sich gezogen. Ihr silbernes Haar wehte im Wind, während sie das Lied des Abschieds anstimmte. Ich schaute sie an, bemüht, mir ihr Gesicht einzuprägen, und versuchte, jedes Wort zu verstehen, das sie sang. Der Wind trug ihre Stimme über das Wasser, und die letzte Zeile des Lieds schien uns zu begleiten.
Nuair a chailltear agus nuair a bhuaightear na cathanna.
Selbst als der Nebel sie längst verschluckt hatte und wir das andere Ufer erreichten, sah ich sie immer noch vor meinem geistigen Auge.
Auf dem Heimritt genoss ich die Wärme meiner Mutter an meinem Rücken. Sie küsste mein Haar und streichelte mich so wie früher. Brighde musste ihr etwas Schönes versprochen haben, dass ihre Zuneigung für mich wieder aufgeblüht war. Trotzdem entschloss ich mich, ihr nichts von der Prophezeiung zu erzählen. Sie würde es sowieso nicht verstehen, sie hatte nur noch Söhne und Erben im Kopf.
In jenem Sommer schwamm ich allein im Meer, während ein Wachmann aufpasste. Mit Mutters Zofe strolchte ich über die Hügel und unternahm Bootsfahrten auf dem Firth of Eden. Tag um Tag wuchs ich weiter in meine von den Göttern bestimmte Aufgabe hinein, betrachtete das Land, wie Großmutter es sich gewünscht hätte, sah, wie es sich unter der Sommersonne erwärmte und veränderte, wie der Herbst die Hügel mit violettem Heidekraut überzog, wie alles dunkler wurde, als die Ernte nahte. Ich saugte die Göttlichkeit des Landes in mich auf, wenn ich barfuß über das Gras wanderte. Ich war ganz berauscht von dem Wissen, dass Schottland selbst mich zu seiner rechtmäßigen Herrscherin auserkoren hatte – dass ich aus diesem Grund geboren worden war.
Es war, als hätten die Worte meiner Großmutter mich an das Land gebunden, nicht durch fantastische Geschichten, sondern durch meine Bestimmung als Herrscherin. Dies war mein Land, und ich würde es hegen und lieben, wie noch nie jemand es gehegt und geliebt hatte. In jenem Sommer dachte ich, ich würde niemals irgendetwas so sehr lieben wie Schottland.
Dann wurde Adair geboren.
Kapitel 3
Der Sichelmond am dunklen Himmel kündigte den Winter an. Die Erntezeit war fast zu Ende, es war die Zeit der Festessen, aber all das interessierte mich nicht.
Meine Mutter wehklagte in ihrer Kammer.
Ihre Schreie hatten mich in der Nacht geweckt, und ich war zu ihr gelaufen. In ihrer Kammer hatten sich mehrere Frauen aus nahe gelegenen Dörfern eingefunden, von denen mich eine zurück in die Halle führte und zu beruhigen versuchte, was ihr jedoch nicht gelang.
»Ich will wissen, was los ist!«, beharrte ich, denn die mitfühlenden Blicke der Frauen machten mir Angst.
»Ihr Kind ist ein bisschen zu früh gekommen, das ist alles«, sagte die Frau sanft.
»Zu früh?«
»Hoffen wir, dass es ein Junge ist. Es wird Kraft brauchen. Sie werden beide Kraft brauchen.«
Warum hatte ich nichts davon gewusst, dass meine Mutter guter Hoffnung war? Sie war in letzter Zeit ein bisschen rundlicher geworden, aber ich hatte viele Frauen während der Erntezeit dick werden sehen und mir nichts dabei gedacht. Zwar hatte sie in der Nacht auf der Insel inbrünstig zu Brighde gebetet, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Göttin ihr ihren Wunsch erfüllen würde, vor allem nachdem sie mir eine solch ruhmreiche Zukunft vorausgesagt hatte. Wozu brauchte meine Mutter Söhne, wenn ihre Tochter dazu bestimmt war, die Königin von Schottland zu werden?
Plötzlich dämmerte mir, warum mein Vater neuerdings so zugewandt war. Ich hatte gesehen, wie er meiner Mutter in Gegenwart seiner Thanes zärtlich den Kopf gestreichelt hatte, wie er ihr von seinen Besuchen in den Siedlungen seines Landes getrocknete Früchte mitgebracht hatte. Er behandelte sie neuerdings wie ein Druide eine Göttin. Und sie ließ sich sowohl seine Zärtlichkeiten als auch seine Geschenke gefallen.
»Siehst du, meine Kleine«, hatte sie zu mir gesagt, »so gewinnt man einen Mann und alles Land, über das er gebietet.«
Lächelnd hatte sie die getrockneten Früchte gegessen und ihr Haar mit den Spangen hochgesteckt, die mein Vater ihr mitgebracht hatte. Ich hatte das alles auf weibliche List zurückgeführt, aber in Wirklichkeit lag es daran, dass sie ein Kind im Bauch hatte.
Als ich jetzt sorgenvoll im Bett lag, fragte ich mich, ob Vater in der Burg war. In der Kammer meiner Mutter hatte ich ihn nicht gesehen, aber ich hatte auch nicht viel mehr gesehen als blutbefleckte Tücher. Ich weinte und flüsterte Gebete zu allen Göttern, von denen ich mir Gehör erhoffte. Immer wieder fiel ich in einen unruhigen Schlaf, und als ich am frühen Morgen aufwachte, herrschte Stille ringsum.
Die Türangeln waren gut geölt, und so hörte mich niemand, als ich mich in den langen Flur schlich. Ich spähte in die Dunkelheit, aber es war weit und breit niemand zu sehen.
Bedrückt angesichts der Stille schlich ich auf Zehenspitzen zur Kammer meiner Mutter. Als ich durch die Tür lugte, war zu meiner Erleichterung nirgendwo Blut zu sehen. Im Licht einiger Fackeln sah ich meine Mutter im Bett liegen. Sie atmete tief und ruhig, man hatte ihr frische Sachen angezogen und sie mit Fellen zugedeckt. Neben ihr lag mein Vater in seiner leinenen Tunika. Und zwischen den beiden lag das winzigste Kind, das ich je gesehen hatte. Seine Haut war so violett wie die Morgendämmerung, aber es atmete auch tief und ruhig.
Die Bodendielen knarzten, als ich einen Schritt machte. Meine Mutter öffnete die Augen.
»Komm her, Gruoch.«
Ich ging zum Bett, schlüpfte unter die Schaffelle und kuschelte mich an Mutters warmen Rücken.
»Ist es ein Junge?«, flüsterte ich.
Meine Mutter lachte leise.
»Ja. Du hast einen Bruder.«
»Warum ist er so klein?«
»Weil er es nicht erwarten konnte, dich kennenzulernen.«
Die Antwort gefiel mir. Ich kuschelte mich noch fester an meine Mutter und schlief ein.
Sie nannten ihn Adair – Glück. Aber wie so viele Worte in meiner Sprache hat auch dieses mehrere Bedeutungen. Adair bedeutet auch Speer, und mein Vater gab meinem Bruder diesen Namen, weil er ihn zu einem großen Krieger erziehen wollte, der Schottland zurückerobern würde. Vielleicht hätte es mich wütend machen sollen, dass meine Eltern sich von nun an nur noch für Adairs Zukunft interessierten, aber mein Bruder war so klein und so wunderbar, ich konnte ihn einfach nicht ablehnen.
Ganz besonders freute es meinen Vater, dass sein Sohn ihm wie aus dem Gesicht geschnitten war. Adairs blonde Locken fielen ihm in die blauen Augen, und er hatte das strahlendste Lachen. Schon als Säugling hatte er kräftige Arme wie Vater, und als er anfing zu laufen, bekam er einen kompakten Brustkorb. Aber er hatte nichts vom Auftreten unseres Vaters. Adair war still, nachdenklich, er nahm alles um ihn herum mit den Augen auf, die genauso groß waren wie meine.
Als kleiner Junge entwickelte er keine Freude daran, mit dem Schwert zu spielen, sosehr Vater auch versuchte, ihn dafür zu begeistern, kaum dass er laufen gelernt hatte. Stattdessen hing Adair mir am Rockzipfel, auf seinen kurzen, kräftigen Beinen folgte er mir überallhin, und ich war froh, einen treuen Untertan zu haben, an dem ich die Macht üben konnte, die mir von meiner Großmutter prophezeit worden war. In unseren Spielen war ich mal die gütige Herrscherin, mal die rachsüchtige Göttin, und er verehrte mich in jeder Rolle mit der Liebe des kleinen Bruders.
Aus Furcht, unsere enge Beziehung könnte seinen Sohn weibisch werden lassen, versuchte Vater stets, Adair mit den anderen Jungen in der Burg zusammenzubringen.
»Sein erstes Wort war Pferd«, erzählte er jedem, als Adair sprechen lernte. »Er wird einmal ein großer Krieger werden.«
»Sein erstes Wort war Haar«, erzählte meine Mutter voller Stolz ihren Zofen, wenn sie ihr rotbraunes Haar, das, obwohl sie zwei Kinder geboren hatte, immer noch herrlich glänzte, zu Zöpfen flochten.
Ich hätte schwören können, dass Adairs erstes Wort hais gewesen war, was überhaupt kein Wort, sondern Kindergebrabbel war. Aber ich wollte weder Vater noch Mutter verstimmen. Sie hatten beide unabhängig voneinander eine Vorstellung von Adairs Zukunft entwickelt: Vater sah in ihm einen mächtigen Herrscher, der seinem Land zu Ruhm und Ehre verhelfen würde, Mutter sah in ihm einen treuen Sohn, der in die Welt hinausgehen und von der Schönheit und Würde seiner Mutter künden würde.
Im nächsten Frühling besuchten wir meine Großmutter nicht, und auch nicht im darauffolgenden, denn Adair war noch zu klein für so eine beschwerliche Reise. Mutter versicherte mir, dass wir sie besuchen würden, sobald Adair groß genug war, doch ich hatte die Vermutung, dass Vater seinen Sohn um jeden Preis vom Einfluss seiner Großmutter fernhalten wollte.
Um Adairs Position als rechtmäßigem Erben zu untermauern und vielleicht auch, um zu demonstrieren, dass die Linie von König Coinneach wiederbelebt war, lud Vater in Adairs zweitem Herbst alle Bewohner von Fife zu einem großen Festessen ein.
»Warum haben wir kein Fest gefeiert, als er geboren wurde?«, fragte ich.
Vater fuhr zu mir herum.
»Warum fragst du das?«
Erschrocken wich ich einen Schritt zurück.
»Ich dachte nur …«
Vater seufzte, aber als er antwortete, klang er unwirsch, und er hatte solche Mühe, seine Gefühle zu verbergen, dass er sich mehrmals verhaspelte.
»Ich muss dafür sorgen, dass mein Sohn mit Autorität sprechen und mit dem Schwert umgehen kann. Ich möchte nicht, dass er mich vor meinen Leuten beschämt.«
Adair konnte mit kleinen Holzstöcken zuschlagen, aber keins von Vaters echten Schwertern heben, und er konnte schon ziemlich gut sprechen, aber von »Autorität« konnte keine Rede sein.
Ich ging zu Barrach, unserem Koch, einem loyalen, freundlichen Mann mit rosigen Wangen und kahlem Kopf. Von ihm erhoffte ich mir eine Erklärung für Vaters Verhalten. Barrach war als junger Mann ein großer Krieger gewesen, bis er in den Diensten meines Großvaters ein Bein verloren hatte. Jetzt befehligte er eine kleine Schar Diener, die fleißig dabei waren, Hammelfleisch und Trockenfrüchte für das Festessen zuzubereiten.
»Viele Kinder überleben ihre ersten Winter nicht«, sagte er, während er mit seinen kräftigen Kriegerhänden Teig knetete. »Das ist eine Einladung an den Totengott Manau, der mit einem Festmahl geehrt wird, damit er ein Kind segnet, das das Säuglingsalter überlebt hat.«
Plötzlich herrschte Stille um uns herum. Der Name Manau lag in der Luft wie ein Fluch.
»Aber Vater glaubt doch gar nicht mehr an die alten Götter«, flüsterte ich, so als könnte die Erwähnung seines Unglaubens Manau herbeirufen.
»Dein Vater ist abergläubischer als wir alle«, sagte Barrach. »Aber weil er feige ist, verbirgt er das vor Malcolm.«
An dem Tag wich ich nicht mehr von Adairs Seite.
Der Sommer schien sich ewig hinzuziehen, während wir auf das Fest für Adair warteten. Jeden Tag folgte ich dem Wachmann um den Palisadenzaun herum und hielt Ausschau nach unseren Gästen. Aber erst als die erste Ernte eingebracht wurde, begannen sie einzutreffen. Anfangs kamen einzelne Familien, dann trafen sie in Scharen ein.
Gäste von Bedeutung wurden in der Burg untergebracht. Die anderen bauten entlang der Küste und im Tal hinter unserer Burg ihre Zelte auf. Viele hatten Tiere mitgebracht, teils um sie für das Festmahl zu schlachten, teils als Geschenke für Boedhe. Die Kinder nannten mir aufgeregt die Namen ihrer Schweine und Ziegen.
»Das da ist Dagda, und das ist Morrigan, und der da heißt Cernunnos, weil er die größten Hörner hat. Das da ist Columba, und das ist Nynia …«
»Nach wem sind die letzten beiden benannt?«, fragte ich. Ich hatte die Namen des Gottes aller Götter, der Kriegsgöttin und natürlich des gehörnten Gottes erkannt – ein passender Namenspatron für einen Widder. Aber die Namen Columba und Nynia waren mir unbekannt. Die waren in Großmutters Erzählungen noch nicht vorgekommen.
»Sind das Götter?«
»Nein!« Die Kinder lachten. »Das sind Männer, aber wir verehren sie wie Götter.«
»Segnen die auch eure Ernten und bringen euch Regen?«, fragte ich.
»Nein.«
»Wozu sind sie dann gut?«, fragte ich verdattert. »Warum betet ihr dann zu ihnen?«
»Sie haben uns das Christentum gebracht«, sagten sie und fragten ungläubig: »Kennst du ihre Namen etwa nicht?«
Nein, ich kannte sie nicht, musste ich zugeben. Obwohl mein Vater die neue Religion von König Malcolm übernommen hatte, hatte er mir nichts davon beigebracht. Die Kinder aus Fife erzählten mir von den Männern, die eine Generation zuvor die seltsamen neuen Riten in unser Land gebracht hatten. Die Leute beteten zu diesen Männern, wie wir zu Brighde beteten. Aber heimlich beteten sie auch weiterhin zu den alten Göttern, die zu allen Jahreszeiten Segen und Fluch über ihre Felder und Flüsse brachten.
Froh über die Informationen, die ich von den Kindern bekam, versorgte ich sie mit allem Möglichen und bemühte mich, ihnen ab und zu eine Freude zu machen. Den Mädchen flocht ich Blumen ins Haar, so wie ich es von meiner Mutter kannte, und den Jungs zeigte ich kleine Tricks, die ich mir bei den Soldaten meines Vaters abgeschaut hatte, die ich gern bei ihren Übungen beobachtete – zum Beispiel, wie man Feinde mit einem unerwarteten Rückwärtsschritt überrascht oder sie mit Kriegsgeschrei in die Flucht treibt. Immer wieder schlich ich mich in die Küche, um Barrach ein paar Süßigkeiten abzuschwatzen, die ich dann unter den Kindern verteilte.
Ihre Freude und Dankbarkeit waren berauschend, und ich herrschte über meinen kleinen Hofstaat wie die Piktenkönigin, die ich einmal sein würde. Ich war selig.
Nachdem alle Gäste in Fife eingetroffen waren, begann das große Fest. Vater hatte sich ein zweiwöchiges Fest gewünscht, wie es sich für die Geburt eines Königs gehörte, aber obwohl unser Land wohlhabend war, hätten unsere Mittel dafür nicht gereicht. Mein Vater mochte seine Fehler haben, aber er war ein guter Earl, der nicht mehr von seinen Untertanen verlangte, als sie geben konnten. Und so begnügte er sich mit einer Woche.
Am ersten Tag wurde bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Obwohl es keine druidischen Zeremonien gab, lag ein Hauch von Magie über allem. Vater sprach im Flüsterton davon, dass die Linie von Coinneach wieder aufleben und ihren rechtmäßigen Patz auf dem Thron einnehmen würde, und versprach allen Edelleuten einen Titel. Der Alkohol machte ihn großherzig, und die, die gekommen waren, um mit ihm zu feiern, bestärkten ihn in seinem Leichtsinn.
Die Festlichkeiten zogen sich über drei Tage hin. Uns Kindern ließ man immer mehr Freiheit, wir konnten nach Herzenslust umherstromern. Von Abend zu Abend wurden die Gesänge misstönender, die Tänze ausgelassener, wurde Vaters Prahlerei immer verwegener, hatte er doch endlich einen männlichen Erben.
Meine Mutter saß neben ihm und genoss seine Macht, als wäre es die ihre. Sie sah sich auf dem Thron, der ihr gebührt hätte, in einem Palast in Scone, eine Königin, wie es sie in Schottland noch nie gegeben hatte. Ganz im Gegensatz zu der dummen, hässlichen Britannierin, die jetzt auf dem Thron saß und nicht mal in der Lage war, Malcolm einen männlichen Erben zu schenken. Meine Mutter würde meinem Vater einen Sohn nach dem anderen schenken, ihre Herrschaft würde niemals enden. Ihre Söhne würden Könige sein und deren Söhne nach ihnen.
Die beiden waren überglücklich und sorglos und berauscht von ihrer Herrlichkeit.
Kapitel 4
Ich sah sie als Erste.
Es war schon hell, vor uns lag ein klarer, kalter Tag. Wir Kinder waren schon seit dem Morgengrauen auf und liefen in den Lagern umher wie die Möwen auf der Suche nach Fleischbröckchen und Brotkrumen. Nachdem wir uns an den Resten des Festmahls satt gegessen hatten, liefen wir in die Hügel hinauf, von wo wir einen Blick auf die Burg hatten.
Adair saß auf meinem Schoß und nuckelte zufrieden an einem Stück Apfelschale. Ich schaute zum Wasser hinunter und ließ den Blick an der Küste entlangwandern bis zum Firth of Eden. Dort, in den engen, bewaldeten Tälern, ließ die aufgehende Sonne das Gold und Rot wehender Fahnen aufleuchten.
Ein königlicher Reitertrupp.
Ich hatte noch nie Reiter des Königs gesehen, aber meine Eltern hatten mir genug erzählt, sodass ich sofort wusste, wer da geritten kam. Mir blieb fast das Herz stehen.
War das King Malcolm, der kam, um uns Adair wegzunehmen?
Ich sprang auf und lief den Hügel hinunter. Die anderen hielten es für ein Spiel, sprangen ebenfalls auf und rannten laut schreiend hinter mir her. Der Lärm, den wir veranstalteten, riss schon von Weitem alle aus dem Schlaf, die bis dahin weder das Kreischen der Möwen noch die aufgehende Sonne hatte wecken können.
Als wir die Burg fast erreicht hatten, kam Vater uns mit einem strahlenden Lächeln entgegen.
»Meine Kinder«, rief er uns zu, »wo habt ihr den ganzen Morgen gesteckt?«
»Der König kommt, um uns Adair wegzunehmen!«, schrie ich atemlos.
Alles um uns herum erstarrte, und Vaters Augen wurden schmal.
»Was redest du da?«, fragte er ruhig.
Ich berichtete ihm, was ich vom Hügel aus beobachtet hatte.
»Nein. Das muss etwas anderes sein.«
Er drehte sich auf dem Absatz um und ging mit großen Schritten zum Hauptfestzelt. Ich blieb ihm auf den Fersen. Immer mehr Männer folgten uns, ich hörte sie hinter mir nervös tuscheln und ihre Schwerter ziehen. Doch Vater betrat gelassen das Zelt und nahm seinen Platz an der Hohen Tafel ein, ohne sein Schwert zu ziehen. Zögernd steckten die Männer ihre Schwerter wieder weg und setzten sich ebenfalls an die Tafel.
»Esst!«, rief er mit einem gezwungenen Lächeln.
Einige Männer aßen lustlos ein paar Happen, aber einige ließen die Hand am Schwertgriff und behielten den Zelteingang im Auge.
»Es gibt nichts zu fürchten, Gruoch«, sagte Vater, als ich mich neben ihn setzte, doch mir entging nicht, dass er seinen goldenen Halsreif zurechtrückte und nicht vorhandenen Staub von seinem Umhang wischte.
»Es ist nichts Ungewöhnliches, dass der König den Sohn eines seiner Earls besucht«, sagte Mutter und nahm auf Vaters anderer Seite Platz.
Ich verstand die beiden nicht. Sie redeten, als käme der König, um ihren Sohn zu segnen, dabei hatte ich bis dahin immer nur gehört, wie sehr König Malcolm meinem Vater misstraute. Sie saßen ganz entspannt da, während ich auf meinem Stuhl herumzappelte, bis plötzlich laute Rufe vor dem Zelt unsere Aufmerksamkeit auf sich zogen.
Vater gab einem jungen Diener ein Zeichen, woraufhin der nach draußen lief, um die Gäste zu begrüßen. Kurz darauf war eine Männerstimme zu hören.
»Nicht nötig. Ich bin nicht von so hohem Stand, dass ihr mich wie einen eurer Götter behandeln müsst.«
Das klang zwar freundlich, aber ich meinte, bei den Worten eure Götter einen verächtlichen Unterton herauszuhören. Allein durch seinen Ton war mir der Sprecher schon unsympathisch.
Mein Eindruck bestätigte sich, als ein großer, schlanker Mann das Zelt betrat. Er hatte dichte schwarze Locken und eine so glatte Haut wie ein Jüngling. Ich hatte gehört, dass König Malcolm bereits eine ganze Schar Enkel hatte, aber dieser Mann schien noch jung zu sein, vielleicht so alt wie mein Vater. Er war auf einschüchternde Weise gut aussehend, und sein kostbarer Umhang war von tiefem Blau, so dunkel wie das Meer bei Nacht. Anstatt des für einen König oder einen Earl üblichen goldenen Halsreifs trug er an einem Lederriemen um den Hals ein goldenes Kreuz, das sich auf seiner Brust glänzend von seiner dunklen Kleidung abhob.
»Crinan«, sagte mein Vater, und an seinem Ton hörte ich, dass er ebenso überrascht war wie ich. Das war also gar nicht der König. »Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Ihr Eure Abtei verlassen würdet, um unsere bescheidene Feier mit Eurer Gegenwart zu beehren.«
»Ich auch nicht.« Crinan lächelte huldvoll. Seine Stimme war wie Heidekrauthonig – warm, süß, weich. Er sprach mit einem Akzent, den ich noch nie gehört hatte, und ich musste mich zusammennehmen, um nicht vor ihm zurückzuweichen.
»Der König hat erfahren, dass Boedhe jetzt einen Sohn hat, und er hat mir befohlen, an seiner Stelle herzukommen, um einen Segen auszusprechen. Er wäre gern selbst gekommen, aber die Regierungsgeschäfte in seinem Königreich beanspruchen ihn zu stark.«
Seine Worte klangen äußerst respektvoll, und nur daran, dass mein Vater neben mir kaum merklich zusammenzuckte, erkannte ich, dass wir gerade beleidigt worden waren.
»Zu unserer großen Freude lässt Euch die Betreuung der kleinen Abtei in Dunkeld genug Zeit, um uns mit Eurer Gesellschaft zu segnen«, erwiderte Vater.
Mit Genugtuung beobachtete ich, wie Crinans Lächeln verrutschte. Ich richtete mich auf, stolz darauf, dass Vater den Sticheleien dieses aufgeblasenen Mannes Paroli bot.
»Bleibt doch eine Weile«, fuhr Vater fort. »Esst Euch satt. Ihr müsst die ganze Nacht durchgeritten sein, um so früh am Morgen hier einzutreffen.«
»Wir haben in der Nähe unser Nachtlager aufgeschlagen. Der Ritt hierher war nicht anstrengend.«
Er lehnte die Einladung nicht direkt ab, aber er nahm sie auch nicht an. Mein Vater würde die Einladung wiederholen müssen – eine weitere Beleidigung. Außerdem hatten sie sich in unserem Land aufgehalten, ohne dass Vater davon erfahren hatte. Sie waren über unsere Hügel und durch unsere Wälder geritten, und das war mir unheimlich.
Im nächsten Augenblick wurde ich abgelenkt, als die eindrucksvollste Frau, die ich je gesehen hatte, das Zelt betrat. Ihr langes, glattes Haar fiel ihr über den Rücken wie flüssiges Gold. Ihre Augen hatten eine Farbe wie Heidekraut im Herbst, ihre Haut war so blass wie der Mond. Ihr Halsreif aus geflochtenem Gold war so dick, wie ich noch nie einen gesehen hatte, und ich wunderte mich, dass sie nicht unter seinem Gewicht in die Knie ging. Ihre Kleidung war noch prächtiger als Crinans.
Meine Mutter war zwar schöner, aber diese Frau strahlte Macht aus. Ich war wie gebannt. Ihr Blick streifte kurz meine Mutter, dann schaute sie meinen Vater an, der sich ebenso wie alle anderen Männer erhoben hatte. Das war die Macht der Frauen über die Männer, von der meine Mutter immer wieder sprach. Ich schämte mich fast ein bisschen, als ich Mutters vor Eifersucht verzerrtes Gesicht sah.
»Lady Crinan«, sagte mein Vater ehrfurchtsvoll.
Die Frau deutete ein Nicken an.
»Ich bedaure, dass mein Vater nicht selbst kommen konnte«, sagte sie. »Aber ich hoffe, dass meine Anwesenheit Euch ein würdiger Ersatz ist.« In ihrer Stimme lag nicht die Spur eines Zweifels.
Prinzessin Bethoc, Lady Crinan, war die älteste von König Malcolms drei Töchtern. Meine Mutter sprach nur sehr selten von ihr, und wenn, dann nicht mit schmeichelhaften Worten. Als ich Lady Crinan betrachtete, konnte ich verstehen, warum meine Mutter sie kaum erwähnte.
Trotz all der höflichen Worte lag eine Spannung in der Luft, als könnte das ganze Zelt jeden Augenblick in Flammen aufgehen. Ich wünschte, ich hätte einen Dolch oder ein Messer. Oder wenigstens einen Stock, um mich zu verteidigen, wenn der Konflikt ausbrach. Stattdessen hielt ich Adairs Hand etwas fester umklammert, und er protestierte nicht.
»Greift zu«, sagte mein Vater nach einer Weile. »Unsere Vorräte stehen euch zur Verfügung.«
»Da alle Vorräte in Schottland dem König gehören, würde ich auch nichts anderes erwarten«, sagte Crinan grinsend. Bethoc quittierte sein ungehobeltes Benehmen mit einem missbilligenden Blick. Wenn sie jemanden beleidigen wollte, würde sie es sicher nicht so plump anstellen.
Ich wünschte, mein Vater würde reagieren, sich zur Wehr setzen. Ich wünschte, er würde verkünden, dass unsere Vorratskammern die besten im ganzen Land waren. Ich wollte nicht, dass er wieder zu so einem furchtsamen Mann wurde, wie er es vor Adairs Geburt gewesen war. Ich wollte, dass er etwas unternahm, irgendetwas.
Doch er saß nur stumm da, der Feigling, und wartete auf Crinans nächste Worte.
»Ist dein Sohn schon getauft?«, wollte Crinan wissen.
»Wir wollen warten, bis er seinen zweiten Winter erlebt hat«, antwortete Vater.
Ich runzelte die Stirn, denn ich war mir ziemlich sicher, dass kein Ritual der neuen Religion geplant war. Crinan sah mich an, seine Mundwinkel zuckten hämisch, als meine offensichtliche Verwunderung uns verriet.
»Ihr fürchtet wohl, eine Taufe könnte Mananou erzürnen – oder wie heißt auch noch euer Totengott?«, fragte Crinan.
Als ich ein Kichern nicht unterdrücken konnte, weil Crinan den Namen unseres Gottes auf lächerliche Weise falsch ausgesprochen hatte, funkelte er mich zornig an, und ich verstummte. Auch Bethoc sah mich an, in ihren Augen lag eine Kälte, die mir Angst machte. Ihr Blick erinnerte mich an die Ungeheuer der Tiefe, vor denen meine Großmutter mich gewarnt hatte.
»Ihr Heiden«, sagte Crinan leise, ohne den Blick von mir abzuwenden, »erschreckt vor einer Blume, wenn sie ihre Blüte am falschen Tag öffnet. Ihr berauscht euch am Aberglauben ebenso wie am Bier. Wenn Ihr Euren Sohn getauft hättet, hättet Ihr sein Seelenheil in diesem ebenso wie im nächsten Leben gesichert, dann bräuchtet Ihr Euch nicht vor Euren primitiven Göttern zur fürchten.«
Während er sprach, verschwand die Maske der Höflichkeit, und offene Feindseligkeit breitete sich auf seinem Gesicht aus. Meine Wangen glühten, und meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich schaute zu meinen Eltern hinüber. Sie würden es sich doch sicherlich nicht bieten lassen, dass jemand vor ihren Untertanen so mit ihnen redete? Doch sie saßen beide nur schweigend da.
In dem Augenblick gab es für mich nur eine Möglichkeit, das Gefühl der Demütigung loszuwerden, das mir den Magen umdrehte. Ich wollte sehen, wie Crinan zu Boden ging, so wie ich einmal einen Mann hatte zu Boden gehen sehen. Ich kannte nur das Lied meiner Großmutter in unserer alten Sprache, aber ich war mir sicher, dass Crinan nicht in der Lage war, ein Schlaflied von einem Fluch zu unterscheiden. Genauso wie meine Mutter es an dem Tag gemacht hatte, als mein Vater sie geschlagen hatte, murmelte ich die Worte leise vor mich hin, während ich Crinan unverwandt anschaute.
»Cathain a bhuailfimid le chéile arís.«
Ein Schauer der Erregung lief mir über den Rücken, als Crinan plötzlich die Luft einsog und das Kreuz ergriff, das um seinen Hals hing. Ich flüsterte lächelnd weiter.
»Le toirneach tintreach nó báisteach.«
Dann nahm ich mir Bethoc vor. Ich versuchte, sie mit meinem Blick zu fixieren, aber sie setzte ein breites Lächeln auf, das jedoch eher boshaft als freudig wirkte. Erst da bemerkte meine Mutter, was ich tat, und hielt mir den Mund zu. Ich schrie, aber mein Schreien wurde von Bethocs Lachen übertönt.
»Crinan, du bist zu streng mit ihnen«, sagte sie. »Sie sind keine Heiden. Sie haben ihren Kindern bloß alberne Liedchen beigebracht, du hast von ihnen nichts zu befürchten.«
Er senkte verlegen den Blick, als Bethoc sich meiner Mutter mit einem vernichtenden Lächeln zuwandte. Meine Mutter lief rot an, aber meine Eltern schwiegen immer noch. Warum sagten sie denn nichts? Am liebsten hätte ich Crinan mit einem Stein den Schädel zertrümmert. Am liebsten hätte ich so laut geschrien, dass mein Schrei auf dem ganzen Meer zu hören war, bis zu den Göttern, damit sie unsere Ehre verteidigten. Aber meine Mutter hielt mir entschlossen den Mund zu.
Crinan wandte sich erneut an meinen Vater, die Maske des geheuchelten Respekts hatte er wieder aufgesetzt.
»Bedauerlicherweise können wir nicht bleiben, so gern wir auch an Eurem Festmahl teilnehmen würden.« Es klang überhaupt nicht so, als hätte er Lust dazu.
Meine Mutter ließ mich los, doch ich schaute zu Boden. Meine Wangen glühten, und mir brannten die Augen – das war die endgültige Niederlage. Ich war mir sicher, dass ich meine Scham nicht vor Bethoc würde verbergen können, wenn ich sie ansah, und dann würde ich in Tränen ausbrechen.
»Mein Gemahl spricht die Wahrheit«, sagte Bethoc, die plötzlich gelangweilt klang. »Wir sind auf der Reise zu einer entfernten Base in Northumbria. Ihre Tochter ist meinem Sohn Duncan versprochen, um unsere beiden Königreiche zu stärken.«
»Dem Bruder der Tochter wurde der Titel eines Earls versprochen«, fügte Crinan hinzu. »Er ist seiner Schwester sehr zugetan, man wird also dafür sorgen, dass er etwas in der Nähe bekommt, damit er sie jederzeit besuchen kann.«
Vater zuckte zusammen, und Mutter erbleichte und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Dann wäre Athall genau das Richtige«, sagte Vater in dem Versuch, die Sache herunterzuspielen, aber ich sah, wie sich Mutters Fingernägel in ihre Oberarme gruben.
Ich berührte ihren Arm, um sie zu beruhigen, doch sie schlug meine Hand weg.
»Vielleicht«, sagte Crinan in einem Ton, als verfügte er über geheimes Wissen. Bethoc sah ihn unverhohlen verächtlich an. »Aber der Ritt von Scone nach Fife ist bemerkenswert mühelos und für einen liebenden Bruder nicht zu weit.«
»Noch ist nichts entschieden«, sagte Bethoc eisig. »Wir sollten uns verabschieden, wir haben Euch schon lange genug belästigt.«
Wieder wurden ein paar Nettigkeiten ausgetauscht, geheuchelte Segenswünsche ausgesprochen. Dann machten sie sich auf den Weg.
Am Nachmittag desselben Tages endeten die Feierlichkeiten. Barrach verteilte die Speisen, die er vorbereitet hatte, unter den Ärmsten, und Fleisch und Fisch wurden für den Winter eingepökelt. Mutter zog sich in ihre Kammer zurück, bis auch der letzte Gast abgereist war, doch Vater verabschiedete tapfer jeden einzelnen seiner Gäste und gab ihnen Geschenke und seinen Segen mit auf den Weg.





























