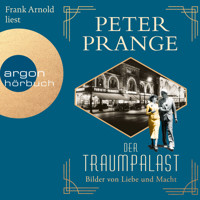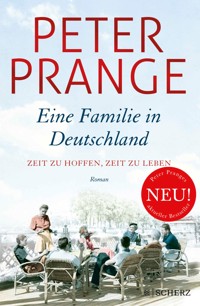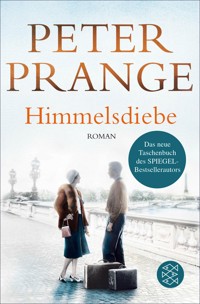Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Mittelalter verwurzelt, stößt er das Tor zur Renaissance auf: MAXIMILIAN I. von Habsburg - letzter Ritter des Abendlands, erster Kaiser der Neuzeit. Mitreißend schildert Bestseller-Autor Peter Prange den Mann, dessen Ideen und Taten Europa bis heute prägen und der doch ein Zerrissener ist - in der Liebe zu zwei ganz unterschiedlichen Frauen und im Zwiespalt zwischen Macht und Leidenschaft. Er wird einmal über halb Europa herrschen – doch als er seiner Lebensliebe Rosina von Krain begegnet, ist er noch ein "Bettelprinz", der sich am verarmten Wiener Kaiserhof nach Ruhm und Ehre sehnt. Angetrieben von seiner Idee, das alte römisch-deutsche Kaiserreich wiederaufzurichten, wirbt er um Maria, die Erbin von Burgund. Fortan wird er ein Zerrissener sein in der Liebe zu zwei ganz unterschiedlichen Frauen und im Zwiespalt zwischen Kalkül und Gefühl. Als Herrscher stößt er in seinem Reich das Tor zur Neuzeit auf – aber um welchen Preis? Die dramatische Lebensgeschichte des Tat- und Prachtmenschen, des Liebhabers und Kunstfreundes Maximilian erzählt Erfolgsautor Peter Prange ebenso sachkundig wie mitreißend.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Prange
Ich, Maximilian – Kaiser der Welt
Historischer Roman
Über dieses Buch
1519: Kaiser Maximilian I., Herrscher über halb Europa, Prachtmensch, Liebhaber, Kunstfreund, hat den Tod vor Augen. Er entledigt sich aller Insignien der Macht, hüllt sich in ein Grabtuch und legt sich in den Sarg, den er seit Jahren mit sich führt. Er ist bereit.
Sein Weg bis dorthin ist das Leben eines Mannes, der aus dem Mittelalter kommt und das Tor zur Neuzeit aufstößt. Er ist ein Zerrissener zwischen zwei Frauen, seiner ersten Liebe Rosina und seiner Ehefrau Maria, der Erbin von Burgund. In seinen Streben nach Ruhm und Ehre will er das alte römisch-deutsche Kaiserreich in neuem Glanze wiederaufrichten. Aber dieses Ziel hat einen hohen Preis. Wird er dafür sein Glück und das Glück seiner Kinder opfern? Wird es ihm gelingen, als Sieger Frieden in Europa zu stiften?
Die dramatische Lebensgeschichte des Tat- und Prachtmenschen, des Liebhabers und Kunstfreundes Maximilian erzählt Bestsellerautor Peter Prange ebenso sachkundig wie mitreißend. Die Verfilmung von ORF/ZDF war ein großer TV-Erfolg.
»Autor Prange ist selbst eine Art ›deutscher Kaiser‹ der historischen Erzählkunst!« Arno Udo Pfeiffer, buchbord.de
»Der Tübinger Autor setzt Päpsten, Königen und Künstlern literarisch ein Denkmal.« Express
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Peter Prangeist als Autor international erfolgreich. Er studierte Romanistik, Germanistik und Philosophie in Göttingen, Perugia und Paris. Nach der Promotion gewann er besonders mit seinen historischen Romanen eine große Leserschaft. Seine Werke haben eine internationale Gesamtauflage von über zweieinhalb Millionen verkaufter Exemplare erreicht und wurden in 24 Sprachen übersetzt. Mehrere Bücher wurden verfilmt bzw. werden zur Verfilmung vorbereitet. Der Autor lebt mit seiner Frau in Tübingen.
Weitere Titel von Peter Prange:
›Herrliche Zeiten. Die Himmelsstürmer‹, ›Der Traumpalast. Im Bann der Bilder‹, ›Der Traumpalast. Bilder von Liebe und Macht‹, ›Eine Familie in Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben‹, ›Eine Familie in Deutschland. Am Ende die Hoffnung‹, ›Winter der Hoffnung‹, ›Unsere wunderbaren Jahre‹, ›Das Bernstein-Amulett‹, ›Himmelsdiebe‹, ›Der Kinderpapst‹, ›Die Rose der Welt‹, ›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹, ›Die Philosophin‹, ›Die Principessa‹, ›Die Gärten der Frauen‹, ›Die Rebellin‹, ›Werte: Von Plato bis Pop – alles, was uns verbindet‹
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2014 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd°, München
Coverabbildung: Getty Images und Arcangel Images
Abbildungsnachweis: Schwert © www.buerosued.de
Landkarte und Stammbaum: Thomas Vogelmann, Mannheim
ISBN 978-3-10-402887-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
Burg von Wels, Oberösterreich, Januar 1519
Erster Teil
Wiener Neustadt, Frühjahr 1473
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Zweiter Teil
Gent, Januar 1477
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Dritter Teil
Plessis-les-Tours, Spätsommer 1477 [Teil 1]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
Plessis-les-Tours, Spätsommer 1477 [Teil 2]
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
Vierter Teil
Gent, Frühjahr 1482
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Fünfter Teil
Vor Béthune, Juli 1487
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Sechster Teil
Nürnberg, Mai 1490
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Epilog
Bologna, Februar 1530
Nachwort und Zeittafel
Personenverzeichnis
Für meine Leserinnen und Leser
Prolog
Der Kaiser
»Wer sich im Leben kein Gedächtnis macht, der hat im Tod kein Gedächtnis, und desselben Menschen wird mit dem Glockenton vergessen.«
Maximilian I. von Habsburg
Burg von Wels, Oberösterreich, Januar 1519
Sie erreichten die Burg im Abendgrauen. Schwaden von Pulverschnee trieben ihnen entgegen, in eisiger, lautloser Stille.
Der kaiserliche Tross kam aus Innsbruck und hatte den weiten Weg ohne viel Rasten zurückgelegt, erst zu Wasser, dann zu Lande, wobei der Kaiser die mitgeführte Sänfte verächtlich abgetan hatte. Er war sein Leben lang ein ausdauernder Reiter gewesen. Hier aber, hinter den schützenden Toren seiner vertrauten Stadt Wels, ließ er die Zügel seines Pferdes, kaum dass sie angehalten hatten, fahren und sagte: »Ich bin müde. Weiter geht es nicht mehr.«
War es wahrhaftig er, der so sprach? Maximilian, römisch-deutscher Kaiser, der sein gewaltiges Reich jahrzehntelang vom Sattel aus regiert, der seinen umherziehenden Hofstaat bis an die Grenzen seiner Kräfte gefordert, selber aber nie Müdigkeit gekannt hatte? Ohne Zögern war Rosina, die mit den Damen reiste, zu ihm geeilt. Die eisklare Luft hüllte den Tross in ein seltsames Schweigen, in der die Stimme des Kaisers weit trug, obgleich er gedämpfter sprach, als Rosina es von ihm kannte. Als sie ihn die wenigen Worte sagen hörte, wusste sie, dass es tatsächlich nicht mehr weiterging, sondern hier zu Ende war. Sie würden die Burg, in der sie so oft gemeinsam angekommen waren, nicht mehr gemeinsam verlassen.
Dass er an Kraft verlor, war schon im vergangenen Sommer in Augsburg nicht zu übersehen gewesen. Unter den Ständen des Reichstags hatte es Getuschel gegeben: Der Kaiser, einst Inbild unverwüstlicher Manneskraft, sei fahl im Gesicht, gelb seine Haut und die Wangen eingefallen. Rosina bemerkte vor allem, dass seinem Blick etwas fehlte. Dieser helle, klare Blick aus seinen Bernsteinaugen, der ihr so oft die Sinne verwirrt hatte, schien auf einmal trüb. Wir sind alt geworden, mein Liebster. Aber du darfst doch nicht rascher ans Ende kommen als ich!
Sie hätte ihm gern geholfen, doch nach dem halben Jahrhundert, das sie an seiner Seite verbracht hatte, wusste sie: Er hätte es ihr nicht gedankt. Er war noch immer Maximilian, geboren, um zu herrschen und das Schicksal zu formen, so wie er als Jüngling schon mit bloßen Händen eiserne Hufeisen verformt hatte. Wenn ihn etwas in die Knie zwang, wollte er keine mitleidigen Zeugen.
Maximilian stieg von seinem Braunen, schlug die Steigbügel über und klopfte dem Tier den Hals, ehe er es seinem Burschen überließ. Allein, hochaufgerichtet, schritt er durch den knirschenden Schnee der Burg entgegen, die er nach seinen Wünschen hatte umbauen lassen. Dass seine Schritte schleppend waren, bemerkte nur, wer ihn sein Leben lang kannte. Am Tor des Südtrakts klopfte er dem Wächter, der vor ihm das Knie beugte, leutselig auf die Schulter, wie er es immer tat. Erst auf der Treppe, auf dem Weg zu seinem Lieblingssaal, in deren Decke er rohe Holzbalken hatte einziehen lassen, damit sie nach Wald und Jagd dufteten, brach er zusammen.
Zwei seiner Kammerherren trugen ihn hinauf. Wolf sollte es tun, durchfuhr es Rosina, Wolf, der Freund seit Kindertagen. Aber Wolf war nicht mehr da. Von ihrem Dreigestirn waren nur noch sie beide übrig, Max und Rosina, und sie wusste, es würden nicht Tage, sondern Wochen vergehen, bis die hohen Herren, sein Kanzler und all die anderen Besserwisser, Rosina erlaubten, Max zu sehen.
Das Abendessen konnte der Kaiser nicht mehr in seinem geliebten Saal einnehmen. Stattdessen trugen sie ihn in ein Schlafgemach hinter der Pfeilerhalle. Den Raum mit Blick in den Hof, wo er die Hufe der Pferde scharren hörte, sollte er nicht mehr verlassen. Von hier aus regierte er noch einmal für kurze Zeit das Riesenreich, das ständig vom Zerfall bedroht war wie das Gebiss eines Greises. Eine Gesandtschaft aus Kroatien traf ein und bat um Hilfe für ihre Grenzstädte, die immer wieder von Türken überfallen wurden. Maximilian hatte vom Kreuzzug gegen die Türken geträumt, sein Leben lang, doch jetzt konnte er den Gesandten nur sagen, dass es ihm am Geld fehlte. Woher sollte er es auch nehmen? In Innsbruck war sein Hofstaat schmählich aus den Gasthäusern gewiesen worden, weil seine Schulden sich himmelhoch türmten und der Kaiser nicht imstande gewesen war, sie zu bezahlen.
Es war nicht mehr Dezember, sondern Januar, nicht mehr das endlose Jahr 1518, sondern ein blankes, neues Jahr, als der Kanzler in ihre Kammer kam, um sie zu holen.
Rosina sprang auf. »Steht es so schlecht?«
Der kaiserliche Berater senkte den Blick. »Der Priester ist bei ihm.«
»Georg Reysch?« Max vertraute dem kauzigen Kartäuser, dem wenig Menschliches fremd war. »Er gibt ihm die Sakramente?«
Der Kanzler bekreuzigte sich.
Rosina nahm ihr Schultertuch, das sie vors Feuer gehängt hatte, um es anzuwärmen. Durch die Fugen der Burg kroch Kälte, und die Nacht würde lang werden.
Würde sie jemals enden?
In der Tür von Maximilians Gemach blieb Rosina stehen, während der Kanzler dem Kaiser meldete, dass seine Maîtresse en titre gekommen sei. Früher hatten nicht wenige der Herren Max um Rosina beneidet, um ihre dunkle Schönheit und die Sinnlichkeit, aus der sie keinen Hehl machte. Heute mochte sich mancher fragen, warum er die verblühte Mätresse bei sich behielt. Doch Rosina wusste, in seinen Augen war sie immer noch schön. Müde lehnte sie ihr Gesicht an den Türstock und spähte ins Halbdunkel, in dem ihr Geliebter lag. Für die Welt sind wir zwei alte Leute, die ihre Zeit überlebt haben. Die zwei lebensgierigen Kinder, die wir waren, sehen nur noch du und ich.
Das Zimmer erschien ihr warm, fast überheizt. Vor den Erker mit dem Kreuzstockfenster hatte jemand einen Gobelin gehängt, um den jaulenden Nachtwind auszusperren. Das Heer der Berater war in den Hintergrund getreten, stand jetzt aufgereiht wie einstmals Max’ Holzsoldaten in den Schatten und wartete. Auch Georg Tannstetter, der Erste unter den Leibärzten, hatte sich bereits dorthin zurückgezogen, da seine Kunst hier nichts mehr vermochte. Nur zwei Männer bewegten sich im Raum. Der eine, um seine Aufgabe zu Ende zu bringen, und der zweite, weil er niemals still saß.
Georg Reysch, der Kartäuserprior, beugte sich noch einmal über das Gesicht seines Kaisers, dem er die Stirn mit dem heiligen Chrisam gesalbt hatte, und legte ihm die Hostie auf die Lippen. Zum letzten Mal. Leib und Blut Jesu, Wegzehrung für die Reise ohne Rückkehr. Eine gemurmelte Segensformel beendete das kleine Seelenamt. Der Priester wandte sich ab und stellte die Schalen des Versehbestecks zurück auf die Kredenz.
Das Geschöpf, das am Fußende des Bettes auf und ab hüpfte, hätte Rosina gern ans andere Ende der Welt verbannt. Aber es gehörte hierher, in dieses Zimmer und in diese Nacht. Kunz von der Rosen: Narr des Kaisers und Vollstrecker ihrer aller Schicksal. Sein durchpflügtes Gesicht schien so alt, als hätte er den Tod aus der Taufe gehoben. Noch immer flink wie ein Äffchen winkte der ewige Zeremonienmeister die Berater heran, kaum dass der Priester vom Bett des Kaisers zurückgetreten war. War es nicht seltsam, dass ein schrumpeliger Zwerg diesen kraftstrotzenden Weltenherrscher überleben sollte? Eine verkrüppelte Kiefer, die windzerzaust dem Sturm widerstand, der die prächtige Eiche fällte …
Jetzt hüpfte der Zwerg zu Rosina, die ihm im Lauf der Zeit manches gewesen war: Verbündete, Feindin, Mittel zum Zweck. Mit seiner Affenpfote winkte er sie in den Raum. Die Gegenwart des Todes erfasste sie plötzlich mit solcher Macht, dass sie zurückscheute. Dann aber sah sie keinen Tod mehr, sondern nur noch Max. So wie damals im Stroh. Sie musste sich beherrschen, ihm nicht entgegenzurennen.
Das Bett unter dem roten Baldachin war ihr nicht unbekannt. Ein so bequemes Polster hatten wir nicht allzu oft für die Liebe, mein Herr und Kaiser. Vor uns war kein Ort sicher, nicht einmal in den letzten Jahren, auch wenn die Glieder schon gehörig ächzten. Als er ihre Schritte hörte, wandte er ihr das Gesicht zu. Gelb wie Wachs und bis auf die Knochen ausgezehrt. Seine mächtige Habsburger-Nase, bei der sie ihn so manches Mal gepackt hatte, um ihm den verstockten Kopf durchzurütteln, glich jetzt endgültig dem Schnabel eines Falken.
Der nimmermüde Kunz rollte ein Pult mit Schreibutensilien herbei und stellte es den Herren zurecht. An Rosinas Seite schob er eine geschmiedete Truhe, die sie sogleich erkannte. Sie drehte sich weg. Noch hatte sie kein Auge dafür. Nur für Max. Sie nahm seine Hände, gab den Teufel darum, ob es sich schickte. Wann hätten wir uns je darum geschert?
Einst hatte er triumphierend gelächelt wie einer jener römischen Feldherren und Cäsaren, von denen er abzustammen meinte. Wie einer, der tollkühn Brücken hinter sich abbricht, um voller Tatendrang vor seinen Füßen neue zu errichten. Mach halblang, Gernegroß, hatte Rosina in solchen Momenten gespottet, dir quillt der Stolz wie Dampf aus den Ohren. Nie hatte sie ihn wissen lassen, wie sehr sie dieses Lächeln liebte.
Jetzt war davon nichts mehr übrig. Dunkel flackerte sein Blick. »Ich bin gescheitert, nicht wahr?« Unsäglich schwach klang seine Stimme. »Das Reich, das ich festigen wollte, zerbröckelt mir unter den Händen. Und Karl ist noch nicht gewählt!«
Karl, seinen Enkel, wollte er noch zu Lebzeiten als Nachfolger einsetzen, um dem Haus Habsburg die Kaiserwürde zu sichern.
»Sorgt Euch jetzt nicht darum, Majestät.«
Täuschte sie sich oder war da ein Zucken im Winkel des Mundes? »Wenn nicht jetzt – wann dann, figliola? Es ist doch nichts fertig. Nicht einmal mein Grabmal, trotz all der Jahre, die daran schon herumgepfuscht wird.«
Sie presste die Lippen zusammen. Zu lachen, wenn ihr zum Weinen war, hatte sie gelernt, aber jetzt wollte es nicht gelingen.
»Ich habe versagt, nicht wahr? Was ich ihr gelobt habe – ich habe es nicht gehalten.«
Ihr. Der Schmerz, der sich in Rosinas Herz grub, war so roh und harsch und frisch wie vor vierzig Jahren. Die anderen Frauen bedeuteten nichts – weder die flüchtigen Gespielinnen oder Schlafweiber noch die zwei traurigen Gestalten, mit denen er sich an neuen Ehen versucht hatte. Nur die eine. Noch immer und auf ewig – sie.
Rosina betrachtete sein Gesicht. Sie hatte ihn ohrfeigen wollen, jedes Mal, wenn er mit diesem weltentrückten Blick von jener Frau zu sprechen begann, und oft genug hatte sie es getan. Jetzt sah sie das Flehen in seinen Augen und wollte es nicht mehr. Was immer die andere ihm gewesen war und was sie selber nicht hatte sein dürfen – sie, Rosina, war die Frau, die ihm im Sterben zur Seite stand.
Sie strich ihm über den Handrücken. »Doch, Majestät. Ihr habt es gehalten.«
»Aber ich kann meinem Enkel Karl Burgund nicht übergeben.«
»Ihr übergebt ihm ein geeintes Reich.« Rosina nahm all ihre Kraft zusammen, um ihrer Stimme Festigkeit zu geben. »Eines, in dem die Sonne nicht untergeht, Majestät.«
Die Augen, deren Funkeln Rosina immer wieder um den Verstand gebracht hatte, richteten sich noch einmal auf sie, und jetzt zupfte an den Winkeln des Mundes sein Lächeln. »Danke, mia bella bugiarda. Mein süßes, verbotenes Mädchen. Danke für alles. Und keine Majestät mehr. Damit ist es vorbei.«
Er drückte ihre Hände mit einem Rest seiner alten Kraft. Manchmal hatte sie ihn angefaucht: Lass mich los, du Untier, du brichst mir die Knochen! Dann wandte er sich an Kunz: »Ist zum Schreiben alles bereit?«
»Alles nach Wunsch, Majestät.«
»Keine Majestät mehr«, verwies Maximilian auch den Narr. Seine Hand zitterte, als er sie aus Rosinas Händen befreite, das kaiserliche Siegel von dem schmalen Tisch neben seinem Bett nahm und es den Wartenden entgegenhielt. Gerade noch rechtzeitig, ehe es zu Boden fiel, schob Kunz ein samtenes Kissen darunter, auf dem er es in den dunklen Teil des Raumes, zum Heer der Berater trug.
Der Kaiser beugte sich vor, um die golddurchwirkte Stola von seinen Schultern zu streifen, zog sich die Ringe von den Fingern und hielt alles, ohne hinzusehen, ins Leere. Wiederum war das Äffchen Kunz zur Stelle und nahm ihm die Kleinodien ab. »Ich habe die Zeichen meiner Macht abgelegt«, sagte Maximilian. »Fortan untersage ich einem jeden, mich mit den Titeln anzusprechen, die zu tragen ich auf Erden berechtigt war. Mein Testament ist geschrieben und um alles Nötige ergänzt. Lediglich die Anweisungen für mein Begräbnis bedürfen noch der Niederschrift.«
Er machte eine Pause, sandte seinen müden Blick zur Tür, als erwarte er noch einen Gast. »Bringt meinen Sarg«, sagte er dann. Kunz, der die dazu nötigen Männer bereits herbeibeordert hatte, erteilte mit rudernden Armen Befehle.
In der Stille trommelte Rosinas Herz. Bereits seit vier Jahren führte Maximilian seinen Sarg auf all seinen Reisen mit sich. Er hatte ihn selbst entworfen, ein schlichter Kasten aus geschliffenem Holz. In der Abgeschiedenheit ihrer Kammer hatte Rosina ihn deswegen gescholten: Alles musst du in Szene setzen wie ein Schauspiel. Selbst den Tod versuchst du, deinem Willen zu unterwerfen. Als jetzt der Sarg, der für den überlebensgroßen Kerl viel zu schmal schien, hereingetragen wurde, dachte sie: Er mag sich darin geborgen fühlen. Ein wenig Ruhe vor dem letzten Sturm.
»Hilf mir, Rosina.«
Seine Stimme ließ sie herumfahren. Fragend sah sie ihn an.
»Dir wird es nicht zuwider sein, mir mit dem Niederkleid zu helfen.« Der neuerliche Versuch eines Lächelns war von Schmerz verzerrt.
Wie hätte es Rosina zuwider sein können? Um die straffen Lenden, von denen sie die Decke herunterschob, waren einmal ihre süßesten Träume gekreist. Wie oft haben wir nicht schnell genug zupacken können, haben Stoff in Fetzen gerissen und einander wehgetan, weil wir zu gierig waren, um sacht zu sein? Jetzt war sie sacht. Öffnete die Truhe, die Kunz bereitgestellt hatte, und entnahm ihr das letzte Gewand, das sie ihm um die Hüften wickelte.
»Das Leichenhemd auch, figliola.« Sie musste sich zu ihm niederbeugen, um seine Stimme zu vernehmen.
»Hat das nicht Zeit bis – danach?«
»Ich will es selbst tun!«, begehrte er auf. Kaum mehr hörbar, aber noch immer herrisch. Rosina wollte unter Tränen lachen.
Seine prächtigen Schultern waren knochig geworden. Ein letztes Mal liebkoste sie sie, während sie ihm half, die Falten des Totenkleides glattzustreichen. Ihr Gaumen war ausgetrocknet, sie musste schlucken.
»Da mein Grabmal noch nicht fertig ist, wünsche ich, in der Sankt-Georg-Kapelle in Wiener Neustadt begraben zu werden«, wandte sich Maximilian an die Berater, die sogleich zu schreiben begannen. In jener Kapelle war er einst getauft worden. Maximilian, ersehnter Kaisersohn, die leuchtende Hoffnung für Geschlecht und Reich. Hatte damals, als sie ihn im Glanz des Osterfestes übers Taufbecken hoben, die Luft nach Frühling geschmeckt? Wenn sie ihn zu Grabe trugen, würde der Morgen dunkel sein und das Land erstarrt unter Eis.
»Näht meinen Leichnam in einen Sack und begrabt ihn unter den Stufen des Altars«, fuhr Max schwer atmend fort. »So dass der Priester, wann immer er die Messe zelebriert, mein Herz mit seinen Tritten traktiert.«
Rosina wollte auffahren, die Berater holten tief Luft, und selbst Kunz, den sonst nichts auf der Welt aus der Fassung bringen konnte, sperrte wortlos das Maul auf. »Mein Leichnam soll nicht gesalbt werden«, fuhr Max unbeirrt fort. »Stattdessen lasst mir die Zähne herausbrechen, meinen Schädel kahl rasieren und meinen Leib geißeln, als Sühne und Strafe für mein Leben.«
»Niemals!«, rief Rosina.
Sein Blick traf sie. »Du weißt wofür.« Dann presste er die Lippen aufeinander und verstummte.
Zu ihrem Entsetzen sah Rosina, dass seine Hand nach dem Sarg tastete, dass er das Gewicht seines wundgelegenen Körpers verlagerte und versuchte, die Beine über den Rand des Bettes zu strecken. Er würde darauf bestehen, auch dies Letzte selbst zu tun, würde es keinem anderen überlassen.
Sich ihm entgegenzustellen, hatte nie Sinn gehabt. Also stützte sie ihn, damit er sich keinen Schmerz zufügte. Sein Blick flackerte jetzt so heftig, dass er vermutlich nichts mehr sah, und sein Atem ging in flachen Stößen. Als er jedoch spürte, dass die hölzernen Wände seine Schultern umfassten, kam eine Art von Ruhe über ihn. Langsam sank sein Kopf zurück, das Gesicht von Resignation gezeichnet. Rosina schaute ihn an. Er hatte recht, sein Werk war nicht vollendet, und vielleicht gab es das auf Erden auch nicht: Vollendung. Aber er hatte getan, was ihm zu tun blieb.
Rosina kauerte sich neben dem Sarg am Boden und wartete. Eine klamme Kälte verdrängte die Wärme im Raum. Sie zog sich das Tuch um die Schultern und umfasste ihre Knie. Die Stundenkerze brannte herunter, und Kunz hieß einen Diener eine neue anzünden.
Vielleicht war Rosina für ein paar Augenblicke eingeschlafen, als die Stimme Tannstetters sie aufschrecken ließ. »Der Kaiser ist tot.« Weich und leise. Mit dem Finger an seinem Hals.
»Der Kaiser ist tot«, wiederholte der Kanzler gewichtig, und es begann ein allgemeines Kreuzeschlagen. »Schreib Er das nieder. Die dritte Morgenstunde. Den zwölften Jänner.«
Verstohlen, mit einem Hüpfschritt, war Kunz hinter Rosina getreten. »Das Gedächtnis der Welt wird richten«, zischte er an ihrem Ohr. »Über ihn. Über dich. Über uns alle.«
Erster Teil
Der Bettelprinz
»Die Frauen werden ihn gernhaben müssen.«
Kaiser Friedrich III. über seinen Sohn Maximilian
Wiener Neustadt, Frühjahr 1473
1
Der prächtige Turnierharnisch lag achtlos hingeworfen auf der Stallgasse. Als Rosina sich aufsetzte, um einen Strohhalm aus ihrem Strumpf zu zupfen, musste sie lächeln. Etwas von einem toten Käfer hatte das vielgliedrige Ding aus poliertem Metall, in dem die Sonne sich spiegelte. Männer stürzten sich in Schulden, um ein solches Stechzeug zu besitzen. Rasseln und Scheppern, begleitet vom Gewieher der Pferde, drang von draußen herbei, wo sich die Ritter für das Turnier bereitmachten. Nichts Erstrebenswerteres schien es für sie zu geben, als in voller Rüstung einander aus dem Sattel zu heben. Sobald jedoch das Liebeswispern einer Schönen sich ins Waffenklirren mischte, kam so mancher aus dem verschraubten Blech nicht schnell genug heraus.
Das galt auch für Max, der sich den Verschlag in der Stallgasse mit ihr teilte. Mit Schwung warf er sie ins Stroh und verschloss ihr die Lippen mit den seinen. Rosina musste noch mehr lachen, gleichzeitig belustigt und seltsam verzückt. Obwohl es in ihrem ganzen Leib kribbelte, packte sie ihn bei den Schultern, über denen er weder Blech noch Leder trug, und kniff ihm ins Fleisch. Ein Aufschrei entfuhr ihm, und er musste ihre Lippen freigeben. Was sie selbst im nächsten Augenblick bedauerte.
»Du Satansweib!« Er setzte sich auf und rieb sich die Schulter. Ein paar Strähnen seines gewellten, goldgelben Haars fielen ihm in die Stirn, in seinen Augen funkelte es, und wenn Rosina an seinem muskulösen Oberkörper herabsah zu der straffen Bauchdecke, tat es ihr fast leid, dass er das Beinzeug der Rüstung anbehalten hatte. Dabei war er nicht einmal schön, seine Nase hätte einem Falken besser gestanden, und dem Alter nach war er fast noch ein Kind. Erst vierzehn Jahre zählte er, zwei Jahre weniger als Rosina. Aber er hatte etwas an sich, das allen jungen Mädchen und sogar mancher erwachsenen Frau einen Seufzer entlockte: Schaut her – ein Mann!
Mit seinen Bernsteinaugen erwiderte er ihren Blick. »Wie schön du bist«, flüsterte er. Die dunkle Stimme war die eines Mannes, aber die Erregung darin, die ungeduldige Freude enthielt noch eine Ahnung von dem Jungen, der ein Geschenk in den Händen hält und nicht abwarten kann, es auszupacken.
Sollte Rosina ihn gewähren lassen? Sie war Kammerfrau bei Prinzessin Kunigunde, der Tochter des Kaisers und Maximilians Schwester. Ihr Onkel, der Bischof von Salzburg, dem sie die Stellung im Haushalt der Prinzessin verdankte, hatte ihr eingeschärft, stets den Standesunterschied zu achten. Sie sei die Tochter eines Kärntner Freiherrn und einer Italienerin unbestimmter Herkunft – ihr Schicksal sei es, auf einen braven Kammerherrn oder allenfalls einen Ritter zu hoffen.
Als würde Max ahnen, was in ihr vorging, zog er sie an sich, und ehe sie sich’s versah, küsste er sie von neuem. Rosina ließ sich fallen und genoss das schwindelerregende Gefühl. Woher wollte ihr Onkel wissen, was ihr Schicksal war? Er kannte die Zukunft doch genauso wenig wie sie!
»Rosina«, raunte Max in ihr Ohr. »Ich will dich, mia bella bugiarda. Jetzt. Ganz.«
Durch die Art, wie er ihren Körper erkundete, mit seinen Augen und seinen Händen, spürte Rosina, wie schön sie war. Trotzdem wusste sie, dass sie ihr Herz festhalten musste. Sanft, aber bestimmt schob sie ihn zurück.
»Eile mit Weile, Hoheit. So weit sind wir noch nicht.«
»Aber ich will dich!«, rief er, mit blitzenden Augen.
»Ach, Ihr wollt mich?« Rosina lachte. »Gestern noch das Stottergöschl, das keine drei Worte sagen kann, und heute säuselt er schamlose Wünsche.«
Sein Blick wurde finster, und über der großen Hakennase bildeten sich zwei Furchen. »Ganz wie du willst«, versetzte er schneidend. Beim Versuch, sich in dem schweren Beinzeug zu erheben, geriet er ins Schwanken. »Glaub ja nicht, du wärst die Einzige, Rosina. Es gibt andere, nicht weniger schön als du, denen bin ich schon ziemlich lange Manns genug!«
Sie hatte ihn verletzt. Stottergöschl, so hatten die Wiener ihn als Kind genannt, weil er noch mit drei Jahren kein Wort hatte richtig aussprechen können und wie ein Säugling stammelte. Obwohl er das Stottern längst überwunden hatte, setzte die Kränkung ihm sichtlich immer noch zu.
Sie hielt ihn am Handgelenk fest und sah zu ihm auf. »Ist das dein Ernst, Max? Bin ich nicht die Schönste?« Ihn zu duzen und bei der Koseform seines Taufnamens anzusprechen, hatte sie sich nie zuvor herausgenommen.
»Doch«, sagte er. »Du bist die Schönste, und das weißt du. Aber einen Narren aus mir zu machen, erlaube ich keiner, nicht mal dir.«
Rosina sprang auf und legte ihm die Hände auf die Schultern. Während sie ihn auf die schmollend vorgestreckte Lippe küsste, flüsterte sie: »Wer käme denn auf solche Gedanken und wollte aus dir einen Narren machen?«
Gleich wurde er wieder übermütig, neigte den Kopf und wollte den Ansatz ihrer Brust küssen. Zärtlich griff Rosina in seine Locken, um ihn daran zu hindern. »Meinst du nicht, du solltest dir die Freuden, die du begehrst, erst mal verdienen?« Wie auf ein Zeichen drang das Klirren sich kreuzender Klingen in ihr Versteck, und gleich darauf wieherte ein Pferd. Rosina wies mit dem Kinn in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. »Willst du in den Schranken meine Farben tragen? Oder bin ich dir das nicht wert?«
Nur einen Herzschlag lang ließ seine Miene einen Anflug von Zweifel erkennen. Rosina wusste, seit er am Morgen die Rüstung angelegt hatte, brannte er darauf, in die Turnierbahn einzureiten und sich mit anderen Rittern zu messen. Trotzdem hatte er den Harnisch wieder ausgezogen – ihretwegen.
Max umfasste ihr Kinn und zwang sie, zu ihm aufzublicken. »Eure Farben, werte Dame.« Während er ihr seine Linke entgegenstreckte, hob er mit dem rechten Arm den Harnisch, der doch so schwer war wie ein Kalb, mit solcher Leichtigkeit vom Boden, als wöge er nicht mehr als ein Lederwams. Rosina sah den Stechhelm, der am Rücken der Rüstung befestigt war und nach vorn herunterklappte wie bei einem Gehängten. Gott gebe acht auf deinen Kopf, mein süßer Prinz.
Sie löste einen Streifen Seide von ihrem Kleid und wand ihn um seinen Unterarm. Als sie ihm noch einmal über die Wange strich, nahm er ihre Hand und drückte auf die Innenseite einen Kuss. »Vergiss nicht – ich komme wieder. Um mir meinen Lohn zu holen.«
»Das werden wir ja sehen, Gernegroß.« Sie gab ihm einen Klaps und fuhr ihm durchs Haar.
Statt einer Antwort bückte er sich zu Boden, wo ein Hufeisen im Stroh lag, hell und blank. Er hob es auf und hielt es in die Höhe. »Siehst du dieses Eisen?«
»Na und?« Rosina zuckte die Schultern. »Das muss der Rappe verloren haben, den sie vorhin zum Stechen holten.« Plötzlich ritt sie der Teufel, und mit einem Grinsen fügte sie hinzu: »Der steirische Ritter, der ihn reitet, ist übrigens nicht weniger stattlich gebaut als sein Tier.«
Ohne ein Wort erwiderte Max ihren Blick, und während er ihr in die Augen schaute, packte er mit beiden Händen die Schenkel des Eisens und faltete es zusammen, als wäre es aus Pergament. Dann drückte er es ihr in die Hand und wandte sich ab.
Am Ende der Stallgasse schaute er noch einmal über die Schulter zu ihr zurück. Sein Blick versprach ihr ein Himmelreich, und mit rasendem Herzen wünschte sich Rosina, er möge sein Versprechen halten.
2
Natürlich glich ein Turnier, das der geizige Kaiser für seine Gäste gab, nicht den großartigen Spektakeln, die Max aus den Ritterromanen und Heldensagen kannte. Seine Mutter Eleonore, eine gebürtige Portugiesin, hatte ihn damit gefüttert wie mit Milch und kandierten Früchten. Aber seine Mutter lebte nicht mehr, seit sechs Jahren war sie schon tot. Im Geiste sah Max wieder Rosinas Gesicht, ihr verführerisches Lächeln, ihren spöttischen Blick … Nein, er war kein Kind mehr, sondern ein Mann, und ein Mann erfocht Turnierpreise nicht für seine Mutter, sondern für seine Liebste.
Mit seiner schweren Rüstung, deren Blechplatten bei jedem Schritt laut klirrten, trat Max zu seinem Pferd, dem der Bursche gerade die Rossstirn und den Schellenkranz umlegte, damit es beim gegnerischen Angriff nicht scheute. Das Tier, das durch den Schutz ohne Augenlöcher nichts sah und kaum etwas hörte, war allein auf die Hilfen seines Reiters angewiesen. Nur wenige Pferde besaßen Vertrauen genug und waren hinreichend ausgebildet, um sich ihrem Reiter in solcher Weise in die Hand zu geben. Iwein, sein Brauner, dem jetzt der schützende Stechsack vor die Brust gebunden wurde, war ein solches Pferd. Max legte ihm die Hand zwischen die wachsam gespitzten Ohren und spürte sein Blut pulsieren. Als ihm die goldgelbe Decke mit dem Doppeladler über den Leib geworfen wurde, regte das Tier nicht einen Muskel.
Max hatte den Braunen, ein Geschenk seines Onkels Sigmund, selbst ausgebildet, obgleich sein Vater eingewandt hatte, er sei dafür zu jung und werde sich nur die Glieder brechen. Max hatte ihn eines Besseren belehrt. Solange er sich erinnerte, hatte er die Aufgaben eines Ritters allen anderen vorgezogen, hatte lieber im Sattel gesessen als in der Studierstube, um lateinische Vokabeln zu lernen, lieber mit Hunden und Falken gearbeitet, als in der Kanzlei den Belehrungen seines Vaters und dessen Beratern zu lauschen, und jede sich bietende Gelegenheit zur Jagd und zum Wettstreit genutzt. Die Welt war, so seine tiefste Überzeugung, weder eine Studierstube noch eine Kanzlei, sondern ein einziger großer Turnierplatz, auf dem die Edelsten sich maßen, um Ruhm und Ehre zu erlangen.
Max spürte, wie ihm unter dem gefütterten Leinen der Helmhaube die Hitze in die Wangen stieg, und mit einem Lachen packte er den Knauf des Sattels. Zwei Mann waren für gewöhnlich nötig, um einen voll gerüsteten Turnierer auf den Rücken seines Pferdes zu hieven, doch Max schaffte es allein. Verstohlener Applaus wurde laut. Max tat, als bemerke er ihn nicht, ließ sich die Lanze reichen und legte sie auf dem Rüsthaken des Brustpanzers auf. Dass sich alle Blicke auf ihn richteten, wenn vor den Schranken sein Name verkündet und sein Wappen aufgezogen wurde, war er von klein auf gewohnt und störte ihn nicht. Im Gegenteil. In der Bewunderung der Menschen badete er wie in einem Zuber mit französisch parfümierter Seife, die er im kärglichen Haushalt seines Vaters allerdings kaum je bekam.
Mit sachtem Druck schloss Max die Schenkel um Iweins Leib und lenkte den Hengst im versammelten Schritt vom Hof. Er fieberte der Stechbahn entgegen – wer immer sich ihm dort entgegenstellen würde, er sollte in ihm einen mehr als würdigen Gegner kennenlernen. Für dich, Rosina.
»Max! So warte doch – Max!«
Gedämpft durch den Helm erkannte Max die Stimme seines Freundes Wolf von Polheim. Der um ein Jahr ältere Sohn aus altem Adel war Max als Kämmerer beigegeben worden, noch ehe sie beide auf eigenen Beinen laufen konnten. Max hatte es flinker gelernt als Wolf, doch wann immer er gestürzt war, hatte Wolf ihm aufgeholfen. Die Hofschranzen nannten ihn darum Maxls schmalen Schatten. Tatsächlich aber war der unscheinbare junge Mann der wohl einzige Mensch, von dem Max sicher annehmen konnte, dass er ihn liebte.
Jetzt sprang ihm Wolf in den Weg und griff Iwein in den Zügel. Der Hengst, der eine fremde Hand nicht gewohnt war, scheute und versuchte zu steigen. Max hatte alle Mühe, ihn zur Räson zu bringen. »Hast du den Verstand verloren? Wenn Iwein dir den Schädel eingeschlagen hätte, hätte er mehr Mitleid verdient als du.«
»Max, du darfst nicht zum Stechen.« Noch einmal hob Wolf die Hand, um nach dem Zügel zu greifen.
»Ich soll was nicht dürfen?«
»An dem Turnier teilnehmen. Dich mit der Lanze stechen.«
»Aha. Und wer will mir das verbieten?«
»Dein Vater! Erst beim Frühstück hat er gesagt, er wünsche nicht, dass sein Sohn sich einer solchen Gefahr aussetzt.«
»Mein Vater soll sich wünschen, was er will.« Gelassener, als er sich fühlte, zuckte Max die blechbewehrte Schulter. »Außerdem muss er es ja nicht unbedingt erfahren.«
»Aber er weiß es doch schon!«, rief Wolf. »Irgendwer hat es ihm verraten, kaum dass du im Harnisch warst.«
Inzwischen hatten sie die Aufmerksamkeit der ringsum versammelten Knappen und Knechte auf sich gezogen. Ein paar Spötter tuschelten und lachten.
»Verstehe«, erwiderte Max. »Und du sollst mir jetzt den Harnisch runterreißen, damit dem kaiserlichen Wunsch Genüge getan ist, richtig?« Er spürte, wie der Zorn in ihm aufstieg. Er hatte es satt, sich wie ein dummer Junge behandeln zu lassen. Er war ein Mann, der für seine Angebetete in den Kampf zog!
Unglücklich verzog Wolf das Gesicht. »Nimm doch Vernunft an, Max. Dein Vater ist außer sich, er droht dir mit allen Teufeln!«
»Ich pfeife auf die Drohungen meines Vaters!« Max warf den Kopf in den Nacken. »Hat er damit etwa die Böhmen aufgehalten oder die Ungarn? Genauso wenig hält er mich damit auf. Er bellt nur, das ist alles, was er kann. Zum Beißen fehlen ihm die Zähne.« Max straffte die Zügel und trieb sein Pferd an. »Aus dem Weg.« Ohne nach links und rechts zu schauen, trabte er an, so dass Wolf nichts anderes übrigblieb, als mit einem Aufschrei aus dem Weg zu springen. Die Spötter verstummten.
Unter der Fahne mit seinem Wappen nahm Max Aufstellung. Der Anblick der fast endlosen Bahn im gleißenden Sonnenlicht erregte ihn. Platz genug, um sein Pferd anzugaloppieren, Tempo aufzunehmen und ruhigen Bluts den Moment abzuwarten, in dem er die Lanze zurücknehmen und mit aller Kraft zustoßen musste.
Sein Vater war so geizig, dass er für das Turnier nicht mal eine Tribüne hatte aufschlagen lassen. Sogar die Damen mussten sich in Ermangelung von Sitzplätzen am Rand der Stechbahn drängen, wo aufwirbelndes Erdreich ihre Kleider beschmutzte. Ein schneller Seitenblick verriet Max, dass Rosina nicht unter ihnen war. Aber er wusste, irgendwo im Verborgenen sah sie zu, wie ihr Ritter sich für sie schlug. Er hatte ihr rotes Seidenband nicht um den Schaft seiner Lanze gewunden, wo man für gewöhnlich die Farben seiner Dame trug, sondern es am eisernen Armschutz der Rüstung belassen. Jetzt hob er die Hand und ließ das Band im Wind flattern. Mein Banner, Rosina. Halte dich bereit.
Eine Fanfare ertönte. Für Iwein war dies ein Signal, sich unter seinem Reiter noch mehr zu sammeln.
Drüben, am anderen Ende der Bahn, wartete der Gegner. Max hob nur flüchtig den Blick. Sein Herausforderer war der Ritter, den er sich insgeheim gewünscht hatte, der Besitzer des mächtigen Rappens, der das Hufeisen verloren hatte. Er musste kurz schlucken. Rosina hatte nicht übertrieben. Der schwarze Hengst war ein Riese, ein wahres Ungetüm von einem Pferd, und über den Reiter hätte man Ähnliches sagen können. Einen so gewaltigen Kerl aus dem Sattel zu stoßen würde ein Maß an Kraft kosten, wie Max es nie zuvor hatte aufbringen müssen.
Er verkürzte die Zügel, um Iwein am Tänzeln zu hindern. Hatte die leise Furcht, die ihn beschlichen hatte, sich auf das Tier übertragen? Plötzlich wurde Max bewusst, dass er in diesem Kampf den Tod finden konnte, dass sein Herz in ein paar Augenblicken womöglich seinen letzten Schlag tat. Die Spitze der Lanze war zwar stumpf, doch wenn sie zwischen die Panzerplatten der Rüstung drang, konnte sie einem Mann den Schädel durchbohren. Andere brachen sich den Rücken oder das Genick. Ein Ritterstechen mochte ein Spiel sein, aber es war das Abbild einer Schlacht: ein Kampf auf Leben und Tod.
Der steirische Ritter schloss sein Visier, und Max wollte es ihm eben nachtun, als eine Stimme gellend seinen Namen rief. Schon wieder Wolf. »Max, du darfst nicht!« Gelächter von der Seite. »Dein Vater wird toben, wenn er das erfährt.«
»Ich werde dir zeigen, was ich nicht darf!« Wütend klappte Max das Visier herunter und gab seinem Pferd die Sporen. Aus dem Stand fiel Iwein in Galopp, jagte mit donnerndem Hufschlag auf den Gegner los, so dass die Erdbrocken nur so stoben. In seinem Rücken verhallte Wolfs Schrei.
Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage, Triumph oder Schmach lag in der Wahl des richtigen Augenblicks. Im ersten Durchgang verpassten sie ihn beide, der Steirer ebenso wie Max. Die zu früh gestoßene Lanze des Gegners streifte seine Hüfte und warf ihn zur Seite, doch es gelang ihm, sich im Sattel zu halten, auch wenn der Schmerz ihm den Atem raubte. Sein eigener Stoß erfolgte einen Wimpernschlag zu spät und ging ins Leere. Am Ende der Bahn wendete er sein Pferd und stellte sich neu auf.
In seiner Hüfte wütete ein Feuer. Wie sollte er mit solchen Schmerzen sich in den Stoß legen und diesem die nötige Wucht verleihen? Das Visier seines Gegners sah aus wie eine grinsende eiserne Maske. Zweifellos war der Steirer ein erfahrener Kämpfer, dem nicht entgangen war, welche Wirkung sein Stoß erzeugt hatte. War der Kampf schon entschieden?
Wieder glaubte Max, ein Lachen zu hören, das Lachen einer Frau. Rosina? Mit aller Kraft trieb er Iwein erneut zum Galopp an. Der Rausch der Geschwindigkeit löschte den Schmerz, eine seltsame Kälte nahm von ihm Besitz. Ohne Hast neigte er seinen Körper zur Seite, fasste die Brust des Gegners ins Auge und legte sein ganzes Gewicht in den Stoß der Lanze. Im Donnern der Hufe und dem Klirren der Rüstung hörte er kaum den Aufprall, mit dem die Spitze seiner Waffe den Panzer traf, und er galoppierte weiter bis ans Ende der Bahn. Nur an der Erschütterung des Bodens, die wie eine Welle in seinem Rücken aufstieg, spürte er, dass er den Steirer aus dem Sattel gestoßen hatte.
3
Wenn Wolf von Polheim auf etwas in seinem Leben stolz war, dann darauf, Maximilian von Habsburgs Freund zu sein. Obwohl er selber der Ältere war, bewunderte er den Sohn des Kaisers so sehr, dass er sich fast darüber wunderte, dass dieser ihn zu seinem Freund erkoren hatte. Darum empfand Wolf es nicht nur als seine selbstverständliche Pflicht und Schuldigkeit, Max immer wieder aus der Patsche zu helfen, sondern betrachtete jede sich bietende Möglichkeit, seinem Freund beizustehen, als Auszeichnung und Ehre. Wie anders hätte er beweisen können, dass er der Wertschätzung des Prinzen würdig war?
Natürlich war dem Kaiser nicht verborgen geblieben, dass Max sich über sein Verbot hinweggesetzt hatte, und er schäumte vor Wut. Jedes seiner Lebensjahre, so hatte er gedroht, wolle er seinem Sohn zur Strafe auf das Sitzfleisch nummerieren, wenn dieser nicht auf der Stelle bei ihm erscheine.
Wo würde Max nach seinem Triumph stecken? Wolf brauchte nicht lange zu raten: im Stall natürlich – Max würde sein Pferd, das ihn zum Sieg getragen hatte, selbst versorgen, wie es sich für einen Ritter gehörte. Wolf lief über den Hof und eilte hinüber zur langen Reihe der Verschläge. Als er die angelehnte Stalltür aufstieß, stutzte er. Was war das? Iwein, der Braune seines Freundes, stand unversorgt mit Sattel und Decke auf dem Rücken in seinem Verschlag – doch von Max keine Spur.
Ein Geräusch ließ ihn aufhorchen. Ein leises Stöhnen, als litte jemand Schmerzen. Wolf drehte sich um. Auf der anderen Seite der Stallgasse stand eine der hölzernen Halbtüren offen. Als er in den Verschlag blickte, musste er grinsen. Aus dem Stroh ragten ihm zwei männliche Hinterbacken entgegen, die rhythmisch auf und ab tanzten, darum herum lag das zerlegte Beinzeug einer Rüstung, aus deren Mitte die Schamkapsel in die Höhe ragte.
Max. Er war mal wieder der Erste von ihnen, auch darin, obwohl er der Jüngere war.
Auf Zehenspitzen wollte Wolf sich davonschleichen. Doch dann sah er das Gesicht des Mädchens, das da mit Max im Stroh lag. Im selben Augenblick stockte ihm der Atem. Rosina von Kraig. Die Eine, die Wolf für sich erkoren hatte. Das Mädchen, dem seine Minne galt und auf das er nachts in seiner Kammer heimlich Gedichte verfasste, um ihre Schönheit zu besingen. Er spürte, wie ihm das Blut aus den Wangen wich, und sein Herz begann mit solcher Macht zu rasen, als wolle es ihm aus der Brust springen.
»Max!«
Das tanzende Gesäß hielt inne. Rosinas Züge erstarrten.
Unendlich langsam drehte Max sich herum. »Sei uns willkommen, mein Freund«, sagte er mit einem Grinsen. »Auch wenn der Zeitpunkt ein besserer sein könnte.«
»Du sollst sofort zu deinem Vater kommen«, sagte Wolf, ohne Rosina eines Blickes zu würdigen. »Sofort! Hörst du? Sonst macht er Kleinholz aus dir.«
4
Mit hitzigem Gesicht lief Max die Stufen zur Studierstube seines Vaters hinauf. Auf dem Treppenabsatz blieb er stehen, und atmete einmal tief durch. Dann öffnete er die Tür und betrat den Raum.
Im nächsten Moment hatte er eine Ohrfeige sitzen.
Vor Empörung schnappte er nach Luft. Zum letzten Mal war er als Kind von seinem Hauslehrer geschlagen worden. Er hatte dem Kerl keinen einzigen Rutenstreich vergeben, und das Latein, das ihm die Schläge eingetragen hatte, hasste er noch heute. Seitdem hatte kein Mensch mehr gewagt, die Hand gegen ihn zu erheben. Mit geballten Fäusten fuhr er herum, um seinen Vater zur Rede zu stellen. Doch anstelle des Kaisers fand er sich dessen Kanzler gegenüber, Haug von Werdenberg, ein knöcherner Mann, der ihn dünnlippig ansah und mit der Hand durch die Luft strich, als wolle er der Wange des Kaisersohnes gleich noch eine Lektion erteilen. Blind vor Wut wollte Max ihm an die Gurgel.
»Beherrsch Er sich!« Die Stimme seines Vaters rief ihn zurück. Der Kaiser hing tief in seinem Sessel und lutschte an einer Melonenscheibe. »Sonst kann Er von derselben Arznei gern Nachschlag erhalten. Wie’s jedem gebührt, der sich Unserem Befehl widersetzt.«
Max spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Er hatte an diesem Tag einen gefürchteten Ritter aus dem Sattel gehoben, er hatte das schönste Mädchen des Hofes erobert, und wäre Wolf nicht gekommen, hätte er mit ihr womöglich die äußersten Freuden der Liebe geteilt. Doch sein greiser Vater, der übellaunig in seiner klösterlich armseligen Studierstube hockte und von morgens bis abends Melonen schlabberte und Kerne ausspuckte, ließ ihn von diesem Tintenpisser ohrfeigen! In dem verzweifelten Versuch, einen Rest seiner Würde zu bewahren, wandte Max sich ab und wollte gehen, doch ein schwammiges Hindernis versperrte ihm den Weg. Sein Onkel, Sigmund von Tirol, genannt das Weinfass. Die Hände wie ein Mönch vor dem Bauch gefaltet, in dem Unmengen von Süßspeisen und Bratenstücken begraben waren, verzog er schmerzlich das Gesicht, als hätte er selbst den Backenstreich einstecken müssen, den sein Neffe gerade empfangen hatte.
Ehe Max ihm ausweichen konnte, kniff sein Onkel ihm in die misshandelte Wange. »Nicht so stürmisch, Bub. Auch wenn es gehörig in der Ehre zwickt – aber verdient ist verdient!«
»Verdient?« Max glaubte, nicht richtig zu hören.
»Du musst deinen Vater verstehen«, fuhr Sigmund fort. »Du bist schließlich sein einziger Sohn, wie kann er dir da gestatten, dass du dir den Hals beim Ringelspiel brichst? Nun zieh keine so finstere Miene, das missfällt den Damen. Befassen wir uns lieber mit den schönen Plänen, die dein Vater für dich hat.«
»Pläne?«, wiederholte Max noch einmal wie ein Idiot. »Was für Pläne?«
Ohne von seiner Melone zu lassen, bedeutete der Kaiser mit einem Kopfnicken dem Kanzler, für ihn zu sprechen. Wie es seine Angewohnheit war, zupfte Werdenberg an seinem Spitzbart, bevor er zu reden begann.
»Euer Vater und Euer Onkel sind übereingekommen, dass es an der Zeit für Euch ist zu heiraten.«
Max war so verblüfft, dass es ihm für einen Moment die Sprache verschlug. Heiraten? Er? Nachdem man ihm gerade noch eine Ohrfeige verpasst hatte wie einem dummen Bäckerjungen?
Plötzlich regte sich in ihm ein vollkommen aberwitziger, doch so verlockender, wunderbarer, paradiesisch schöner Gedanke, dass er gar nicht anders konnte, als seine ganze Hoffnung in ihn zu setzen.
»Und?«, fragte er mit trockener Kehle. »Wer soll meine Braut sein?«
5
Gleich nach der Morgenandacht war Philippe de Commynes, Vertrauter und Gesandter des Herzogs von Burgund, zur Audienz beim französischen König gerufen worden, um das Anliegen seines Herrn Karls des Kühnen vorzutragen, doch Ludwig hatte immer noch nicht das Wort an ihn gerichtet, obwohl die Glocken der Schlosskapelle bereits zum Angelus läuteten. Stattdessen beschäftigte der König sich mit seinem dreijährigen Sohn und Thronfolger, dem Dauphin Charles, einem auffallend hässlichen, buckligen Kind, das zu allem Überfluss auch noch an einem Wasserkopf zu leiden schien.
Herr im Himmel, dachte Philippe – das soll Maries Bräutigam sein?
Mit ängstlicher Neugier strich der Junge gerade um einen Käfig, in dem ein purpurgewandeter Greis wie ein Tier gefangen war.
»Warum ist der Mann eingesperrt?«, wollte Charles wissen.
»Er soll dir selber die Antwort geben«, erwiderte Ludwig. »Nun, Eminenz«, forderte er den Gefangenen auf, »worauf wartet Ihr?«
»Weil ich ein Verräter bin, mein Prinz«, antwortete dieser.
»Was ist ein Verräter, Sire?«, fragte Charles den König.
»Ein böser Mensch. Kardinal La Balue war unser Finanzminister. Doch statt unser Geld zu mehren, hat er uns bestohlen.«
»Warum habt Ihr ihn dann nicht geköpft?«
»Damit er jeden Tag die Herrlichkeit mitansehen muss, von der er nun ausgeschlossen ist. Außerdem ist er ein nützliches Tier. – Ah, Unser Barbier«, begrüßte Ludwig einen schmächtigen Mann, der mit einem Stoß Akten unter dem Arm in den Saal getrippelt kam. »Was bringt Ihr für Neuigkeiten?«
Philippe de Commynes hob die Brauen. An den europäischen Höfen ging das Gerücht, dass König Ludwig sich von seinem Barbier täglich mit unzähligen Nachrichten versorgen ließ, die seine Spione in Frankreich und auf dem ganzen Kontinent für ihn zusammentrugen. Obwohl Commynes die Warterei mehr als satt hatte, war er gespannt.
»In Eurer Hauptstadt Paris herrscht Hungersnot«, berichtete der Barbier. »Das Volk beginnt, gegen Eure Majestät zu murren.«
Ludwig zuckte gleichgültig die Schulter. »Man soll in den Kirchen verkünden, es habe einen Anschlag auf Unser Leben gegeben, der erst im letzten Augenblick vereitelt werden konnte. Dann wird das Volk seinen König wieder lieben und den Hunger vergessen.«
Philippe war beeindruckt. Die Idee war genial.
»Was noch?«, fragte Ludwig.
»Der Kanzleisekretär, der Eure Majestät beleidigt hat, wurde heute Morgen hingerichtet«, erklärte der Barbier.
»Beleidigt? Mich? Wie hat ein Kanzleisekretär das geschafft?«
»Er hat Eure Majestät eine Spinne genannt.«
Ludwig lächelte, sichtlich geschmeichelt. »Aber so nennt mich doch halb Europa! Schade um seinen Kopf.« Dann wurde er wieder ernst. »Und was gibt es für Nachrichten aus Burgund?«
Jetzt begriff Philippe, warum Ludwig ihn so lange hatte warten lassen.
»Die Gerüchte verdichten sich. Prinzessin Marie soll Maximilian von Habsburg heiraten. Es ist bereits die Rede von einem Treffen in Trier. Zwischen dem Kaiser und Herzog Karl.«
»Das ist ungeheuerlich!« Ludwig verließ seinen Thron und trat zu dem Käfig, in dem der Kardinal aufmerksam das Gespräch verfolgte. »Was haltet Ihr von der Sache, Eminenz?«
»Ich fürchte, Eure ureigensten Interessen stehen auf dem Spiel«, erwiderte La Balue. »Wenn Friedrich und Karl sich durch eine Ehe ihrer Kinder verbünden, ist die Wiederherstellung von Frankreichs Einheit in Gefahr. Und damit Euer Lebenswerk.«
»Wie recht Ihr habt! Leider …« Ludwig nahm ein Stück Kuchen und steckte es dem Kardinal durch das Gitter in den Mund. »Doch danke für Euren Rat.« Dann fuhr er mit einem plötzlichen Ruck zu Philippe herum. »Und Herzog Karl erdreistet sich, unser Angebot seit Monaten ohne Antwort zu lassen?«, fragte er in scharfem Ton. »Will er Uns beleidigen, indem er Unseren Sohn als Bräutigam seiner Tochter abweist? Zugunsten eines Prinzen, der von seinem kaiserlichen Vater nichts erben wird als einen Sack voll Schulden?«
Philippe de Commynes straffte sich. Endlich kam Ludwig auf den Grund zu sprechen, weshalb sein Herr ihn nach Plessis-les-Tours an den französischen Hof geschickt hatte. Er sollte Ludwig beschwichtigen, ohne verbindliche Zusagen zu machen.
»Herzog Karl lässt Euch ausrichten, er sei von Eurem Angebot, Euren Sohn Charles mit seiner Tochter Marie zu verehelichen, überaus geschmeichelt. Nur angesichts des zarten Alters des Dauphins schien ihm keine Eile geboten.«
»Unsinn! Karl will mich hintergehen, er will seine Tochter dem Sohn des Kaisers verkuppeln, Maximilian von Habsburg. Doch richtet ihm aus, als Maries Pate werde ich nicht zulassen, dass sie einen anderen Prinzen heiratet als den Thronfolger Frankreichs.«
»Ich bin sicher, Herzog Karl hegt keinen anderen Wunsch.«
»Wollt Ihr mich zum Narren halten?« Ludwig trat einen Schritt auf Philippe zu. »Es heißt, Ihr seid ein gewitzter Mann. Wenn es Euch gelingt, Karl von seinen österreichischen Plänen abzubringen, und er sich an seine Pflichten gegenüber Frankreich erinnert, soll es Euer Schaden nicht sein. Vielleicht«, fügte er mit einem Blick auf den Kardinal hinzu, »brauche ich ja bald einen neuen Berater.«
Damit ich auch eines Tages in einem solchen Käfig lande?, dachte Philippe. Nein, da haben wir schönere Aussichten. Laut sagte er: »Erlaubt Ihr ein offenes Wort, Sire?«
»Redet!«
»Ich selber betrachte die österreichischen Pläne mit ähnlichem Argwohn wie Ihr. Auch ich bin der Meinung, dass auf einer Verbindung der Häuser Burgund und Habsburg kein Segen liegt.«
Ludwig runzelte die Stirn. »Soll das heißen, Ihr stellt Euch gegen Euren Herrn?«
»Nein, Sire«, erklärte Philippe. »Ich stelle mich nur auf die Seite Burgunds.«
Ludwig sah ihn prüfend an. »Was führt Ihr im Schilde?«
Würde ich Euch das verraten, würdet Ihr mich vermutlich köpfen.
»Nun? Heraus mit der Sprache!«
Philippe dachte nach. »Was die Vermählung des Dauphins mit Karls Tochter angeht«, sagte er dann, »so kann ich Euch nichts versprechen. Prinzessin Marie hegt wegen des Altersunterschiedes Bedenken. Aber ich bin gewillt, alles mir Mögliche zu tun, um die österreichische Verbindung zu hintertreiben.« Und nicht nur diese, fügte er im Geiste hinzu.
»So? Wollt Ihr das?«, fragte Ludwig. »Warum? Zieht es Euch an meinen Hof?«
Philippe überlegte, ob er durch eine solche Lüge die Wahrheit vielleicht glaubwürdiger machen sollte. Doch dann entschied er sich dagegen. Warum die Dinge unnötig komplizieren?
»Nein, Sire, bei allem Respekt. Mein Platz ist in Burgund.«
»Wieso helft Ihr mir dann?«
»Allein aus Achtung vor mir selbst. Aus keinem anderen Grund.«
Ludwig zog ein überraschtes Gesicht. »Oho«, sagte er. »Seid Ihr etwa ein Mann von Charakter?«
6
Ich will diese Marie nicht heiraten«, protestierte Max. »Ich kenne sie doch gar nicht!«
So behände, wie es ihm niemand zugetraut hätte, schnappte sein Vater sich seinen beinernen Stock, holte aus und versetzte der Wandtafel zu seiner Linken einen pfeifenden Hieb. Max zuckte zusammen und wandte wider Willen den Blick. Die Tafel zeigte einen kunstvoll verzierten Stammbaum des Hauses Habsburg. Die Stockspitze ruhte auf dem schwarzen Schriftzug unter der Stammbaumwurzel: AEIOU.
Der Kaiser ließ die Stockspitze klopfen. »Und? Bequemt Er sich vielleicht, Uns zu sagen, was diese Lettern bedeuten?«
Max verdrehte die Augen. »Austria est imperare orbi universo«, betete er die lateinische Formel herunter. Sein Vater hatte sie ihn so oft hersagen lassen, dass er sie im Schlaf beherrschte.
»Und – was heißt das auf Deutsch?«
»Alles Erdreich ist Oesterreich untertan.«
»Brav«, lobte der Vater. »Und wie, meint Er, soll Unser geliebtes Österreich dieser Bestimmung gerecht werden? Auf dem Schlachtfeld? Wie stellt Er sich das vor? Ohne Soldaten und ohne Geld? So schlau ist selbst ein Esel, dass er davon die Finger ließe, wenn er welche hätte.« Er schüttelte den Kopf. »Tu felix Austria nube – du, glückliches Österreich, heirate! Burgund ist reich, Burgund ist mächtig. Du kannst es erobern, mit einem einzigen Wort vor dem Traualtar, dem kleinen Wörtchen Ja!«
Für einen Augenblick sah Max das Füllhorn der Fortuna vor sich. Das Großherzogtum Burgund, ein Flickenteppich mehrerer Reichs- und französischer Kronlehen, das von Dijon bis Holland, von Luxemburg bis zur Picardie reichte, war ein so reiches und gesegnetes Land, als hätte die Glücksgöttin all ihre Gaben darüber ausgegossen. Ein Ehebündnis mit der burgundischen Prinzessin war darum der Traum eines jeden Prinzen.
»Na, Maxl, fällt langsam der Groschen?« Onkel Sigmund nickte ihm aufmunternd zu. »Die Euch zugedachte Braut ist das begehrteste Fräulein unter allen heiratsfähigen Fürstentöchtern in Europa. Und nun hat gar der Heilige Vater in Rom sein Wort eingelegt und sich für Eure Vermählung mit Marie ausgesprochen. Ein Bündnis zwischen Burgund und Habsburg wäre als Bollwerk gegen die Gefahr der Türken nämlich ganz in seinem Sinne.«
»Ich bedaure«, erwiderte Max.
»Ihr bedauert was?«
»Ich danke für die Ehre, die Ihr mir antragt. Doch leider sehe ich mich nicht imstande, diese Ehre anzunehmen.«
»Was bitte schön soll das heißen, Ihr seht Euch nicht imstande?«, fragte Werdenberg.
»Das heißt, was es heißt. Ich bin einer anderen im Wort.« Max warf den Kopf in den Nacken, und todesmutig fügte er hinzu: »Es ist mein Wunsch, Rosina von Kraig zu ehelichen.«
Falls der Kanzler vorgehabt hatte, ihm seine Rede mit einer weiteren Backpfeife zu vergelten, so erstarrte ihm vor Schreck die Hand. Diese zitterte in der Luft wie sein Spitzbart.
»Rosina von Kraig.« So unwillig, dass seine Halswülste bei jeder Silbe wabbelten, wiederholte Onkel Sigmund den Namen. »Wollt Ihr behaupten, Ihr sprecht im Ernst? Man teilt Euch mit, dass Euer Vater mit dem reichsten Herzog Europas in Verhandlung treten will, um Euch dessen Erbtochter zu sichern, und Ihr werft uns ins Gesicht, Ihr wolltet Euch die Kammerfrau Eurer Schwester ins Brautbrett legen? Ja, ja, ich weiß, Bub, la bella Rosinella hat Äuglein wie ein Kohlenfeuer, und in ihrem Mieder gibt es tüchtig was zu schnüren. Aber Hand aufs Herz: Kannst du dir das Glutäuglein vielleicht mit einer Krone auf den schwarzen Locken vorstellen? Ist das ein Weib, dem du dein Haus- und Staatswesen anvertraust, wenn dich das Schlachtfeld ruft?«
»Rosina von Kraig ist die Nichte des Bischofs von Salzburg!«, brach es aus Max heraus. »Die Frau, die Gott mir anbefohlen hat! Und ich stehe zu dem Wort, das ich ihr verpfändet habe, bei meiner Ehre! Außerdem – von welchem Schlachtfeld redet Ihr? Rüsten wir etwa ein Heer, um dem Haus Habsburg und dem gerupften Reichsadler wieder Ruhm und Achtung zu verschaffen? Kriege kosten Geld, und von Geld trennt mein Herr Vater sich nicht. Statt in den Kampf gegen Ungarn zu ziehen, schüttelt er lieber sein leeres Säckel, dass man sich schämen muss. Bettelkaiser schimpfen die Wiener ihn, und mich, seinen Sohn, einen Bettelprinzen.« Wie zum Beweis blickte Max an seinem schäbigen Gewand herunter. »Sind das Kleider, die der Sohn eines Kaisers trägt? Ha! Würde ich mich Marie von Burgund in diesem Aufzug präsentieren, müsste sie glauben, man wolle sie mit einem Vagabunden als Bräutigam narren.«
In Erwartung eines höchstkaiserlichen Zornesausbruchs hielt Max inne. Doch sein Vater legte seinen Stock beiseite, setzte sich an den Tisch und griff nach einer Melonenscheibe.
»Genug des Wortemachens«, erklärte er. »Wir sind uns einig? Dann troll Er sich, vergäll Er Uns nicht länger das Frühstück.«
Max straffte die Schultern. »Wir sind uns keineswegs einig«, versetzte er. »Eure Erwägungen in Ehren, aber ich liebe Rosina von Kraig und bin entschlossen, sie zu heiraten.«
»Heiraten will Er sie. Lieben tut Er sie.« Der Vater würdigte ihn keines weiteren Blickes, sondern wandte sich Sigmund zu. »Hört Euch das an, Vetter. Was macht ein Mensch von Verstand mit solchem Kindskopf? Wir reden von der Zukunft des Heiligen Römischen Reiches, und der Kerl träumt von den Apfelbäckchen einer Kammerjungfer.«
Nicht von Apfelbäckchen, dachte Max, von Liebe. Aber dass du von der nichts verstehst, weiß ich nur allzu gut. Und meine arme Mutter wusste es auch.
»Nicht solche Strenge, Majestät, ich bitt’ Euch.« Sigmund zauste sich das schüttere Haupthaar. »Haben wir als junge Hirsche nicht alle geglaubt, wir müssten jedem Bäumchen erst einen Altar errichten, ehe wir uns daran das Geweih abstoßen?« Er spitzte sein Mündchen wie zu einem Kuss. »Für die Liebe, Bub, für die gibt’s andere Lösungen. Seht mich an! Meinen Lenden dürften an die vierzig Kinder von fünfzig verschiedenen Müttern entstammen, oder meinethalben auch fünfzig Kinder von vierzig Müttern, ich kann mir das nicht merken. Aber habe ich die vielleicht alle geheiratet? Werde ich mir Blei ans Bein ketten, wenn ich Gold haben kann?«
»Ich bin ein Ehrenmann«, fauchte Max.