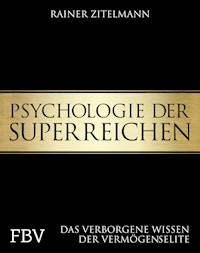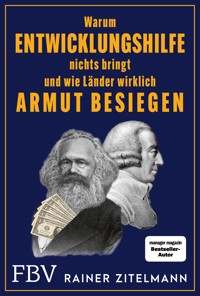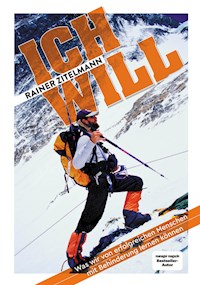
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nach seinem Bestseller Setze dir größere Ziele! beleuchtet Zitelmann in seinem neuen Buch wieder ganz ungewöhnlich erfolgreiche Menschen – Persönlichkeiten, die trotz Behinderung geradezu Übermenschliches geleistet haben: darunter ein Blinder, der den Mount Everest bestiegen hat, ein Weltreisender, der schon vor 200 Jahren blind 400.000 Kilometer zurücklegte, ein Motivationsredner ohne Arme und Beine, eine erfolgreiche Unternehmerin im Rollstuhl, eine taubblinde Schriftstellerin und ein weltberühmter Schauspieler mit Parkinson. 20 faszinierende Porträts, die verraten, was man von diesen Erfolgsmenschen lernen kann! Saliya Kahawatte, den viele aus seinem Film Blind Date mit dem Leben kennen, schreibt im Vorwort: »Wenn Sie es mögen, betrachten Sie dieses Buch gern als eine Fundgrube menschlicher Diamanten. Wir alle wissen, dass jeder dieser seltenen Edelsteine früher einmal ein gewöhnliches Stück Kohle war, das über lange Zeit gewaltigem Druck standhielt, so seine Stabilität erhielt und erst durch gezieltes, präzises Schleifen seinen einzigartigen Glanz erreichte.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rainer Zitelmann
ICH WILL
Was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können
RAINER ZITELMANN
ICH WILL
Was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Originalausgabe, 1. Auflage 2021
© 2021 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Ansgar Graw
Korrektorat: Anja Hilgarth
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: Didrik Johnck
Fotos im Innenteil: S. 24: GL Archive / Alamy Stock Photo; S. 40: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo; S. 56: Falkensteinfoto / Alamy Stock Photo; S. 72: Margarete Steiff GmbH; S. 84: Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo; S. 102: Imago History Collection / Alamy Stock Photo; S. 120: Jerónimo Alba / Alamy Stock Photo; S. 136: Patrick McMullan / Getty Images; S. 154: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo; S. 174: Hulton Archive / Getty Images; S. 190: NASA Photo / Alamy Stock Photo; S. 206: Redferns / Getty Images; S. 222: Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo; S. 238: Panther Media GmbH / Alamy Stock Photo; S. 254: Trevor Collens / Alamy Stock Photo; S. 270: Didrik Johnck / Corbis Sygma; S. 288: Getty Images North America / Getty Images; S. 302: Malte Metag; S. 316: Kathy Hutchins / Alamy Stock Photo; S. 330: Hasko Witte
Satz: Zerosoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-469-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-894-2
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-895-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
Vorwort von Saliya Kahawatte
Vorwort
1. Ludwig van Beethoven »Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen«
2. James Holman Er reiste blind 400.000 Kilometer
3. William Hickling Prescott Amerikas erster Geschichtswissenschaftler
4. Margarete Steiff Die Unternehmerin mit dem Teddy-Bären
5. Vincent van Gogh Der Sämann
6. Helen Keller Eine amerikanische Ikone
7. Frida Kahlo Die berühmteste Malerin Lateinamerikas
8. John Forbes Nash Jr. Schizophrener Nobelpreisträger und Mathe-Genie
9. Ray Charles Der Hohepriester des Soul
10. Christy Brown My Left Foot
11. Stephen Hawking Erforscher der Schwarzen Löcher
12. Stevie Wonder Der Superstar
13. Andrea Bocelli »Ich habe eine Barriere zerschlagen«
14. Thomas Quasthoff Seine Stimme berührt Millionen
15. Michael J. Fox Parkinson hat ihn nicht bezwungen
16. Erik Weihenmayer Ein Blinder bezwingt die höchsten Gipfel der Welt
17. Marla Runyan »Die Zukunft ist noch nicht geschrieben«
18. Johann König Als er seine Galerie eröffnete, war er blind
19. Nick Vujicic Motivationsredner und Prediger
20. Felix Klieser Hornist ohne Arme
Der Autor
Anmerkungen
Literatur
Vorwort von Saliya Kahawatte
»Du wirst es nicht schaffen!«, erklärte mir der Schulleiter des Gymnasiums in einem sehr ernsten Tonfall, setzte sich seine Brille wieder auf und überflog noch einmal das Attest der Augenklinik, das vor ihm auf dem Tisch lag. »Mit deinem schweren Augenfehler kommst du hier nicht weiter, du musst sofort auf die Blindenschule wechseln und die Blindenschrift lernen.« Unsicher rutschte ich auf meinem Stuhl in dem kahlen, lieblos eingerichteten Direktorenbüro herum, ließ meine Blicke traurig zu Boden sinken und spürte, wie meine Mutter etwas zaghaft nach meiner rechten Hand griff. »Saliya, sei nicht traurig, du musst dich damit abfinden, dass du behindert bist und nun ein anderes Leben führen wirst.«
Ich erinnere mich noch sehr gut an diese dramatische Wendung in meinem jungen Leben, das ich davor eher sorglos und unbeschwert geführt hatte. Es war im Spätsommer des Jahres 1985, ich war 15 und gerade in die zehnte Klasse des Gymnasiums versetzt worden. Einige Wochen vor den großen Ferien wurde bei mir eine schwere Netzhautablösung diagnostiziert, die sich in einer hundertprozentigen Schwerbehinderung auswies. Der Großteil meines Sehvermögens war unwiederbringlich verlorengegangen. Seither sehe ich die Welt wie durch eine dicke Milchglasscheibe, alles ist nur noch grau und sehr verschwommen.
Ich folgte weder dem Rat der Augenärzte noch der Empfehlung der Schulbehörde – meine Entscheidung stand sehr schnell fest: »Ich will in der Welt der Sehenden bleiben und Karriere machen, koste es mich, was es wolle!« Schon nach wenigen Tagen setzte ich meinen Entschluss um und suchte fieberhaft nach einer neuen Möglichkeit, dem Unterricht irgendwie folgen zu können. »Wenn es mit deinen Augen nicht mehr geht, nimm doch deine Ohren zu Hilfe«, dachte ich mir und konzentrierte mich mit meinem Gehör voll auf die Worte des Lehrers.
Schon nach wenigen Wochen konnte ich mir sechs Stunden Gesprochenes am Stück mühelos einprägen. Nachmittags hörte ich mir den Unterrichtsstoff, den ich auf der »Mailbox« meines Langzeitgedächtnisses gespeichert hatte, erneut an und konnte meine Hausaufgaben erledigen. Da ich nicht in der Lage war, meine Ausführungen selbstständig zu kontrollieren, lasen sich meine Mutter oder meine Schwester abends noch mal alles durch, um sicherzugehen, dass ich alles richtig niedergeschrieben hatte.
Entgegen allen Befürchtungen verschlechterten sich meine Noten kaum, zur Mitte des Schuljahres trauten mir meine Lehrer den Verbleib auf dem gewöhnlichen Gymnasium zu. Mir wurde schon damals klar, dass ich meine Behinderung nur mit viel Fleiß und Disziplin ausgleichen könnte, um mit dem Unterrichtstempo schrittzuhalten. Ich erkannte früh, dass ich meine Zeit völlig anders einsetzen musste als meine Mitschüler: Während sie in die Disko gingen, ihren Führerschein machten oder ihre Freundin ausführten, saß ich allein an meinem Schreibtisch und kämpfte mich durch den immer anspruchsvoller werdenden Schulstoff.
Im Jahr 1989 schaffte ich das Abitur und war überglücklich. Ich hatte mein erstes Ziel erreicht. Leider war der Glücksmoment nur von kurzer Dauer. Einige Zeit später trennten sich meine Eltern; ich setzte alles daran, ganz schnell erwachsen zu werden. Um auf eigenen Beinen stehen zu können, bewarb ich mich auf freie Ausbildungsplätze in der Hotellerie und legte in allen Bewerbungen meine Behinderung offen. Obwohl ich gute Noten hatte, wurde ich zu keinem einzigen Vorstellungsgespräch eingeladen. Es war klar, dass die Arbeitgeber wegen des besonderen Kündigungsschutzes kein Interesse daran hatten, einen schwerbehinderten Jugendlichen einzustellen. Als ich das begriff, entschloss ich mich zu einem riskanten Manöver. In den folgenden Bewerbungen verschwieg ich mein Handicap und erhielt schon nach dem nächsten Vorstellungsgespräch einen Ausbildungsplatz zum Hotelfachmann in einem Fünf-Sterne-Hotel.
Wie zuvor auf dem Gymnasium, war ich fast ganz auf mich selbst gestellt. Mein einziger Verbündeter war der Wille, es irgendwie zu schaffen. Mit dem Beginn der Ausbildung begann meine »Mission Impossible«, mit getrübten Blicken machte ich mich auf die Suche nach geheimen, verborgenen Pfaden, die mich in der Welt der Sehenden ans Ziel führen würden.
Ich lernte Hunderte Artikelnummern auswendig, um die Bestellungen quasi »blind« in die Kasse einzutippen, und trainierte meinen Tastsinn, um Bestecke und Gläser korrekt auf den Tischen der Gäste platzieren zu können. Mit meinem feinen Gehör erkannte ich am Klang eines Glases, ob ich es auf Hochglanz poliert hatte, und mixte an der Bar exotische Cocktails, deren Rezepturen ich auswendig wusste und nach Gefühl in die Gläser einschenkte. Zum Glück hatte ich damals einen geheimen Helfer, ein Mit-Azubi wusste von meinem Handicap, behielt es für sich und unterstützte mich nach Leibeskräften, wenn mein Augenfehler aufzufliegen drohte. Nach dem Bestehen meiner Gesellenprüfung zog ich nach Hamburg. Wieder verschwieg ich meine Behinderung und setzte meine Laufbahn in der Luxus-Hotellerie als Stationskellner fort.
Im Sommer 1994 eröffnete ich mit meiner damaligen Freundin ein gemeinsames Restaurant. Wir fuhren die Welt auf der Schubkarre, wie man in meiner Region sagt, und lebten sehr über unsere Verhältnisse. Es war eine tolle Zeit, an die ich mich sehr gerne erinnere. Doch wieder hielt das Leben eine schmerzliche Überraschung für mich bereit: Bei mir wurde Krebs diagnostiziert. Es folgte ein Jahr voller kräftezehrender Chemotherapien und Bestrahlungen.
Nur knapp entkam ich dem Tod und kämpfte mich mühsam in meinen Arbeitsalltag zurück, der schon mit einer neuen Herausforderung auf mich wartete. Das gemeinsame Restaurant stand kurz vor dem Aus. Während meiner Abwesenheit hatten sich haushohe Außenstände bei Lieferanten und Steuerschulden angehäuft. Meine Freundin und ich schafften es nicht, den Laden wieder ins Laufen zu bringen. Wir gingen pleite und im Streit ums Geld auseinander.
Mittellos und vom Leben abgehängt, flog ich aus der Wohnung und landete auf der Straße, ich rutschte ab in eine schwere Depression. An einem kühlen, trüben Herbsttag stand ich vor einer Unterkunft für Wohnungslose und tastete gerade mit meinen Blicken den Himmel ab, als die Sonne in kräftigen Gelbtönen durch die Wolken brach. Ich spürte die angenehm warmen Strahlen auf meiner Haut, hatte plötzlich einen Geistesblitz und sprach entschlossen mit mir selbst. »Hey, erinnere dich mal an deinen Plan, es wird höchste Zeit weiterzugehen!« Wieder verschwieg ich meine Behinderung und schaffte den Einstieg in die Top-Hotellerie. Ich wurde Barkeeper, Weinkellner und eines Tages sogar Oberkellner.
Jeden Tag überforderte ich mich aufs Neue, ich führte ein Leben auf Lügen und auf tausend Splittern. Ich spielte die Rolle des Sehenden, ohne zu erkennen, dass ich schon längst keinen Durchblick mehr hatte. Mit den vielen Führungsaufgaben wurde ich zunehmend ängstlicher, immer häufiger überkamen mich heftige Selbstzweifel, die mit scharfem, gezacktem Blatt am Sockel meiner Persönlichkeit sägten.
Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Immer wieder betäubte ich mich mit Alkohol und Medikamenten, tagsüber putschte ich mich mit billigen Drogen auf, um meinen Aufgaben weiterhin gewachsen zu sein.
Als ich schließlich Restaurantleiter wurde, musste ich Dienstpläne schreiben, Computerkassen programmieren und die Berichtshefte der Auszubildenden kontrollieren. Dieses Mal hatte ich zu hoch gepokert, das Eis des Lügens unter meinen Füßen schmolz dahin, ich brach komplett ein. Ich verlor meinen Job, saß nur noch zu Hause, fühlte mich nutzlos und verloren. Mein Alkoholkonsum stieg ins Unermessliche, schon bald erreichte ich den Tiefpunkt meiner Suchtkarriere, ich gab mich komplett auf.
Nach zahlreichen Suizidversuchen kam ich für mehrere Monate in die geschlossene Psychiatrie und machte anschließend eine Langzeittherapie. Mir wurde klar, dass ich mein bisheriges Handeln zunächst kritisch hinterfragen müsste, bevor ich einen Neustart meines Lebens planen könnte.
An einem kalten, verregneten Märzabend trottete ich allein durch den Park hinter dem Therapiehaus und redete unentwegt mit mir selbst. Obwohl der Regen immer dichter wurde, ging ich einfach weiter, bis ich irgendwann völlig durchnässt stehenblieb, meine Fäuste in den dunklen Himmel streckte und schrie: »Du musst deine Behinderung endlich akzeptieren!« Weinend sackte ich auf einer Holzbank unter einer Laterne zusammen und starrte in eine Pfütze. Ich fasste einen Entschluss: »Dein Lügenspiel hat dich hierhergeführt, ab jetzt gehst du offen mit deinem Handicap um!«
Nach der Therapie arbeitete ich in einer Behindertenwerkstatt und besuchte die Hamburger Blindenschule, hier wurde ich mit einer Spezialsoftware am PC ausgebildet. Schon bald konnte ich selbstständig E-Mails schreiben und im Netz surfen, ich wollte raus aus der Behindertenwerkstatt und suchte nach einer neuen Herausforderung.
Im Sommer 2003 begann ich ein internationales Management-Studium und legte nach dessen erfolgreichem Abschluss meine Schwerbehinderung in allen Bewerbungen offen. Der schwarze Schatten meines Handicaps begrub die glänzenden Noten meines Bachelor-Abschusses unter sich, ich schrieb über 250 Bewerbungen, kein Arbeitgeber interessierte sich für mich. Alle Personalverantwortlichen reduzierten mich wieder nur auf meinen Augenfehler. Mein positives Selbstbild, mein Wille und meine Disziplin fielen ihnen offensichtlich nicht auf. »Aufgeben ist keine Option, du musst eine andere Richtung einschlagen«, dachte ich mir eines Tages und hatte eine Vision. »Mache deinen Makel zur Marke und baue dein eigenes Business aus deinem Handicap auf!«
Obwohl ich von Hartz IV lebte, kein Startkapital hatte und die Wirtschaft schon bald darauf unter der Finanzkrise ächzte, ging ich mit meinem »Bauchladen« selbstbewusst in den Markt. Ich wollte mein Glück als Schriftsteller, Coach und Berater versuchen. Das erste Jahr meiner Selbstständigkeit war die reinste Katastrophe, ich übte mich in Kaltakquise und fand keinen einzigen Kunden. In jedem Geschäftstermin hörte ich immer das Gleiche: »Wo sind denn Ihre Referenzkunden, wo sind Ihre Büroräume und wo ist eigentlich Ihre Homepage?« Ich hatte nichts, einfach gar nichts, manchmal war ich niedergeschlagen, aber ich dachte niemals daran, aufzugeben.
Trotz der zahllosen Rückschläge begann ich, meine Lebenserfahrungen niederzuschreiben, kontaktierte unzählige Verlage – und bekam nur Absagen. Als ich meine Story ein sechstes Mal neu verfasst hatte, wurde ich endlich belohnt, im Herbst 2009 präsentierte ich meine Autobiografie »Mein Blind Date mit dem Leben« auf der Frankfurter Buchmesse. Es folgten unzählige Medienauftritte, meine Bekanntheit kurbelte mein Geschäft an, schon bald mietete ich ein kleines Büro an und stellte erste Mitarbeiter ein. Immer wieder wurde ich von Firmen angefragt, um meine Story vor Publikum zu erzählen. Ich griff auf eine alte Lerntechnik zurück: Da ich einen Text nicht einfach ablesen kann, schrieb ich meine Reden zuerst auf und ließ sie mir dann von der Sprachausgabe so lange vorlesen, bis ich sie auswendig vortragen konnte.
Im Jahre 2017 kam meine Lebensgeschichte als Film in die deutschen Kinos, schnell ging meine außergewöhnliche Story um die Welt. Selbst Hollywood hat schon angeklopft und sich die Rechte an meinem Leben gesichert. Heute bin ich Autor, Coach und Keynote Speaker, aktuell arbeite ich an einem Roman und der Fortsetzung des ersten Kinofilms. Mit meinem Team bin ich mittlerweile weltweit unterwegs, ich denke, Sie erlauben mir ein sehr persönliches Statement: »Mit der Kraft meines Willens habe ich es geschafft, in der Welt der Sehenden Karriere zu machen, mein Teenager-Plan ist aufgegangen!« Wenn ich mein bisheriges Leben wie ein Vogel überfliege, um es von oben zu betrachten, gelange ich zu einer ungewöhnlichen Erkenntnis: Es waren meine vermeintlichen Defizite, aus denen ich das entwickelte, was mich heute ausmacht!
Im Sommer 2020 erreichte mich die E-Mail eines von mir sehr bewunderten Berufskollegen, Dr. Dr. Rainer Zitelmann. Natürlich kenne ich viele seiner auch im Ausland sehr erfolgreichen 24 Bücher und konnte es fast nicht glauben, dass er ein Buch über behinderte Menschen schreiben wollte, zu dem er sich ein Vorwort von mir wünschte. An einem herrlichen warmen Septembertag besuchte mich der sehr dynamisch wirkende Mann in meinem Hamburger Büro, er begrüßte mich mit einer festen Stimme und einem ebensolchen Händedruck. Für mich war sofort klar, mit wem ich es zu tun hatte, vor meinem geistigen Auge entstand ein scharfes Bild. »Da steht ein aufrichtiger Mann vor dir, der genau weiß, was er will!«
Rainer Zitelmann berichtete eindrucksvoll von seinem Buchprojekt und all den berühmten behinderten Persönlichkeiten, die er in seinem Werk porträtieren wollte. Ich fühlte mich ein wenig geschmeichelt, und fragte ihn, warum denn ausgerechnet ich das Vorwort schreiben solle, und wurde direkt von dem sympathischen Profi-Autor aufgeklärt. »Wie alle Menschen in meinem neuen Buch auch sind Sie ein authentisches Beispiel für gelebte Resilienz, ist doch klar, dass Sie das machen sollten.« Ohne zu zögern blickte ich in seine Richtung und nickte einmal. »Herr Dr. Zitelmann, es ist mir wirklich eine große Ehre, das übernehmen zu dürfen, Sie können auf mich zählen.«
Als der Zeitpunkt näher rückte, hatte ich Zweifel, ob ich es mit dem versprochenen Vorwort termingerecht schaffen würde, da ich mit meinen anderen Projekten von frühmorgens bis spät in die Nacht ausgelastet war. Vorsichtig fragte ich Zitelmann, was sein »Plan B« sei, wenn ich es nicht schaffen sollte. Er schrieb eine Minute später knapp: »Es gibt keinen Plan B, ich weiß, dass Sie es schaffen werden und ich mich auf Ihr Wort verlassen kann.«
In den Wochen nach unserem Meeting hatten Zitelmann und ich im ständigen Mail-Austausch gestanden, und in schneller Folge hatte er mir ein Portrait nach dem anderen gemailt. Aufmerksam ließ ich mir die Ausführungen meines Berufskollegen von der Sprachausgabe meines Notebooks vorlesen und kam am Ende zu einer verblüffenden Erkenntnis: Obwohl alle Betroffenen eine Behinderung hatten, die sie erheblich einschränkte, waren sie in der Lage, mit ihrer ungeheuren Willenskraft ihre Potenziale einzusetzen, um über sich hinauszuwachsen. Egal ob Frida Kahlo, Thomas Quasthoff, Margarete Steiff oder Stevie Wonder, alle 20 Kämpfernaturen, die auf den nachfolgenden Seiten von Rainer Zitelmann eindrucksvoll porträtiert werden, haben eines gemeinsam: Sie alle haben Dinge geschafft, die sich die meisten nicht behinderten Menschen nicht zutrauen, obwohl sie es ohne Behinderung doch so viel leichter hätten.
Bei den Vorbereitungen zu diesem Vorwort identifizierte ich mich mit allen Protagonisten dieses Buchs, schaute oft in den Spiegel meines eigenen Lebens und zähle mich, wenn Sie es mir erlauben, auch gern zur Familie der erfolgreichen Menschen mit Handicap. Unabhängig von der Schwere unserer Behinderungen haben wir uns alle niemals von dem Weg abbringen lassen, den wir uns einmal in den Kopf gesetzt hatten. Auf der Basis unseres veränderten Selbstbildes gelingt es uns, das Handicap völlig außer Acht zu lassen und unsere Schwächen zu ignorieren, um unseren Fokus mit der dahinterliegenden Energie nur noch auf die Weiterentwicklung unserer Stärken richten zu können. Wenn etwas nicht gelingt, gehen wir hart mit uns ins Gericht, halten uns nicht mit Schuldzuweisungen auf und widmen uns mit viel Disziplin dem sogenannten »bewussten Üben«. Mit einem für Nichtbehinderte ungewöhnlichen Energieeinsatz arbeiten wir, auch über Jahre hinweg, an dem Erreichen unseres Lebensziels und entwickeln dabei eine außergewöhnliche Frustrationstoleranz.
Auch wenn in diesem Entwicklungsprozess vieles schiefgeht und schon mal ein ganzes Jahrzehnt verstreicht, ist dies für uns kein Drama. In unserer Selbstwahrnehmung haben wir keine Fehler gemacht, sondern lediglich Zeit investiert, um etwas Neues zu lernen oder die Qualität unserer erworbenen Fähigkeiten durch hartes Training weiter zu steigern. Die Macht der erlernbaren Resilienz, einzigartige Erfolgsstrategien, ungewöhnliche Selbstbilder und vieles mehr können Sie von den Menschen lernen, die in diesem Buch von Rainer Zitelmann sehr detailreich, unverblümt und meisterhaft zugleich vorgestellt werden.
Wenn Sie mögen, betrachten Sie dieses Buch gern als eine Fundgrube menschlicher Diamanten. Wir alle wissen, dass jeder dieser seltenen Edelsteine früher einmal ein gewöhnliches Stück Kohle war, das über lange Zeit gewaltigem Druck standhielt, so seine Stabilität erhielt und erst durch gezieltes, präzises Schleifen seinen einzigartigen Glanz erreichte.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schürfen und Entdecken!
Saliya Kahawatte, Autor von »Mein Blind Date mit dem Leben«, Februar 2021
Vorwort
Denken Sie einmal nach, wie viele erfolgreiche Menschen mit Behinderung Ihnen spontan in den Sinn kommen, egal ob aus Politik, Sport, Kultur, Wirtschaft oder Wissenschaft – und unabhängig davon, ob diese Menschen noch leben oder schon verstorben sind. Ich war neugierig, was den Deutschen dazu einfällt, und gab eine repräsentative Umfrage bei dem Institut für Demoskopie Allensbach in Auftrag, die im Februar 2021 durchgeführt wurde. Die Befragten wurden gebeten, bis zu drei Personen zu nennen.
35 Prozent der Befragten in Deutschland fiel keine einzige Person ein, weitere 21 Prozent nannten immerhin eine Person. Nur 43 Prozent warteten mit zwei oder drei Namen auf. Am häufigsten wurde der CDU-Politiker und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble genannt, der im Rollstuhl sitzt. Nach Schäuble gaben die Befragten u.a. Stephen Hawking, Andrea Bocelli und Stevie Wonder an. Die gleiche Frage ließ ich in den USA von dem Institut Ipsos MORI stellen: 51 Prozent der Amerikaner konnten keine einzige erfolgreiche Person mit Behinderung benennen. 21 Prozent fiel nur ein einziger Name ein, und lediglich 28 Prozent konnten zwei oder mehr Persönlichkeiten mit Handicaps nennen. Am häufigsten wurde von den Amerikanern Stephen Hawking genannt, es folgten Nennungen von Michael J. Fox, Stevie Wonder, Franklin D. Roosevelt und Helen Keller.
Dass ich ein Buch zu diesem Thema geschrieben habe, hat einen persönlichen Hintergrund: Kurz nach meinem 61. Geburtstag bekam ich bei einer Routineuntersuchung beim Augenarzt einen Befund, mit dem ich nicht gerechnet hatte – epiretinale Gliose. Ich leide also an einer Netzhautstörung, bei der sich eine Membran oder ein Häutchen auf der Oberfläche des Netzhautmittelpunkts (Makula) gebildet hat. Auf dem rechten Auge, so der Arzt, sei die Krankheit fortgeschritten, aber auch das linke Auge sei betroffen. Im Extremfall werde die Erkrankung dazu führen, dass ich nicht mehr lesen könne, auch nicht mit der stärksten Brille der Welt. Jetzt müsse man noch nicht operieren, aber irgendwann werde das vermutlich notwendig werden. Auf meine Frage nach den Erfolgsaussichten erwiderte der Arzt: »Die Wahrscheinlichkeit, dass es gleich bleibt und keine Besserung eintritt, liegt bei einem Drittel, die Wahrscheinlichkeit, dass es durch die Operation besser wird, ebenfalls bei einem Drittel, und die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter wird, liegt auch bei einem Drittel.«
Ich konsultierte danach mehrere andere Spezialisten und entschied mich schließlich für eine Professorin an der Charité in Berlin. In den beiden folgenden Jahren war ich regelmäßig zur Untersuchung. Ich merkte, dass ich selbst mit meiner Brille nur noch mit dem linken Auge lesen konnte. Wenn ich das linke Auge zuhielt, sah ich mit dem rechten nur noch schwer zu entziffernde Wörter in Schlangenlinien. Also entschloss ich mich zu einer Operation, die zwei Jahre nach der Erstdiagnose stattfand. Die Professorin meinte, mein erster Arzt habe die Erfolgsaussichten einer Operation zu negativ eingeschätzt. Aber einen Prozentsatz für die Erfolgschancen wollte sie mir nicht nennen. Sie fügte nur hinzu, dass es oft ein halbes Jahr oder länger dauern könne, bis man den Effekt merke, und meist werde noch eine zweite, kleinere Operation notwendig.
Ein halbes Jahr später, am Heiligabend, stand ich am Gabentisch direkt unter einer Lampe und hielt eine Weihnachtskarte meiner Freundin in der Hand. Ich hatte die Lesebrille vergessen und war überrascht, dass ich bei hellem Licht mit dem operierten Auge sogar ohne Brille lesen konnte. Eine schöne Weihnachtsüberraschung! Die Ärzte nennen meine Art, wie ich heute sehe, »Monovision« oder »Goethe-Blick«: Mit dem linken Auge sehe ich fern gut, mit dem rechten nahe gut, beide ergänzen sich also.
Auf Probleme reagiere ich gewohnheitsmäßig so, dass ich mich mit der Frage auseinandersetze, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Dann versuche ich, das Positive an der Sache zu sehen. Positiv ist jedenfalls, dass Sie dieses Buch sonst nicht in den Händen hielten, denn ich hätte es ohne meine Krankheit nicht geschrieben. Ich begann jetzt, Bücher über Menschen mit einer Sehbehinderung bzw. über Blinde zu lesen – unter anderem das tolle Buch von Saliya Kahawatte »Blind Date mit dem Leben«. Ich hätte diesen außergewöhnlichen Menschen, der das Vorwort zu diesem Buch geschrieben hat, sonst nicht kennengelernt.
Inspiriert durch sein Buch begann ich, mich mit anderen erfolgreichen Menschen zu beschäftigen, die eine Behinderung hatten oder haben. Ich las mehrere Zehntausend Seiten Bücher sowie Berichte und Interviews über und mit behinderten Menschen und versuchte herauszufinden, was ihnen die Kraft gab, trotz ihrer Beeinträchtigungen aktiv und erfolgreich zu sein. Mit einigen konnte ich auch persönlich sprechen. In diesem Buch lesen Sie unter anderem über
einen Bergsteiger, der als Blinder auf sieben Kontinenten die jeweils mächtigsten Gipfel erklomm, darunter auch den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt;
einen weltweit bekannten und erfolgreichen Galeristen, der blind war, als er seine erste Galerie eröffnete;
den »Blind Traveller«, einen Engländer, der vor etwa 200 Jahren als Blinder mit nur wenig Geld ausgedehnte Reisen durch die ganze Welt unternahm, dabei 200 verschiedene Kulturen kennenlernte und eine Strecke zurücklegte, die länger ist als die Entfernung von der Erde zum Mond;
Ludwig van Beethoven, der fast vollständig taub war, als er seine 9. Sinfonie komponierte;
Vincent van Gogh, der seine berühmtesten Bilder malte, während er in der Psychiatrie saß;
die Unternehmensgründerin Margarete Steiff, Produzentin des ersten Teddybären, die als Kleinkind an Kinderlähmung erkrankte und seitdem im Rollstuhl saß;
Stephen Hawking, den Erforscher der Schwarzen Löcher und bekanntesten Wissenschaftler unserer Zeit;
den Motivationsredner und Buchautor Nick Vujicic, der ohne Arme und Beine auf die Welt kam und in 63 Ländern viele Millionen Menschen mit seinen inspirierenden Reden erreichte;
Helen Keller, die eineinhalb Jahre nach ihrer Geburt taubstumm und blind wurde und später eine weltweit erfolgreiche Schriftstellerin wurde;
Ray Charles, den »Hohepriester des Soul«, der im Alter von sieben Jahren erblindete und einer der besten Sänger aller Zeiten wurde.
Das Buch enthält weitere Geschichten über insgesamt 20 bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten, die sich in vielerlei Hinsicht unterschieden, aber alle in ihrer jeweils eigenen Art Unglaubliches taten oder erreichten. Bewusst habe ich sowohl berühmte Personen wie Beethoven oder van Gogh porträtiert, aber auch solche, von denen die meisten Leser vermutlich noch nie etwas gehört haben – wie etwa den Historiker William Hickling Prescott oder die Leichtathletin Marla Runyan. Das, was diese Menschen geleistet haben, ist sehr unterschiedlich: Manche haben mit ihren Werken Geschichte geschrieben, andere waren weit davon entfernt. Aber selbst für jene, auf die Letzteres zutrifft – so etwa Christy Brown –, gilt, dass sie weit mehr aus den ihnen gegebenen Möglichkeiten gemacht haben, als die meisten Zeitgenossen ihnen zugetraut hätten.
Ich hoffe, dass dieses Buch Menschen mit Behinderung und Eltern von behinderten Kindern ermutigt. Aber es richtet sich vor allem an Menschen ohne Behinderung, denen ich zeigen möchte, dass widrige äußere Umstände nicht entscheidend sind, wenn wir die Kraft unseres Geistes verstehen, uns große Ziele setzen und …
Ich möchte nicht alle Geheimnisse schon jetzt verraten. Sie werden sie in jedem Kapitel selbst finden! Es ist eine große Schatztruhe voller verborgener Erkenntnisse, und ich würde Ihnen die Freude am Entdecken nehmen, wenn ich sie schon vorher verriete. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass jedes Kapitel weit mehr als eine Aufzählung der wichtigsten Lebensstationen der porträtierten Persönlichkeit ist, sondern zudem Lektionen darüber enthält, was wir von diesen Menschen lernen können. Schreiben Sie selbst diese Lektionen heraus und denken Sie darüber nach, denken Sie sich mit diesen Erkenntnissen in den eigenen Erfolg!
Einen treffenden Titel und Untertitel für dieses Buch zu finden, der allen Porträtierten gerecht wird, war nicht einfach, weil die Begriffe »erfolgreich« und »Menschen mit Behinderung« Fragen hinterlassen:
Das Wort »Behinderte« weckt oft falsche Assoziationen, und man würde es für einige Menschen, die in diesem Buch porträtiert werden – so etwa für Frida Kahlo oder Vincent van Gogh – kaum verwenden. Das zeigt: Die Grenzen zwischen »Normalen«, »Gesunden« und »Behinderten« sind fließend, und niemand sollte auf seine Behinderung reduziert werden. Auch dies demonstrieren die Porträts der Akteure in diesem Buch, die in allererster Linie kreative, aktive und erfolgreiche Menschen sind. In zweiter Linie sind sie Menschen, die in verschiedener Weise eingeschränkt waren oder sind. Und »normal« zu sein, ist ohnehin nicht für jeden erstrebenswert. Erstrebenswert ist es aus meiner Sicht, ein erfülltes, kreatives, bemerkenswertes, aufregendes, inspirierendes Leben zu leben, in dem man im besten Fall etwas für die Nachwelt hinterlässt.
Waren aber alle Akteure in diesem Buch »erfolgreich«? Das kommt darauf an, wie Sie Erfolg definieren. Alle haben etwas geleistet, was ungewöhnlich und überdurchschnittlich ist. Bei manchen ist es unklar, ob man von »erfolgreich« sprechen kann. Das gilt beispielsweise für den genialen Mathematiker John Forbes Nash Jr. Er erhielt zwar 1994 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften und wurde als Mathematiker für einige grundlegende Entdeckungen berühmt, aber er verbrachte viele Jahre seines Lebens in Einsamkeit und in der Psychiatrie und war in diesen Zeiten sehr unglücklich. Ray Charles oder Stevie Wonder dagegen führten ein erfülltes und glückliches Leben. Versteht man unter einem erfolgreichen auch ein überwiegend »schönes« Leben, dann ist also der Begriff des »Erfolges« für manche in diesem Buch porträtierten Personen zu relativieren. Das trifft besonders für jene zu, die psychisch erkrankten (van Gogh und Nash), aber auch für jemanden wie den Schriftsteller Christy Brown, der seine schriftstellerische Karriere und sein Leben schließlich durch Alkohol ruinierte.
Was die Menschen, die in diesem Buch porträtiert werden, verbindet, ist, dass sie nicht aufgaben, selbst unter größten Schwierigkeiten. Dies gilt beispielsweise für den Schauspieler Michael J. Fox, der an Parkinson erkrankte, oder für den renommierten amerikanischen Geschichtswissenschaftler William Hickling Prescott, der sein Leben lang mit einer schweren Augenerkrankung kämpfen musste.
Wenn Sie das Leben erfolgreicher Menschen analysieren, dann werden Sie feststellen, dass die meisten Erfolgreichen – so wie alle anderen auch – Handicaps haben, die sie als Gründe vorbringen könnten, wären sie gescheitert. Der eine kommt aus schwierigen sozialen Verhältnissen, der andere steht im Schatten eines erfolgreichen Vaters, der nächste hat einen Migrationshintergrund oder keine gute Schulbildung. Manche fühlen sich zu jung für eine große Karriere, andere fühlen sich zu alt, um neu zu starten. In den Jahrzehnten, in denen ich mich mit erfolgreichen Menschen befasse, habe ich festgestellt, dass Erfolgsmenschen niemals ihre wirklichen oder vermeintlichen Nachteile als Ausreden anführten. Und genau dies trifft auch für die Menschen mit Behinderung zu, die ich in diesem Buch porträtiere.
Heute fühlen sich viele Menschen als Opfer: Opfer der Gesellschaft, Opfer von Benachteiligung oder Diskriminierung, Opfer widriger Umstände. Die Menschen in diesem Buch haben sich nie als Opfer gesehen. Sie wollten auch kein Mitleid. Sie sahen sich als Gestalter ihres eigenen Schicksals und glaubten daran, dass sie Dinge erreichen konnten, die selbst die meisten Menschen ohne Behinderung niemals erreichen würden. Was glauben Sie, was Sie alles erreichen können, wenn Sie diese Kraft kennen und nutzen lernen, die es diesen Persönlichkeiten ermöglichte, Unglaubliches zu tun?
Man sagt oft, Gesundheit sei das Wichtigste im Leben, und ich selbst habe diesen Satz auch manchmal gedankenlos gesagt und daran geglaubt. Bis ich anfing, mich mit den Menschen zu beschäftigen, über die Sie in diesem Buch lesen. Als ich die Biografie von Ray Charles las, fand ich Trost darin: Selbst, wenn ich blind werden würde – was in meinem Fall extrem unwahrscheinlich ist – oder nicht mehr lesen könnte, dann könnte ich ein glückliches, kreatives Leben leben. Denn Gesundheit ist zwar wichtig, aber wichtiger noch ist unsere innere Einstellung, und wichtiger ist, dass wir die verborgenen Kräfte kennenlernen, die in uns liegen.
Bedanken möchte ich mich vor allem bei Erik Weihenmayer, Felix Klieser und Johann König, die mir Fragen zu ihrem Leben beantwortet haben, und bei Saliya Kahawatte dafür, dass er trotz eines eigenen Buchprojektes Zeit für das Vorwort fand. Danken möchte ich auch dem Beethoven-Experten Professor Matthias Henke, den Van-Gogh-Experten Professor Uwe M. Schneede und Professor Manfred Clemenz sowie der Frida-Kahlo-Biografin Dr. Karen Genschow, die die entsprechenden Kapitel des Buches gelesen haben. Für Anregungen und Zuspruch danke ich auch meinen Freunden Dr. Gerd Kommer, Dr. Helmut Knepel, Oliver Luksic, Professor Hermann Simon, Dieter Nuhr und Jürgen Michael Schick. Und zuletzt gebührt mein Dank meinem Freund Ansgar Graw, der auch dieses Buch lektoriert hat.
Rainer Zitelmann, März 2021
1. Ludwig van Beethoven – »Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen«
Ludwig van Beethoven (Gemälde von Joseph Karl Stieler von 1820): »Kraft ist die Moral der Menschen, die sich vor anderen auszeichnen, und sie ist auch die meinige.«
In 45 Jahren schrieb er 138 Werke mit Opuszahl und etwa 240 Werke ohne Opuszahl,1 und selbst Menschen, die sich nicht für klassische Musik interessieren, haben mit Sicherheit schon eines davon gehört: Vielleicht ist es Beethovens wunderbare 5. Sinfonie (auch Schicksalssinfonie genannt) oder die Sinfonia eroica (seine 3.), vielleicht aber auch eine seiner vielen Klaviersonaten wie etwa die sogenannte Mondscheinsonate oder sein Klavierstück »Für Elise«. Es dürfte jedenfalls kaum jemanden geben, der nicht Beethovens 9. Sinfonie kennt – zumal das Hauptthema des letzten Satzes seit 1985 die offizielle Europahymne ist.
Die 9. Sinfonie wurde am 7. Mai 1824 in Wien uraufgeführt. Michael Umlauf dirigierte das Orchester und Beethoven stand schräg hinter ihm. Es wird berichtet, der große Komponist habe mit wilden Gebärden und Verrenkungen den Ausdrucksgehalt der Musik wiederzugeben versucht.2 Er fuhr »wie ein Wahnsinniger hin und her. Bald streckte er sich hoch empor, bald kauerte er bis zur Erde, er schlug mit Händen und Füßen herum, als wollte er allein die sämtlichen Instrumente spielen und den ganzen Chor singen.«3 Die Musiker achteten jedoch nur auf Umlauf, denn Beethoven, der zu diesem Zeitpunkt schon taub war, konnte seine eigene Musik nicht mehr hören und nicht dirigieren.
»Beethoven«, schreibt Jan Caeyers in seiner Beethoven-Biografie, »erlebte an diesem Abend einen der größten Triumphe seiner Karriere.«4 Schon nach dem zweiten Satz brach ein Beifallssturm los. Freilich hörte Beethoven nichts davon, die Sängerin Caroline Unger drehte ihn zum Publikum um, damit er die Ovationen entgegennehmen konnte. Das Schluss-Crescendo versetzte die Zuhörer in Ekstase, der Saal schien zu explodieren und Beethoven wurde fünfmal nach vorn gerufen. Selbst die kaiserliche Familie rief man gewöhnlich nur dreimal.5
Der Komponist hatte die 9. Sinfonie innerhalb von nur neun Monaten zwischen Mai 1823 und Februar 1824 zu Papier gebracht, jedoch schon viele Jahre zuvor Stoff und Ideen für sein großes Werk gesammelt.6
Beethoven, der am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren wurde, entstammte einer Musikerfamilie. Sein Großvater, der übrigens den gleichen Vornamen trug, war Hofkapellmeister in Bonn, der jüngere Ludwig van Beethoven bewunderte ihn sein Leben lang, obwohl er ihn kaum kennengelernt hatte: Der Großvater starb, als er drei Jahre alt war. Auch Beethovens Vater war Musiker, aber der Tenorsänger an der Hofkapelle war nicht besonders talentiert und verfiel immer mehr dem Alkohol. Johann van Beethoven wurde 1789 vorzeitig in den Ruhestand versetzt und sein ältester Sohn Ludwig zum Vormund seiner Brüder bestimmt. Beethovens strenger Vater hatte ihm zwar den ersten Musikunterricht erteilt, und im Alter von acht Jahren trat der Sohn in Köln bereits erstmals öffentlich als Pianist auf. Der Vater erkannte jedoch selbst die Grenzen seiner eigenen Möglichkeiten und meldete den Sohn im Alter von elf Jahren zum Klavier- und Kompositionsunterricht bei Christian Gottlob Neefe an, der zu seinem ersten wichtigen Lehrer wurde. 1783 veröffentlichte Neefe einen später immer wieder zitierten Artikel im »Magazin der Musik«, in dem er große Worte für das »vielversprechende Talent« seines Schülers fand: »Dieses junge Genie verdiente Unterstützung, dass er reisen könnte. Er würde gewiss ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er angefangen.«7
Vier Jahre später reiste Beethoven nach Wien, um Mozart zu treffen, aber wahrscheinlich kam es zu keiner Begegnung. 1792 lernte Beethoven Joseph Haydn in Bonn kennen, bei ihm wollte er sich in Komposition unterrichten lassen. Beethoven nahm dann auch bei Haydn – nach Mozarts Tod der bedeutendste Komponist seiner Zeit – Unterricht. Er währte von seiner Ankunft in Wien im November 1792 bis kurz vor Haydns Abreise nach England im Januar 1794. »Die Bedeutung dieser Erfahrungen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden«, so Caeyers. »In Bonn hatte Beethoven schon bewiesen, dass er die Grundlagen des Komponierens beherrschte. Er konnte schöne, zusammenhängende melodische Linien erfinden, war mit den Prinzipien der klassischen Formenlehre vertraut, kannte sich mit den üblichen harmonischen Schemata aus und verstand sich aufs Orchestrieren.« Er hatte also das Handwerkszeug gelernt, aber er wusste, dass Haydns und Mozarts Musik jenes »gewisse Etwas« hatten, das sie vor ihren Zeitgenossen auszeichnete, vor allem eine »richtige Dosis gut durchdachter Unberechenbarkeit«.8 So wollte auch Beethoven komponieren lernen. Er bastelte systematisch an seiner Karriere, wollte sich einen Namen machen, in Wien, das nun seine neue Heimat wurde, aber auch darüber hinaus.
So brach er im Februar 1796 zu einer Konzertreise nach Prag, Dresden, Leipzig und Berlin auf. Das Publikum in Prag war begeistert, in Presseberichten wurde Beethoven als »Genie« und »Abgott« gefeiert.9 In Berlin spielte er vor dem König Friedrich Wilhelm II., und dieser soll sogar erwogen haben, Beethoven zu engagieren. Zu einem Angebot kam es aber nicht mehr, weil der König 1797 starb.10
Beethoven etablierte sich zunehmend in Wien, wo er hervorragende Lehrer fand, Adlige, die ihn finanziell unterstützten, und ein Publikum, das ihn mochte. Sein erstes Wien-Jahrzehnt ist eine Periode unaufhaltsamer Erfolge. Gefeiert von der Öffentlichkeit und umworben von Musikverlegern, gewinnt er zunehmend an Selbstbewusstsein und schreibt an seinen Freund Nikolaus Zmeskall: »Kraft ist die Moral der Menschen, die sich vor anderen auszeichnen, und sie ist auch die meinige.«11
Beethovens Arbeitstag war diszipliniert. Er stand sehr früh auf und arbeitete dann, nur unterbrochen von einer oder zwei kurzen Pausen, bis zum Mittagessen um zwei oder drei Uhr. Nach dem Essen ging er spazieren. Dabei achtete er kaum auf die Umgebung, sondern war mit den Gedanken ganz bei seiner Musik. Manchmal blieb er stehen und notierte Einfälle, die er später am Schreibtisch oder am Klavier ausarbeitete. Beethoven komponierte eigentlich »immer und überall«. Seine Kompositionen durchliefen mehrere Stadien: »Eine noch vage Idee gewann in einem langsamen, mühevollen Entwicklungsprozess Gestalt, bis ein vollständig ausgearbeitetes, in sich stimmiges Ganzes entstand.«12
Beethoven hatte als Pianist begonnen und sein Ziel war es ursprünglich gewesen, Kapellmeister zu werden. Doch ein gesundheitliches Problem, das sich mehr und mehr in den Vordergrund drängte, gab seinem Leben eine andere Wendung. Es begann alles scheinbar harmlos: Die ersten Symptome traten im linken Ohr auf, bald aber war auch das rechte betroffen. Zunächst hatte er glücklicherweise beim Klavierspielen kaum Probleme. Aber Unterhaltungen wurden für ihn zunehmend schwieriger, weil er seine Gesprächspartner nur noch schwer verstehen konnte. Er ging von einem Arzt zum anderen: Die Ärzte schlugen allerlei Behandlungen vor, doch keine brachte Besserung. Doch Beethoven wollte sich nicht von der Krankheit bezwingen lassen und schrieb im November 1801 trotzig an seinen Freund Franz Gerhard Wegeler: »Ich will dem Schicksal in den rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiß nicht – für ein stilles – Leben, nein ich fühl’s, ich bin nicht mehr dafür gemacht.«13
Anfang Mai 1802 zog er auf Rat seines Arztes nach Heiligenstadt, ein Dorf mit nur 400 Einwohnern. Beethoven hatte sein Leben lang Unterleibserkrankungen und die Ärzte vermuteten einen Zusammenhang zu seinem Gehörleiden. Eine Badekur und Abstand vom hektischen Treiben in Wien sollten Abhilfe schaffen.14
Beethoven hatte vor seinen Freunden und der Öffentlichkeit die Gehörprobleme zu verbergen versucht, da er befürchtete, es würde seiner Karriere als Musiker schaden, wenn sich dies herumsprechen würde. Auf einer Wanderung mit seinem Schüler Ferdinand Ries wurde sein Geheimnis jedoch offenbar. Ries berichtete: »Ich machte ihn nämlich auf einen Hirten aufmerksam, der auf einer Flöte, aus Fliederholz geschnitten, im Walde recht artig blies. Beethoven konnte eine halbe Stunde hindurch gar nichts hören, und wurde, obschon ich ihm wiederholt versicherte, auch ich höre nichts mehr (was indes nicht der Fall war), außerordentlich still und finster.«15
Gegen Ende seines Aufenthaltes in Heiligenstadt erlitt Beethoven vermutlich einen körperlichen Zusammenbruch. Zwar erholte er sich rasch, aber dies war wohl der Anlass, warum er Anfang Oktober 1802 ein Dokument aufsetzte, das als »Heiligenstädter Testament« Berühmtheit erlangte. Das Schriftstück wurde erst in seinem Nachlass gefunden, wahrscheinlich hat er es nie jemandem gezeigt. Es war auch weniger ein Testament im engeren Sinn. Die eigentliche Aufgabe lag nicht in der Regelung des Nachlasses, sondern er wies vehement Vorwürfe wegen seines Verhaltens zurück. Zum Hintergrund muss man wissen, dass Beethoven ein schwieriger Mensch war, der häufig in Konflikte mit seinen Mitmenschen geriet – mit Freunden, Mäzenen, Verlegern, einfach mit jedermann. Seine mütterliche Vertraute Helene von Breuning pflegte zu sagen, wenn er mal wieder einen seiner Ausbrüche hatte: »Er hat heute wieder seinen Raptus« (der medizinische Ausdruck für einen Wutanfall).16 Bekannt und oft zitiert ist eine Äußerung von Goethe, der Beethoven 1812 getroffen hatte: »Sein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genußreicher macht.«17 Und Beethovens Freund, der Arzt und Dichter Aloys Weißenbach, meinte über ihn: »Diese hohe Reizbarkeit des Gemüthes und der mächtige Trotz des Kunst-Genius in ihm machen sein Glück und sein Unglück aus; sein Glück, in so fern sie ihn immer auf sich selbst zurückweisen; sein Unglück, in so fern sie ihn beständig mit der Welt in feindlicher Spannung halten.«18
Beethoven selbst erklärte Ferdinand Ries, der zeitweilig sein Sekretär war, zwar habe er oft die ihm eigene »Empfindlichkeit verbergen und zurückhalten« können, aber wenn man ihn zur Unzeit reize, wenn er »empfänglicher für den Zorn« sei, dann »platze« er »stärker aus, als jeder Andere«.19 Es gibt zahllose Berichte über sein eruptives, bis zur körperlichen Attacke reichendes Verhalten. Einmal habe er sogar auf Bedienstete eingeprügelt, ein anderes Mal einen unbeholfenen Ober mit Suppe übergossen.20
Anscheinend hatte die Kritik an Beethovens Verhaltensweisen in dieser Zeit so stark zugenommen, dass er sich in seinem »Heiligenstädter Testament« zu erklären suchte. Die Bedeutung des Dokumentes liegt vor allem darin, dass es uns einen einzigartigen Einblick in seine psychische Verfassung und in seine Verzweiflung wegen der zunehmenden Schwerhörigkeit gibt. Der Text, der etwas schwierig zu lesen ist, weil Beethoven lange Passagen ohne Punkte, Kommata und Absätze schrieb, begann so: »O ihr Menschen die ihr mich für Feindselig störisch oder Misantropisch haltet oder erkläret, wie unrecht thut ihr mir, ihr wisst nicht die geheime ursache von dem, was euch so scheinet, mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens, selbst große Handlungen zu verrichten dazu war ich immer aufgelegt, aber bedenket nur, daß seit 6 Jahren ein heilloser Zustand mich befallen, durch unvernünftige Ärzte verschlimmert, von Jahr zu Jahr in der Hoffnung gebessert zu werden, betrogen, endlich zu dem überblick eines daurenden Übels das (dessen Heilung vielleicht Jahre dauren oder gar unmöglich ist) gezwungen, mit einem feurigen Lebhaften Temperamente gebohren selbst empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft, muste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen, wollte ich auch zuweilen mich einmal über das hinaussezen, o wie hart wurde ich durch die verdoppelte traurige Erfahrung meines schlechten Gehör’s dann zurückgestoßen, und doch war’s mir noch nicht möglich den Menschen zu sagen: sprecht lauter, schreyt, denn ich bin Taub, ach wie wär es möglich dass ich den die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bey mir in einem Vollkommeneren Grade als bey andern seyn sollte ...«21
Beethoven fährt fort, dass er »wie ein Verbannter« leben müsse, weil er Angst habe, seine Umwelt könne die Schwerhörigkeit bemerken. In Situationen, wo er fürchten musste, dass andere seine Schwerhörigkeit bemerkten, sei er »nahe an Verzweiflung« gewesen, es habe wenig gefehlt »und ich endigte selbst mein Leben«. Er fügte hinzu: »Nur sie die Kunst, sie hielt mich zurück, ach es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fühlte …« Er habe trotz aller Hindernisse der Natur doch noch alles getan, was in seinem Vermögen stand, »um in die Reihe würdiger Künstler und Menschen aufgenommen zu werden«. Der Tugend und der Kunst habe er es zu verdanken, »daß ich durch keinen selbstmord mein Leben endigte«.22
Als Erklärung für seine Wutausbrüche waren diese Ausführungen nicht überzeugend, denn diese waren von seinen Zeitgenossen auch schon vor Beginn seiner Krankheit beobachtet worden, und sie setzten sich fort, als er nicht mehr – wie in diesem Text beschrieben – unter dem Druck stand, das Geheimnis seiner Schwerhörigkeit vor seinen Mitmenschen zu verbergen. Man muss hinzufügen, dass solche Ausbrüche bzw. Wutanfälle für geniale Menschen nicht ungewöhnlich sind – auch heute kennen wir viele Berichte über extreme Verhaltensweisen von außergewöhnlichen Persönlichkeiten wie etwa Steve Jobs oder Bill Gates.23
Den Wert des »Testamentes« hat Beethovens Biograf Jan Caeyers treffend beschrieben: Beethoven habe mit großer Sorgfalt ein »feierliches Credo niedergeschrieben, um sich selbst von der Bedeutung seiner künstlerischen Sendung zu überzeugen«. Und er fügt hinzu: »Heutige ›Mentaltrainer‹ schwören auf ähnliche Methoden und würden sie Beethoven sicher empfehlen.«24
Beethoven litt zunehmend unter der Schwerhörigkeit. Verschiedene Hörrohre, die er anfertigen ließ, trugen nicht zu Linderung bei. Seinen Klavierbauer bat er, ihm lautere Instrumente zu konstruieren.25 Auch das Dirigieren wurde immer schwieriger, da er nichts mehr hören konnte. Bei einer Probe für die von ihm komponierte Oper Fidelio richtete er ein so großes Chaos an, dass man ihn vom Dirigentenpult entfernen musste.26 Mit seinen Mitmenschen konnte er irgendwann nur noch kommunizieren, wenn sie ihm in das Ohr schrien, als auch dies nicht mehr ging, verständigte er sich nur noch schriftlich mit seinen sogenannten »Konversationsheften«, die heute eine einmalige historische Quelle sind. Seine »Gesprächspartner«, manchmal auch er selbst, schrieben dort Wörter, Sätze und Satzfragmente hinein.
Doch wie alle großen und erfolgreichen Menschen gelang es Beethoven, den Nachteil in einen Vorteil zu verwandeln. Erfolgreiche Menschen werden, so wie andere auch, immer wieder mit Krisen und Schwierigkeiten konfrontiert. Aber sie zeichnen sich dadurch aus, dass es ihnen gelingt, in der Krise Chancen zu nutzen, weil sie verstehen – wie das Napoleon Hill immer wieder betonte –, »dass sich jeder Nachteil in einen zumindest gleich großen Vorteil verwandeln lässt«.27
Auch wenn er deswegen vorübergehend in Verzweiflung verfiel und an Selbstmord dachte, so erwies sich Beethovens Taubheit in einer Hinsicht sogar eher als Segen denn als Fluch. »Das Schicksal«, so Caeyers, »ersparte ihm eine vielleicht unmögliche Entscheidung, denn es zwang ihn, seine vielversprechende Karriere als Konzertpianist aufzugeben und sich ganz auf die Komposition zu konzentrieren.«28 Zudem sei es ein Vorteil gewesen, dass er sich wegen seiner Krankheit zunehmend von der Außenwelt abgewandt und zurückgezogen habe, was auch nicht ohne musikalische Konsequenzen geblieben sei: »Er ›hörte‹ nicht mehr auf musikalische Regeln und Konventionen, das heißt, er war freier und konnte gerade dank der erzwungenen musikalischen Enthaltsamkeit eine neue Musiksprache entwickeln, die er selbst schon sehr früh als ›neuen Weg‹ bezeichnete. So gesehen, war die persönliche und soziale Tragödie seines Lebens auch eine Chance, und Beethoven nutzte sie, indem er ungeahnte musikalische Welten erkundete.«29
Wir wissen von anderen genialen Menschen, dass sie oft versuchen, äußere Einflüsse zu minimieren. Der geniale Investor Warren Buffett lebt beispielsweise sein Leben lang in Omaha und nicht etwa in New York, auch deshalb, weil er sich bewusst dem hektischen Treiben und den Einflüssen der Wallstreet zu entziehen versucht. Und für Beethoven war es vermutlich ein Vorteil, dass er mit zunehmender Taubheit immer mehr auf seine eigene Fantasie zurückgeworfen war und sich damit unabhängiger von Moden und äußeren Einflüssen auf seine für die damalige Zeit ungewöhnliche – und für manche Ohren gewöhnungsbedürftige – Musik konzentrieren konnte.
Wirtschaftlich war die Situation für Beethoven zeit seines Lebens schwierig, obwohl er in manchen Phasen hohe Einnahmen hatte. Er hatte auch einige Aktien gekauft, aber die wollte er nur in der höchsten Not veräußern oder beleihen. Als der italienische Komponist Rossini ihn besuchte, war er erstaunt über die Diskrepanz zwischen seiner eigenen luxuriösen Lebensführung und den bescheidenen Verhältnissen, in denen Beethoven wohnte: »Als ich die Treppe hinaufstieg, die zu der armseligen Wohnung führte, in welcher der große Mann lebte, hatte ich einige Mühe, meine Gefühle zu beherrschen. Als sich die Tür öffnete, befand ich mich in einer Art finsterem Loch, das ebenso schmutzig war wie es von einer schrecklichen Unordnung zeugte. Ich erinnere mich vor allem, dass die Decke, die unmittelbar unter dem Dach lag, breite Risse zeigte, durch welche der Regen in Strömen eindringen konnte.«30
Beethoven war es völlig egal, ob sein Zimmer aufgeräumt oder unordentlich war; ebenso gleichgültig war ihm, was Besucher davon hielten. Und ihn kümmerte auch nicht, ob sich die Leute über seine nachlässige Kleidung, sein unrasiertes Kinn oder sein ungekämmtes Haar das Maul zerrissen. Er, der sich schon als Jugendlicher mit den Helden der griechischen Antike identifiziert hatte und sich berufen fühlte, Großes zu leisten, scherte sich nicht um solche Dinge, weil er wusste, dass er am Ende seines Lebens nicht danach beurteilt würde, ob die Wohnung oder seine Frisur ordentlich waren, sondern dass er an seinem Werk gemessen würde.
Beethoven konzentrierte sich zunehmend auf das Komponieren, und ein Geheimnis seines Erfolges ist eben diese Fokussierung und seine Angewohnheit, so viele Dinge wie nur möglich an andere Menschen zu delegieren. Er hatte keine geringen Einnahmen, aber er gab viel Geld aus, damit er sich ganz auf das Komponieren fokussieren konnte. Er hatte Haushaltshilfen, mit denen er jedoch oft aneinandergeriet, sodass es eine große Fluktuation gab. Und der Komponist beschäftigte einen beachtlichen Kreis von Kopisten, auch das kostete Geld. Er hatte die Angewohnheit, alles zu delegieren und spannte die Kopisten auch für Schreib- und Botendienste sowie Besorgungen aller Art ein. Zudem engagierte er zahlreiche Rechtsanwälte, da er häufig Rechtsstreitigkeiten auszufechten hatte. Schließlich kosteten die Ärzte viel Geld, denn Beethoven litt nicht nur unter Schwerhörigkeit, sondern hatte so viele Krankheiten, dass deren Beschreibung und Analyse ein ganzes Buch mit 270 Seiten füllt.31
»Angesichts der finanziellen Belastungen erscheint Beethovens in den 1820er-Jahren zunehmende Angst vor Altersarmut verständlich zu sein«, schreibt der Biograf Matthias Henke. »Anders als die meisten Kollegen übte er neben dem Komponieren kaum eine Nebentätigkeit aus.«32 Die Pianistenlaufbahn hatte er wegen der zunehmenden Schwerhörigkeit abgebrochen. Andere Komponisten verdienten zusätzlich Geld als Lehrer, doch auch hierdurch wollte Beethoven sich nicht ablenken lassen. Nur für außerordentlich talentierte Schüler machte er gerne eine Ausnahme. Und natürlich dann, wenn sich die Gelegenheit ergab, jungen, attraktiven Frauen Unterricht zu geben; nicht selten entwickelte er dabei Gefühle für seine Schülerinnen.
Matthias Henke schreibt, Beethovens Zurückhaltung bei Nebentätigkeiten möge schlicht einer Neigung entsprochen haben oder aber dem »Wunsch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf den ›neuen Weg‹«.33 Andererseits zwang ihn diese Zurückhaltung, umso nachdrücklicher und härter mit den Verlegern um den besten Preis zu verhandeln. Nach seiner Rückkehr aus Heiligenstadt war eine der Entscheidungen Beethovens, dass sein Bruder Kaspar Karl sich der finanziellen Dinge und der Verhandlungen anzunehmen habe.34 Nachdem Beethoven beschlossen hatte, sich ganz auf das Komponieren zu beschränken, antwortete Kaspar Karl einem Verleger, der einige kleinere Kompositionen bestellen wollte, dass sein Bruder fast nur noch größere Werke wie Oratorien oder Opern schreibe. Die in dem Schreiben verlangten Honorare waren ungewöhnlich hoch.35 Der Bruder entlastete Beethoven in dieser Hinsicht ganz erheblich. Allerdings währte die Zusammenarbeit nur vier Jahre und endete 1806 mit der Heirat von Kaspar Karl.36
Beethoven selbst war nie verheiratet. Er verliebte sich oft, doch die meisten Affären dauerten nur wenige Monate. Er begeisterte sich für Frauen, die für ihn unerreichbar blieben, beispielsweise weil sie adlig oder verheiratet waren oder nur einen Partner mit besseren finanziellen Möglichkeiten heiraten wollten. Berühmt geworden ist sein »Brief an die unsterbliche Geliebte« vom Juli 1812, der für die Forschung bis heute ein Rätsel bleibt. Niemand kann sicher sagen, an wen er gerichtet war, ob an Josephine Brunsvik, wie manche Forscher meinen, oder an Antonie Brentano, wie andere vermuten37 – möglicherweise auch an gar keine konkrete, einzelne Person, sondern an ein »Ideal der Weiblichkeit«38. Jedenfalls ist es das Dokument der Liebe zu einer Frau, die verheiratet war, weshalb eine offizielle Bindung unmöglich schien.39
Beethoven war wohl auch in Bezug auf Frauen Perfektionist mit den höchsten Ansprüchen an ein Ideal, so wie bei seiner Musik: Immer wieder und wieder schrieb er seine Musikstücke um, nie war er ganz zufrieden. Diese produktive Unzufriedenheit ist ein Merkmal vieler sehr erfolgreicher Menschen. Aber auf der Suche nach der perfekten Frau blieb er alleine und ohne Familie. Einerseits erleichterte ihm dies die Fokussierung ganz auf seine Arbeit. Andererseits vermisste er offensichtlich eine Familie, denn er kämpfte geradezu wie besessen (und mit hohen Anwaltskosten) um die Vormundschaft für seinen Neffen Karl, den Sohn seines 1815 verstorbenen Bruders Kaspar. Die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten raubten ihm sicherlich ebenso viel Energie wie später dann die Sorge um die Entwicklung seines Neffen. Auch in der Beziehung zum 1806 geborenen Karl, den er wie seinen Sohn betrachtete, zeigte sich Beethovens Perfektionismus, der ihm in der Musik so viel nutzte, aber in den Beziehungen so viel schadete. Beethoven ließ den geliebten Neffen regelrecht beschatten, stets von der Angst getrieben, er könne einen Fehltritt begehen. Der Neffe, der schließlich einen Selbstmordversuch beging (ihn aber überlebte), meinte, er sei »schlechter geworden«, weil ihn sein Onkel »besser haben wollte«.40
Beethovens letzter öffentlicher Auftritt als Konzertpianist war am 22. Dezember 1808 in Wien.41 Er hatte lange darauf gewartet und bombardierte das Publikum gleichsam mit vielen seiner Kompositionen. Es wurde auf eine harte Probe gestellt, denn in dem Saal herrschte sibirische Kälte und das Konzert dauerte vier Stunden. Beethoven selbst spielte bei diesem letzten öffentlichen Auftritt als Pianist schlecht und auch das Orchester war nicht gut. Bereits bei den Proben war es zu so heftigen Auseinandersetzungen zwischen Beethoven und dem Orchester gekommen, dass man ihn aus dem Saal entfernen musste. Auch beim Konzert entstand ein so großes Chaos, dass man abbrechen und von vorne beginnen musste.42
Eine Zeit lang sah es so aus, als würde Beethoven sich mit diesem Konzert von Wien verabschieden. Einige Wochen zuvor hatte er eine Berufung als Kapellmeister an den Kasseler Hof erhalten. Kassel war damals die Hauptstadt des neuen Königreichs Westphalen und wurde von 1807 bis 1813 von Napoleons jüngstem Bruder Jérôme regiert. Beethoven überlegte sich tatsächlich, das Angebot von Jérôme anzunehmen. Im Januar 1809 schrieb er in einem Brief, er sei von »Ränken und Kabalen und Niederträchtigkeiten aller Art gezwungen«, Wien zu verlassen.43 Sein Sekretär handelte einen Vertrag aus, doch in Wien war man alarmiert. Mehrere Adlige taten sich zusammen und machten Beethoven das Angebot, ihm eine jährliche Leibrente von 4.000 Gulden zu zahlen, um ihn in Wien zu halten. Die Vereinbarung enthielt nur vage Verpflichtungen für Beethoven und die Adligen zeigten ihr Verständnis für seine Bedürfnisse, wenn sie erklärten: »Da es aber erwiesen ist, daß nur ein so viel [als] möglich sorgenfreyer Mensch, sich seinem Fache allein widmen könne, und diese, von allen übrigen Beschäftigungen ausschlüssliche Verwendung allein im Stande sey, grosse, erhabene, und die Kunst veredelnde Werke zu erzeugen, so haben Unterzeichnete den Entschluss gefaßt, Herrn Ludwig van Beethoven in den Stand zu setzen, daß die nothwendigsten Bedürfnisse ihn in keine Verlegenheit bringen und sein kraftvolles Genie dämmen sollen.«44
Der Vertrag, der eigentlich Beethovens finanzielle Schwierigkeiten lösen sollte, bereitete jedoch zusätzliche Probleme und war über Jahre hinweg Anlass für zahlreiche Rechtsstreitigkeiten. Für eine längere Zeit zahlten einige der Sponsoren nicht, zum Teil, weil sie es nicht konnten, dann wiederum gab es eine Inflation, durch die das ursprüngliche Zahlungsversprechen entwertet wurde. Beethoven war nicht nur verzweifelt wegen seiner finanziellen Situation, sondern vor allem, weil ihn die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten von der Musik ablenkten. Dabei war doch der Sinn des Vertrages gerade gewesen, dass er sich ganz und gar auf die Kunst konzentrieren konnte. »Welche Beschäftigung für einen Künstler, dem nichts so sehr am Herzen liegt, als seine Kunst«, klagte Beethoven anlässlich eines bevorstehenden Rechtsstreites über den Vertrag.45
Es gibt Künstler, die von ihren Zeitgenossen nicht in ihrer Bedeutung erkannt wurden und erst den Ruhm der Nachwelt erlangten, es gibt andere, die schon zu Lebzeiten berühmt wurden. Bei Beethoven verhält es sich differenziert. Er gehörte nicht zu den Unbekannten, die von den Zeitgenossen verkannt und erst von der Nachwelt entdeckt wurden. Zeitweise war er ein gefeierter Mann, obwohl in der letzten Periode seines Schaffens andere Musiker weitaus populärer waren als er. Caeyers sieht eine gewisse Tragik darin, dass Beethovens Berühmtheit in breiten Bevölkerungsschichten einen Höhepunkt erreichte mit Kompositionen wie der Schlachtensinfonie »Wellingtons Sieg«. Das 1813 komponierte Stück versetzte die Wiener in geradezu schiere Begeisterung. Er selbst freute sich einerseits natürlich über den grandiosen Erfolg, doch andererseits war dies nicht die Art von Musik, die ihm am Herzen lag.
»Es stimmt nachdenklich«, so meint der Biograf, »dass sein Erfolg nicht auf den beinahe hundert im Jahrzehnt zuvor komponierten Werken beruhte, in denen er wirklich Großes geleistet hatte. Wir können uns damit trösten, dass es noch ungerechter gewesen wäre, hätte Beethoven Ruhm geerntet, ohne je diese andere und bessere Musik geschrieben zu haben.«46 Es trifft für viele Künstler zu, dass sie Kompromisse machen und einerseits Werke verfassen, die ihnen selbst sehr viel bedeuten und von denen sie sich erhoffen, dass die Nachwelt sie angemessen zu würdigen weiß, andererseits aber auch Stücke, die sich eher am Geschmack des breiten Publikums ausrichten und mit denen sie dann oft mehr Geld verdienen.
Im besten Fall kommen alle drei Dinge zusammen, die Anerkennung durch das zeitgenössische Publikum, die Anerkennung durch die Musikexperten und die Anerkennung durch die Nachwelt. Dass es sich dabei nicht immer um einen Widerspruch handeln muss, zeigt Beethovens 9. Sinfonie. Sie wird von Musikexperten und dem breiten Publikum gleichermaßen geschätzt, fand bereits bei der ersten Aufführung begeisterten Beifall und zieht bis heute die Menschen in ihren Bann. Man kann sogar argumentieren, dass das breite Publikum in diesem Fall einen sichereren Geschmack bewies als manche Experten unter Beethovens Zeitgenossen. Der Komponist und Geiger Louis Spohr schrieb beispielsweise: »Ich […] gestehe frei, daß ich den letzten Arbeiten Beethovens nie habe Geschmack abgewinnen können. Ja, schon die viel bewunderte neunte Symphonie muß ich zu diesen rechnen […], deren vierter Satz mir […] monströs und geschmacklos und in seiner Auffassung der Schiller’schen Ode so trivial erscheint, daß ich immer noch nicht begreifen kann, wie ihn ein Genius wie der Beethoven’sche niederschreiben konnte. Ich finde darin einen neuen Beleg zu dem, was ich schon in Wien bemerkte, daß es Beethoven an ästhetischer Bildung und an Schönheitssinn fehle.«47 Freilich gab es damals auch schon andere Stimmen. Die angesehene »Allgemeine musikalische Zeitung« feierte die Sinfonie in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben, es war die längste Besprechung, die je in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde. Für Beethovens Fans ließ die Zeitschrift sogar ein Porträt des Komponisten stechen, das als kostenlose Beilage veröffentlicht wurde.48
In der Besprechung hieß es: »Einem niederschmetternden Donnerschlag vergleichbar kündet sich das Finale an; als aber endlich, nach einer Aufforderung des Solo-Basses, auch der volle Chor in majestätischer Pracht das Loblied der Freude anstimmt, da öffnet das frohe Herz sich weit dem Wonnegefühle des seeligen Genusses, und tausend Kehlen jauchzen [...] Kunst und Wahrheit feyern hier ihren glänzendsten Triumph, und mit Fug und Recht könnte man wohl sagen: non plus ultra! – Wem möchte es wohl gelingen, diese unnennbare Stelle noch zu überbieten?«49
Als er die Sinfonie komponierte, war Beethoven nicht nur fast völlig taub, sondern litt auch – was weniger bekannt ist – an einer ernsten Augenerkrankung, ja, er war halb blind.50 Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in den folgenden Jahren zunehmend, und sein beträchtlicher Alkoholkonsum verschlimmerte seine zahlreichen Leiden, darunter eine Leberzirrhose. Er starb am 26. März 1827 und wurde wenige Tage später beerdigt. Zehntausende gaben ihm das letzte Geleit. Der Schauspieler Heinrich Anschütz hielt die von dem Dramatiker Franz Grillparzer verfasste Trauerrede: »[...] ein Künstler war er, und was er war, war er nur durch die Kunst. Des Lebens Stacheln hatten ihn tief verwundet, und wie der Schiffsbrüchige das Ufer umklammert, so floh er in deine Arme, o du, [...] des Leides Trösterin, von oben stammende Kunst!«51
2. James Holman – Er reiste blind 400.000 Kilometer
James Holman mit Noctograph: »Falls meine Unternehmungen keinen anderen Nutzen haben als jenen, der Welt zu beweisen, was mit heiterer Hartnäckigkeit trotz schweren Gebrechens erreicht werden kann …, dann bin ich zufrieden und glaube, dass meine Anstrengungen nicht völlig wertlos waren.«
»Seit frühester Jugend hatte es mich gedrängt, ferne Regionen zu erforschen und die Vielgestaltigkeit der menschlichen Natur zu studieren, wie sie unter dem Einfluss anderer Klimazonen, Sitten und Gesetze zutage tritt«, erinnerte sich James Holman in seinem 1822 erschienenen ersten Reisebericht.1 Schon früh setzte sich der britische Abenteurer große Ziele: Er war »von dem innigen Wunsch getrieben, so viele Ecken der Welt kennenzulernen, wie es mir mein Beruf ermöglichte, und ich war entschlossen, mich nicht eher zufriedenzugeben, bis ich die Welt umrundet hatte«.2
Und seine Träume waren Wirklichkeit geworden! Bis zur Erfindung der Verbrennungsmaschine war Holman der am weitesten gereiste Mann der Welt. Er reiste fast immer allein. »Niemand stand mir mit Rat und Tat zur Seite, und ich bewältigte meine Reisen, die oftmals beschwerlich waren und über weite Strecken gingen, mit sehr geringen finanziellen Mitteln«.3 Er benutzte Postkutschen, Bauernwagen, Pferde, reiste auf vom Wind vorangetriebenen Schiffen und ging oft zu Fuß, eine Eisenbahn benutzte er nie. »Er hat den Erdball ausgiebiger bereist als jeder andere Reisende vor ihm«, stellte der bekannte Journalist William Jerdan 1866 fest.4 Holman hatte nicht weniger als 400.000 Reisekilometer zurückgelegt5 – das Zehnfache des Erdumfangs und weiter als von der Erde zum Mond. »Er durfte sich einer gründlichen Kenntnis jedes von Menschen bewohnten Erdteils rühmen, und des direkten Kontakts mit mindestens zweihundert klar voneinander abgegrenzten Kulturen.«6
Doch mit seinen eigenen Augen gesehen hat er all diese Länder nie – als er mit seiner Reisetätigkeit begann, war er bereits blind. James Holman wurde am 15. Oktober 1786 in der südenglischen Hafenstadt Exeter (Devonshire) als Sohn eines Apothekers geboren. Mit zwölf Jahren trat er in die britische Navy ein und machte dort rasch Karriere. Mit 16 Jahren wurde der Mittelschiffsmann zum Kapitän nicht nur eines, sondern einer ganzen Reihe von Schiffen befördert.7 Vermutlich hätte er eine großartige Karriere in der Navy gemacht, wenn er nicht schwer erkrankt wäre. An was er genau litt, wissen wir nicht, aber er hatte heftige Gliederschmerzen, sodass er kaum noch laufen konnte. Die Diagnose lautete »erkranktes Fußgelenk und wandernde Gicht«8, doch es ist unwahrscheinlich, dass es sich tatsächlich um Gicht handelte.