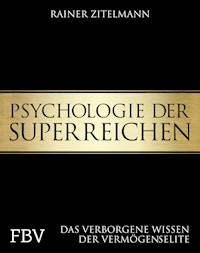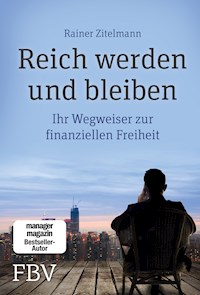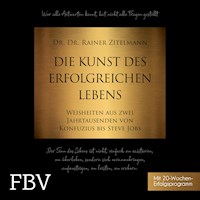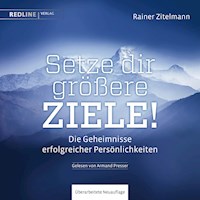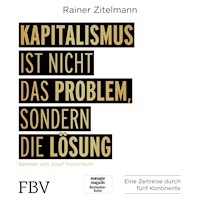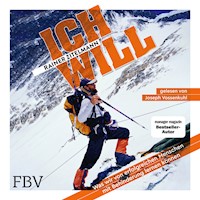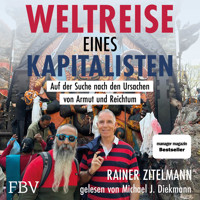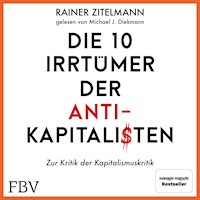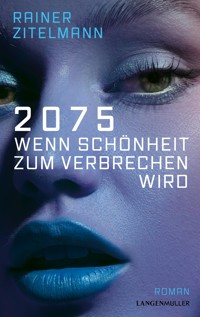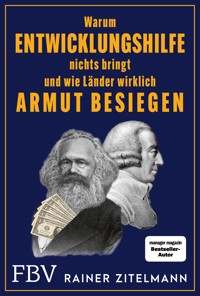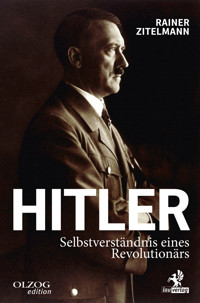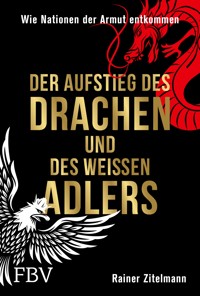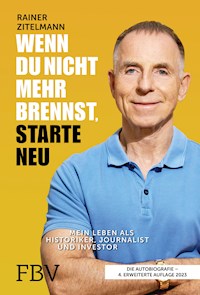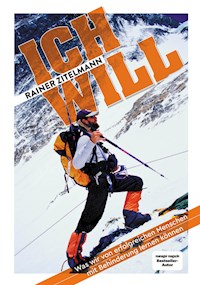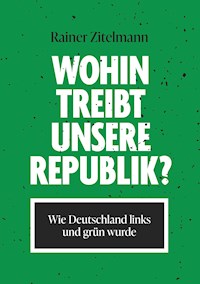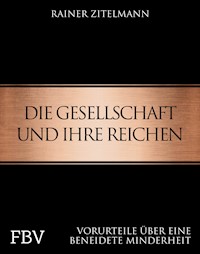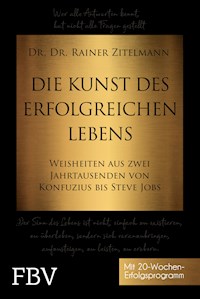21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Asuncion, Bogota, Buenos Aires, Bukarest, Danzig, Hanoi, Kathmandu, Montevideo, Memphis, New York, Santiago de Chile, Seoul, Tiflis, Tirana, Ulaanbaatar, Zürich – das sind nur einige der Stationen auf der Weltreise von Rainer Zitelmann. Der Historiker und Soziologe hat in 20 Monaten 30 Länder auf vier Kontinenten bereist und dabei 260.000 Kilometer zurückgelegt. Der Autor präsentiert eine spannende Mischung aus persönlichen Reiseeindrücken, historischen Recherchen, Ergebnissen internationaler Umfragen und vor allem Hunderten von Gesprächen mit Ökonomen, Unternehmern, Journalisten, Politikern und einfachen Menschen in diesen Ländern. Dieses Buch lässt die Leser die 30 Länder gründlicher erfahren, als es jede touristische Visite vermag. Vorgestellt werden die Gesellschaften und ihre Hintergründe, die Nationen mit ihrer Geschichte und ihrer Zukunft. Aus der Perspektive eines intellektuellen Freiheitsfreundes wird gezeigt, wie Armut und Reichtum entstehen. Mit 16-seitigem, farbigem Bildteil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rainer Zitelmann
Weltreiseeines Kapitalisten
Rainer Zitelmann
Weltreiseeines Kapitalisten
Auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe, 1. Auflage 2024
© 2024 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Ansgar Graw
Korrektorat: Christoph Roolf
Umschlaggestaltung: Sonja Vallant
Umschlagfoto: Basanta Adhikari, Founder & Executive Director des libertären Thinktanks Bikalpa-an Alternative in Nepal
Satz: Zerosoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-783-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-532-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-531-4
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort
April 2022
Zürich, Schweiz
Tiflis, Georgien
Mai 2022
Tirana, Albanien
Warschau, Polen
Mai/Juni 2022: Lateinamerika
Santiago de Chile, Chile
Buenos Aires, Corrientes und San Miguel de Tucumán, Argentinien
Asunción, Paraguay
Montevideo, Uruguay
São Paulo, Brasilien
Juli 2022
Washington und Las Vegas, USA
Gogolin, Polen
August 2022
Tiflis, Georgien
September 2022
Warschau, Polen
Hanoi, Vietnam
Oktober 2022
Miami, USA
November 2022
Lissabon und Porto, Portugal
Prag, Tschechien
Dezember 2022
Sarajevo, Bosnien-Herzegowina
Januar 2023
Bratislava, Slowakei
Belgrad, Serbien
Warschau und Danzig, Polen
Februar 2023
London, Großbritannien
Washington und New York, USA
März 2023
Athen, Griechenland
Warschau, Polen
April 2023
Washington, New York und Boston, USA
Bukarest, Rumänien
Tiflis, Georgien (Treffen mit Exil-Russen)
Mai 2023
Mailand und Rom, Italien
Seoul und Gangwon, Korea
Ulaanbaatar, Mongolei
Juni 2023
Madrid, Spanien
Adam Smith hat Geburtstag
Juli 2023
Memphis, USA
August 2023
Thüringen, Deutschland
Stockholm, Schweden
September 2023
Amsterdam, Niederlande
Oktober 2023
Sofia, Bulgarien
Tirana, Albanien
November/Dezember 2023
Bogotá und Medellín, Kolumbien
Buenos Aires, Argentinien
Asunción, Paraguay
Santiago de Chile, Chile
Dezember 2023
Kathmandu, Nepal
Monaco
Der Autor
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Viele Menschen träumen von einer Weltreise. Ich habe eine Weltreise gemacht, die mich von April 2022 bis Dezember 2023 nach Asien, in die USA und nach Lateinamerika geführt hat und zudem in 18 europäische Länder. Insgesamt habe ich 260.000 Flugkilometer zurückgelegt, ein Alptraum für jeden Öko-Aktivisten. Doch ich habe es für eine gute Sache getan, und dies ganz ohne schlechtes Gewissen bzw. »Flugscham«.
Dabei besuchte ich Staaten, mit denen ich zuvor schon mehr oder weniger gut vertraut war, aber auch solche, wo ich noch nie war – beispielsweise Argentinien, Kolumbien, Chile, Nepal oder die Mongolei. Und auch Länder, in die ich vorher nur zum Urlauben gereist war, so etwa nach Vietnam. Im Urlaub jedoch liege ich gerne faul in der Sonne und lese. Da lerne ich das Land nicht kennen. Viele Länder besuchte ich in diesen etwa eineinhalb Jahren mehrfach: In den USA war ich in New York, Washington, Boston, Miami, Las Vegas, West Palm Beach und Memphis. Mehrfach bereiste ich auch Chile, Argentinien, Paraguay, Polen, Albanien und Georgien.
Ich nenne die Reise »Liberty Road Trip« oder »Liberty Journey«. Was hat eine Weltreise in 30 Länder mit Freiheit zu tun? Ich habe die 30 Länder in den Jahren 2022 und 2023 besucht, um mehr über den Stand der wirtschaftlichen Freiheit in diesen Ländern zu erfahren. Politische Freiheit und wirtschaftliche Freiheit sind beide gleich wichtig, aber der Fokus lag für mich auf der wirtschaftlichen Freiheit, weil ich der Meinung bin, dass wirtschaftliche Freiheit in einem Land die wichtigste Voraussetzung im Kampf gegen Armut ist. Deshalb setze ich mich weltweit für wirtschaftliche Freiheit ein. Ich mache das mit meinen Büchern, mit Artikeln, Interviews und Vorträgen.
Dadurch habe ich in vielen Ländern auf der Welt großartige Menschen kennengelernt, die sich für Freiheit und Kapitalismus einsetzen. Oftmals nennen sie sich »Libertäre« oder »klassische Liberale«, was jedoch keineswegs eine geschlossene Weltanschauung ist, sondern eher eine bestimmte Geisteshaltung. So unterschiedlich die Menschen, die sich zur liberalen oder libertären Bewegung zählen, auch sind, so haben sie eines gemeinsam: die hohe Wertschätzung für die Freiheit. Sie lernen in diesem Buch also auch die libertäre Weltbewegung und einige ihrer Protagonisten kennen. Ich beschreibe diese Bewegung, über die die meisten Leser vermutlich nur wenig wissen, aus einer Warte kritischer Sympathie: Ich selbst bin Historiker und Soziologe, der Sympathien für manche Gedanken der Libertären hat, sich jedoch keinem Dogma unterordnen möchte. Davon habe ich genug, seit ich in meiner Jugend Maoist war.
Am Beginn eines jeden Jahres setze ich mir Ziele für die nächsten zwölf Monate. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zielsetzung, wie ich sie in meinem Buch »Setze dir größere Ziele« beschreibe, funktioniert. Mein Ziel, das ich am Silvesterabend 2021/22 niederschrieb, lautete: »Mein Buch ›Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten‹ erscheint in 20 Sprachen.« Ich nahm mir vor, in alle 20 Länder zu reisen. Doch bereits nach einem halben Jahr hatte ich Buchverträge für 20 Länder geschlossen und erhöhte daher das Ziel auf 30. Das ist eine Menge, denn bis dahin war keines meiner Bücher in mehr als einem Dutzend Sprachen erschienen.
Ich versprach jedem Verlag in diesen Ländern, dass ich eine Umfrage darüber in Auftrag geben werde, wie die Menschen dort zur wirtschaftlichen Freiheit stehen. Und ich versprach den Verlagen und den liberalen Thinktanks, persönlich in jedes einzelne dieser Länder zu kommen.
Ich wusste, dass mich das alles etwa 1,5 Million Euro kosten würde, denn Umfragen, die von renommierten Meinungsforschungsinstituten gemacht werden, sind teuer. Allein für die Meinungsumfragen zum Image des Kapitalismus (35 Länder) und zum Image der Reichen (13 Länder) bezahlte ich genau 658.000 Euro. In den meisten Ländern führte das Institut Ipsos MORI die Befragungen durch. Diese Umfragen waren für das Buch sehr wichtig. Sie gaben mir einen ersten Eindruck davon, wie die Menschen in dem jeweiligen Land zu Marktwirtschaft und Kapitalismus stehen.
Beides ist wichtig: persönliche Gespräche und Eindrücke auf der einen Seite, empirische Forschungen auf der anderen Seite. Die Ergebnisse der Umfragen konnte ich oft besser verstehen, wenn ich in das Land gereist war und dort mit den Menschen gesprochen hatte. Umgekehrt konnte ich meine Eindrücke aus den Gesprächen besser einordnen, wenn ich die in den Umfragen ermittelten Daten heranzog.
Dass ich in all diese Länder reisen konnte, hängt auch mit Freiheit zusammen, mit finanzieller Freiheit. Bis ich 40 Jahre alt war, hatte ich gar kein Geld. Ich verdiente zwar gut, gab aber alles aus. Ich interessierte mich vor allem für Politik, und oft vertrat ich Meinungen, die politisch nicht korrekt waren. Als freiheitsliebender Mensch wollte ich stets sagen, was ich dachte, und das führte dazu, dass ich viele Menschen um mich scharte, die dies schätzten. Aber es führte auch immer wieder zu Problemen – sogar zu wirtschaftlicher Existenzangst!
Bei einem Spaziergang in Berlin, ich war damals 39 Jahre alt, sagte mir ein befreundeter Politiker: »Querköpfe wie Sie und ich müssen ordentlich Geld verdienen, um frei unsere Meinung vertreten zu können.« Er selbst war jemand, der nicht – wie viele Berufspolitiker – wirtschaftlich von der Politik abhängig war, sondern der als glänzender Jurist so gut verdiente, dass er wirtschaftlich unabhängig war. Das machte es ihm viel leichter, eine unabhängige Meinung zu vertreten und gegen den Strom zu schwimmen. Der Satz von Peter Gauweiler, das ist der Name des Politikers, war für mich ein Schlüsselerlebnis. Nach diesem Gespräch entschloss ich mich, reich zu werden. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber genau so war es. Ich würde Millionär werden – und ich wurde es in wenigen Jahren.
Heute bin ich finanziell frei, was bedeutet: Ich muss schon lange nicht mehr für Geld arbeiten. Ob ich arbeite, was ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, wann ich arbeite und mit wem ich arbeite, bestimmt niemand anderer als ich selbst. Ohne diese finanzielle Freiheit wäre es für mich nicht möglich gewesen, all die teuren Umfragen in Auftrag zu geben und die Reisen in all diese Länder zu finanzieren. Übrigens gehört zu der Freiheit, die ich mir nehme, auch, dass ich mehrere Freundinnen habe und nicht nur eine. Ich bin mit ihnen schon viele Jahre zusammen, und natürlich wissen alle voneinander. Manche haben mich auf meinen Reisen begleitet. Wundern Sie sich daher bitte nicht, wenn Sie mehrere weibliche Vornamen finden.
Warum wollte ich aber in so viele Länder reisen? Zunächst aus Neugier und weil ich die Idee hatte, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben. Aber da war noch mehr, nämlich eine Mission. Nachdem ich 2016 meine Firma verkauft und meine zweite Doktorarbeit beendet hatte, setzte ich mir ein neues, wirklich großes Ziel: Ich wollte die Welt erobern. Ich habe als Jugendlicher nur zwei Spiele mit Leidenschaft gespielt: »Monopoly« (hier sammelt man bekanntlich Immobilien) und »Risiko«. Bei letzterem geht es darum, die Welt zu erobern, ein Land nach dem anderen zu besetzen. Und genau dieses Spiel setze ich heute im wirklichen Leben fort: Mit »die Welt erobern« meine ich natürlich nicht, dass ich ein zweiter Alexander der Große werden möchte. Meine Ziele sind wesentlich bescheidener – und doch sehr ambitioniert: Ich will als Autor und Publizist weltweit meine Botschaften verbreiten und Menschen von der Idee der Freiheit und des Kapitalismus überzeugen.
Geändert hat sich bei mir mit 60 Jahren der geografische Fokus. Jeder Mensch hat einen geografischen Raum für sein Denken und Handeln. Als ich jung war, hatte ich eine Freundin, für die der Hauptfokus das Dorf Messel mit 3.000 Einwohnern war, wo wir damals wohnten. Sie verreiste manchmal, aber der Bezugsrahmen ihres Denkens und Handelns blieb stets Messel. Bei manchen meiner Bekannten aus der Immobilienbranche ist der Bezugsrahmen die Stadt Berlin: Sie interessiert vor allem, was in dieser Stadt geschieht, verfolgen intensiv die regionalen Medien. Mein primärer Bezugsrahmen war in den Jahren bis 2017 stets Deutschland. Meine Firma war deutschlandweit aktiv, und ich war ständig in Deutschland unterwegs – Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Köln und Düsseldorf.
Bei den meisten Menschen ist der geografische Fokus das eigene Land. Das ist verständlich, aber auch etwas engstirnig. Ich merke das immer, wenn ich Medien in Deutschland Artikel anbiete: Alles, wo es um Deutschland geht, wird gerne genommen. Ein Artikel über Argentinien? »Zu weit weg für unsere Leser.« Wegen Albanien oder der Mongolei brauche ich erst gar nicht zu fragen.
Mein Fokus ist heute die ganze Welt. Ich reise um den Globus, weil ich neugierig bin auf andere Menschen, auf andere Länder. Und weil ich meine Botschaften verbreiten und etwas dazu beitragen möchte, den Gedanken der Freiheit in der Welt populärer zu machen. Meine Reisen sehen anders aus als die der meisten Menschen: Ich interessiere mich nicht besonders für »Sehenswürdigkeiten«, die Touristen mit Fotoapparaten anziehen. Die kann ich mir auch im Internet anschauen.
Ich interessiere mich für Menschen. Ich lerne mehr über ein Land, wenn ich Menschen treffe, die mir etwas über das Land erzählen: Ökonomen und Politiker beispielsweise oder Menschen, die sich für Freiheit in ihren Ländern einsetzen. In allen Ländern wurde ich von Journalisten interviewt, aber ich nutzte stets die Gelegenheit, die Rollen zu vertauschen und vor oder nach dem Interview die Journalisten über die Politik und Wirtschaft in ihrem Land auszufragen. Ich begegne gerne auch ganz »normalen« Menschen, jungen Menschen, die kaum Geld haben, aber auch Unternehmern, die Multimilliardäre geworden sind. Ich habe Hunderte interessante Gesprächspartner getroffen und dabei eine Menge gelernt. Was ich gelernt habe, lesen Sie in diesem Buch.
In manche Länder, die ich gerne besucht hätte, konnte ich nicht reisen. Zwar erschienen viele meiner Bücher auch in Russland, wo ich einige Freunde habe. Mich verbindet vieles mit dem Land, und ich war mehrere Jahrzehnte sogar Mitglied der Russisch-Orthodoxen Kirche, bis ich dann ausgetreten bin, weil die Kirche sehr stark Putins Krieg unterstützte. Ich wollte nicht während des Krieges nach Russland reisen, denn dort nichts zum Krieg zu sagen, wäre ein Fehler, und wenn ich etwas zum Krieg gesagt hätte, wäre das zu gefährlich für mich gewesen. Ich habe aber viele Ukrainer und Russen getroffen, vor allem in Polen und Georgien. Auch von diesen Zusammenkünften werde ich berichten.
In China war ich 2018 und 2019 in vielen Städten und hatte auch schon eine Reise für den Oktober 2023 gebucht. Kurzfristig teilte mir jedoch mein chinesischer Verlag mit, dass Genehmigungen für Vorträge zu meinem Buch »The Rich in Public Opinion« wider Erwarten doch noch nicht erteilt wurden. Schade, ich hatte mich auf die Reise nach China gefreut. Ich wollte auch nach Nigeria und Uganda reisen, wo mein Buch »Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten« erschien. Aber ich wollte mich nicht gegen Gelbfieber impfen lassen, so dass ich kein Visum für Nigeria bekam und meinen Vortrag online halten musste. Später bei Uganda gelang es mir, obwohl das nicht einfach war, eine Bescheinigung von der Berliner Charité zu bekommen, die es mir erlauben wird, ohne Impfung einzureisen. Ich hoffe also, in einer späteren 2. Auflage dieses Buches auch über Uganda zu berichten.
Bevor ich in ein Land gereist bin, habe ich mich mit dessen Geschichte befasst, denn ich bin Historiker und weiß deshalb, dass der Schlüssel zum Verständnis eines Landes in seiner Geschichte liegt. Ohne die Umfragen, die ich vor Beginn der Reise in den Ländern durchführen ließ, und ohne das Studium der Geschichte dieser Länder wären meine Reisen nicht so informativ verlaufen. Das Buch ist nicht nur ein Reisebuch, sondern auch ein Geschichtsbuch – wie bei einem Historiker vielleicht nicht anders zu erwarten. Vielleicht werden Sie neugierig, mehr über diese Länder zu erfahren – und lesen weitere Bücher darüber oder unternehmen selbst Reisen dorthin.
Rainer Zitelmann, April 2024
April 2022
Zürich, Schweiz
Mein »Liberty Road Trip«, der mich auf vier Kontinente und in 30 Länder führen soll, beginnt am 12. April 2022 in der Schweiz. Laut dem »World Happiness Report 2023« zählt die Schweiz zu den zehn glücklichsten Ländern der Welt.1 Und sie ist ein wohlhabendes Land – das durchschnittliche Vermögen beträgt 685.000 Dollar pro Kopf. In Deutschland sind es nur 256.000 Dollar und in den USA 551.000 Dollar.2 Freilich hat diese Durchschnittszahl auch etwas mit der hohen Millionärsdichte zu tun. Von den 8,7 Millionen Schweizern ist jeder achte (1,1 Millionen) Dollar-Millionär. In Deutschland, gemessen an der Einwohnerzahl fast zehnmal so groß wie die Schweiz, lebten 2022 »nur« 2,6 Millionen Millionäre. Somit ist etwa jeder 32. Deutsche ein Millionär.3
Eingeladen hat mich das Liberale Institut zu einem Vortrag an der Universität Zürich. Die Schweiz ist ein guter Ausgangspunkt für meinen Liberty Road Trip, denn im Index der wirtschaftlichen Freiheit steht sie auf Platz zwei von 176 Ländern, nur 0,1 Punkte hinter dem Spitzenreiter Singapur.4 Das Land hat Spitzenwerte in den Kategorien »Property Rights«, »Judicial Effectiveness«, »Fiscal Health« und »Government Integrity«. Das Gesamtergebnis wäre noch besser, wenn der Staat nicht zu viel Geld ausgeben würde und es weniger staatliche Regulierung im Arbeitsmarkt gäbe.
Dennoch: Die Schweiz ist das kapitalistischste Land der Welt. In der Schweiz lässt es sich gut leben. Eine Freundin von mir, Jenna, wohnt seit vielen Jahren in dem Land. Sie möchte auf keinen Fall mehr nach Deutschland zurück. Ich war mit ihr vor 13 Jahren fest zusammen. Damals war sie 25 Jahre alt und leitet heute die Kommunikationsabteilung einer der renommiertesten Luxusmarken der Welt in Zürich. Ich lade Jenna – zusammen mit Isabelle, die mich auf meiner Reise nach Zürich begleitet – zum Abendessen beim Asiaten ein. Wir drei lieben asiatische Küche. Warum sie es in der Schweiz so toll findet? Einer der Gründe ist, dass sie hier fast drei Mal so viel verdient wie ihre Kollegen in Deutschland und dazu noch weniger Steuern zahlt. Sie bekommt hier etwa 10.000 Franken im Monat. »Natürlich sind auch die Lebenshaltungskosten höher, aber eben nicht drei Mal so hoch. Und die Steuern sind viel niedriger.«
Hohe Lebenshaltungskosten? Das bestätigt mir eine andere Bekannte, mit der wir am Vorabend Essen waren. Sie ist Arzthelferin, kommt aus Syrien und hat früher in Berlin gewohnt. Sie sagt, dass sie 5.800 Franken verdient – allerdings zahlt sie auch 1.400 Franken für eine winzige, 20 Quadratmeter große Wohnung.
Bevor ich mit meinem Vortrag starte, hält Olivier Kessler, der Leiter des Liberalen Instituts, ein kurzes Eingangsstatement, in dem er erklärt, warum die Schweiz gerade kein kapitalistisches, sondern ein halbsozialistisches Land sei. Er verweist auf die zahlreichen Regulierungen und Beschränkungen, die dem Geist der Marktwirtschaft widersprechen. Der Kapitalismus, so seine Argumentation, sei ein System, in dem die einzige Aufgabe des Staates darin bestehe, das Privateigentum zu schützen. Es herrsche unbeschränkte Vertragsfreiheit auf unbehinderten Märkten. Angesichts zahlreicher Staatseingriffe sei all dies in der Schweiz nicht der Fall. Seine Folgerung: »Wir leben in der Schweiz nicht im Kapitalismus.«
Fast alle seine Kritikpunkte teile ich. Aber den reinen Kapitalismus gibt es in keinem Land auf der Welt, und immerhin ist die Schweiz kapitalistischer als fast alle anderen Staaten. Ich selbst messe ein Land nicht in erster Linie an einem Ideal, sondern an anderen Ländern.
Das Publikum, etwa 100 Teilnehmer, besteht aus überzeugten Pro-Kapitalisten. Einer kam sogar mit dem »I love Capitalism«-T-Shirt, das ich manchmal bei Vorträgen trage (diesmal jedoch nicht). Nach dem Vortrag kommt ein Schweizer Ökonom, Hans Rentsch, auf mich zu und drückt mir ein Buch in die Hand: »Wie viel Markt verträgt die Schweiz?«5 Es ist ein skeptisches Buch, denn es zeigt, dass die schweizerische Politik in den vergangenen Jahrzehnten auf nationaler Ebene kaum je aus eigener Initiative marktwirtschaftliche Reformen angestoßen hat.6 Skeptisch sieht Rentsch auch die oft gelobte »direkte Demokratie« der Eidgenossen. Die Schweiz ist bei Anhängern der direkten Demokratie sehr beliebt, weil die Bürger über viele Themen direkt abstimmen. Oft erweisen sich die Schweizer dabei als klug, aber Rentsch führt auf vielen Seiten eine Menge Beispiele dafür an, dass seine Landsleute gegen mehr Marktwirtschaft und für mehr staatliche Beschränkungen der Freiheit gestimmt hätten, ob das nun die Liberalisierung des Strommarktes oder das Gesundheitswesen betrifft.7
Wenn die Schweiz ökonomisch erfolgreich sei im Vergleich zu anderen Ländern, so Rentsch, dann nicht wegen, sondern trotz der direkten Demokratie. »Die staatsfreundliche und marktskeptische Grundhaltung der Bevölkerung hat politische Konsequenzen … In kaum einem vergleichbaren Land dürfte die Stromversorgung derart ausgeprägt von staatlichen Akteuren mit Mehrfachinteressen dominiert sein wie hierzulande durch die Kantone und Gemeinden mit ihren lokalen und regionalen Monopolen … In kaum einem anderen vergleichbaren Land verfügen die Staatseisenbahnen über eine so dominierende Marktstellung wie die SBB in der Schweiz … Auch im schweizerischen Gesundheitswesen sind der Markt und der Wettbewerb durch staatliche Regulierung weitgehend ausgeschaltet.«8
Positiv sieht er dagegen den Wettbewerb der einzelnen Gemeinden und Kantone in der Schweiz, der viel Gutes bewirkt habe. Viele Bekannte von mir sind Anhänger der »direkten Demokratie«. Sie wollen, dass das Volk selbst unmittelbar entscheidet. Ich war da schon immer skeptisch, wobei ich zugeben muss, dass die Entscheidungen der gewählten Parlamentarier, zum Beispiel in Deutschland, auch nicht besser sind als die des Volkes. Aber die Deutschen sind anders als die Schweizer. 56 Prozent der Berliner haben 2021 für eine Enteignung großer Immobilienunternehmen gestimmt. Der Sozialismus ist wieder zurück. Auch in Deutschland.
Isabelle ist auf Anhieb begeistert von der Schweiz, zumal alles hier sehr sauber ist und man sich sicher fühlt, auch wenn man nachts auf der Straße geht. Die Menschen sind viel gepflegter gekleidet als in Berlin. Am Tag nach meinem Vortrag fahren wir nach Zug. Die Stadt ist nur 40 Autominuten entfernt von Zürich. Ich mag Bahnfahrten nicht so sehr, sondern leiste mir einen Chauffeur in einem S-Klasse-Mercedes. Die Hinfahrt kostet 240 Franken. Zurück werden wir vom Chauffeur des Mannes gefahren, den wir besuchen. Es ist Hans-Peter Wild, der wie so viele aus Deutschland stammende Milliardäre in der Schweiz lebt.
Zug ist besonders beliebt, weil es als kleines Steuerparadies gilt. Hier haben renommierte und innovative Unternehmen ihr Domizil oder größere Niederlassungen – etwa der Lebensmittelkonzern Nestlé, Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie und Handel oder auch viele Start-ups, die als »Crypto-Valley« der Schweiz an neuen Technologien arbeiten. Der Spitzensteuersatz des Kantons Zug liegt im Durchschnitt bei rund 23 Prozent – ein Traum für Steuerpflichtige in vielen anderen Ländern wie etwa Deutschland.
Hans-Peter Wild ist Inhaber von Capri-Sun, einer der weltweit führenden Marken für nicht-alkoholische Getränke. »Bedienen Sie sich gerne«, fordert uns seine Assistentin mit Blick auf einen Behälter auf, der Capri-Sun gekühlt in allen Geschmacksrichtungen enthält. Ich greife zu und fühle mich an meine Kindheit erinnert, als ich »Capri-Sonne« oft getrunken habe. Heute wird der charakteristische Getränkebeutel in 24 Ländern produziert und in mehr als 100 Ländern unter dem anglisierten Namen Capri-Sun verkauft. Aber in jedem Land, so erzählt Wild, haben die Menschen einen anderen Geschmack, und die Kunst liegt darin, das Produkt jeweils sehr individuell den lokalen Vorlieben anzupassen.
Wild fragt mich, ob ich ein besonderes Anliegen habe. Ich vermute, ihn besuchen oft Leute, die irgendetwas von ihm wollen. Sein Nettovermögen beträgt laut der Forbes-Liste 3,5 Milliarden Dollar. Nein, ich habe kein Anliegen. Ich freue mich einfach, ihn wiederzusehen und zu plaudern. Und Isabelle, die eine begeisterte Reiterin ist, freut sich, jemanden zu treffen, der in jüngeren Jahren selbst ein begeisterter Reitsportler war. Wild ist heute 80 Jahre alt und hat gerade seine Autobiografie geschrieben. Ich habe sie als erster gelesen, weil ich das Vorwort schreiben sollte. Besonders fasziniert hat mich, dass er durch die ganze Welt gereist ist, weil sein Unternehmen weltweit aufgestellt ist. Ich bin gerade etwas frustriert darüber, dass beispielsweise die Partner in Südamerika, die eine Reise nach Argentinien und Chile im nächsten Monat organisieren sollen, bisher langsam und wenig zuverlässig sind. Wir sind uns beide einig: Auch wenn das für pünktliche Menschen schwer ist – wir können die Welt nicht ändern. »Man muss sich ein sehr dickes Fell zulegen«, rät Wild. In seinem Büro steht ein riesiger Globus – ein Mann wie Wild, auch wenn er in einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern wohnt, denkt global.
»Mein Ziel war es von Anfang an, Capri-Sonne und WILD-Flavors zu Global Players zu machen. Man muss sich Ziele setzen und darf sie, trotz mancher Unwägbarkeiten auf der Strecke, nicht aus den Augen verlieren«, so Wild unter Nennung des zweiten von ihm aufgebauten Weltunternehmens, des Aromen-Herstellers WILD Flavors Inc. Sein Vater rechnete ihm vor, dass sein Unternehmen, wenn jeder in der damaligen Bundesrepublik nur eine einzige Capri-Sonne im Jahr trinkt, 60 Millionen Beutel verkaufen würde. Seine Mitarbeiter hielten solche großen Zahlen für unrealistisch, aber für Wild Junior waren sie zu klein. Sein Ziel war es, jedes Jahr weltweit mehrere Milliarden Capri-Sonne zu verkaufen – und er hat diesen Plan, den die meisten Menschen als »unrealistisch« oder gar »unmöglich« abgetan hätten, realisiert.
Wie sieht die wirtschaftliche Zukunft der Schweiz aus? Für mein Buch »Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten« hatte ich 2021 eine Befragung in der Schweiz durchführen lassen. Das Ergebnis war, dass die Menschen in der als kapitalistisch geltenden Schweiz dem Kapitalismus ähnlich skeptisch gegenüberstehen wie in Deutschland. Die größte Zustimmung bei der Umfrage unter den Eidgenossen fanden die Aussagen, Kapitalismus führe zu steigender Ungleichheit und zu Monopolen, fördere Egoismus und Profitgier, die Reichen bestimmten die Politik und die Menschen würden zum Kauf von Produkten animiert, die sie gar nicht brauchten. Nur 21 Prozent der Schweizer sagten in der Umfrage, Kapitalismus bedeute wirtschaftliche Freiheit, und ebenfalls nur 21 Prozent befanden, Kapitalismus führe zu Wohlstand.
Wir formulierten einige der Fragen, ohne das Wort »Kapitalismus« zu verwenden, weil es für viele Menschen einen schlechten Klang hat. Die Zustimmung stieg in der Schweiz (wie in vielen anderen Ländern). Aber auch wenn das Wort nicht erwähnt wurde, war die Einstellung der Schweizer nicht positiv, sondern neutral – das heißt, die Zustimmung zu pro- und anti-marktwirtschaftlichen Aussagen hielt sich die Waage.
Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass es zwischen dem objektiven Stand der wirtschaftlichen Freiheit (wie er im Index of Economic Freedom gemessen wird) und der Einstellung der Menschen (die Ipsos MORI in der Umfrage ermittelt hatte) nicht unbedingt einen Zusammenhang gibt.
Aber was heißt es für die Zukunft, wenn die Menschen in einem Land wie der Schweiz dem Kapitalismus skeptisch gegenüberstehen? Volksabstimmungen könnten künftig häufiger anti-marktwirtschaftlich ausfallen als in der Vergangenheit. Dies hatte ich schon direkt nach der Umfrage von Ipsos MORI vorhergesagt, und leider wurde diese pessimistische Prognose schon bald darauf bestätigt: Im März 2024 stimmten 58 Prozent der Schweizer für einen Vorschlag der Gewerkschaften, wonach der Staat den Rentnern ein 13. Monatsgehalt zahlen muss. Das Referendum wurde von linken Parteien unterstützt. Die Frage stellt sich: Wird die Schweiz dauerhaft ihren tollen Spitzenplatz im Ranking der wirtschaftlichen Freiheit behalten?
April 2022
Tiflis, Georgien
Ende April reise ich nach Georgien. Das kleine Land (3,7 Millionen Einwohner), das früher zur Sowjetunion gehörte, liegt am Schwarzen Meer im Westen Asiens, wird aber von seinen Einwohnern stolz als »Balkon Europas« bezeichnet. Nachbarländer sind die Türkei, Aserbaidschan und Russland. Im Jahr 2008 griff Russland das Land an. Seitdem sind etwa 20 Prozent des Staatsgebietes russisch besetzt.
Eingeladen bin ich von der Free Market Roadshow, einer Veranstaltung des Austrian Economic Center. Die Free Market Roadshow bringt Referenten aus der ganzen Welt zusammen, um die Ideen von Freiheit und Marktwirtschaft zu verbreiten – insbesondere, aber keineswegs ausschließlich in Osteuropa.
Ich war noch nie zuvor in Georgien gewesen, hatte aber Kontakt zu Professor Gia Jandieri, dem Gründer und Vizepräsidenten eines libertären Thinktanks in Georgien namens New Economic School. Ich bin schon neugierig, ihn persönlich kennenzulernen. Gia holt mich und meine Freundin Alica morgens im Radisson-Hotel ab und zeigte uns die Stadt. Was auf den ersten Blick auffällt: die vielen alten und faszinierenden Gebäude, die meisten aus dem 19. Jahrhundert. Gia zeigt uns das Panorama von Tiflis. Und mitten unter all den schönen Gebäuden der Altstadt stach ein hässlicher Bau hervor: »Der stammt aus der Sowjetzeit«, so Gia.
Man sieht Tiflis an, dass weder der Erste noch der Zweite Weltkrieg auf dem Territorium von Georgien ausgetragen wurden. Die Gebäude blieben erhalten, aber mit etwa 300.000 toten Soldaten hatte Georgien im Zweiten Weltkrieg einen hohen Blutzoll zu entrichten. Gia meint, der sowjetische Diktator Josef Stalin habe – obwohl selbst in Georgien geboren – seine Landsleute nicht besser behandeln wollen, sondern eher im Gegenteil ins Feuer geschickt.
Manche der schönen alten Gebäude sind in einem sehr guten Zustand, weil sie nach dem Ende des Kommunismus renoviert wurden. Aber es gibt auch viele in einem schlechten Zustand. Ich erzähle Gia, dass dies auch in Ostdeutschland nach dem Ende des Sozialismus so war und umfassende Modernisierungen der alten Gebäude durch Steueranreize möglich wurden. Gia schüttelt den Kopf: »In einem Land wie Deutschland, wo man 40 oder mehr Prozent Steuern zahlt, haben solche Steuersparmodelle funktioniert, aber hier zahlen die Menschen nur 20 Prozent, da gibt es keinen so großen Anreiz, Steuern zu sparen – solche Anreizmodelle würden nicht funktionieren.« Die meisten Wohnungen sind im privaten Besitz, nach dem Ende des Sozialismus wurden sie privatisiert. Mietrechtliche Beschränkungen wie in Deutschland gibt es nicht, die Mieten können frei verhandelt werden.
Ich frage Gia, wie er zu einem überzeugten Anhänger der Marktwirtschaft wurde. Er wurde 1961 geboren, wuchs in der Sowjetunion auf und stand schon in seiner Jugend dem System kritisch gegenüber. Er war im Ministerium für Großhandel in Georgien tätig und sah jeden Tag, dass das planwirtschaftliche System nicht funktionierte und die Korruption das gesamte Wirtschaftsleben dominierte. 1988 las er das Werk »Der Weg zur Knechtschaft« von Friedrich August von Hayek. Die Schriften von Hayek und Ludwig von Mises prägen ihn bis heute. 2001 gründete Gia zusammen mit anderen pro-marktwirtschaftlichen Ökonomen die New Economic School, entwarf ein Modell für eine radikale Steuerreform und verfasste die »25 Principles for Economic Prosperity of Georgia« für das Programm des Präsidentschaftskandidaten Micheil Saakaschwili. Der vormalige Justizminister wurde im Januar 2004 zum Staatspräsidenten gewählt. Er stand für Marktwirtschaft und wollte die alten Eliten entmachten.
Die Jahre nach 2004 waren auch die Zeit, in der Gia am meisten bewirken konnte. Er war Mitglied in einem Team, das eine große Steuerreform vorbereitete. »Ich war und bin überzeugt von diesem Ansatz, der zur Vereinfachung des Steuersystems und zur Senkung der Steuern führte«, sagt Gia. »Zusammen mit anderen Deregulierungen löste die Reform ein enormes Wirtschaftswachstum in meinem Land aus.«
Das war eine gute Zeit für Georgien. Wieder einmal zeigt sich in der Praxis, dass das Postulat der Anhänger des Kapitalismus stimmt: Niedrigere Steuern führen zu höherem Wachstum und im Ergebnis sogar zu höheren Steuereinnahmen für den Staat.
»Eine wichtige Rolle bei den Reformen spielte Kacha Bendukidse, und ich bin stolz, ihn meinen Freund nennen zu dürfen«, so Gia. Bendukidse war ein bekannter Unternehmer in Russland (einer der führenden Köpfe des Verbandes russischer Industrieller und Unternehmer), verließ dann Russland, investierte weltweit, arbeitete aber von 2004 bis 2008 in der georgischen Reformregierung und beriet sie bis 2013 weiter. 2014 kam er in die Ukraine, um die gleichen Reformen anzubieten. Seine berühmte Rede vor der ukrainischen Regierung trug den Titel: »You don’t guess in what a shit you live«. Wenig später starb er in einem Londoner Hotel nach einer Herzoperation in der Schweiz. Bendukidse war in libertären Kreisen sehr beliebt, unterstützte sie auch finanziell massiv und gründete in Tiflis eine marktwirtschaftlich orientierte Freie Universität.
Nach den marktwirtschaftlichen Reformen in den Jahren 2004 bis 2007 und zwei Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten wurde die Vertretung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Tiflis im Mai 2008 geschlossen, weil »Georgien ihn nicht mehr brauchte«. Dem Land ging es ohne Hilfe besser. Das IWF-Büro wurde erst nach der russischen Intervention im September 2008 wiedereröffnet, da die internationale Gemeinschaft ihre Solidarität mit Georgien zeigen wollte.
Und wie sieht Gia die Situation heute? Er ist skeptisch. Das Land werde von Bidsina Iwanischwili beherrscht, der offiziell zwar nur von 2012 bis 2013 Premierminister war, aber faktisch immer noch das Sagen habe. Iwanischwili machte Milliarden in Russland, kehrte 2003 nach Georgien zurück, nahm später die französische Staatsbürgerschaft an und lebt heute in einer Residenz oberhalb von Tiflis, deren Wert 2012 auf 50 Millionen Dollar geschätzt wurde.
Was sind die größten Herausforderungen für Georgien, frage ich Gia. Einmal natürlich die fortdauernde russische Bedrohung des Landes. Doch den konsequent marktwirtschaftlichen Weg, den er für den besten für das Land hält, sieht er auch durch die EU-Bürokratie bedroht. In den Verhandlungen mit der EU wurde Georgien ständig mit neuen staatlichen Regulierungsideen konfrontiert, die etwa die Freiheit des Arbeitsmarktes einschränkten und mit hohen Kosten sowie bürokratischem Aufwand verbunden waren.
Gia glaubt an die Kraft des Unternehmertums. Oft nähmen die Menschen an, Intellektuelle seien moralisch überlegen, sagt Gia. Aber nach seiner Überzeugung leben vor allem Unternehmer nach der Erfahrung, die sie immer wieder in ihrem Berufsleben machen, nämlich dass sich Ehrlichkeit auf die Dauer mehr auszahlt als unethisches Verhalten: Denn durch Unehrlichkeit nimmt die Reputation des Unternehmers Schaden.
»Bad ideas attract bad people«, das habe er in der Zeit des Kommunismus gelernt. Ich vergesse diesen Satz nicht. Der Kommunismus, so Gia, sei eine solche schlechte Idee und habe Menschen wie den Georgier Stalin angezogen, der ein Krimineller war. Gia zeigt uns einen Platz, auf dem früher das Gefängnis stand, in dem Stalin wegen Bankraub eingesessen hatte. Der Georgier Josef Dschugaschwili, so der Geburtsname des späteren sowjetischen Diktators, war für die Planung einer Aktion verantwortlich, die am 26. Juni 1907 durchgeführt wurde. Dschugaschwili überfiel mit einem Gefolge von rund zwanzig Männern und Frauen einen Geldtransport der russischen Staatsbank. Der Transport bestand aus zwei Panzerwagen, die von Pferden gezogen wurden. Während im ersten Wagen das Geld war – er wurde von zwei Bankbeamten und zwei Wächtern begleitet –, befand sich im zweiten Wagen ein Begleittrupp aus Polizisten und Soldaten. Stalin und seine Leute bewarfen den kleinen Konvoi mit starken Granaten, große Teile des Begleitpersonals sowie ihre Pferde wurden getötet oder verstümmelt. Nahezu zeitgleich setzten Angriffe auf die in den umliegenden Straßen patrouillierenden Kosaken und Schutzmänner ein. Die Angaben über die Zahl der Toten schwanken zwischen fünf und 40. Stalin kam dafür ins Gefängnis. Gia zeigt uns den Platz, wo das Gefängnis stand, das der Kreml-Herrscher jedoch später abreißen ließ. Heute ist dort ein Parkplatz.
Gia unterstützt die libertäre Partei in Georgien, die zwar klein ist, aber nach seiner Meinung die besten Ideen für das Land habe. Er sucht nach einer Alternative sowohl zum Sozialismus, in dem er aufwuchs, als auch zum europäischen Wohlfahrtsstaat, den er für einen Irrweg hält. Vordergründig scheine der Wohlfahrtsstaat zu funktionieren, langfristig werde er jedoch scheitern. Gia plädiert für ein wirtschaftliches System, wie es Hayek und von Mises beschrieben haben. Georgien, so Gia, brauche weitere Steuersenkungen, Deregulierungen und eine Währungsreform. Der Euro sei nicht ideal, aber er plädiert für eine Anbindung der Währung an den Dollar oder den Euro, auch wenn er noch lieber verschiedene konkurrierende Privatwährungen hätte, wie Hayek dies favorisierte.
Bevor ich in ein Land reise, beschäftige ich mich mit dessen Wirtschaft und Geschichte und mache mir dazu einige Notizen. Hier einige Fakten: Nachdem die Sowjetunion zusammenbrach, hatten es viele Länder schwer, die bis dahin zu dem großen Sowjetreich gehörten. Doch Georgien hatte es besonders schwer. Erst 1918 unabhängig geworden, wurde es 1921 von der Roten Armee besetzt und in die Sowjetunion eingegliedert. 70 Jahre danach erlangte es zum zweiten Mal seine Unabhängigkeit. Georgien hatte eine doppelte Herausforderung zu bewältigen: Die erste Herausforderung teilte es mit allen ehemals sozialistischen Staaten, nämlich die Notwendigkeit, die sozialistische Staatswirtschaft durch eine Marktwirtschaft zu ersetzen.
Die zweite bestand darin, dass Georgien in hohem Maße abhängig von Russland war und der gesamte Außenhandel des Landes hauptsächlich auf Russland ausgerichtet war. Und: »Bereits vom ersten Tag seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion an war Georgien aggressivem Druck durch die Russische Föderation ausgesetzt«, so etwa im Energiebereich.9 Zudem gab es von Anfang an militärische Aggressionen Russlands, die 2008 im Angriff auf Georgien ihren vorläufigen Höhepunkt fanden.
Als ich in Georgien bin, hat gerade der russische Krieg gegen die Ukraine begonnen. Ich sehe überall Fahnen als Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine. Paata Shehelidze, der Präsident der New Economic School, meint, die Gefahr einer erneuten russischen Aggression gegen das Land (20 Prozent von Georgien sind faktisch von Russland okkupiert) verunsichere potenzielle Investoren aus dem Ausland. Und natürlich ist diese Verunsicherung durch den Ukraine-Krieg größer geworden. Der Feind ist bereits im Land – wie in der Ukraine hat Russland Teile Georgiens als angeblich unabhängige Gebiete installiert.
Die russische Bedrohung war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht das einzige Problem für Georgien. Erschwert wurde die Situation dadurch, dass es keine politisch stabilen Verhältnisse gab. Mehrere Regierungen lösten einander ab, aber es war nicht der in den meisten etablierten Demokratien entwickelte normale Wechsel zwischen Opposition und Regierung. Die jeweils unterlegene Seite bezichtigte die neue Regierung nach jeder Wahl der Wahlfälschung, und die neue Regierung ging regelmäßig gegen den politischen Gegner mit juristischen Mitteln vor. Die jeweils herrschende Partei setzte alles daran, es der Opposition unmöglich zu machen, eines Tages an die Regierung zu gelangen.10
Die 90er-Jahre waren durch politisches Chaos und wirtschaftlichen Niedergang gekennzeichnet. Überall herrschten Korruption und organisierte Kriminalität. In diesem Umfeld konnte kein Unternehmertum gedeihen: »Es war schlichtweg unmöglich, den steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Die Gründung eines Unternehmens war ein heldenhaftes Unterfangen, und jeder Unternehmer konnte schnell zum Kriminellen werden – einfach nur durch einen Fehler in der Buchhaltung oder bei der Zahlung von Steuern. Dies wurde zu einem nützlichen Instrument zur Diskreditierung und Unterdrückung von Unternehmen, was wiederum die Wirtschaft erheblich schwächte«, so erklärt Gia.11
Im November 2003 wurde Präsident Eduard Schewardnadse (der ehemalige sowjetische Außenminister) zum Rücktritt gezwungen, man sprach später von einer »Rosenrevolution«. 13 Jahre nach Erringung der politischen Unabhängigkeit setzte Micheil Saakaschwili marktwirtschaftliche Reformen in Gang. Die Zahl der Steuerarten wurde von 22 auf sieben reduziert (jetzt sind es sechs), und die Einkommenssteuer fiel von 39 auf 20 Prozent. Es begannen umfangreiche Privatisierungen, und die Korruption wurde zurückgedrängt.
Korruption ist für viele Länder ein großes Problem, aber Georgien ging sehr radikal vor, was sich auszahlte. Gia berichtet, dass man auf einen Schlag sämtliche etwa 35.000 Polizisten des Landes entlassen habe und dafür etwa 15.000 neue einstellte, die aber besser bezahlt wurden. In der Übergangsphase sei die Kriminalität nicht einmal gestiegen, denn die schlimmsten Banditen seien bis dahin sowieso die Polizisten selbst gewesen. Organisierte Kriminalität gebe es heute in Georgien kaum, da der Staat eine »Zero Tolerance«-Politik betreibe.
Mindestens ebenso maßgeblich für die Korruptionsbekämpfung war jedoch, dass durch Reformen zahlreiche überflüssige Regulierungen und Vorschriften beseitigt wurden. Eine wichtige Lehre auch für andere Länder: Je weniger staatliche Vorschriften es gibt, desto weniger Ansatzpunkte gibt es für Korruption. Noch 2004 lag Georgien im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International auf Platz 133, aber 2022 immerhin auf Platz 41 von 180.12 Zum Vergleich: Russland liegt heute auf Platz 137.13
Die Deregulierungen und die Steuerreform hatten sehr positive Auswirkungen: »Die Ergebnisse der Reformen waren bald sichtbar – mit einem Anstieg des BIP, der Einkommen, der Einlagen, der Zahl der Autos und so weiter, was die Verbesserung sehr gut veranschaulicht. Daher lässt sich aus dieser Geschichte die Folgerung ziehen: Entschlossene Schritte, Liberalisierung und die Übernahme von Verantwortung für hausgemachte Probleme sind die besten politischen Lösungen für Krisen jeder Art – auch und gerade für ärmere Länder in einer Übergangskrise.«14
Das Beispiel Georgiens zeigt, dass Steuersenkungen und Steuervereinfachungen oft zu größeren Steuereinnahmen führen – was wir immer wieder auch in anderen Ländern beobachtet haben, Sozialisten jedoch nie begreifen werden. Die Steuerreform von 2005, die nach der Rosenrevolution umgesetzt wurde, hatte laut Gia diese Auswirkungen: »In allen Arten von Steuern (mit Ausnahme der Zollsteuer, deren effektiver Steuersatz gegen null geht) erhöhten sich die Staatseinnahmen: Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer stiegen um mehr als das Siebenfache, die aus der Einkommenssteuer um mehr als das Achtfache und die Einnahmen aus der Gewinnsteuer um das Zehnfache.«15
Die wirtschaftliche Lage verbesserte sich erheblich. Das Bruttoinlandsprodukt verdoppelte sich in den ersten vier und verdreifachte sich in den ersten acht Jahren nach der Reform – und dies trotz der Auswirkungen der Finanzkrise von 2008/09.16 Dies war ein Ergebnis der Steuerreform, aber auch weiterer Deregulierungen und Liberalisierungen in anderen Bereichen der Wirtschaft.
In dem Zeitraum von 1997 bis 2020 stieg die Punktzahl Georgiens im Index of Economic Freedom so stark wie in kaum einem anderen Land der Welt, und es lag 2020 sogar auf Platz zwölf in dem Ranking. Seitdem verliert Georgien jedoch wieder in dem Index, und das Land liegt 2023 auf Platz 35.17
2011 wurde der »Economic Liberty Act«, das Wirtschaftsfreiheitsgesetz, beschlossen, das ab Anfang Januar 2014 galt. Dabei handelte es sich um eine Sammlung von Verfassungsänderungen sowie ein spezielles Gesetz zur Beschränkung der Staatsausgaben (sowohl auf zentraler als auch lokaler Ebene) auf maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und ein Defizit von drei Prozent. Zudem sah das Gesetz vor, dass es für jede Steuererhöhung oder auch die Einführung einer neuen Steuer eine Volksabstimmung geben muss.
Im Jahr 2016 bildete die Partei »Georgischer Traum«, die 2012 an die Macht gekommen war, eine Verfassungskommission, um eine neue Verfassung zu erarbeiten. Dass viele Georgier sich nicht an dem Modell des europäischen Wohlfahrtsstaates orientieren wollten, sondern an einem stärker marktwirtschaftlichen Modell, wurde auch durch die Verabschiedung eines sogenannten Organgesetzes deutlich, das die Einführung neuer Steuern oder von Steuererhöhungen und insbesondere auch die eines progressiven Steuersystems verbietet. Das heißt: Die Festlegung von unterschiedlichen Steuersätzen je nach Einkommen, wie sie in den meisten Ländern praktiziert wird, ist verboten. Zudem wurde fixiert, dass Steuergesetze nur geändert werden dürfen, wenn dies durch einen Volksentscheid bestätigt wird. Einen solchen Volksentscheid kann indes nur die Regierung initiieren, und – besonders wichtig – er darf nicht die Frage der progressiven Besteuerung betreffen.18
Doch anstatt diesen Schutz der Bürger vor dem Staat weiter auszubauen, ging die Regierung in den vergangenen Jahren den umgekehrten Weg und hob die Beschränkungen auf. Gia kritisiert das Freihandelsabkommen mit der EU, das dazu führte, dass wieder eine Menge überflüssiger staatlicher Regulierungen eingeführt wurde.
Georgien zeigt, wie auch viele andere Länder: Freiheit, auch wirtschaftliche Freiheit muss immer wieder neu erkämpft werden. Es besteht stets die Gefahr, dass Politiker an die Macht kommen, die Reformen wieder rückgängig machen, so wie es in Georgien zum Teil geschehen ist. Beispielsweise sollen ab 2027 die sinnvollen Regelungen in der Verfassung, wonach neue Steuern oder Steuererhöhungen nicht ohne einen Volksentscheid eingeführt werden dürfen, wieder abgeschafft werden.
Mit Gia verbindet mich bis heute eine Freundschaft. Ich lud ihn zu meinem 65. Geburtstag nach Berlin ein, er übersetzte mein Buch »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung« ins Georgische und hielt eine Vorlesung darüber an der Universität.
Anfang Mai 2022
Tirana, Albanien
Anfang Mai 2022 war ich in Albanien, eingeladen von der Free Market Roadshow. Wir fahren etwa eine Stunde vom Flughafen zum Hotel in Tirana. Ich war sofort beeindruckt von der schönen Landschaft und den Bergen. Die Häuser am Straßenrand sind fantasievoll und vielfältig gestaltet. »Ich glaube nicht, dass es hier 25.000 Bauvorschriften gibt wie in Deutschland«, sage ich meiner Freundin Isabelle, die mich begleitet.
Bjorna Hoxhallari von den Students for Liberty, die ich später treffe, bestätigt, dass viele Häuser ohne Genehmigung gebaut wurden. Gibt es in Deutschland zu viele Vorschriften, sind es hier zu wenige. Während des Erdbebens im September 2019 stürzten viele Häuser ein, weil sie mit minderwertigen Materialien gebaut und unprofessionell konstruiert waren. Was auffällt, sind die Wassertanks auf jedem Haus. Ich kann mir das nicht erklären, denn um den ganzen Wasserbedarf zu decken, sind sie zu klein. Bjorna klärt mich auf, dass die Wasser- und Stromversorgung oft nicht richtig funktioniert, und bei diesen Ausfällen kommen dann die Tanks auf den Häusern mit dem gesammelten Regenwasser zum Einsatz.
Wir kommen im Xheko Imperial Hotel im Zentrum von Tirana an, das als eine der ersten Adressen der Stadt gilt. In anderen europäischen Ländern würde es eher als Mittelklasse-Hotel gelten. Ich war letzte Woche in Tiflis, und im Vergleich zur georgischen Hauptstadt schneidet Tirana ungünstig ab. Gab es in Tiflis viele schöne, alte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, so sind diese in Tirana eine seltene Ausnahme. In den prächtigsten Gebäuden sitzen ein paar Regierungsbehörden. Im Stadtzentrum überwiegen hässliche Bauten aus der kommunistischen Zeit oder solche, die später gebaut wurden und meist auch nicht schöner sind. Viele sind zudem in einem sehr schlechten Zustand und man hat das Gefühl, die beste Lösung sei, sie abzureißen.
Wie steht es mit der Sicherheit in Albanien? Ein Freund aus Deutschland schickt mir vor meiner Abreise eine WhatsApp-Nachricht: »Lassen Sie sich nicht beklauen im Schurkenstaat Albanien.« Isabelle und ich haben unsere teuren Uhren, eine Rolex und eine Cartier, deshalb lieber in den Hotelsafe eingeschlossen. Bjorna meint jedoch, unsere Sorge sei unbegründet, die Straßen hier seien sehr sicher.
Ich lerne Adri Nurellari kennen, eine beeindruckende Persönlichkeit, die die libertäre Bewegung in Albanien geprägt hat. Er war Berater der Demokratischen Partei in Albanien und berät heute die Demokratische Partei im Kosovo. Adri hat vier Jahre lang in London Wirtschaft studiert. Zum Thema Sicherheit und Kriminalität meint er: Ja, es gibt eine hohe Kriminalität im Drogenbereich. Aber gerade deshalb, weil die Kriminellen Unsummen mit dem Anbau und Verkauf von Drogen verdienen könnten, lohne sich die Kleinkriminalität nicht: »Warum einen Touristen um einige Hundert Euro bestehlen, wenn man Millionen mit der Drogenkriminalität verdienen kann?«
Beim Abendessen frage ich Bjorna, wovon die Menschen hier leben. »Weißt du das wirklich nicht?«, fragt sie mich und lacht. »Vom Anbau und Verkauf von Marihuana.« Sie kritisiert den albanischen Präsidenten, der aus Albanien einen »Narko-State« gemacht habe. Es gibt dazu natürlich keine offiziellen Zahlen, aber das Land wird inzwischen als »Columbia of Europe« bezeichnet.19 Schätzungen sagen, dass ein Drittel bis die Hälfte des Bruttosozialproduktes in Albanien aus dem Drogenhandel kommt. Jedenfalls sind es mehrere Milliarden Euro pro Jahr, die mit Drogenhandel erwirtschaftet werden.
Laut dem Weltdrogenbericht 2022 des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) gehört Albanien zu den größten Cannabis-Produzenten der Welt. Der Bericht befasst sich mit dem Stand des Drogenanbaus und erstellt eine Rangliste der Länder, in denen der Anbau am stärksten verbreitet ist, und jener, in denen er kaum betrieben wird. Von 154 Ländern belegt Albanien den siebten Platz nach Marokko, Afghanistan, Spanien, den Niederlanden, Pakistan und dem Libanon. Durch das Land führt auch eine der Hauptrouten des Heroinhandels, die in Pakistan beginnt und über Syrien, die Türkei, Griechenland und schließlich Albanien nach Westeuropa führt.
Ein Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) stellte fest, dass albanische kriminelle Gruppen seit 2017 nicht nur größer, sondern auch raffinierter geworden seien und im Import und in der Verteilung von Kokain aus Lateinamerika nach Europa arbeiteten.20 Mit dem Drogenthema ist ein anderes Problem verbunden: die hohe Korruption in Albanien. Viele Politiker, bis hinein in die Regierung, sind eng mit der Drogenmafia verbunden. Albanien stand zuletzt auf Platz 101 von 180 Ländern im Korruptions-Wahrnehmungsindex von Transparency International.21
Die Themen, über die wir sprechen, sind überwiegend unerfreulich, aber das Restaurant, das Bjorna uns zeigt, ist großartig. Albanien ist für besonders gutes Essen bekannt, und auch als Vegetarier werden meine Freundin und ich nicht enttäuscht. Für umgerechnet 45 Euro haben wir ein tolles Abendessen zu dritt. Und am nächsten Tag zeigt uns Adri ein anderes Restaurant, ebenfalls mit köstlichen Mahlzeiten. Ich lade acht Personen ein, es gibt mehrere Gänge, die Rechnung beträgt umgerechnet 110 Euro.
Trotz aller Armut in dem Land: Die Lebensverhältnisse haben sich im Vergleich zur sozialistischen Zeit wesentlich verbessert. Bjorna berichtet, dass ihre Großeltern mit der Familie noch in einer 80-Quadratmeter-Wohnung lebten – mit bis zu 20 Personen. Das kann man sich kaum vorstellen, aber ich hatte schon vorher gelesen, dass damals vier bis zehn Menschen nicht selten in nur 50 Quadratmeter großen Wohnungen lebten.22
Albanien war in dieser Zeit das ärmste Land Europas. »Wer damals im Flugzeug über Albanien geflogen ist, der sah Jugoslawien unter sich leuchten. Dann, 200 Kilometer bis nach Griechenland, prangte ein dunkler Fleck. Das war Albanien.«23
Im ganzen Land gab es nur 1.265 Autos, keines davon privat. Noch Anfang der 90er-Jahre existierte im ganzen Land keine einzige Ampel. Heute ist Tirana mit Autos überfüllt, und man merkt, dass die Stadt nicht für Autos gebaut wurde. Ähnlich wie in Manhattan steht man fast ständig im Stau. Hier und da sieht man auffallend teure Luxuswagen, etwa von Ferrari. »Das sind die Drogenleute«, mein Bjorna.
Auf meinem Erkundungsgang durch Tirana komme ich an mehreren Bunkern vorbei. Der Diktator Enver Hoxha war paranoid und fürchtete ständig, das Land könne von kapitalistischen Mächten angegriffen werden. Deshalb überzog er das Land mit 200.000 Bunkern, von denen noch viele erhalten sind. Bjorna erzählt mir, dass Bekannte von ihr einen Bunker in ihr Restaurant integriert haben. Am Flughafen lerne ich einen jungen Mann kennen, der Jura studiert und angefangen hat, in Immobilien zu investieren. Er zeigt mir das Foto eines ehemaligen Bunkers mit geschmackvoller Inneneinrichtung. Es wäre sein Traum, so einen Bunker zu einer Ferienwohnung umzubauen und zu vermieten.
Die meisten Bunker sind aber anders, als wir sie aus anderen Ländern kennen. Oft ist darin nur Platz für zwei oder drei Personen. Ich frage Bjrona, ob sie ein Foto von mir in einem dieser kleinen Bunker macht, aber das scheitert an einem schrecklichen Geruch: Offenbar verrichten manche Menschen dort ihre Notdurft, so dass ich lieber ein Foto vor dem Bunker machen lasse. Ein größerer Bunker in Tirana blieb als »Bunker-Museum« erhalten. Die Ausstellung in dem Museum ist beeindruckend. Sie zeigt die Realität des kommunistischen Terrors in Enver Hoxhas Staat.
Was hier gezeigt wird, ist das genaue Gegenteil von dem Bild, das ich als Jugendlicher von Albanien hatte. Als Teenager war ich Maoist. Ich hatte mit 13 Jahren eine »Rote Zelle« an meiner Schule gegründet und gab eine Zeitung heraus, die sich »Rotes Banner« nannte. Wir lehnten sowohl die kapitalistischen Länder ab als auch die Sowjetunion und die DDR, die aus unserer Sicht den Sozialismus verraten hatten. Den wahren Sozialismus gab es unserer Meinung nach nur in zwei Ländern, nämlich in Maos China und in Hoxhas Albanien. So wie wir unsere »Informationen« über China aus der »Peking-Rundschau« bezogen, die ich jede Woche direkt aus Peking geschickt bekam, so bezogen wir unsere »Informationen« über Albanien von Radio Tirana.
Ich erinnere mich noch, wie ich abends im Bett lag und um 23 Uhr Radio Tirana hörte. Die Sendung begann mit dem kommunistischen Kampflied, der »Internationale«. Dann: »Hier ist Tirana, hier ist Tirana. Mit einer Sendung in deutscher Sprache.« Und es gab Sendereihen wie »Die marxistisch-leninistische Weltbewegung wächst und erstarkt«.
Also: In Wahrheit wussten wir überhaupt nichts über Albanien, sondern projizierten unsere sozialistischen Utopie-Sehnsüchte auf das Land, in dem von 1946 bis 1985 Hoxha regierte. Einige meiner Genossen, die studierten, fuhren freiwillig in den Semesterferien nach Albanien, um beim Aufbau des Sozialismus zu helfen, und arbeiteten dort ohne Entgelt.
Was wir nicht wussten – und auch die Albaner nicht: Enver Hoxha und die führenden Kommunisten hatten ein sehr viel besseres Leben, total abgeschottet vom Rest des Landes. Von Ende 1960 bis zu seinem Tod im April 1985 verließ Hoxha sein Land nicht, ja, kaum einmal verließ er den sogenannten »Block«, ein zentral in Tirana gelegener Bezirk, der nur so groß war wie 21 Fußballfelder. Ich frage Bjorna beim Gang durchs Zentrum Tiranas, wo dieser abgeschottete Bezirk sei, in dem die Parteielite wohnte. »Wir sind hier mittendrin, das ist der Block«, meint sie. Irgendwie hatte ich ihn mir anders vorgestellt.
Hier lebte Hoxha von 1944 bis zu seinem Tod und ebenso die Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens mit ihren Familien. »Die Bewohner des Blocks genossen eine besondere Behandlung: Für sie gab es Bedienstete und Hauswirtschaftspersonal, besondere Geschäfte, in denen sie ihre Lebensmittel und Kleidung aus dem Westen kauften, staatliche Villen und Ferienhäuser im ganzen Land sowie zahlreiche weitere Privilegien.«24 Es war eine kleine, verschworene Gemeinschaft, die sich von ihrem eigenen Volk abschottete – meist heirateten die Einwohner des Blocks untereinander.25 Hoxha verbrachte die Zeit vollständig in seinen Ideologien – in seinem Leben schrieb er 68 Bücher, mehr als die meisten Schriftsteller.26 Ich erinnere mich noch, wie ich als 14-Jähriger eine seiner kleineren Schriften vom Englischen ins Deutsche übersetzte. Es mutet absurd an, dass sich der Führer eines Staates selbst abkapselt und im ärmsten Land Europas eine Schrift nach der anderen über die Überlegenheit des Sozialismus produziert.
Natürlich wollte ich das ehemalige Haus von Enver Hoxha sehen. Es ist sehr groß, sieht aber weniger spektakulär aus, als ich dachte. Direkt gegenüber ist eine amerikanische Investmentbank. Ich denke mir, Enver Hoxha würde sich im Grab umdrehen, wenn er das wüsste. Leider wurde das Haus renoviert, als ich da war, und so konnte ich es nicht von innen besichtigen.
Bjorna ist 25 Jahre alt und hat Political Science studiert. Sie spricht perfekt Englisch und arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Englischlehrerin in einem Sushi-Restaurant, das sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Onkel besitzt. 75 Prozent der jungen Menschen in Tirana sprechen Englisch, so Bjrona. Sie hat die Bücher von Adam Smith, Milton Friedman und Ayn Rand gelesen, die ihr Denken geprägt haben. Für Albanien wünscht sie sich vor allem, dass die Bürokratie abgebaut, die Steuern gesenkt werden und dass es mehr Rechtssicherheit für Investoren gibt.
In der sozialistischen Zeit gab es neben den Statuen von Enver Hoxha auch Stalin-Skulpturen, weil Albanien den sowjetischen Diktator noch verehrte, als er in der Sowjetunion bereits in Ungnade gefallen war. Die Menschen waren eingesperrt. Wer versuchte, das Land illegal zu verlassen, wurde im besten Fall für viele Jahre ins Gefängnis oder in eines der Arbeitslager eingeliefert. Oder er wurde erschossen. Fast 1.000 Menschen bezahlten den Versuch, das Land zu verlassen, mit ihrem Leben.27
Das Land hatte sich total von der Außenwelt abgekapselt, was folgende Begebenheit veranschaulicht: Mutter Teresa, eine aus Skopje stammende Albanierin, die weltweit bekannt wurde durch ihre Arbeit in Indien mit Armen, Obdachlosen, Kranken und Sterbenden und in der katholischen Kirche als Heilige verehrt wird, wollte unbedingt ihre im Sterben liegende Mutter daheim in Albanien besuchen. Staatsoberhäupter versuchten ihr auf diplomatischen Wegen zu helfen, dass ihr dieser Wunsch erfüllt wurde, aber selbst ihnen gelang es nicht. Ihre Mutter starb 1981 allein in Albanien, ohne dass sie ihre Tochter noch einmal sehen konnte. Erst 1990, fünf Jahre noch Hoxhas Tod, konnte Mutter Teresa in das Land reisen und das Grab ihrer Mutter besuchen.28
Im Februar 1991 stürzten 100.000 Demonstranten am zentralen Platz in Tirana, dem Skanderberg-Platz, die große Statue von Enver Hoxha, die Zäune fielen und die Arbeitslager öffneten sich.
Die Lage verbesserte sich auch nach dem Ende des Kommunismus zunächst nicht. In den 90er-Jahren brach das Chaos aus. Grund: Die Menschen, die im Sozialismus in bitterer Armut lebten, wollten jetzt reich werden, und zwar schnell. Aber sie verstanden nicht, wie das im Kapitalismus funktioniert. Hunderttausende fielen auf ein dubioses Pyramidenspiel ein, bei dem Gewinne bis zu 50 Prozent versprochen wurden. Das Spiel endete wie alle Schneeballsysteme, aber in diesem Fall waren drei von vier Familien in Albanien betroffen und 1,2 Milliarden Dollar, mehr als die Hälfte des damaligen Bruttosozialproduktes, waren weg.29 Bjorna erinnert sich, dass auch ihre Familie viel Geld verlor – sie besitzt heute noch die wertlosen Zertifikate des Pyramidenspiels.
Nachdem die Albaner merkten, dass sie betrogen worden waren, kam es zum sogenannten Lotterieaufstand, das Land versank im Chaos. Ein britischer Journalist berichtete: »Junge Männer – berauscht von Schnaps und Marihuana – fuhren in rasender Geschwindigkeit mit gestohlenen Autos herum und schossen mit automatischen Waffen in die Luft, als wären sie Chuck Norris in einem Actionfilm.«30
Viele Albaner sind heute Amerika-Fans. Albanien gilt als das pro-amerikanischste Land Europas. Überall im Land sehen wir die albanische Fahne, die Albaner haben einen ausgeprägten Nationalstolz. Daneben sehen wir jedoch oft auch die USA-Fahne – und die der Europäischen Union. Die Albaner hoffen darauf, irgendwann zur EU zu gehören. Das Land hat Fortschritte gemacht bei der wirtschaftlichen Freiheit und seit 1995 um 16 Punkte im Index der wirtschaftlichen Freiheit zugelegt. Doch erreicht es nur Rang 49 von 176 im Ranking der wirtschaftlichen Freiheit.31
In dem Index-Bericht 2023 heißt es: »Die Grundlagen der wirtschaftlichen Freiheit in Albanien werden durch die Schwäche des Rechtsstaats untergraben. Die relativ niedrige Bewertung Albaniens in der Kategorie der Eigentumsrechte ist vor allem auf politische Einmischung in die Justiz zurückzuführen, die durch die anhaltende Korruption noch verschärft wird. Expansive Staatsausgaben haben in den letzten Jahren zu Haushaltsdefiziten geführt.«32
Auf die Frage, was schief gelaufen sei im Übergang vom Sozialismus zu Demokratie und Marktwirtschaft, antwortet Adri: »Es hat keinen Wechsel der Eliten gegeben. Im Wesentlichen sind es die gleichen geblieben. Vielleicht ein Dutzend Familien, die zur Zeit Enver Hoxhas die Macht hatten und sie auch heute noch haben.« Daher bestehe auch kein ernsthaftes Interesse an einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und den Verbrechen der Hoxha-Diktatur. Charakteristisch sei, dass vielleicht gerade einmal 20 Prozent der von den Kommunisten enteigneten Unternehmer und Landbesitzer ihr Eigentum zurückbekommen und dafür eine lächerliche Entschädigungssumme von zehn Millionen Dollar erhalten hätten.
Nach dem Ende des Sozialismus verließen viele Menschen ihre Heimat. In Relation zur Bevölkerungszahl emigrierten seit dem Ende des Sozialismus aus keinem anderen europäischen Land mehr Menschen. In den vergangenen 30 Jahren habe Albanien etwa 30 Prozent der Bevölkerung verloren. Nur noch 2,8 Millionen Menschen leben in dem Land. Die besten und talentiertesten jungen Albaner sind zu einem großen Teil ausgewandert. Viele gingen nach Griechenland oder Italien. Allein in Italien, so Adri, lebten heute 350.000 Albaner, die 40.000 Unternehmen besitzen. In Italien erwirtschafteten sie immerhin sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Heute leben mehr Albaner außerhalb des Landes als in Albanien.
Eine wichtige Einnahmequelle der Menschen in Albanien, vor allem auf dem Land, sind daher Überweisungen von Angehörigen, die in anderen europäischen Ländern leben. Und meistens überweisen sie monatlich Geld, um ihre Familien zu unterstützen. In Albanien verdient man durchschnittlich etwa 350 Euro im Monat. In Albanien selbst, so Adri, sehen talentierte junge Unternehmer keine Chance, da viele Bereiche der Wirtschaft monopolisiert seien. Und wer über keine exzellenten Beziehungen zur Politik verfügt, hat hier wenig Chancen. Hinzu komme, dass Gesetze und Regeln ständig geändert würden, was zur Verunsicherung von Investoren führe. Die Gesetze zum Schutz des Privateigentums seien seit dem Ende des Kommunismus allein 16-mal überarbeitet worden, auch Steuergesetze würden ständig geändert. Das schrecke ausländische Investoren und Banken ab. Manche von ihnen – so etwa die Deutsche Bank oder die Société Générale – hätten deshalb bereits das Land verlassen. Im International Property Rights Index 2021, der misst, wie sicher die Eigentumsrechte in einem Land sind, kommt Albanien nur auf Platz 98 von 129.
In allen Ländern lerne ich wichtige Menschen kenne, mit denen ich auch danach den Kontakt halte. Einer davon ist Adri Nurellari. Ich traf ihn wieder am 7. Juni 2022 auf einer Konferenz in Stockholm, zu der mich mein Freund Anders Ydstedt einlud. Adri gewann dort den ersten Preis für Ideen, die geeignet sind, libertäre Projekte bei jungen Menschen in Albanien zu verbreiten. Da ich finde, dass seine Gedanken Nachahmung verdienen, hier seine Idee, die er für das Albanian Liberal Institute (ALI) eingereicht hat: »Das Albanian Liberal Institute würde gern eine Reihe von zehn Seminaren an den zehn wichtigsten öffentlichen und privaten Universitäten in sieben albanischen Städten organisieren. Angeregt wurde dieses Projekt durch das erfolgreiche Modell und die Erfahrung der ›Free Market Road Show‹. Sein Ziel ist es, marktwirtschaftlich orientierte Literatur bekannt zu machen und gleichgesinnte junge Menschen zu finden und zu rekrutieren. Darüber hinaus schlägt das ALI vor, eine Sammlung von 20 ins Albanische übersetzten Büchern zum Thema freie Marktwirtschaft zusammenzustellen und diese den Studenten und Dozenten von zehn privaten und öffentlichen Universitäten in Albanien zur Verfügung zu stellen.
Die Zielgruppe des Projekts während der Veranstaltungen in den Universitätsbibliotheken der verschiedenen Städte sind die dortigen Studenten und Lehrkräfte an den albanischen Universitäten sowie lokale Interessenvertreter, Journalisten und Aktivisten der Zivilgesellschaft. Die Studenten und Lehrkräfte sind ein wichtiger Teil der albanischen Gesellschaft, denn sie sind hochqualifiziert und daher eher in der Lage, die Bedeutung der liberalen Werke zu verstehen. Aufgeschlossen gegenüber politischen Ideen und Debatten, sind sie im Allgemeinen sehr aktiv und engagiert in der Öffentlichkeit und werden höchstwahrscheinlich die zukünftigen Entscheidungsträger und Führungskräfte sein. Darüber hinaus sind sie auch die wichtigsten Meinungsmacher, Multiplikatoren und Wissensvermittler und als solche in der Lage, die öffentliche Meinung und Wahrnehmung in Bezug auf die Werte des liberalen Denkens zu prägen …. Jedes der Seminare besteht aus zwei Teilen. Der erste besteht in einer Präsentation von Idealen wie Individualrechte, Unternehmertum und Freiheit. In einem zweiten Teil werden die wichtigsten Autoren und Werke diskutiert. Während in der ersten Präsentation die Bedeutung des klassischen Liberalismus für die Entwicklung eines Landes und einer Gesellschaft im Mittelpunkt steht, ist der zweite Teil darauf ausgelegt, dem Publikum ein besseres Verständnis der Geschichte der liberalen Bewegung und ihrer wichtigsten Autoren und Werke zu vermitteln. Darüber hinaus werden die Studenten über die Aktivitäten des Netzwerks ›European Students for Liberty‹ informiert und ermutigt, einen lokalen Zweig zu gründen.« Ich finde das eine tolle Idee. Deshalb habe ich 200 meiner Bücher in albanischer Sprache gestiftet, um das Projekt zu unterstützen.
Mai 2022
Warschau, Polen
Ende 2021 lädt mich Brad Lips, der CEO des Atlas-Network (der weltweit größten Vereinigung libertärer Thinktanks) nach Kiew zum »Europe Liberty Forum 2022« als Referent ein. Dann kommt am 24. Februar Putins Einmarsch in die Ukraine, und die Veranstaltung wird nach Warschau verlegt. Ich reise am Vorabend, Mittwoch, den 11. Mai 2022, an. Der Kongress ist gut besucht, mit etwa 200 Vertretern libertärer Thinktanks aus ganz Europa. Obwohl ich das erste Mal dabei bin, habe ich das Gefühl, viele Bekannte zu treffen.
Am Donnerstagabend findet ein gemeinsames Abendessen statt, und ich habe richtig Glück. Links von mir sitzt meine Freundin Alica und rechts von mir Maryan Zablotskyy, Abgeordneter des Parlaments der Ukraine und Mitglied der regierenden Partei von Wolodymyr Selenskyj, dem Präsidenten der Ukraine. Er stellt sich mir vor und erzählt, dass er vorher Mitglied der Ukraine Economic Freedom Foundation war, eines 2015 gegründeten liberalen Thinktanks. Heute ist er nicht nur mein Tischnachbar, sondern auch Gastredner bei dem Abendessen.
Er berichtet mir von der ungeheuren Wut, ja dem Hass, den er gehabt hatte, als er am 24. Februar erfuhr, dass Putin tatsächlich in die Ukraine einmarschierte. Seine Frau und sein Kind seien in Sicherheit in der Westukraine (sofern man von Sicherheit sprechen kann), und seine Gedanken sind heute vor allem auf die Zukunft gerichtet. Wir sprechen über Wirtschaft. Die Einkommenssteuer in der Ukraine, so Zablotskyy, wurde kürzlich auf zwei Prozent gesenkt, zahlreiche Regulierungen und Zölle wurden abgeschafft.