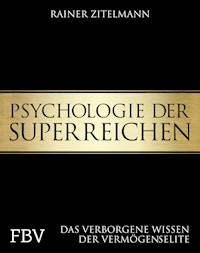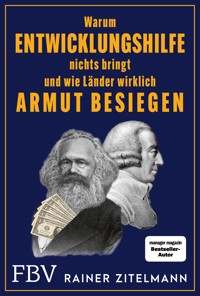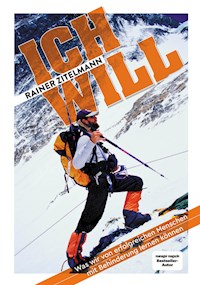21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Journalist und Unternehmer, Historiker und Immobilieninvestor, Bodybuilder und Reichtumsforscher, erst Maoist, später Multimillionär. Rainer Zitelmann hat in 60 Jahren kaum etwas ausgelassen. Er war erfolgreicher Verleger, meinungsstarker Journalist, international angesehener Hitler-Biograf und Bestseller-Autor. Mit 59 Jahren verkaufte er sein erfolgreiches PR-Unternehmen und schrieb seine zweite Doktorarbeit über die Psychologie der Superreichen. Rainer Zitelmanns »Lehr- und Wanderjahre« vom Historiker zum Journalisten und Multimillionär sind nicht nur ein spannender Blick zurück auf 60 Jahre beeindruckende Leistungen, sondern auch eine Inspiration: Wenn du nicht mehr brennst, starte neu! Rainer Zitelmann hat weltweit eine immer größer werdende Fangemeinde. Der Meister der Selbstvermarktung hat die ursprünglich 2017 erschienene Autobiografie um zwei Kapitel sowie zahlreiche Fotos erweitert und berichtet u.a. von seinen Reisen nach Asien und Lateinamerika.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
RAINER ZITELMANN
WENN DU NICHT MEHR BRENNST, STARTE NEU
MEIN LEBEN ALS HISTORIKER, JOURNALIST UND INVESTOR
DIE AUTOBIOGRAFIE – 4. ERWEITERTE AUFLAGE 2023
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
5., erweiterte Auflage 2023
© 2017 by FinanzBuch Verlag,
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Ansgar Graw
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Coverfoto: Frank Nürnberger
Satz: inpunkt[w]o, Haiger (www.inpunktwo.de)
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-693-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-333-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-334-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort von Dr. Hermann Otto Solms
Vorwort
Prolog
Kapitel 1: Von der Galaktischen Zeitung zum Roten Banner
Kapitel 2: Mao, Marx und Reich
Kapitel 3: Entdeckungen über Adolf Hitler
Kapitel 4: Vier Jahre Freie Universität
Kapitel 5: Bücher gegen Links
Kapitel 6: Chef der »Geistigen Welt«
Kapitel 7: Das Liberale Manifest und der 8. Mai 1995
Kapitel 8: Ich entschließe mich, reich zu werden
Kapitel 9: Die erste tägliche Immobilienseite in Europa
Kapitel 10: Ich werde Unternehmer!
Kapitel 11: 15 Jahre Marktführer
Kapitel 12: Investor: Millionär gegen den Strom
Kapitel 13: Was ich von 45 Superreichen lernte
Kapitel 14: Publizist zur Finanz-, Euro- und Flüchtlingskrise
Kapitel 15: Meine zwölf Lebensregeln
Kapitel 16: Ich erobere die Welt
Kapitel 17: Eine Augenkrankheit, die Corona-Zeit und mein Projekt »Welteroberung«
Danksagung
Der NEO-FFI-Test
Bücher von Rainer Zitelmann
Ausgewählte Aufsätze von Rainer Zitelmann
Vorwort von Dr. Hermann Otto Solms
Das Leben von Rainer Zitelmann ist das eines Reisenden. Das Leben eines Mannes, der nicht stehen bleibt, den es immer weiterzieht und der offen und neugierig ist für alles, was ihm auf dieser Reise begegnet. Dabei entwickelt er sich stets weiter und kennt zielstrebig nur eine Richtung – nämlich vorwärts.
Das erste Mal bin ich Rainer Zitelmann Anfang der 90er-Jahre begegnet. Ich war zu einem Redaktionsbesuch bei der »Welt« in Berlin. Dort arbeitete er zu dieser Zeit als Redakteur. Doch bei der Tätigkeit als Journalist sollte es nicht bleiben. Seine berufliche Reise sollte noch weitergehen.
In all den Jahren, die ich Rainer Zitelmann nun kenne, war er in zahlreichen unterschiedlichen Bereichen und Branchen tätig – sei es als Journalist, Historiker, Buchautor, Unternehmer oder Immobilienexperte. Doch ganz egal, was er in Angriff genommen oder wo er sich engagiert hat, er war immer sehr erfolgreich.
Das liegt zu einem Großteil daran, dass er immer offen für etwas Neues ist. Er verfügt über eine nicht enden wollende Neugier und Wissbegier. Auch scheut sich Rainer Zitelmann nicht davor, ganz neu zu starten. Im Gegenteil. Mehrmals in seinem Leben hat er einen beruflichen Neustart begonnen. Nicht aus Zwang, sondern aus Neugierde und aus Begeisterung. Beides Eigenschaften, die ihn ausmachen und gleichzeitig sehr starke Triebfedern in seinem Leben sind.
Diesen Mut und diese Entschlossenheit respektiere ich. Beispielsweise, dass er mit 59 Jahren die eigene Firma verkauft und noch einmal eine Doktorarbeit geschrieben hat. Das trauen sich nicht viele zu. Rainer Zitelmann schon. Er sticht aus der Masse heraus, schwimmt gerne gegen den Strom und kennt keine Selbstzweifel.
Wie in beruflicher Hinsicht, so begab sich Rainer Zitelmann auch politisch auf eine Reise. Diese Reise hatte viele Stationen, die zum Teil nicht unterschiedlicher sein konnten. Seine Neugier und sein Interesse an und für Politik begannen schon in jungen Jahren. Bereits als Junge las er den »Spiegel« und die »Frankfurter Rundschau«. Ganz außergewöhnlich ist, dass er als 8-Jähriger einen Schriftwechsel mit Willy Brandt hatte. Das können wahrlich nicht viele von sich behaupten – schon gar nicht in diesem Alter. Rainer Zitelmann hat Brandt nach der verlorenen Bundestagswahl im Herbst 1965 angeschrieben und eine Antwort samt persönlich signiertem Foto erhalten, das lange Zeit an der Wand seines Kinderzimmers hing.
Seine politische Reise ging vom ehemaligen SPD-Fan weiter in Richtung Kommunismus. Zitelmann gründete eine Rote Zelle und wurde Gefolgsmann der maoistischen KPD/ML. Als ich ihn kennenlernte, war er überraschenderweise bei der FDP angekommen und engagierte sich hier, seit Ende der 90er-Jahre vor allem mit Bezug auf Immobilien-Themen. Er moderierte Kongresse und gründete die FDP-nahe »Liberale Immobilienrunde e.V.«.
Mit all diesen Erfahrungen, die Rainer Zitelmann auf seiner Lebens-Reise gemacht hat, ist er stets ein kritischer Dialogpartner gewesen, dessen Kommentare zu Themen aus der Wirtschaft, der Politik und der Finanzwelt ich schätze. Er ist ein kluger Kopf, dem es immer gelingt, die Dinge auf den Punkt zu bringen und nicht selten auch den Finger in die Wunde zu legen.
Seine Autobiografie ist wie all seine Bücher kurzweilig geschrieben und dabei auch noch amüsanter Lesestoff, der interessante Einblicke in das ungewöhnlich bewegte und abwechslungsreiche Leben von Rainer Zitelmann gibt. Dieses Buch zeigt auch, wie spannend es sein kann, mehrmals im Leben ganz neu zu starten und sich in ganz andere Lebenswelten zu begeben. Rainer Zitelmann sieht darin Chancen. Er lässt sich nicht von äußeren Zwängen abhalten – und schon gar nicht aufhalten.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Reise von Rainer Zitelmann noch weitergehen wird. Dass er noch viele Neuanfänge vor sich hat und diese mit der für ihn typischen Freude und Begeisterung anpacken wird.
Wenn man bedenkt, dass sowohl seine Großeltern als auch seine Eltern bis ins hohe Alter hinein sehr aktiv waren, dann kann man sich vorstellen, wohin die Reise noch gehen wird. Rainer Zitelmann ist ein Mann, der noch viel vorhat – darauf bin ich gespannt.
Dr. Hermann Otto Solms
Vizepräsident des Deutschen Bundestages a.D.
Vorwort
Manche Autoren erklären zu Beginn ihrer Autobiografie, sie hätten lange mit sich gerungen und gezweifelt, ob es richtig sei, über ihr Leben zu schreiben. Und dann sei es dem Lektor eines Verlages, ihren Freunden und ihrer Frau mit vereinten Kräften doch noch gelungen, sie zu überreden, sich der Mühe zu unterziehen. Sie fügen dann bescheiden hinzu, vielleicht gebe es ja auch das eine oder andere, was nicht völlig uninteressant sei … Ich habe diese Selbstzweifel nicht. Ich finde mein Leben unglaublich interessant, aufregend und vor allem ziemlich ungewöhnlich. Das reicht mir als Grund, um darüber zu berichten.
Von meiner Berufsausbildung her bin ich Historiker. Dessen Aufgabe ist es, wie Leopold von Ranke einmal formuliert hat, aufzuzeigen, »wie es eigentlich gewesen« ist. Um nichts anderes geht es in dieser Autobiografie. Ich will damit weder irgendjemanden belehren noch versuchen, mich selbst zu analysieren. Das zumindest war mein Vorsatz, als ich mit dem Schreiben begann. Später konnte ich es mir dann doch nicht verkneifen, hie und da selbstanalytische und auch einige »belehrende« Passagen einzuflechten.
Es kann große Freude machen, gegen den Strom zu schwimmen – aber man braucht viel Kraft und starke Nerven dafür. Und es ist aufregend, mehr als nur ein Leben zu führen. Seit ich 20 Jahre alt bin, bewundere ich Arnold Schwarzenegger, der mehrere Leben gelebt hat, als Bodybuilder, Geschäftsmann, Filmstar und Politiker. Das war und ist auch mein Lebenskonzept.
Das Modell, das früher vorherrschte, nämlich eine Ausbildung zu machen oder ein Fach zu studieren und dann das ganze Leben lang das Gleiche zu tun, hat eine Berechtigung, und es wird – entgegen anderen Voraussagen – auch in Zukunft Menschen geben, die einem solchen Weg folgen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wer aber darüber nachdenkt, aus gewohnten Pfaden auszubrechen, für den könnte dieses Buch eine Ermutigung sein. Die Schnelligkeit der Veränderungen in unserer Welt wird ohnehin immer mehr Menschen dazu zwingen, herauszufinden, ob in ihnen mehr als nur eine Begabung steckt.
Viele Bürger der neuen Bundesländer waren nach dem Zusammenbruch des Sozialismus zu einem beruflichen Neustart gezwungen. Manche haben darüber geklagt, andere haben darin eine große Chance gesehen und diese genutzt. Bei mir, einem Westdeutschen, war es anders: Ich habe nicht deshalb mit etwas Neuem begonnen, weil ich dazu gezwungen gewesen wäre, sondern weil ich neugierig war. Und weil ich irgendwann merkte, dass ich meinen Beruf zwar gerne ausübte, aber nicht mehr mit brennender Begeisterung. Das war für mich Grund genug, nach Neuem Ausschau zu halten. Nacheinander war ich Historiker, Cheflektor, leitender Journalist, Unternehmer und Investor. Alles, was ich unternahm, tat ich mit Freude und Begeisterung. Aber nichts davon wollte ich mein ganzes Leben lang tun.
Sie erfahren in diesem Buch unter anderem, wie ich
eine Zeitungsanzeige mit 128 Worten formulierte und damit die politische Klasse (einschließlich Bundeskanzler Kohl) in helle Aufregung versetzte;
als Cheflektor des Ullstein-Verlages und Ressortleiter der »Welt« die politische Linke herausforderte, bis mein Auto in Flammen aufging;
dank der (teilweise geheimen) Unterstützung mächtiger Männer im Axel-Springer-Konzern überlebte, obwohl meine politischen Gegner mich vorübergehend ins Abseits gestellt hatten;
von der Politik und Geschichte zur Immobilie kam und das führende Unternehmen für die PR-Beratung der Immobilienbranche aufbaute;
mit einem anfänglichen Kontostand von minus 10.000 Mark in wenigen Jahren Millionär wurde;
fast ohne Eigenmittel am Berliner Immobilienmarkt viele Millionen investierte und damit »unendliche« Renditen erzielte.
Ich verschweige aber auch nicht meine Dummheiten und Schwächen – vom exzessiven Hasch- und Alkoholmissbrauch bis zu Fehlern in der Menschenführung während meiner Zeit als Unternehmer. Ausführlich wird zudem meine Zeit als Gründer einer Roten Zelle und Gefolgsmann der maoistischen KPD/ML beschrieben.
Ein kluger Kopf, auf dessen Urteil ich sonst viel gebe, hat mir empfohlen, nicht so offen über meine Schwächen zu schreiben. Er hat mir zugleich nahegelegt, etwas bescheidener zu sein, wenn es um meine Erfolge geht. Ich bin weder dem einen noch dem anderen Rat gefolgt. Dies soll eine ehrliche Autobiografie sein, in der Sie als Leser mich so erleben, wie ich bin.
Schon früh habe ich fast alles aufbewahrt: von den Schülerzeitungen über die politischen Abhandlungen in meiner linken Periode bis zu den Unterlagen über meine Immobilieninvestitionen, mit denen ich in den vergangenen zwei Jahrzehnten vermögend wurde. Das war gut so, denn ich habe zwar ein sehr gutes Gedächtnis, weiß jedoch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, wie stark dies Menschen täuschen kann, wenn es um ihre eigene Vergangenheit geht.
Es gibt Autobiografien, in denen die Autoren ausführlich von Erlebnissen in ihren ersten Lebensjahren (manche sogar vor ihrer Geburt!) berichten, obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass es unmöglich ist, sich daran zu erinnern. Wer sich für das Thema interessiert, dem empfehle ich die faszinierenden Arbeiten der Gedächtnisforscherin Julia Shaw. Sie weist nach, dass die meisten Menschen ihre autobiografische Gedächtnisleistung massiv überschätzen und selbst felsenfest überzeugt sind, bestimmte Dinge hätten sich so zugetragen, die sich tatsächlich nie oder ganz anders ereignet haben. Daher stütze ich mich, anders als viele auf Erinnerungen basierende Autobiografien, in diesem Buch, so weit möglich, auf schriftliches Material. Und dies ist auch ein Grund, warum ich erst mit dem siebten bzw. achten Lebensjahr beginne. Nicht, weil ich nicht wüsste, dass frühkindliche Erfahrungen prägend sein können. Sondern weil ich weiß, dass unsere vermeintlichen Erinnerungen gerade an diese Zeit besonders anfällig für Fehler sind.
Ganz persönliche Dinge, die den Privatbereich anderer Menschen – etwa meiner Freundinnen oder Geschwister – berühren, lasse ich weg. Nicht, weil mir diese Menschen nicht wichtig wären. Im Gegenteil. Aber ich möchte deren Privatsphäre respektieren.
Das ist eine Zwischenbilanz. Ich denke, dass ich in 10 oder 20 Jahren noch mehr zu berichten haben werde. Meine Großmutter mütterlicherseits, Marie Hock, ist 106 Jahre alt geworden, mein Vater Arnulf Zitelmann hat mit 87 Jahren ein 1.200 Seiten starkes Buch geschrieben, meine Mutter Dietlinde Zitelmann mit 82 Jahren Kurse für Erwachsene in der Volkshochschule gegeben. Ich hoffe, ich habe gute Gene, und setze auf ein langes Leben. Ich habe noch viel vor.
Für diese erweiterte Neuauflage der zuerst 2017 erschienenen Autobiografie habe ich die Kapitel 16 und 17 hinzugefügt, in denen ich beschreibe, was nach dem Verkauf meiner Firma im Jahre 2016 geschehen ist. »Ich erobere die Welt« – diese Überschrift ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen, aber Sie werden sehen, dass mein Lebensmotto auch im Alter von 65 Jahren unverändert geblieben ist: Setze dir größere Ziele!
Dr. Dr. Rainer Zitelmann, November 2022
Prolog
Drei Tage vor Heiligabend, am 21. Dezember 2015, war mein engster Mitarbeiter am Telefon. Ich wartete gerade vor der Gepäckkontrolle am Frankfurter Flughafen, so wie fast jede Woche. Und so wie seit 15 Jahren jeden Tag etwa zehn Mal telefonierte ich mit Holger Friedrichs, dem Leiter der PR-Abteilung meiner Firma »Dr. ZitelmannPB.«. Ich erzählte ihm eine gute Nachricht von einem Kunden, der seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hatte. Friedrichs ging gar nicht darauf ein, sondern erwiderte: »Ich habe auch eine Nachricht, aber eine schlechte. Ich gehe. Ende Januar bin ich weg.«
Das war ein Schock. Die geschäftliche Partnerschaft mit Holger Friedrichs hatte 15 Jahre gedauert. Und jetzt das. Völlig überraschend. Drei Tage vor Weihnachten. Aus heiterem Himmel. Meine Firma hatte im letzten Jahr viele gute Mitarbeiter verloren, vor allem durch meine Schuld. Ich hatte einige Fehler gemacht. Mich zu wenig um die Firma gekümmert, weil ich den rechten Spaß verloren hatte. Ich hatte mehr Freude daran, meine zweite Doktorarbeit zu schreiben. Und ich war immer schon ein schwieriger Chef, mit dem viele Mitarbeiter nicht zurechtkamen. Einer war mir immer treu geblieben und hatte Tag und Nacht für die Firma gearbeitet, als wäre es die eigene.
Und nun geht: er. Der Mitarbeiter, von dem fast alles abhängt! Was er konnte, konnte ich nie. Ein PR-Genie mit einer schlafwandlerischen Sicherheit für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Am 1. Oktober 2001 hatte ich ihn eingestellt. Ich hatte meine Firma ein Jahr zuvor gegründet. Weil ich ein guter Verkäufer bin, war es mir gelungen, sieben Kunden zu gewinnen, mit denen ich startete. Jeder zahlte 120.000 D-Mark im Jahr. Aber nach einem Jahr dämmerte es mir, dass ich eine Firma gegründet hatte, von der die Kunden mehr Kompetenz in der PR forderten, als ich selbst sie hatte. Ja, ich war vorher einige Jahre lang ein erfolgreicher und bekannter Journalist gewesen. Doch von PR verstand ich nur wenig, so wie übrigens die meisten Journalisten.
Damals bewarb sich eine junge Frau bei uns, die sich dann letztlich für einen anderen Job entschied. »Wenn Sie mir einen bringen, der was von PR versteht«, versprach ich ihr, »dann bekommen Sie 1.000 D-Mark Belohnung.« Sie brachte Friedrichs. Ich wusste sofort: Das war der richtige Mann. Mir gefiel seine Studienkombination – Philosophie und Chemie –, und er hatte vor allem mehrere Jahre PR-Erfahrung.
Friedrichs ist ein ruhiger Typ. Ganz das Gegenteil von mir. Der nur zehn Prozent von dem redet, was ich rede. Der wenig lacht – bzw. nur dann, wenn man dazusagt, dass man gerade einen Witz erzählt hat. Aber ein Mensch, dem man zu 100 Prozent vertrauen kann. Nur das und der große Fleiß – sowie eine gehörige Portion Selbstbewusstsein – verbinden uns beide. Jetzt stehe ich hier vor dem Gepäckband am Frankfurter Flughafen, und er sagt mir, dass er in wenigen Wochen weg sei. »Was wollen Sie machen?« Dazu wollte er nichts sagen.
Hatte ihn ein Kunde abgeworben? Würde er seine eigene PR-Firma aufmachen und vielleicht dabei einige Kunden und Mitarbeiter mitnehmen? Mehrere Kunden hatten sich sogar vertraglich zusichern lassen, dass sie sofort kündigen können, wenn Friedrichs die Firma verlassen sollte. Ich tippte spontan darauf, dass er sich selbstständig machen wollte. Diese Befürchtung hatte ich vor vielen Jahren manchmal gehabt, aber wenn das jemand über 15 Jahre nicht tut, rechnet man irgendwann nicht mehr damit. Vor allem, weil wir uns immer super verstanden haben – und bis heute super verstehen.
»Herr Friedrichs, wenn Sie schon gehen, dann bitte nicht sofort. Das geht auf keinen Fall. Sie wissen, in welcher schwierigen Situation die Firma ist. Das fliegt mir komplett um die Ohren.« Vielleicht war das ein wenig übertrieben, aber die Situation ohne Friedrichs wäre auf jeden Fall sehr schwierig geworden. Er war nicht zu erweichen: 31. Januar. Keinen Tag länger. »Dann bin ich weg.«
In einer solchen Situation kann man sehr unterschiedlich reagieren, zum Beispiel: »Warum passiert das mir? Was für eine Schweinerei! Wie undankbar ist der?! Lässt der mich von heute auf morgen im Stich …« Glücklicherweise habe ich nicht die Gewohnheit, so zu reagieren. Vor allem nicht, wenn es wirklich ernst wird. Dann überlege ich sofort: »Wofür könnte das Problem gut sein? Wie kann ich die Chance nutzen, die in dem Problem steckt?«
Zwei Minuten nachdem Friedrichs (ich sieze mich mit ihm wie mit allen Mitarbeitern und übrigens auch, bis auf vier oder fünf Ausnahmen, mit allen männlichen Freunden) mir eröffnet hatte, dass er geht, hörte ich mich sagen: »Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen die Firma verkaufe?« Mir schoss dieser Gedanke spontan durch den Kopf, als ich mich zwang zu überlegen: »Wo könnte die Chance in diesem Problem liegen?« Ja, liegt darin nicht eine Riesenchance für mich? Eine solche Firma, die den eigenen Namen trägt und von der jeder glaubt, sie sei nicht viel wert ohne einen selbst, ist schwer zu verkaufen. Man kann sie höchstens an eine andere Firma verkaufen, die dann aber in der Regel von einem verlangt, dass man noch einige Jahre an Bord bleiben soll. Als Angestellter! Das wäre so für mich, wie wenn ich mich scheiden ließe, und der Richter sagen würde: »Bedingung ist aber, dass Sie weitere vier Jahre mit dieser Frau zusammenleben.« Viele Firmenchefs machen so etwas. Für mich wäre das nichts.
Und nun kündigt mein engster Mitarbeiter. Das könnte eine Chance sein … Zwei Tage nach dem Telefonat saßen Friedrichs und ich mit einem Wirtschaftsprüfer und zwei Steuerexperten zusammen, danach führten wir Gespräche mit den Banken. Diskutierten, wie man den Verkauf strukturieren und finanzieren könnte. Fünf Wochen später unterschrieben wir beim Notar den Kauf- und Übertragungsvertrag für 100 Prozent der Firmenanteile sowie eine Beratungs- und Kooperationsvereinbarung für die nächsten drei Jahre.
Ich habe die Firma zu einem vernünftigen Preis verkauft, aber es kam mir nicht darauf an, das Maximum rauszuholen. Mit Immobilien hatte ich genug Geld verdient. Jetzt ging es nicht um eine Million mehr oder weniger, sondern darum, sauber aus der Sache rauszukommen. Den Mitarbeitern eine Perspektive zu geben. Die Kunden nicht im Stich zu lassen. Meinem engsten Mitarbeiter, dem ich viel zu verdanken habe, eine Chance zu eröffnen. Der Firma eine Zukunftsperspektive zu hinterlassen. Und selbst ganz frei zu werden. Wäre mir der Verkauf nicht gelungen, hätte ich die Firma im schlimmsten Fall abwickeln müssen. 40 Mitarbeiter wären ohne Job gewesen.
Durch den Verkauf der Firma fühlte ich mich frei, befreit. Ich flog erst einmal für sieben Wochen nach New York, wo ich 2012 eine Wohnung gekauft hatte, die sonst vermietet ist. Nun wohnte ich selbst dort und verbrachte die Zeit ohne Plan und ohne Programm. Ich wollte erst einmal die neue Freiheit und den Sommer in Manhattan genießen.
Ich musste nicht mehr von Termin zu Termin. In den letzten 15 Jahren war jeder Tag verplant, meist schon zwei bis drei Monate im Voraus. Zum Abschied haben mir die Mitarbeiter ein kleines Buch geschenkt und ausgerechnet, dass ich 468.845,44 Flugmeilen geflogen und 129.142,94 Kilometer mit der Bahn gefahren bin. Um 136 Kunden zu gewinnen und zu betreuen, 22 in Hamburg, 13 in Frankfurt, 23 in München, fünf in Stuttgart, sieben in Düsseldorf, vier in Köln, drei in Bonn usw. Mir hat diese Arbeit eine Riesenfreude gemacht, so wie die anderen Dinge, die ich zuvor im Leben gemacht hatte – als Historiker, als Verlagslektor und als Journalist. Aber es war nun einmal nie mein Konzept, das ganze Leben über nur eine Sache zu tun.
Kapitel 1:
Von der Galaktischen Zeitung zum Roten Banner
Wir waren vier Geschwister. Für jedes Kind hatte meine Mutter ein Album angelegt. Neben Fotos schrieb sie dort in kurzen Berichten auf, wie sie ihren Sohn und ihre drei Töchter erlebt hat. Für 1964, ich war damals sieben Jahre, findet sich ein Foto, wie ich an meiner ersten Schreibmaschine sitze, die ich mir zu Weihnachten gewünscht hatte. Seitdem sind nur wenige Tage in meinem Leben vergangen, an denen ich nicht an der Schreibmaschine oder – später dann – am PC gesessen hätte.
Meine Berufswünsche als Kind wechselten. Mit sieben Jahren wollte ich unbedingt Archäologe werden. Das war mein großer Traum. Damals waren wir in ein Neubaugebiet in der Frankfurter Nordweststadt gezogen. Da konnten wir überall aufsammeln, was wir »Römerscherben« nannten, also Bruchstücke aus Krügen und anderen Gefäßen. Ich sammelte alles: Münzen, eine Pfeilspitze, Teile von Tongefäßen – all das war mehr als 1.600 Jahre alt. Ich war oft den ganzen Tag mit den Archäologen zusammen und sah zu, wie sie beispielsweise einen Keller aus der Römerzeit freilegten. Dort wurden bedeutende Funde einer ehemaligen Siedlung der Römer gemacht.
Für das Frühjahr 1966, ich war acht Jahre alt, finden sich drei ungewöhnliche Bilder und Kommentare meiner Mutter in dem Album. Eines zeigt mich neben einer riesigen Fotocollage. Für die Collage hatte ich Fotos von bekannten deutschen Politikern aus Zeitungen und Zeitschriften ausgeschnitten und aufgeklebt. Ganz groß sieht man den für seine bissigen Zwischenrufe im Bundestag bekannten SPD-Politiker Herbert Wehner mit seiner markanten Pfeife. Meine Mutter überschrieb das Foto: »Das Interesse für Politik wächst«.
Daneben ein anderes Foto – wie ich als Achtjähriger im Grundgesetz lese: »Studium der Verfassung«, hatte meine Mutter dazugeschrieben, und: »Seit Beginn der Wahl Herbst 1965 wird die Archäologie beiseitegelegt, Rainer ist nur noch ›SPD-Politiker‹. Jede Zeitung, Spiegel, Nachrichten usw. sind wichtig, allen voran Willy Brandt … Dein Zimmer hängt voller Bilder der Politiker, Rainer weiß darüber bestens Bescheid. Das Zimmer ist stets in guter Ordnung mit einem ›Bürotisch‹.«
Und dann schließlich ein ungewöhnliches Bild mit einem ungewöhnlichen Kommentar. Ich sitze in meinem Zimmer am Schreibtisch. Das Zimmer sieht nicht aus wie ein Kinderzimmer, sondern wie ein Büro. An der Wand hängt ein persönlich von Willy Brandt signiertes Foto. Und daneben schrieb meine Mutter: »Unser SPD-Abgeordneter in seinem ›Büro‹. Willy Brandt hochverehrt. Von ihm persönlich Brief + Bild erhalten.«
Kaum dass ich lesen gelernt hatte, las ich Magazine und Zeitungen wie den »Spiegel« und die »Frankfurter Rundschau«, die meine Eltern abonniert hatten. So wie andere Jungen die Fußball-Bundesliga verfolgten (die mich nicht im Geringsten interessierte), verfolgte ich gebannt jede Landtags- und Bundestagswahl. 1965 fieberte ich mit Brandt, dem Kanzlerkandidaten der SPD – er verlor. Warum ich mich so für Brandt begeisterte, kann ich nicht sagen. Er war ein charismatischer Politiker, und meine Eltern wählten SPD. Brandt wurde scharf von seinen konservativen Kritikern angegriffen – das machte ihn mir sympathisch.
Als Achtjähriger malte ich Hefte mit politischen Karikaturen und Zeichnungen. Die SPD und Brandt waren die Guten, die CDU und Ludwig Erhard die Bösen. Und die NPD-Leute malte ich mit Hakenkreuz. Vor allem finden sich in den Heften Entwürfe für die Wahlwerbung der SPD. »Man kann wieder wählen. Man wählt SPD«, lautete einer der Slogans, die ich aufzeichnete. Ob ich ihn mir selbst ausgedacht oder irgendwo aufgeschnappt hatte, weiß ich heute nicht mehr. Jedenfalls zeigte sich darin ein sehr frühes Interesse für Politik einerseits und Marketing andererseits. Beide Themen sollten mich mein Leben lang begleiten. Manche Zeichnungen waren sehr kindlich, z.B. »Erhard ist doof, Willy ist gut. Nur SPD«. Dazu eine Zeichnung von Erhard mit seiner Zigarre. Eine Zeichnung fertigte ich offenbar an nach dem enttäuschenden Ausgang der Wahl mit der tröstenden Prognose: »1969 wird Willy Brandt gewählt«.
Mein Vater und ich schickten die Hefte mit den Zeichnungen an Willy Brandt. Als ich diese Autobiografie schrieb, fand ich die Aufzeichnungen im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung – zusammen mit der Korrespondenz. Brandt schrieb mir am 5. November 1965: »Über deine Aufzeichnungen aus der Zeit des Wahlkampfes habe ich mich sehr gefreut, vor allem auch darüber, dass ein Junge in deinem Alter schon so regen Anteil am politischen Leben nimmt.« Dazu schickte er mir eine signierte Autogrammkarte. Im Archiv fand sich ein Entwurf des Briefes (wahrscheinlich durch einen Referenten) mit persönlichen Änderungen von Brandt. Der Leiter des Archivs der Friedrich-Ebert-Stiftung schrieb mir dazu: »Da der Entwurf des Antwortschreibens handschriftliche Einarbeitungen von Willy Brandt trägt, können Sie getrost davon ausgehen, dass er die beiden Büchlein auch tatsächlich gesehen hat.« Mein handschriftlicher Antwortbrief fand sich ebenfalls noch nach über 50 Jahren im Archiv.
Dass mein Vater mich darin bestärkte, meine Kritzeleien dem SPD-Vorsitzenden zu schicken, ist nur eines von vielen Beispielen dafür, dass er und meine Mutter der Meinung waren, ich sei ein besonderes Kind mit besonderen Fähigkeiten. Als meine Mitarbeiter nach dem Verkauf meiner Firma mir ein Büchlein mit einer Chronologie der vergangenen 15 Jahre als Abschiedsgeschenk machten, fand ich diese Anmerkung meiner Eltern darin: »Wir, deine Eltern aber, hielten den Atem an. Es existierte kein Ratgeber, der uns helfen konnte, mit einem überbegabten Kind in der Familie den normalbürgerlichen Alltag zu bestehen.«
Manche Psychologen kritisieren, wenn Eltern ihren Kindern immer wieder vermittelten, etwas ganz Besonderes zu sein, machten sie diese damit zu Narzissten. Vielleicht ist das tatsächlich so, aber manche Psychologen sind heute der Ansicht, eine kräftige Dosis Narzissmus sei keineswegs schädlich, sondern hilfreich. Ein hohes Selbstwertgefühl und die damit verbundene Überzeugung, etwas Besonderes zu sein, ist vielleicht die entscheidende Voraussetzung, um im Leben etwas Besonderes zu leisten.
Während im Alter von acht bis zehn Jahren bei mir die Politik im Vordergrund gestanden hatte, wechselte das – ebenso intensive – Interesse mit elf Jahren zum Thema Raumfahrt und Astronomie. Im Dezember 1968 startete die Apollo 8 zum Mond. Das erste Mal umkreisten drei Amerikaner den Mond, diesmal noch ohne auf ihm zu landen. Das faszinierte mich: Für mich gab es jetzt nur die Themen Astronomie und Raumfahrt. »Die Raumfahrt steht im Vordergrund«, schrieb meine Mutter in das Fotoalbum. Andere Jungen verkleideten sich zu Fastnacht als Indianer oder Cowboys. Ich wurde Astronaut. Damals gab es keine fertige Verkleidung für Astronauten zu kaufen. Meine Mutter nähte mir einen Raumanzug, mein Vater bastelte mir aus Styropor einen Astronautenhelm und sogar eine Strahlenpistole, wie ich sie in der der Science-Fiction-Fernsehserie »Raumpatrouille« über das Raumschiff Orion gesehen hatte.
Mit elf Jahren startete ich mein erstes Zeitungsprojekt, eine Zeitung über Raumfahrt und Astronomie. Meine Mutter schrieb 1968 in das Fotoalbum: »Eine Astronautenzeitung in eigener Herstellung zeigt Begabung für Druck, Schriftstellerei. Die Ausdauer bei Dingen, die interessieren, ist enorm. Fast ausschließliche Beschäftigung mit einem Interessengebiet über lange Zeit. Kritisch zur Umwelt, zu den Lehrern!«
Was meine Mutter schrieb, ist später in meinem Leben so geblieben: Die »fast ausschließliche Beschäftigung mit einem Interessengebiet über lange Zeit« ebenso wie eine kritische Haltung zur Umwelt und die Begabung für das Schreiben.
Das Projekt nannte ich »Galaktische Zeitung«. Ich habe noch einige dieser Ausgaben, etwa die aus dem Juni 1969, das war bereits die Nummer 30. Zu Weihnachten hatte ich mir eine Spiritus-Umdruckmaschine gewünscht. Damals gab es keine Fotokopiergeräte, wer etwas vervielfältigen wollte, schrieb auf sogenannten Matrizen, die mit einem Spiritusdrucker vervielfältigt wurden.
Ich war bei dieser Zeitung alles in einer Person: Herausgeber, Redakteur, Drucker und Vertrieb. Nur die Abbildungen ließ ich lieber von einem Freund zeichnen, weil ich das selbst nicht gut konnte. Später ließ ich auch einzelne Artikel von Freunden schreiben. Damals entdeckte ich zwei Dinge, die mir bis heute Freude machen: erstens das Schreiben und zweitens die Akquisition: Wahrscheinlich staunten die Ladenbesitzer nicht schlecht, als ein 11-jähriger Junge zu ihnen hereinspaziert kam und fragte: »Haben Sie Interesse an einer Anzeige in einer Schülerzeitung?«
In einer Ausgabe, in der ich ausführlich die erste Landung auf dem Mond beschrieb (Apollo 11 im Juli 1969), gab es beispielsweise die Anzeige eines Buchladens: »Bücher Korb Nordwestzentrum«. Ich hatte mir überlegt, was für den Ladenbesitzer und für die Leser meiner Zeitung interessant sein könnte, das waren Bücher über die Mondlandung und über Astronomie. Der Anzeigentext lautete: »Hier einige der vielen Mondbücher, die im BÜCHER KORB nordwestzentrum erhältlich sind: Flug zum Mond (Burda-Verlag) für nur 10 DM, Hallo Erde (Metzler) usw.«
In der Nr. 32 informierte ich: »Liebe Leser, heute wollen wir etwas über Anzeigen sagen. Eine Anzeige ist Reklame … In dieser Zeitung kostet jede Zeile 20 Pfennige … Man kann sich folgende Farben aussuchen: Violett, grün, schwarz, rot, blau. Eine Anzeige auf der ersten Seite ist nur bis zu einer Größe von 3 Zeilen möglich, sie kostet 5 Mal so viel wie normal.« Dann gab es noch ein Sonderangebot für größere Anzeigen.
In der Zeitung findet sich auch eine Eigenanzeige für den »Astronautik-Club«, den ich gegründet hatte. Jahrzehnte später berichtete mir Ronny Kohl, ein bekannter Finanzjournalist, er sei damals Mitglied in meinem Club gewesen, in dem wir unsere Begeisterung für die Weltraumfahrt teilten. Ich hatte den Ronny Kohl, dessen Artikel ich in »Euro am Sonntag« las, gar nicht mit dem Ronny aus meiner Kindheit zusammengebracht.
Eine Eigenanzeige warb in der Zeitung für einen neuen »Sammelband der Galaktischen Zeitung, 5-farbig«, den man mit Preisvorteil kaufen konnte. Außerdem überlegte ich mir, wie ich mit meiner Umdruckmaschine Geld verdienen könnte. Deshalb eine weitere Eigenanzeige: »Wir drucken alles, 50 Blätter in 5 Farben, alles inbegriffen, nur 1,50 DM. Rufe sofort an! Nach 1 Stunde ALLES GEDRUCKT! ES LOHNT SICH!« Ob jemand von diesem Angebot Gebrauch machte, weiß ich nicht mehr.
Ich verschlang viele Bücher über Astronomie, wusste auswendig alles über jeden Planeten in unserem Sonnensystem – wie viele Monde er hat, wie hoch die Schwerkraft dort ist, wie groß er im Durchmesser ist usw. Damals begann ich meine ersten kleinen Buchbesprechungen zu verfassen. Die erste fand ich in Nr. 30 der Galaktischen Zeitung, besprochen hatte ich ein Buch mit dem Titel »Raumfahrt – das große Abenteuer«. In der Nr. 32 besprach ich das Buch »Der Mond« aus der Reihe »Was ist was?«: »Das Buch endet mit den Worten: ›Die Welt, in der wir leben, die Erde … ist schön, aber sie ist zu klein für den Menschengeist. Er wird nicht ruhen, bis er die Gestirne erreicht hat.‹« Später in meinem Leben würde ich viele Hundert Rezensionen schreiben, und heute habe ich ein eigenes Internetportal »Empfohlene Wirtschaftsbücher«, auf dem ich Buchbesprechungen veröffentliche.
1970, ich war damals 13, stand wieder die Politik im Vordergrund. Die Schülerzeitung, die ich jetzt herausgab, war schon professioneller hergestellt. Sie hieß »Yeah«, wurde im Offsetdruck produziert und auf der ersten Seite stand: »auflage 2000 Stück, preis: lehrer 1 dm. schüler 0,10 dm.« Die Zeitung entwickelte sich – so wie meine eigene Gesinnung – zunehmend nach links. Das war Ende der 60er- bzw. Anfang der 70er-Jahre nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Die gesellschaftliche Atmosphäre war stark geprägt von der 68er-Bewegung. Ende der 60er-Jahre waren linke Studenten in deutschen Universitätsstädten auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten gegen den Krieg in Vietnam, aber auch ganz generell gegen den Kapitalismus, gegen die »Konsumgesellschaft« und gegen »autoritäre Strukturen«. Heute wird diese Bewegung überwiegend positiv gesehen – ich teile diese Einschätzung nicht. Viele negative Veränderungen unserer Gesellschaft hatten ihren Ausgangspunkt in dieser Kulturrevolution von 1968. Das analysierte ich später in meinem Buch »Wohin treibt unsere Republik?«.
Auch meine Eltern waren links und an meiner Schule standen eigentlich alle mehr oder minder links, die Lehrer ebenso wie die Schüler. Es ging nicht darum, ob man links war, sondern zu welcher linken Fraktion man gehörte. Selbst die »Naturfreundejugend«, in der meine älteren Mitschüler engagiert waren, die die Zeitung »tumor« herausgaben, stand sehr, sehr weit links. Ungewöhnlich war allenfalls, dass ich schon mit 13 Jahren stark politisch engagiert war, denn die Mitschüler aus der Naturfreundejugend, mit denen ich viel Zeit verbrachte, gingen alle in die 12. oder 13. Klasse, während ich erst in der 8. Klasse war.
Die erste Seite meiner eigenen Zeitung »Yeah« vom November 1970 zeigte eine zum kommunistischen Gruß geballte Faust, die Geldscheine zerknüllte. Darunter stand: »Einen Finger kann man brechen, fünf Finger sind eine Faust! Vereint sind wir stärker!« Und in der Zeitung findet sich ein Artikel über die »Rote Zelle«, die ich an meiner Schule gegründet hatte.
Ich hatte vorher andere Schülerzeitungen herausgebracht, und es war mir gelungen, die Firma Neckermann als Anzeigenkunde zu gewinnen. Da war die Zeitung allerdings noch nicht so extrem links. Der Marketingchef von »Neckermann Nordwest-Zentrum« traute seinen Augen nicht, als er in der vierten Ausgabe von »Yeah« neben seiner Anzeige (»Einkaufen im Nordwest-Zentrum. Da gibt’s nur eins: einkaufen bei Neckermann. Dem beliebten Familien-Kaufhaus«) ein Foto eines fetten Kapitalisten fand, der im Geld badete – mit der großen Bildzeile: »Macht den Unternehmern Dampf – Klassenkampf.« Als ich ihm das Belegexemplar vorbeibrachte und nach der nächsten Anzeige fragte, meinte er: »Also das musst du verstehen, dass wir unter dieser Voraussetzung keine Anzeigen mehr schalten können. Auch Neckermann ist ja ein Unternehmen. Und wenn da zum Klassenkampf aufgerufen wird, nein, also das geht nun wirklich nicht mehr.«
Das verstand ich, hatte aber schon neue Finanzierungsmöglichkeiten gefunden. Es gab in Frankfurt mehrere linksradikale Buchhandlungen, so etwa das »libresso« oder die »Karl-Marx-Buchhandlung«. Ich marschierte als 13-Jähriger ins libresso, eine große Buchhandlung in bester Lage, direkt am Opernplatz. Heute befindet sich dort ein teures Restaurant. Damals hingen an den Wänden riesige Poster von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao. Unter jedem Poster stand eine Parole, zum Beispiel: »Es lebe die Diktatur des Proletariats« (bei Stalin) oder »Dem Volke dienen« (bei Mao). »Haben Sie Interesse, eine revolutionäre Schülerzeitung mit einer Anzeige zu unterstützen?«, fragte ich den Besitzer der Buchhandlung. Beide Buchläden sagten zu.
Das war nicht selbstverständlich, denn die Leute, die hinter den Buchhandlungen standen, mochten sich überhaupt nicht. Bei der Karl-Marx-Buchhandlung waren das die Genossen vom »Revolutionären Kampf« – Daniel Cohn-Bendit, später Abgeordneter für die Grünen im Europaparlament, und Joschka Fischer, der spätere grüne Außenminister. Beim libresso war es die KPD/ML. Die rivalisierenden linksextremen Gruppen waren nicht so begeistert, dass eine Anzeige auch für die Buchhandlung der jeweils anderen Fraktion in meiner Zeitung erschien.
Ich war oft im libresso, denn die Buchhandlung war mit einem Café verbunden, in dem sich die ML-Szene traf. Bei einem der Besuche wunderte ich mich, warum an einem Regal ein Eispickel hing. Das war das Regal, in dem die trotzkistische Literatur lag. Daneben ein Zettel: »Die Trotzkisten sollen nicht vergessen, wie Trotzki umgekommen ist.« Das war makaber. Der russische Revolutionär Leo Trotzki war 1940 in seinem Exil in Mexiko von einem Agenten Stalins mit einem Eispickel ermordet worden. Die KPD/ML (Roter Morgen), die hinter dem libresso stand und auf Stalin und Mao schwor, schloss sich 1986 übrigens absurderweise ausgerechnet mit der trotzkistischen »Gruppe Internationaler Marxisten« (GIM) zur »Vereinigten Sozialistischen Partei« (VSP) zusammen. Sie ging 1996 in der PDS auf, die heute »Die Linke« heißt.
Zurück ins Jahr 1970: Ich ging auf die Ernst-Reuter-Schule in der Frankfurter Nordweststadt. Das war eine der bekanntesten Schulen in Deutschland und mit 2.600 Schülern seinerzeit wohl auch die größte. Es gibt zu ihr sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag: »Sie wird ausdrücklich als Modell- und Experimentalschule angesehen, die den neuen gesellschaftspolitischen Bedingungen dadurch gerecht werden soll, dass sie kritische Bürger einer neuen Gesellschaft erzieht. Als Modell- und Experimentalschule sollte sie zum Ausstrahlungspunkt für weitere Schulen im gesamten Bundesgebiet werden.«
Wie erwähnt waren auf der Ernst-Reuter-Schule fast alle Lehrer sehr weit links. Der »rechteste« Lehrer, an den ich mich erinnern kann, gehörte der SPD an. Viele Lehrer waren Mitglied im »Sozialistischen Lehrerbund«. Es gab zwei Lehrer, die mich »entdeckt« hatten und darum wetteiferten, wer mich für seine Gruppe gewinnen könnte. Einer hieß Dieter Kraffert, er war Mitglied der maoistischen KPD/ML. Er hatte gerade ein Haus im Frankfurter Westend besetzt und schrieb in meiner Zeitung einen »Augenzeugenbericht von der Besetzung des Hauses Liebigstraße 20«.
Die andere Lehrerin, die sich bemühte, mich zu »agitieren«, war Mitglied der »Roten Panther« und Freundin des ehemaligen SDS-Chefs Karl Dietrich »KD« Wolff. Sie brachte mir die Publikationen des März-Verlages sowie des Rote-Stern-Verlages mit. Diese Verlage gaben einerseits Schriften der amerikanischen Black-Panther-Bewegung heraus, andererseits die Aufsätze und Reden des nordkoreanischen Diktators Kim Il Sung. Der Freund der Lehrerin hatte 1970 Nordkorea besucht und war begeistert zurückgekehrt.
Ich schloss mich zunächst keiner dieser Gruppen an, sondern gründete meinen eigenen Verein, die »Rote Zelle Ernst-Reuter-Schule«. Das erste Treffen der Roten Zelle fand am 4. Dezember 1970 statt – ich war ein halbes Jahr zuvor 13 Jahre alt geworden. Auf die Idee war ich gekommen, als ich eine Folge des konservativen »ZDF-Magazins« sah. Dieses Magazin wurde von 1969 an von einem glühenden Antikommunisten moderiert, Gerhard Löwenthal. Damals war er für uns das Feindbild. Mitte der 90er-Jahre sollte ich ihn persönlich kennen- und schätzen lernen, weil er einer der wenigen war, die nicht nur über die Unterdrückung im fernen Chile oder Südafrika berichteten, sondern auch über das Unrecht in der DDR.
Löwenthal hatte sich in einer seiner straff konservativen Sendungen heftig darüber erregt, dass sich überall an den Universitäten Rote Zellen gebildet hatten. Das gefiel mir. Rote Zelle. Das war offenbar etwas, worüber sich die Konservativen so richtig aufregten. »Wenn der Feind uns bekämpft, dann ist das gut und nicht schlecht«, war eines meiner Lieblingszitate aus der sogenannten Mao-Bibel – einem kleinen roten Büchlein mit den »Worten des Vorsitzenden Mao Tse-tung«.
Löwenthals Sendung war für mich der Auslöser, selbst eine Rote Zelle an meiner Schule zu gründen. Ich überzeugte Mitschüler, mitzumachen. Wir trafen uns jede Woche, und ich gab Schulungen über die Schriften von Mao. Ich wurde zum Sprecher der Sekundarstufe 1 gewählt – das waren alle Schüler bis zur 9. Klasse.
Mit meiner Roten Zelle stand ich in der gewählten Schülervertretung (SV) gegen die Anhänger der SDAJ, die Jugendorganisation der Moskau-treuen DKP. Wir schrieben allerdings D»K«P und »S«DAJ konsequent mit Anführungszeichen, weil diese aus unserer Sicht den Kommunismus längst verraten hatten. So wie Axel Springer in seinen Zeitungen »DDR« in Anführungszeichen setzte, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass sie nicht demokratisch war. Einmal war sogar das Fernsehen bei uns in der Schule und interviewte mich über die Rote Zelle – und mir war es am wichtigsten, in dem kurzen Interview gegen die SDAJ zu wettern, gegen die ich Artikel in meiner Zeitung schrieb. So berichtete ich empört, dass die SDAJ-Schülergruppe einen Genossen rausgeworfen habe, nur weil er das DDR-System kritisierte.
Unsere Zeitung benannte ich um in »Rotes Banner«, sie war nun das »Organ der Roten Zelle Ernst-Reuter-Schule«. Einmal half uns ein sympathisierender Lehrer, der nachts heimlich in der Schuldruckerei unsere Zeitung druckte. Ansonsten finanzierte ich die Zeitung und die Rote Zelle durch die Anzeigen der linksextremen Buchläden. Andere Anzeigen, wie etwa die Werbung für eine Fahrschule in der Ausgabe 4/71, bekamen wir nur noch selten. Eine neue Methode der Finanzierung, die ich mir ausgedacht hatte, war der Verkauf von Broschüren, Büchern und Postern aus China.
Dazu muss man wissen: Es gab in Peking einen »Verlag für fremdsprachige Literatur«. Da erschien beispielsweise die »Peking Rundschau« in deutscher Sprache, die ich jede Woche las. Zudem druckten die Chinesen Bücher von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Tse-tung in deutscher Sprache. Und sie druckten große farbige Poster dieser »Klassiker des Marxismus/Leninismus«. Ich schrieb im Alter von 14 Jahren einen Brief nach Peking: »Liebe Genossen, seit einiger Zeit beziehe ich die Bücher und Poster aus eurem Verlag. Ich habe eine Bitte: Könnt ihr uns diese Bücher und Poster kostenlos schicken? Ich würde sie gerne an unserer Schule verkaufen, um die revolutionäre Schülerarbeit unserer Roten Zelle zu finanzieren. Mit sozialistischem Gruß. Rainer Zitelmann.« Die Antwort aus Peking war positiv. So hatte ich nach dem Wegfall der alten Anzeigenkunden (wie Neckermann) einen Weg gefunden, die Zeitung und die Aktivitäten der Roten Zelle zu finanzieren.
Was mit den Chinesen geklappt hatte, funktionierte auch mit den Vietnamesen. Ich bestellte Schriften der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams in deutscher Sprache und verkaufte sie über Anzeigen im »Roten Banner«. In einer Anzeige wird beispielsweise »Das Testament des Präsidenten HÔ Chí Minh« für 50 Pfennige angeboten, ebenso eine Schrift über das Massaker von My Lai.
Ich besitze noch einige Ausgaben dieser Zeitung, und darin schrieb ich zum Beispiel über »Umweltverschmutzung«, »Hilfe für Indochina«, »Aktion Widerstand – ein Sammelbecken für Nazis« oder »Angela Davis: neues Opfer der US-Justiz«. Ein wichtiges Thema war der Vietnamkrieg: »Für den Profit der Reichen – geht Nixon über Leichen«, so überschrieb ich einen Artikel. In der gleichen Ausgabe veröffentlichte ich einen sehr kritischen Artikel über den »Sozialismus« in Polen. »Sozialismus« hatte ich in Anführungszeichen gesetzt. Es ging um Arbeiterdemonstrationen in Polen. Die westliche Presse verzerre die Wahrheit, wenn sie behaupte, die Streiks richteten sich gegen den Sozialismus, denn den hätten die Regierenden in Polen längst verraten.
Daneben gab es Artikel, die sich sehr kritisch mit einzelnen Lehrern auseinandersetzten. Ich griff Lehrer scharf namentlich an, was für einiges Aufsehen sorgte. So hieß es in einem Artikel über »Die Methoden von H. Murmann« (Name geändert, R.Z.): »Er stellt Schüler in die Ecke, zieht sie an den Haaren, stößt ihre Köpfe aneinander, greift Schüler persönlich an und duldet keine Verteidigung.«
Als meine Eltern von Frankfurt nach Messel umzogen (ein Dorf in der Nähe von Darmstadt), gründete ich an der Schule gleich eine Niederlassung der Roten Zelle. Da war das Klima ein ganz anderes als an der Ernst-Reuter-Schule. In der Nr. 3/71 berichtete ich: »An der Georg-Büchner-Schule in Darmstadt darf das Rote Banner nicht mehr verkauft werden! Einige Schüler der Georg-Büchner-Schule hatten dort auf dem Schulgelände das Rote Banner verkauft. Die Verkäufer fanden die begeisterte Zustimmung der Schüler für unsere Zeitung: Innerhalb von 10 Minuten wurden über 30 Exemplare verkauft. Doch dann mussten wir aufhören. Eine Lehrerin erschien und beschlagnahmte ca. 15 Exemplare des Roten Banners und teilte uns mit, wir dürften diese Zeitung nicht mehr auf dem Schulgelände verkaufen … Dieses Verbot wurde später auch noch offiziell vom Direktor, Herrn Born bestätigt.«
Der Direktor meinte, wir würden die Ordnung der Schule gefährden, das könne er nicht dulden. Dazu schrieb ich in dem Artikel: »Wir gefährden also die Ordnung an der Schule. Das geben wir zu! Wir sind gegen die herrschende Ordnung, die uns Schülern fast keine und den Lehrern fast alle Rechte gibt. Vorerst werden wir unsere Zeitung vor dem Schulgelände verkaufen.« Auch das half nichts. Kurz darauf hatte ich einen Termin bei dem Direktor, der mir rundheraus erklärte, entweder würde ich die Schule freiwillig verlassen, oder er werde dafür sorgen, dass ich von der Schule verwiesen werde. Ich ging.
Die nächste Schule, in der ich mich anmeldete, war das Victoria-Gymnasium in Darmstadt. Sofort gründete ich dort eine Rote Zelle. Ich habe noch die erste Ausgabe der »Roten Schülerpresse 1/72«, in der ich schrieb: »Am 9.11.72 hat sich an der Vico die Rote Zelle konstituiert.« Deren wichtigste Aufgabe sei der »Kampf gegen die bürgerliche Ideologie, wie sie täglich an den Schulen verbreitet wird«. Verantwortlich zeichnete ich allerdings nicht mehr selbst. Ich glaube nicht, dass mehr als eine Ausgabe dieser Zeitung erschienen ist. Denn ich hatte mich inzwischen entschieden, diese Aktivitäten einzustellen und mich einer der maoistischen Gruppen anzuschließen, die damals in Deutschland sehr aktiv waren.
Kapitel 2:
Mao, Marx und Reich
Nachdem sich die 68er-Studentenbewegung zerstreut hatte, entstanden aus ihr zahlreiche linksradikale Gruppen, die alle gegen »Kapitalismus und Imperialismus« waren, sich untereinander jedoch aufs Schärfste bekämpften. Da gab es die Trotzkisten, die sich auf den russischen Revolutionär Leo Trotzki beriefen, da gab es sogenannte »Spontis« (einer von ihnen war der spätere Außenminister Joschka Fischer) und da gab es die Maoisten, die sich selbst »ML-Bewegung« (ML stand für Marxisten-Leninisten) nannten oder als K-Gruppen bezeichnet werden.
Viele spätere Politiker der Grünen gehörten diesen K-Gruppen an – so beispielsweise der spätere Umweltminister Jürgen Trittin, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Antje Vollmer. Auch bekannte konservativ-liberale Journalisten wie der frühere »Handelsblatt«-Chefredakteur Bernd Ziesemer oder Alan Posener (»Die Welt«) waren in ihrer Jugend in K-Gruppen aktiv.
1971 zählte das Bundesinnenministerium 250 linksextreme Organisationen mit 84.300 Mitgliedern. Diese Gruppen gaben 420 Publikationen mit einer Gesamtauflage in Millionenhöhe heraus. Gerd Koenen schreibt in seinem Buch »Das rote Jahrzehnt«, der organisierte Linksextremismus der 70er-Jahre werde heute erheblich unterschätzt und habe einen weitaus bedeutenderen Umfang gehabt als die 68er-Bewegung. Während das Kernpotenzial der 68er-Revolte bei maximal 20.000 Aktiven gelegen habe, seien in den 70er-Jahren 80.000 bis 100.000 Personen in den diversen linksrevolutionären und kommunistischen Gruppen organisiert gewesen.
Eine dieser Gruppen war die KPD/ML. Davon gab es sogar gleich mehrere. Ende 1968 in Hamburg gegründet, spaltete sie sich mehrfach. Da die Parteien den gleichen Namen trugen, wurden zur Unterscheidung in Klammern oft die Zeitungen hinzugefügt, die sie herausgaben. Die beiden »größten« Parteien waren die KPD/ML (Roter Morgen) – die angeblich in Frankfurt sogar mehr Mitglieder hatte als die FDP – und die KPD/ML (Rote Fahne).
Bei der KPD/ML (Rote Fahne) war Dieter Kraffert engagiert, einer meiner Lehrer von der Ernst-Reuter-Schule. Bevor ich nach Darmstadt zog, gab er mir einen Zettel mit einer Adresse der Partei in Darmstadt. Da sollte ich mich melden. Ich trat mit 14 Jahren dem Jugendverband der Partei bei, dem KJVD (Kommunistischer Jugendverband Deutschlands). Richtiges Mitglied konnte man da allerdings nur schwer werden, wenn man zur »falschen Klasse« gehörte. Das heißt: Wer Arbeiter war, wurde leicht aufgenommen, »kleinbürgerliche Intellektuelle« wie ich (die allerdings die Mehrheit stellten) hatten es schwerer. Wir waren formal nur Sympathisanten, auch wenn wir jeden Tag für die Organisation tätig waren und Funktionen innehatten. Mich dieser Gruppe anzuschließen, war mit mehreren Opfern verbunden. Das erste Opfer waren meine langen Haare. Lange Haare wurden nicht geduldet. Die seien ein Zeichen kleinbürgerlicher Dekadenz. In der Partei der Arbeiterklasse musste der Haarschnitt »proletarisch« sein, also kurz. Wollte ich dazugehören, dann blieb mir nichts anderes übrig, als zuerst einmal den schweren Gang zum Friseur zu gehen.
Das Zweite, was ich opfern musste, war die Rote Zelle. Die Genossen der KPD/ML erklärten mir, es sei halt nun einmal in der derzeitigen Phase der Revolutionsvorbereitung nicht wichtig, »kleinbürgerliche Intellektuelle« zu gewinnen, wie sie an Gymnasien anzutreffen seien. Vielmehr müsse man das Proletariat, also die Arbeiter überzeugen (wir nannten das damals: »agitieren«). Viele Arbeiter gab es zwar nicht in der Partei, aber genau dies sollte geändert werden. Schließlich kämpften wir im Sinne von Marx, Lenin und Stalin für die »Diktatur des Proletariats«.
Für mich hieß das konkret: keine Rote Zelle mehr, sondern morgens in aller Frühe aufstehen und vor Beginn der Schule an den Fabriktoren die »Rote Fahne« und den »Kampf der Arbeiterjugend« verkaufen. »Kampf der Arbeiterjugend« hieß die Zeitung unserer Jugendorganisation. In Darmstadt war der Hauptsitz der großen Pharmafirma Merck. Und so fand ich mich als 14-Jähriger vor den Betriebstoren von Merck, verteilte dort unsere Betriebszeitung (»Der rote Merckarbeiter«) und verkaufte die »Rote Fahne«. Ziel war es, Adressen von Arbeitern einzusammeln, die man für die Betriebszelle gewinnen sollte.
Weil ich gut formulieren konnte, verfasste ich jetzt regelmäßig Flugblätter für den KJVD, in denen ich aus unserer Sicht politische Ereignisse kommentierte. Ich besitze beispielsweise noch ein Flugblatt, in dem ich ausführlich den Ausgang der Bundestagswahl 1972 analysierte. Sarkastisch endete das Flugblatt: »Das einzig Begrüßenswerte finden wir, dass beide große Parteien vor der Wahl erklärten, sie würden Steuererhöhungen durchführen: Hut ab vor dieser Offenheit.«
Für einen Jugendlichen von 14 oder 15 Jahren war das alles recht aufregend. Wir trafen uns nachts, um Parolen wie »Weg mit dem KPD-Verbot!« an Hauswände und Fabriktore zu sprühen. Einmal lief ich vor der Polizei davon, rannte gegen eine Parkbank und musste ins Krankenhaus, um mir mein Knie punktieren zu lassen. In der Nacht verbuddelten wir Parteiunterlagen im Wald, weil wir befürchteten, man werde unsere Partei verbieten. Bei den Sitzungen sprachen wir uns aus konspirativen Gründen nicht mit unseren wirklichen Namen an. Wir befürchteten immer, der Verfassungsschutz könnte uns abhören. Ich glaube, mein Tarnname war Dieter. Fast jeden Abend hatten wir Sitzungen, vor allem Schulungen. Wer sich einer dieser Gruppen verschrieben hatte, der fand eigentlich für nichts anderes mehr Zeit. Entsprechend vernachlässigte ich die Schule.
Immer wieder gingen wir auf Demonstrationen, bundesweit. Disziplin war dabei in jeder Hinsicht großgeschrieben. Die Maoisten erkannte man daran, dass sie – ganz anders als etwa die linken Sponti-Demonstranten – nicht nur alle kurze Haare hatten, sondern diszipliniert in Reihen mit einer bestimmten Anzahl von Demonstranten marschierten. Dabei sangen wir kommunistische Kampflieder (die ich heute noch auswendig kann) und skandierten Parolen wie etwa: »Wir werden kämpfen, wir werden siegen, der Kapitalismus muss unterliegen.« Ich habe gehört, bei der Demonstration einer K-Gruppe hätten sich die Studenten alle »Blaumänner« angezogen, damit man sie für echte Proletarier halte. Da die jedoch alle neu waren, wirkte das eher lächerlich und trug bestimmt nicht dazu bei, Arbeiter für die revolutionäre Sache zu gewinnen.
Meine Eltern waren entsetzt, als ich im August 1972 an einer Demonstration der KPD/ML bei den Olympischen Spielen in München teilnehmen wollte. Sie verboten mir das, aber ich verließ nachts heimlich das Haus und fuhr mit meinen Genossen nach München. Unter der Parole »Straße frei für die Kommunistische Partei« versuchten einige der Demonstranten gewaltsam die Bannmeile zu durchbrechen. Glücklicherweise musste ich da nicht mitmachen; das war einigen Genossen vorbehalten, die Schutzkleidung und Helme trugen. Ja, ich kam damals viel herum als Demonstrationsreisender.
In der Freizeit arbeitete ich unbezahlt in der Druckerei unserer Partei in Darmstadt. Dort wurden die »Rote Fahne« und der »Kampf der Arbeiterjugend« gedruckt, aber auch all die anderen Publikationen, die ich jeden Tag las. Da gab es etwa den »Kommunistischen Nachrichtendienst«, der mehrfach in der Woche erschien und die Weltereignisse aus Sicht der maoistischen Ideologie interpretierte. Es gab ein theoretisches Organ, »Der Bolschewik«, daneben den »Jungen Bolschewik« und vieles andere mehr. Wir druckten beispielsweise die 13 Bände der Gesammelten Werke von Josef W. Stalin nach, die in den 50er-Jahren in der DDR erschienen waren. Es war das erste Mal im Leben, dass ich arbeitete – aber kostenlos, für die Partei. Wir gingen Blut spenden oder verkauften Sachen auf dem Flohmarkt, um Geld für die revolutionäre Sache, also für unsere Partei, einzunehmen. Manche Genossen gingen in den Ferien sogar nach Albanien, um dort zu arbeiten und beim Aufbau des Sozialismus zu helfen. Den Frauen wurde vorher erklärt, sie dürften auf keinen Fall Röcke tragen, weil sich das im sozialistischen Albanien nicht gehörte.
Ich war in den Ferien in einem Jugendlager des KJVD. Da wurden wir zwei Wochen lang geschult, lasen gemeinsam die Schriften von Marx, Engels, Stalin und Mao. Zum Teil spielten sich absurde Szenen ab. Wir schliefen alle in einem Saal, und einer hörte nachts noch Beethoven, was einen anderen störte, der schlafen wollte. Der Beethoven-Hörer hatte irgendein Lenin-Zitat über Beethoven parat. Darauf erwiderte der andere mit einem Zitat des bulgarischen Kommunistenführers Georgi Dimitroff, dass man sich die Zeit richtig einteilen sollte. Schließlich flog statt einem Argument einer der dicken braunen Lenin-Bände durch die Luft.
Eines Abends hatten wir alle zu viel getrunken. Prompt fingen wir an, Witze über unsere eigene Parteizeitung zu machen. Dort waren Arbeiter mit schwieligen (und viel zu großen) Fäusten oder bedrohlichen Hämmern in der Hand abgebildet, mit entschlossenem, revolutionärem Blick. Oft waren die Fäuste größer als der Kopf, worüber wir uns nach ein paar Bieren lustig machten. Die Zeichnungen stammten, wie vieles in unserer Partei, aus der von uns bewunderten stalinistischen KPD der 20er-Jahre. Wir machten Witze darüber, weil diese Abbildungen so gar nicht in unsere Zeit passten und recht kurios wirkten.
Am nächsten Tag gab es eine sehr ernste Besprechung. Es war eigens jemand vom Zentralbüro unserer Partei angereist, um nach dem Rechten zu sehen. Er habe gehört, einige Genossen seien offenbar »ideologisch nicht richtig gefestigt« und hätten »kleinbürgerlich-intellektualistische Standpunkte« vertreten. Unseren Hinweis, dass wir erstens besoffen waren und es zweitens nur um diese Zeichnungen gegangen sei, ließ der Führungsgenosse nicht gelten. Er belehrte uns, was wir da kritisiert hätten, sei nichts anderes als der »proletarische Pinselstrich«. Das habe ich mir gemerkt.
An einem Nachmittag ging ich mit einem älteren Genossen spazieren. Ich bemerkte, es sei doch eigentlich traurig, dass wir hier im Kapitalismus geboren wären und nicht etwa im sozialistischen China und Albanien. Mein Genosse meinte darauf: »Wenn du im Sozialismus geboren wärst, dann wärst du bestimmt für den Kapitalismus.« Er hatte gespürt, dass ich zu den Menschen gehöre, die immer gegen den Strom schwimmen.
Meine Bemerkung über China und Albanien mutet aus heutiger Sicht absurd an: Wie konnte sich ein intelligenter, junger Mensch wünschen, in einer Diktatur in ärmlichen Lebensverhältnissen aufzuwachsen statt in einem freien Land mit einem hohen Lebensstandard? Wahrscheinlich waren China und Albanien einfach nur Projektionsflächen für unsere idealistischen Utopien von einer vermeintlich besseren Welt. Eigentlich wussten wir nicht so viel über China und Albanien, sondern nur das, was wir in der »Peking Rundschau« oder in der Zeitschrift »China im Bild« lasen. Oder das, was wir in »Radio Tirana« hörten.
Ich weiß noch genau, wie ich nachts um 23 Uhr diesen Radiosender hörte, der in 23 Sprachen seine revolutionären Botschaften verbreitete. Die Sendung begann mit der kommunistischen Fanfare »Die Internationale«, dann meldete sich der Sprecher: »Hier ist Tirana. Hier ist Tirana. Mit einer Sendung in deutscher Sprache«. Es gab regelmäßige Erfolgsberichte, etwa unter der Überschrift »Die marxistisch-leninistische Weltbewegung wächst und erstarkt«.
Unsere Feindbilder waren klar. Eigentlich waren alle unsere Feinde, außer den Chinesen, den Albanern und den Nordkoreanern. Die »US-Imperialisten« und alle kapitalistischen Länder waren sowieso unsere Feinde. Zu den Feinden gehörten auch die Sowjetunion, die kommunistischen Ostblockstaaten und die DDR. Sie hätten, so unsere Überzeugung, die kommunistischen Ideale längst verraten. Absurderweise glaubten wir, zur Zeit von Stalin sei es den Arbeitern in der Sowjetunion besser gegangen. Als nach dessen Tod Nikita Chruschtschow die Entstalinisierung einleitete, sei dies der Beginn der kapitalistischen Entartung gewesen.
Junge Menschen sind oft sehr idealistisch. Es gibt ja den Ausspruch, wer mit 20 kein Sozialist sei, habe kein Herz, und wer mit 30 noch einer sei, keinen Verstand. Aber was bringt junge Menschen, die in Freiheit und Wohlstand aufwachsen, dazu, für die »Diktatur des Proletariats« zu kämpfen? Und was bringt sie dazu, einen Massenmörder wie Stalin zu verherrlichen?
Bei mir persönlich spielte ein gutes Stück pubertärer Rebellion mit. Mein Vater war links. Er hatte mit den 68ern gegen den Vietnamkrieg protestiert. Er war evangelischer Pfarrer und hatte eine »Basisbibel« geschrieben, die die Bibel links auslegte. Um gegen einen solchen Vater zu rebellieren, hätte ich entweder ganz rechts werden müssen, oder … Ja, oder: Ich hängte ein Riesenplakat des Diktators Stalin in meinem Kinderzimmer auf. Darunter stand: »Es lebe die Diktatur des Proletariats!« Das gefiel meinen Eltern ganz und gar nicht.
Aber was wussten die schon? Ich sah mich ihnen – und eigentlich fast allen anderen Mitmenschen – als überlegen an, weil ich all die wichtigen Bücher der Klassiker des Marxismus-Leninismus gelesen hatte. Die anderen, so meine Überzeugung, hatten das »falsche Bewusstsein«, waren von den bürgerlichen Medien hoffnungslos manipuliert. Ich las mehr als die anderen Parteimitglieder. Es gab keine der wichtigen Schriften von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao, die ich nicht intensiv studiert hätte. Ich habe heute noch in einem Ordner die Zusammenfassungen, die ich über Bücher wie »Was tun?« von Lenin oder Friedrich Engels’ »Anti-Dühring« für mich anfertigte. Bald schon galt ich – obwohl erst 15 Jahre alt – als Theoretiker, der bestens Bescheid wusste über Marxismus und Leninismus, politische Ökonomie, dialektischen und historischen Materialismus und überhaupt über die revolutionäre Theorie.
So war ich dafür auserkoren, die Schulungen für Studenten durchzuführen, die in Dieburg (einer Stadt in der Nähe von Darmstadt) auf die Fachhochschule der Post gingen und mit unserer Partei »sympathisierten«. Richtige Mitglieder durften sie ja nicht werden, weil sie eben das Pech hatten, dass sie nicht Arbeiter waren, sondern »kleinbürgerliche Intellektuelle«.
Die Studenten – so zwischen 20 und 30 Jahre alt – wunderten sich, als sie das erste Mal ihren Schulungsleiter sahen, der selbst noch Schüler und erst 15 Jahre alt war. Ich war mächtig stolz, und es gefiel mir, mein Wissen zu demonstrieren. Dieses Wissen führte jedoch dazu, dass ich mehr kritische Fragen in der Partei stellte als die weniger belesenen Genossen. Das wurde nicht gerne gesehen. Man warf mir immer wieder vor, ich habe zwar ein großes theoretisches Wissen, sei aber noch nicht richtig »ideologisch gefestigt«. Ideologisch gefestigt war der, der keine kritischen Fragen stellte.
Ende 1972 geriet die Partei in eine große innere Krise. Ein Zeichen der inneren Auflösung war, dass eine massive parteiinterne Diskussion entbrannte – so etwas hatte es vorher nie gegeben. Ich empfand das als befreiend, weil mir schon länger viele Dinge nicht gefallen hatten. Ich verfasste ein Papier, das am 19. Februar 1973 in einer großen Dokumentation zur »Parteidiskussion« veröffentlicht wurde. Dort schrieb ich: »Man wirkt planlos, ziellos, mit falschen oder überhaupt keinen Theorien über den westdeutschen Imperialismus und falschen Parolen.« Ich kritisierte einen »Dogmatismus, sind wir doch bestrebt, die Erfahrungen der KPen anderer Länder in gewisser Weise schematisch und dogmatisch auf unsere Situation zu übertragen«. Vor allem plädierte ich für mehr theoretische Analysen: »Wer kann z.B. aus dem KJVD Darmstadt die Dollarkrise richtig einschätzen? Außer allgemeiner Phraseologie, dass es im Imperialismus immer wieder zu Krisen kommt …« Das war wohlgemerkt noch keineswegs eine Abwendung von der ML-Ideologie, aber ich hatte zunehmend Zweifel, ob das, was wir taten, wirklich sinnvoll sei.
So ging es vielen in der Partei, und die KPD/ML löste sich bald – wie die meisten anderen ML-Gruppen – in zahlreiche Splittergruppen auf. Ich tat mich mit einigen wenigen Genossen aus Darmstadt zusammen, und wir verfassten im April 1973 ein Papier, in dem wir die Meinung vertraten, bevor wir weiter revolutionär arbeiten, müssten wir stärker an der revolutionären Theorie arbeiten und auf der Basis von Marx die Verhältnisse in der Bundesrepublik besser analysieren, um daraus eine revolutionäre Strategie zu entwickeln.