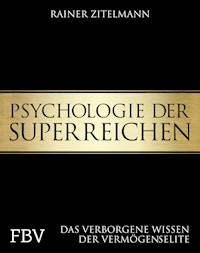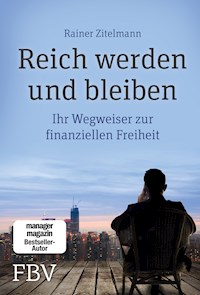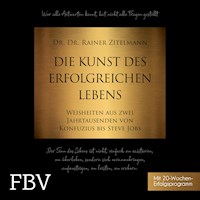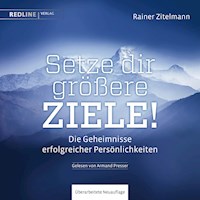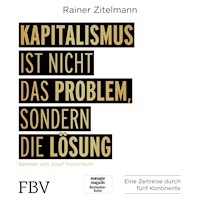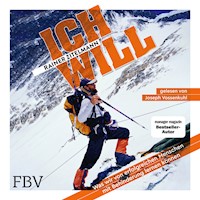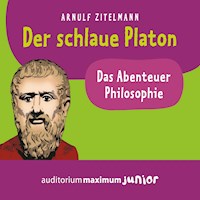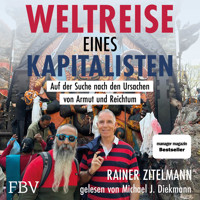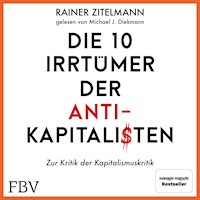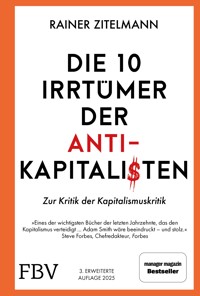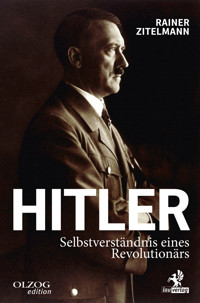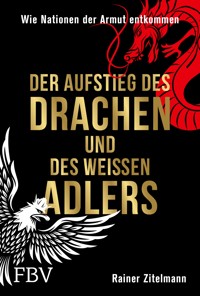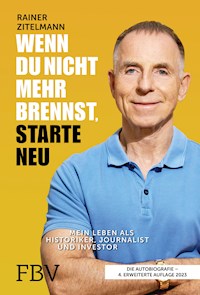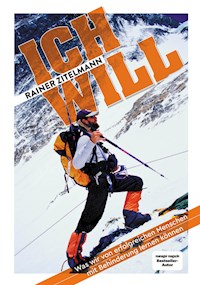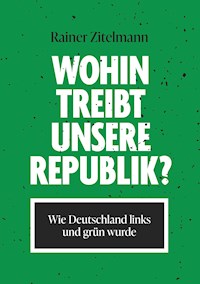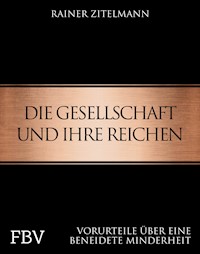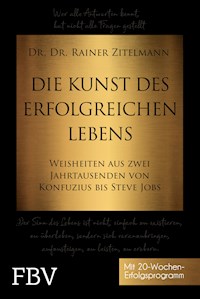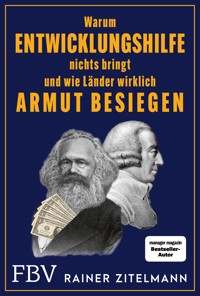
Warum Entwicklungshilfe nichts bringt und wie Länder wirklich Armut besiegen E-Book
Rainer Zitelmann
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dies ist eine aktualisierte und mit neuen Inhalten ergänzte Neuausgabe des Titels "Der Aufstieg des Drachen und des weißen Adlers". Vom Manhattan Institut für den Hayek Book Prize 2025 nominiert Entwicklungshilfe hilft armen Ländern nicht aus der Armut – das belegt der Autor dieses Buches. Was aber hilft Nationen wirklich, der Armut zu entkommen? Die englische und spanische Ausgabe des Buches haben große Beachtung gefunden: »Ein wunderbares Buch, in dem Zitelmann auf großartige Weise erklärt, warum Freiheit der Weg ist, um der Armut zu entkommen. … Ich empfehle die Lektüre dieses Buches unbedingt. Darin finden die Leser Fallstudien, Grafiken und fesselnde Erfahrungsberichte, die auch Laien in Wirtschaftsfragen aufklären.« Manuel Adorni, Ökonom und Sprecher des argentinischen Präsidenten Javier Milei »Der deutsche Sozialwissenschaftler und Unternehmer Rainer Zitelmann beschreibt in seinem Buch, was passiert, wenn arme Nationen mit belastenden Planwirtschaften ihre Pläne über Bord werfen und sich dem Handel öffnen. ... Die jüngere Geschichte sowohl Vietnams als auch Polens lehrt die gleiche Lektion: Ein Land kann Wunder vollbringen, wenn es aufhört, sich in Perfektion verwalten zu wollen und seine Bürger vor Risiken abzuschirmen.« The Wall Street Journal »Dieses Buch bietet eine neue Perspektive darauf, wie die Grundsätze des Kapitalismus in Schwellenländern gesehen werden. Es ist zudem ein aufschlussreicher Einblick in zwei faszinierende Länder, die im 21. Jahrhundert eine bedeutende Rolle spielen werden.« Financial Times »Lesen Sie dieses brillante, äußerst lesenswerte und inspirierende Buch, bevor die Woke-Cancel-Culture davon erfährt! … Dieses Buch könnte in der heutigen unruhigen Welt nicht aktueller sein.« Steve Forbes, Chefredakteur, Forbes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Rainer Zitelmann
Warum
Entwicklungshilfe
nichts bringtund wie Länder wirklich
Armut besiegen
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Zum Zweck der besseren Lesbarkeit und um die Kraft in Chaplins Lebensgeschichte und die Essenz seiner Erfolgsstrategien zu bewahren, wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe, 1. Auflage 2025
© 2025 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Ansgar Graw
Korrektorat: Christoph Roolf
Umschlaggestaltung: Sabrina Pronold
Umschlagabbildung: Shutterstock/Nicku, AdobeStock/Georgios Kollidas, Bernd Leitner
Satz: ZerosofteBook: ePUBoo.com
Dieses Buch wird in Print-on Demand produziert.
ISBN Print 978-3-95972-828-7
ISBN EPub 978-3-98609-608-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort
Lange Zeit war die Entwicklungshilfe kein Thema in der öffentlichen Diskussion in Deutschland. Obwohl jährlich zweistellige Milliardenbeträge für Entwicklungshilfe (heute: »Entwicklungszusammenarbeit« genannt) ausgegeben werden,1 wurde nur selten gefragt, wofür dieses Geld ausgegeben wird und ob die proklamierten Ziele erreicht werden. Die Politiker und die zuständigen staatlichen Stellen konnten das Geld ausgeben, wie sie wollten, weil die Medien und die Opposition nur selten kritische Fragen stellten.
Das hat sich 2022/23 geändert. Politiker von CDU/CSU, FDP und AfD begannen, zumindest einzelne Positionen zu hinterfragen. FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer warf der Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) vor, eine »überdehnte Entwicklungshilfe« zu betreiben. »Alles, was nicht für Deutschlands Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen nützlich ist, hat hintan zu stehen«, so der Politiker. Deutschland fördere zum Beispiel Projekte wie »Kapazitätsaufbau und Gender-Training für zivilgesellschaftliche Basis-Organisationen und Sozialarbeiterstationen in einer Provinz Chinas« und ein »Netzwerk für gendertransformative Bildung« in Afrika. Zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Kamerun durch »gendertransformative Ansätze« seien beispielsweise 21 Millionen Euro bis 2028 verplant. »Bei den Ausgaben müssen wir daher genauer hinschauen und diese auf Effizienz trimmen«, sagte der liberale Politiker.2
Während sich früher Medien kaum dafür interessierten, griff jetzt sogar die »BILD-Zeitung« das Thema auf. Kritisiert wurde etwa, dass mit Steuergeldern die »Förderung der entwicklungspolitischen Bildung« finanziert werde. Rund 43 Millionen Euro wurden 2024 dafür ausgegeben. Dabei würden unter anderem sogenannte »konsumkritische Stadtspaziergänge« von Vereinen gefördert. Anhänger der »Eine-Welt-Gruppe« werben für diese Schulungsmaßnahmen: »Bei den Stadtrundgängen geht es um Globalisierung, nachhaltigen Konsum, Postwachstum und Kapitalismuskritik.«3
Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler kritisierte auf Social Media:
»Konsumkritische Stadtspaziergänge sind geführte Rundgänge durch städtische Gebiete, bei denen die Teilnehmer auf die Auswirkungen und Problematiken des Konsumverhaltens aufmerksam gemacht werden. Dabei wird kritisch hinterfragt, wie Konsum das Stadtbild, die Umwelt und die soziale Struktur beeinflusst. Ziel ist es, das Bewusstsein der Teilnehmer für nachhaltigere und verantwortungsbewusstere Konsumpraktiken zu schärfen. Diese Spaziergänge werden von verschiedenen Organisationen angeboten und durchgeführt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat dafür zwischen den Jahren 2019 und 2023 den Organisationen 37.775 Euro Steuergeld zur Verfügung gestellt. Für 2024 stehen wieder 8.000 Euro zur Verfügung.«4
Ein Sprecher von Entwicklungshilfeministerin Schulze rechtfertigte diese Ausgaben: »Konsumkritische Spaziergänge ermöglichen eine Auseinandersetzung mit dem Thema Fairer Handel in unserem Alltag.« Stadtführer nähmen dabei »Produkte unseres Alltags wie Smartphones, Kaffee oder Elektroartikel genauer unter die Lupe«. Solche Projektförderungen umfassten laut Ministerium in den letzten fünf Jahren insgesamt 4.051.783 Euro. 6.500 meist junge Leute nahmen an den Schulungen organisiert von 18 Eine-Welt-Vereinen teil.5
Freilich sind das kleine Beträge, wenn man sie in Relation setzt zu anderen Ausgaben. Für besondere Aufregung sorgte die Diskussion um die Förderung von Radwegen in Peru. Im Jahr 2020 waren zunächst 20 Millionen Euro für den Ausbau des Radwegenetzes in Lima vorgesehen. Zwei Jahre später, 2022, folgten weitere 24 Millionen Euro für Radwege in anderen Städten Perus. Die Mittel werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verwaltet, die gemeinsam mit der Stadtverwaltung von Lima das Projekt plant und umsetzt.
Ziel sei es, ein Radwegenetz von insgesamt 114 Kilometern Länge zu schaffen, schreibt die »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, die sich im Rahmen einer Reportage vor Ort in Lima ein Bild von den Radwegen machte. Bisher seien allerdings erst 5,5 Kilometer des ehrgeizigen Projekts realisiert worden, heißt es in dem Bericht.
Vor Ort bot sich der FAZ-Autorin folgendes Bild: »Der doppelspurige neue Radweg verläuft auf dem Mittelstreifen zwischen zwei schnurgeraden Schnellstraßen. Breit genug, dass auch zwei Fahrräder aneinander vorbeikommen, eingegrenzt von gelb gestrichenem Kantstein. Ein wunderbarer Fahrradweg – und wir haben ihn für uns allein.« Doch genutzt werde der Fahrradweg kaum, so die Autorin: »Um vier Uhr nachmittags ist kaum ein Radfahrer zu sehen. Dafür ist der Lärm und Gestank der Busse, Autos und Tuk-Tuks umso größer, die rechts und links an uns – in gebührendem Abstand – vorbeirauschen«, schreibt sie.
Jener Radweg in Villa El Salvador, im äußersten Süden Limas, werde längst auch von Fußgängern, Familien mit Kindern oder Hundebesitzern als Spazierweg genutzt. Radfahrer seien in der Minderheit. Viele, die sich vor Ort aufs Rad schwingen, »biken damit am Wochenende in den Bergen. Die brauchen den Radweg eigentlich nicht«, sagt ein Mann, der eine Fahrradwerkstatt betreibt.6
Doch das ist nicht das einzige Projekt, das kritisch gesehen wird. Das von Robert Habeck (Grüne) geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz etwa förderte »grüne Kühlschränke« in Kolumbien mit 4,6 Millionen Euro. Geld fließt auch für erneuerbare Energien in Chile (1,7 Millionen Euro), für emissionsarme Reiserzeugung in Thailand (8,1 Millionen Euro) oder für die energetische Sanierung von Wohngebäuden in der Mongolei (6,2 Millionen Euro).
Deutsche Steuergelder fließen auch in den Aufbau einer modernen Steuerverwaltung in Kamerun (fünf Millionen Euro), in den kommunalen Umweltschutz in Kolumbien (80,5 Millionen Euro) und für den Ausbau von klimafreundlichen ÖPNV-Systemen in Lateinamerika (106,5 Millionen Euro).
Auch die Biodiversität in Paraguay (sechs Millionen Euro) und die Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung in Timbuktu (24,5 Millionen Euro) liegen dem Ministerium sehr am Herzen. Ebenso wie Gender-Trainings in China und ein Projekt zu positiver Maskulinität in Ruanda, wohin ebenfalls deutsche Steuergelder fließen.7
8,5 Millionen Euro will das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für »Grüne Moscheen und Gebäude in Marokko« ausgeben. Moscheen werden mit LED-Beleuchtung und Solarpaneele bestückt. Über 100 Moscheen wurden bereits energetisch modernisiert und in der Stadt Tadmant sogar der Bau einer »Plusenergiemoschee« gefördert. Das Vorhaben, so erklärt das Ministerium, diene auch noch einem anderen Zweck: »Zweitens sensibilisiert das Vorhaben die marokkanische Bevölkerung über die Fortbildung von Multiplikator/innen sowie Imanen und Mourchidas, weiblichen Religionsgelehrten, über Medienkampagnen.«8
Der Tenor der Diskussion ist: Warum werden solche Projekte gefördert, wenn in Deutschland oft für das Nötigste – etwa die Instandhaltung von Schulen und die Bundeswehr – nicht genug Geld vorhanden ist? Diese Fragen sind berechtigt, sie wirken aber für den einen oder anderen auch ein wenig egoistisch. Bringt es nicht mehr, etwas für den Klimaschutz in Peru zu tun, als das Geld in Deutschland auszugeben, lautet die Gegenfrage.
Was weniger gefragt wird: Erreichen diese Ausgaben überhaupt das, was sie erreichen sollen? Kommt das Geld wirklich an? Ist den armen Ländern damit wirklich geholfen? Diese Fragen stelle ich im zweiten Kapitel dieses Buches.
Doch zunächst werde ich mit der Grundfrage beginnen: Was hilft aus ökonomischer Sicht wirklich gegen Armut? Diese Frage war die Leitfrage des schottischen Ökonomen Adam Smith, und seine Antwort erläutere ich im ersten Kapitel.
Ich habe mehrere Bücher über Reichtum geschrieben – warum schreibe ich jetzt ein Buch über Armut und deren Überwindung? Weil ich in meinen Forschungen zu dem vermeintlich paradoxen Ergebnis gekommen bin, dass nur eine Gesellschaft, die Reichtum zulässt und Reichtum positiv sieht, Armut überwinden kann.
Repräsentative Meinungsumfragen, die ich in zahlreichen Ländern habe durchführen lassen, zeigen, dass die Menschen besonders in zwei Ländern Reichtum und Reiche im Vergleich positiver sehen: Polen und Vietnam. Zugleich sind dies auch Länder, in denen die Menschen – trotz der unterschiedlichen politischen Systeme – den Begriff »Kapitalismus« sehr viel positiver beurteilen als ihre Zeitgenossen in den meisten anderen Ländern.
Und es sind zwei Länder, die in den vergangenen Jahrzehnten außerordentlich stark an wirtschaftlicher Freiheit gewonnen haben. Die amerikanische Heritage-Foundation erstellt seit 1995 ein Ranking der wirtschaftlichen Freiheit – man kann es auch Kapitalismus-Skala nennen –, und in keinem Land vergleichbarer Größe nahm die wirtschaftliche Freiheit in diesem Zeitraum so sehr zu wie in Polen und Vietnam.
Diese beiden Länder sind besonders beeindruckende Fallbeispiele dafür, wie Armut überwunden werden kann. Deshalb wird ihre Geschichte in diesem Buch ausführlich geschildert.
Beide Länder waren der Schauplatz schrecklicher Kriege, in denen Abermillionen Menschen ihr Leben ließen – der Zweite Weltkrieg in Polen und der Indochinakrieg in Vietnam. Nach den Kriegen wurden in beiden Ländern sozialistische Planwirtschaften errichtet, die das zerstörten, was der Krieg noch nicht zerstört hatte. Vietnam war das ärmste Land der Welt und Polen eines der ärmsten Länder Europas. Ich schildere in diesem Buch das Leben in diesen Ländern in den Zeiten der Planwirtschaft, und Sie werden sehen, wie bitterarm die Mehrheit der Menschen dort war.
Die Vietnamesen begannen 1986 mit marktwirtschaftlichen Reformen, die man Doi-Moi-Reformen nennt. Wenige Jahre später entschloss sich auch Polen zu marktwirtschaftlichen Reformen. In beiden Ländern führten diese Reformen zu einem bemerkenswerten Wirtschaftswachstum und einer dramatischen Verbesserung des Lebensstandards. Ich werde dies mit Zahlen und Statistiken zeigen sowie anhand von Lebensberichten der Menschen in diesen Ländern.
Dieses Buch erschien zuerst 2023 unter dem Titel »Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers«. Bei der Wahl des Titels hatte ich einen Fehler gemacht, denn kaum ein Leser in Deutschland wusste, was mit dem »Drachen« gemeint ist (nämlich Vietnam, viele dachten aber an China), und erst recht nicht, was mit dem »weißen Adler« gemeint war, nämlich Polen. In den USA erschien das Buch dann unter dem Titel »How Nations Escape Poverty«, und auch für die spanische und die portugiesische Ausgabe wurden andere Titel gewählt. Für die argentinische Ausgabe konnte ich übrigens Manuel Adorni, den Ökonomen und Regierungssprecher von Javier Milei, gewinnen, der das Vorwort geschrieben hat: Besonders das Beispiel Polen, so Mileis Sprecher, zeige, dass eine »kapitalistische Schocktherapie« einem Land aus Inflation, Überschuldung und Armut helfen könne. Das Buch hat deshalb für großes Interesse in Argentinien gesorgt, und ich gab führenden Medien, wie etwa »La Nacion«, Interviews dazu9 und hielt 2024 Vorträge in mehreren Städten Argentiniens.
Ich habe mich dazu entschlossen, das Buch, ergänzt durch dieses Vorwort sowie durch das Kapitel über Adam Smith, mit einem neuen Titel herauszugeben.
Ich danke meinen Freunden in Polen und Vietnam, die mir bei diesem Buch geholfen haben. Lê Chi Mai aus Hanoi hat für mich Übersetzungen und Interviews gemacht, und ich danke Nguyễn Quốc Minh Quang, VũĐình Lộc, Nguyễn Trọng Hòa, Lâm Đức Hùng und Nguyễn Thị Quất für diese Interviews. Dem Rechtsanwalt Dr. Oliver Massmann, der seit 25 Jahren in Hanoi tätig ist und maßgeblich an der Formulierung des Freihandelsabkommens zwischen den USA und Vietnam beteiligt war, danke ich für seine Informationen. Đinh Tuấn Minh, Vertreter eines liberalen Thinktanks, hat mir bei einem Gespräch in Hanoi manche wichtigen Zusammenhänge erklärt.
Besonders danke ich Professor Andreas Stoffers, dem damaligen Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Vietnam, der zahlreiche Kontakte für mich hergestellt hat.
In Polen haben mir mein Verleger Krzysztof Zuber (Wydawnictwo Freedom Publishing) und mein Berater Marcin Chmielowski geholfen – Danke dafür! Zu danken habe ich auch dem ehemaligen Finanzminister von Polen, Professor Leszek Balcerowicz, dessen Reformen ein wesentlicher Grund für Polens wirtschaftliche Gesundung und Aufstieg waren. Danken möchte ich zudem Marcin Zieliński (Forum Obywatelskiego Rozwoju) und Marek Tatała (Fundacja Wolności Gospodarczej), Mateusz Machaj (Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa) sowie Alicja Wancerz-Gluza (Mitbegründerin des Karta-Zentrums) und Tomasz Agencki, mit dem ich den Film »Poland – from Socialism to Prosperity« produziert habe, den Sie auf Youtube sehen können.
Mein Dank gilt auch meinen Freunden Dr. Christian Hiller von Gaertringen und Dr. Gerd Kommer, die das Buch kritisch gelesen haben, Ansgar Graw, der es hervorragend lektoriert, und Sebastian Taylor, der es ins Englische übersetzt hat.
Ich bewundere die Menschen in Polen und Vietnam, und mich verbindet mit ihnen auch etwas sehr Persönliches: Denn die beiden längsten und wichtigsten Beziehungen in meinem Leben hatte ich mit Monika, deren Eltern aus Polen kamen, und Trang, deren Eltern aus Vietnam stammen.
Rainer Zitelmann, im Dezember 2024
1. Adam Smith hatte recht: Nur wirtschaftliche Freiheit kann Armut beseitigen
Über den Menschen Adam Smith wissen wir nur sehr wenig. Wir kennen nicht einmal den Geburtstag des Schotten, sondern nur seinen Tauftag. Er wurde am 5. Juni (Julianischer Kalender) getauft – nach unserem Gregorianischen Kalender ist sein Tauftag also der 16. Juni. Seinen Vater, ein Zollrevisor, hat er nie kennengelernt, denn er starb wenige Monate vor seiner Geburt im Alter von 44 Jahren.
Die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben war seine Mutter, die ihn nicht nur aufzog, sondern mit der er bis zu ihrem Tode im Jahre 1784 zusammenlebte. Geheiratet hat Smith nie. Wir wissen nur, dass er sich zwei Mal verliebt hatte, aber seine Gefühle nicht erwidert wurden,1 was vielleicht auch damit zusammenhing, dass sein Äußeres als ziemlich unattraktiv empfunden wurde. Im Alter von 17 Jahren begann er ein sechsjähriges Studium in Oxford, doch von der Universität hielt er nicht viel. Über die Professoren, die er für faul hielt, äußerte er sich später nur abschätzig. Noch vor seinem 30. Lebensjahr wurde er zum Professor für Moralphilosophie an der Universität Glasgow berufen und veröffentlichte sein erstes großes Werk, die »Theorie der ethischen Gefühle«. Er sollte in seinem ganzen Leben nur zwei große Werke veröffentlichen, wobei das 1776 veröffentlichte Werk »Wohlstand der Nationen« das weitaus bekanntere ist. Er hat noch mehr Bücher geschrieben, aber die Manuskripte hat er vor seinem Tod verbrennen lassen, so dass wir nur diese beiden Bücher und einige Aufsätze oder Niederschriften von Vorlesungen von ihm haben.
Für Menschen, die die Bücher von Smith nie gelesen haben, gilt er manchmal als Vertreter eines extremen Egoismus, ja, vielleicht sogar als geistiger Vater eines Gordon Gekko, der in dem Film »Wallstreet« ausruft: »Greed is good!« Das ist jedoch ein Zerrbild, das daher rührt, dass Smith in seinem Buch »Wohlstand der Nationen« stark das Eigeninteresse der Wirtschaftssubjekte betonte. Doch dieses Bild ist mit Sicherheit schief.
Das erste Kapitel seines Buches »Theorie der ethischen Gefühle« beginnt mit dem Abschnitt »Von der Sympathie«, wobei er diese definierte als »Mitgefühl mit jeder Art von Affekten«.2 Heute würden wir wohl von »Empathie« sprechen: »Man mag den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein. Ein Prinzip dieser Art ist das Erbarmen oder Mitleid, das Gefühl, das wir für das Elend anderer empfinden, sobald wir dieses entweder selbst sehen, oder sobald es uns so lebhaft geschildert wird, dass wir es nachfühlen können.«3
Das Mitgefühl von Smith galt vor allem den Armen. Smith bezog Einkünfte aus verschiedenen Quellen, die sich auf 900 Pfund im Jahr summierten, was dem drei- bis vierfachen Gehalt eines Universitätsprofessors entsprach.4 Aber als das Testament von Adam Smith verlesen wurde, war sein Neffe David Douglas enttäuscht. Er erhielt viel weniger als erhofft, denn was Smiths Freunde bereits lange vermutet hatten, war nun Gewissheit: Smith hatte fast sein gesamtes Vermögen Armen geschenkt, meist heimlich. Smith war so großzügig gewesen, dass er sogar selbst einmal in Geldnöte geraten war.5
Liest man seine beiden Hauptwerke, »The Wealth of Nations« und die »Theory of Moral Sentiment«, wird man kaum eine Stelle finden, wo er sich positiv über die Reichen und Mächtigen äußert. Kaufleute, Unternehmer und Landbesitzer werden fast ausschließlich in negativem Kontext genannt, vor allem als Menschen, die ihre Sonderinteressen durchsetzen wollen und nach Monopolen streben.
»Unsere Kaufleute und Unternehmer klagen zwar über die schlimmen Folgen höherer Löhne, da sie zu einer Preissteigerung führen, wodurch ihr Absatz im In- und Ausland zurückgehe, doch verlieren sie kein Wort über die schädlichen Auswirkungen ihrer hohen Gewinne. Sie schweigen einfach über die verwerflichen Folgen der eigenen Vorteile und klagen immer nur über die anderen Leute.«6 Oder: »Geschäftsleute des gleichen Gewerbes kommen selten, selbst zu Festen und zur Zerstreuung, zusammen, ohne dass das Gespräch in einer Verschwörung gegen die Öffentlichkeit endet oder irgendein Plan ausgeheckt wird, wie man die Preise erhöhen kann.«7
Im »Kommunistischen Manifest« von Marx und Engels finden sich positivere Sätze über Kapitalisten als an irgendeiner Stelle in den Werken von Adam Smith. Die Bourgeoisie habe massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen, so schreiben sie voll Bewunderung.
Von dieser Bewunderung ist bei Smith nichts zu spüren, stattdessen sind die Reichen Zielscheibe ätzender Kritik. Verteidiger von Smith argumentieren, darin spiegele sich kein Ressentiment gegen Unternehmer oder Reiche wider, sondern Smiths Eintreten für freien Wettbewerb und gegen Monopole. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber dennoch hat man bei der Lektüre seiner beiden Hauptwerke den Eindruck: Im Grunde mag Smith die Reichen so wenig wie die Politiker. Auch Adam Smith war nicht frei von dem Ressentiment, das Intellektuelle und Bildungsbürger traditionell gegen Reiche hegen.8
Umgekehrt gibt es jedoch sehr viele Passagen, die Anteilnahme für das Schicksal der Armen zeigen. Wobei er mit »poor« nicht nur die Armen im engeren Sinne des Wortes meinte, sondern etwas wie »not rich«, d.h. »die Situation der großen Mehrheit der Bevölkerung, die Arbeit gegen Lohn eintauschen muss, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen«.9 Glory M. Liu konstatiert in ihrem Buch »Adam Smith’s America«, in der sie die Rezeption von Adam Smith und den Stand der Forschung zusammenfasst: »Es besteht fast einhellige Übereinstimmung darüber, dass für Smith das wichtigste Merkmal der Handelsgesellschaft darin bestand, dass sie die Lage der Armen verbesserte.«10
Berühmt ist die Stelle aus dem »Wohlstand der Nationen«. »Und ganz sicher kann keine Nation blühen und gedeihen, deren Bevölkerung weithin in Armut und Elend lebt. Es ist zudem nicht mehr als recht und billig, wenn diejenigen, die alle ernähren, kleiden und mit Wohnung versorgen, soviel vom Ertrag der eigenen Arbeit bekommen sollen, dass sie sich selbst richtig ernähren, ordentlich kleiden und anständig wohnen können.«11
Diese Worte werden heute manchmal fehlinterpretiert, so als ob Smith damit für eine staatliche Umverteilung plädieren wollte. Das war nicht sein Anliegen, und erst recht wollte er nicht zu einer sozialen Revolution aufrufen. Aber Armut war nach Smith nichts von Gott Gegebenes. Vor allem vertraute er nicht dem Staat. In dem achten Kapitel seines Hauptwerkes, in dem sich die oben zitierten Sätze befinden, weist er darauf hin, dass nur eine wachsende Wirtschaft zu steigendem Lebensstandard führen könne.
Kontinuierliches Wirtschaftswachstum sei der einzige Weg zu steigenden Löhnen – eine stagnierende Wirtschaft führe zu sinkenden Löhnen. An einer anderen Stelle schreibt er, dass Hungersnöte auf nichts anderes zurückgingen »als allein auf den Versuch der Regierung, mit Gewalt und ungeeigneten Mitteln die Unannehmlichkeiten einer Teuerung zu beseitigen«.12 Wie recht er behielt, wissen wir 250 Jahre später, nachdem Hunderte, wenn nicht Tausende Versuche, der Inflation mit Preiskontrollen Herr zu werden, gescheitert sind.
Smith schrieb, eine »großzügige Entlohnung« sei »die Folge des zunehmenden Wohlstandes«, und betonte immer wieder, »dass das Los der ärmeren Arbeiter und damit der Masse der Bevölkerung offenbar dann am leichtesten und besten ist, wenn die Gesellschaft auf dem Weg zu weiterem Wohlstand ist … Ihr Los ist hart in einer stationären und erbärmlich in einer schrumpfenden Wirtschaft.«13
Karl Marx glaubte dagegen, verschiedene ökonomische Gesetze entdeckt zu haben, die notwendigerweise zum Untergang des Kapitalismus führen würden, so etwa den »tendenziellen Fall der Profitrate« oder die Verelendung des Proletariats. In seinem Hauptwerk »Das Kapital«, das 91 Jahre nach dem Werk von Smith erschien, formulierte Marx dies so:
»Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt … Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation.«14
Als »The Wealth of Nations« 1776 erschien, war der Kapitalismus noch in seinen Anfängen und der überwältigende Teil der Menschen lebte in extremer Armut. Und Armut bedeutete damals noch etwas ganz anderes als heute. Die Menschen damals waren mager und kleinwüchsig – die gesamte Geschichte hindurch hat sich der menschliche Körper an unzureichende Kalorienzufuhr angepasst. »Die kleinwüchsigen Arbeiter des 18. Jahrhunderts«, so schreibt Angus Deaton in seinem Buch »Der große Aufbruch«, »waren faktisch in einer Ernährungsfalle gefangen. Sie konnten nicht viel verdienen, weil sie körperlich so schwach waren, und sie konnten nicht genug essen, weil sie ohne Arbeit nicht das Geld hatten, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen.«15
Manche Menschen schwärmen von den harmonischen vorkapitalistischen Zuständen, als alles so schön »entschleunigt« war, aber diese Langsamkeit war meist ein Ergebnis physischer Schwäche infolge von dauerhafter Mangelernährung.16 Man schätzt, dass vor 200 Jahren ungefähr 20 Prozent der Einwohner von England und Frankreich gar nicht arbeitsfähig waren. »Sie hatten höchstens genug Kraft, um jeden Tag ein paar Stunden langsam zu gehen, wodurch sie zeit ihres Lebens zum Betteln verurteilt waren.«17
1754 berichtete ein Autor: »Die Bauern Frankreichs, weit entfernt von Wohlstand, besitzen nicht einmal das Lebensnotwendige; dieser Menschenschlag siecht mangels Erholung von seiner Schwerarbeit schon vor dem 40. Lebensjahr dahin … Schon das Äußere der französischen Bauern kündet von körperlichem Verfall.«18 Ähnlich war es in anderen europäischen Ländern. Der französische Wirtschaftshistoriker Fernand Braudel konstatiert: »Diese Gesamtsituation mit ihrem ungefähren Gleichstand von Sterbefällen und Geburten, der auffallend hohen Kindersterblichkeit, den Hungersnöten, der chronischen Unterernährung und den schweren Epidemien ist für die frühere Lebensordnung kennzeichnend.« In manchen Jahrzehnten starben sogar mehr Menschen, als Säuglinge geboren wurden.19 Der »Besitz« der Menschen beschränkte sich auf einige wenige Dinge, so wie man sie auf zeitgenössischen Bildern sieht: ein paar Hocker, eine Bank und als Tisch ein Fass.20
Smith hatte vorhergesagt, nur eine Ausweitung der Märkte könne zu steigendem Wohlstand führen – und genau dies ist in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Ende der sozialistischen Planwirtschaften geschehen. Allein in China ist durch die Einführung des Privateigentums und marktwirtschaftliche Reformen die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, von 88 Prozent (1981) auf heute unter ein Prozent gesunken. Als ich den liberalen Ökonomen Weiying Zhang von der Peking University fragte, was die Bedeutung von Smith für China sei, antwortete er:
»Chinas rasante wirtschaftliche Entwicklung in den letzten vier Jahrzehnten ist ein Sieg von Adam Smiths Idee des Marktes.« Anders als man es im Westen heute sieht, sei der Rückgang der Armut und das wirtschaftliche Wachstum in China nicht »wegen des Staates, sondern trotz des Staates« erfolgt und habe seine Ursache in der Einführung des Privateigentums.
Während Karl Marx glaubte, das Los der Armen ließe sich nur durch Abschaffung des Privateigentums verbessern, glaubte Smith an die Kraft des Marktes. Dabei war er kein Verfechter einer libertären Utopie ohne Staat – dem Staat schrieb er in seinem Buch wichtige Aufgaben zu. Aber schon 1755, also zwei Jahrzehnte, bevor »The Wealth of Nations« erschien, warnte er in einem Vortrag:
»Menschen werden üblicherweise von Staatsmännern und Projektemachern als Material einer Art politischer Mechanik betrachtet, obwohl nichts anderes erforderlich ist, als die Natur sich selbst zu überlassen, damit sie ihre eigene Ordnung verwirklichen kann … Jede Regierung, die diesem natürlichen Lauf entgegenarbeitet, die Dinge in eine andere Richtung zwingt oder die bestrebt ist, den Fortschritt des Gemeinwesens an einem bestimmten Punkt aufzuhalten, muss zwangsläufig, um sich selbst zu erhalten, unterdrückend und tyrannisch sein.«21
Das waren prophetische Worte. Der größte Irrtum der Planer war schon stets ihre Illusion, man könnte eine Wirtschaftsordnung auf dem Papier planen: Ein Buchautor sitzt in seinem Zimmer und denkt sich eine ideale Wirtschaftsordnung aus. Dann müssen nur noch Politiker überzeugt werden, diese Wirtschaftsordnung in der Praxis umzusetzen.
Friedrich August von Hayek nannte das später »Konstruktivismus« und meinte: »Die Idee, dass vernunftbegabte Menschen sich zusammensetzen und überlegen, wie die Welt neu gestaltet werden kann, ist vielleicht das charakteristischste Ergebnis dieser Plantheorien.« Die anti-rationalistische Einsicht in das historische Geschehen, die Smith mit anderen schottischen Aufklärern wie David Hume und Adam Ferguson teilte, ließ sie – so Hayek – »als Erste verstehen, wie Institutionen und Moral, Sprache und Recht sich durch seinen Prozess kumulativen Wachstums entwickelten und dass die menschliche Vernunft sich nur mit und innerhalb dieses Rahmenwerks entwickeln und erfolgreich arbeiten kann«.22
Wie ein Wirtschaftshistoriker beschrieb Smith die ökonomische Entwicklung, statt ein ideales System zu entwerfen. Die Einsicht von der Überlegenheit der Marktwirtschaft gegenüber staatlicher Planung schwindet heute mehr und mehr. Planwirtschaft ist heute wieder populär. »Klimaschützer« und Kapitalismuskritiker fordern, wir müssten den Kapitalismus abschaffen und eine Planwirtschaft an seine Stelle setzen. Ansonsten hätte die Menschheit keine Chance zum Überleben. In Deutschland wurde ein Buch mit dem Titel »Das Ende des Kapitalismus« ein Bestseller, und dessen Autorin Ulrike Herrmann ist ständiger Gast in allen Talkshows. Sie propagiert ganz offen eine Planwirtschaft, obwohl die in Deutschland ja schon einmal gescheitert ist – und nicht nur dort. Anders als im klassischen Sozialismus sollen die Unternehmen nicht verstaatlicht werden, sondern im Privatbesitz bleiben. Aber der Staat solle festlegen, was hergestellt wird und wie viel.
Flüge würde es nicht mehr geben, auch keine privaten Kraftfahrzeuge.23 Der Staat bestimmt, wie die Menschen wohnen dürfen – beispielsweise soll es keine Einfamilienhäuser und keine Zweitwohnungen mehr geben. Der Neubau wird wegen Klimaschädlichkeit verboten, stattdessen werden die bestehenden Flächen »gerecht« verteilt.24 Der Staat bestimmt, wie viel Fläche jeder bewohnen darf. Der Fleischkonsum wird nur ausnahmsweise erlaubt, weil die Fleischproduktion klimaschädlich ist. Ganz generell dürften die Menschen nicht mehr so viel essen. 2.500 Kalorien am Tag seien genug, meint Herrmann: 500 Gramm Obst und Gemüse, 232 Gramm Vollkorngetreide oder Reis, 13 Gramm Eier, 7 Gramm Schweinefleisch usw. »Auf den ersten Blick mag dieser Speisezettel etwas mager wirken, aber die Deutschen wären viel gesünder, wenn sie ihre Essgewohnheiten umstellten«, tröstet die Kapitalismuskritikerin.25 Und da die Menschen gleich wären, wären sie auch glücklich: »Rationierung klingt unschön. Aber vielleicht wäre das Leben sogar angenehmer als heute, denn Gerechtigkeit macht glücklich.«26
Das ist das Gegenkonzept zu Adam Smith. Smith wird heute oft kritisiert, weil er die Bedeutung der eigenen Interessen hervorgehoben hat. Er betonte die Wichtigkeit des Egoismus, und zwar gerade deshalb, weil der Mensch fortwährend die Hilfe seiner Mitmenschen brauche. Er meinte jedoch, dabei könne der Mensch nicht allein auf das Wohlwollen seiner Mitmenschen vertrauen. In diesem Zusammenhang verwendete er übrigens auch die Formulierung von der »unsichtbaren Hand«, für die er so berühmt wurde, obwohl er sie insgesamt nur drei Mal in seinen Werken verwendete (übrigens trifft das auch für Joseph Schumpeter zu, der seine berühmte Formulierung von der »kreativen Zerstörung« nur zwei Mal verwendete):
»Wenn jeder einzelne soviel wie nur möglich danach trachtet, sein Kapital zur Unterstützung der einheimischen Erwerbstätigkeit einzusetzen und dadurch diese so lenkt, dass ihr Ertrag den höchsten Wertzuwachs erwarten lässt, dann bemüht sich auch jeder einzelne ganz zwangsläufig, dass das Volkseinkommen im Jahr so groß wie möglich werden wird. Tatsächlich fördert er in der Regel nicht bewusst das Allgemeinwohl, noch weiß er, wie hoch der eigene Beitrag ist ... Und er wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat. Auch für das Land selbst ist es keineswegs immer das schlechteste, dass der einzelne ein solches Ziel nicht bewusst anstrebt, ja gerade dadurch, dass er das eigene Interesse verfolgt, fördert er häufig das der Gesellschaft nachhaltiger, als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu tun. Alle, die jemals vorgaben, ihre Geschäfte dienten dem Wohl der Allgemeinheit, haben meines Wissens niemals etwas Gutes getan.«27
Der Ökonom Ludwig von Mises betonte, dass die Gegenüberstellung von egoistischem und altruistischem Handeln falsch sei. Es sei glücklicherweise »nicht so, dass ich die Wahl habe, durch mein Tun und Lassen entweder mir oder meinen Mitmenschen zu dienen. Wäre dem so, dann wäre menschliche Gesellschaft nicht möglich.«28 Und Friedrich August von Hayek bezeichnete als Adams Smiths größten Beitrag zum wissenschaftlichen Denken – weit über die Ökonomie hinausweisend – »seine Vorstellung eines sich selbst ordnenden Prozesses, der wie eine unsichtbare Hand komplexe Strukturen schafft«.29
Totalitäre Ideologien wollen das »Ich« kleinmachen, es soll sich dem »Wir« unterordnen. »Du bist nichts, dein Volk ist alles« (Leitspruch der Hitler-Jugend) oder »Gemeinnutz geht vor Eigennutz« (25-Punkte-Programm der NSDAP), lauteten die Maximen des Nationalsozialismus. Adolf Hitler sagte in einer Rede im November 1930: »Im gesamten Wirtschaftsleben, im Gesamtleben an sich, wird man aufräumen müssen mit der Vorstellung, dass der Nutzen des Einzelnen das Wesentliche ist und dass auf dem Nutzen des Einzelnen sich der Nutzen der Gesamtheit aufbaut, also zunächst der Nutzen des Einzelnen den Nutzen der Gesamtheit überhaupt erst ergibt. Das Umgekehrte ist richtig: Der Nutzen der Gesamtheit bestimmt den Nutzen des Einzelnen … Wenn dieser Grundsatz nicht anerkannt wird, dann muss zwangsläufig ein Egoismus eintreten, der die Gemeinschaft zerreißt.«30
Diese Überzeugung eint alle totalitären Denker, Revolutionäre und Diktatoren, von Robespierre in der Französischen Revolution über Lenin, Stalin und Hitler bis zu Mao. Hannah Arendt, eine der größten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts, schrieb in ihrem Werk »Über die Revolution«: »Nicht nur in der Französischen Revolution, sondern in allen Revolutionen, die ihrem Beispiel folgten, erscheint das Einzelinteresse als eine Art gemeinsamer Feind, und die Terrortheorien von Robespierre bis Lenin und Stalin nehmen alle als selbstverständlich an, dass das Gesamtinteresse automatisch und ständig in Feindschaft liege mit dem Eigeninteresse jedes einzelnen Bürgers.«31 Ja, absurderweise wurde das Handeln gegen das Eigeninteresse sogar zur höchsten Tugend erklärt und der Wert eines Menschen danach bemessen, wir sehr er gegen seine eigenen Interessen und Impulse handelt.32
Smith war ein Vordenker, auf dem viele spätere liberale Ökonomen aufbauten – Hayek und Mises schätzten ihn. Aber es kam auch aus dem Kreis marktwirtschaftlicher Ökonomen scharfe Kritik. Der libertäre amerikanische Ökonom Murray N. Rothbard ließ in seinem monumentalen Werk »Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought« kein gutes Haar an Smith. Smith sei keineswegs der Advokat der freien Marktwirtschaft, als der er dargestellt werde: Mit seiner falschen Arbeitswerttheorie sei er der Vorläufer von Karl Marx gewesen. Marxisten könnten sich durchaus mit einer gewissen Berechtigung auf den schottischen Philosophen berufen und ihn als die ultimative Inspiration ihres eigenen Gründervaters preisen.33 Smith habe die ökonomische Funktion des Unternehmers nicht verstanden und sei sogar hinter die Erkenntnisse von Ökonomen wie Richard Cantillon zurückgefallen34, er sei für eine staatlich festgelegte Zinsobergrenze eingetreten, für hohe Steuern auf Luxusgüter und für zahlreiche staatliche Eingriffe in die Wirtschaft.35 Auch persönlich sei Smith unglaubwürdig, weil er zuvor für den Freihandel gefochten habe, aber die letzten zwölf Jahre seines Lebens als Zollrevisor tätig war.36
Manches an dieser Kritik ist berechtigt, und dennoch ist es falsch, Adam Smith als Linken zu bezeichnen. Selbst der Philosoph Samuel Fleischacker, der die linken Tendenzen bei Smith hervorhebt, räumt ein, Smith hätte sich mit heutigen Sozialdemokraten und Anhängern des Wohlfahrtsstaates nicht identifizieren können.37
Dagegen sprechen vor allem Smiths tiefes Misstrauen gegen Eingriffe des Staates in die Wirtschaft und sein fast grenzenloses Vertrauen in die »unsichtbare Hand«, die die Märkte in die richtige Richtung lenkt. Wenn die Wirtschaft ruiniert werde, dann, so Smith, niemals durch Unternehmer und Kaufleute, sondern stets durch den Staat: »Große Nationen werden niemals durch private, doch bisweilen durch öffentliche Verschwendung und Misswirtschaft ruiniert«, schrieb er im »Der Wohlstand der Nationen«.38 Und er fügte optimistisch hinzu: »Das gleichmäßige, fortwährende und ununterbrochene Streben der Menschen nach besseren Lebensbedingungen, Ursache und Quelle des öffentlichen und nationalen wie des privaten Wohlstands, ist durchweg mächtig genug, trotz Unmäßigkeit der Regierung und größter Fehlentscheidungen in der Verwaltung den natürlichen Fortschritt zum Besseren hin aufrecht zu erhalten. Es wirkt ähnlich wie die Abwehrkräfte im menschlichen Organismus, die den Körper wieder gesunden lassen, trotz unsinniger Anweisungen des Arztes.«39
Das Bild sagt viel aus: Die privaten Wirtschaftsakteure stehen für eine gesunde, positive Entwicklung, die Politiker behindern die Wirtschaft durch ihre unsinnigen Anweisungen. Adam Smith wäre heute sehr skeptisch, wenn er sehen könnte, wie der Staat immer mehr in die Wirtschaft eingreift und wie Politiker glauben, sie seien klüger als der Markt.
Zu den Defiziten bei Smith gehörte, dass er nicht die ökonomische Funktion des Unternehmers verstand, die später so hervorragend von Denkern wie Joseph Schumpeter herausgearbeitet wurde. Irrigerweise sah er in dem Unternehmer vor allem den Manager und