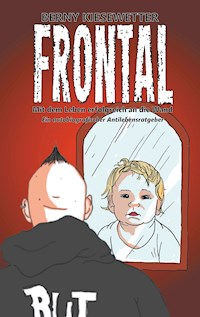Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eigentlich dachte Berny, er hätte es geschafft. Raus aus der Arbeitslosigkeit, raus aus der Drogenhölle. Schluss mit Drama, Eskalation sowie ständig wechselnden Geschlechtspartnerinnen und rein in die Ehe und das geregelte Leben. So war der Plan. Wäre da nicht der allgegenwärtige Wahnsinn, der einfach nicht von ihm ablassen möchte - und sich zu seinem Leidwesen durchaus vielschichtig gestaltet: Hochzeitsvorbereitungen, Exhibitionisten, Guten-Morgen-Radiosendungen, übergriffige Groupies, Nachbarn, Männer, Frauen, Kinder, Tiere, Steine und allem voran: Der verfluchte Alltag. Über Probleme wie diese kann man natürlich ein Buch schreiben, aber könnte man - rein hypothetisch - nicht auch versuchen, an ihnen zu arbeiten? Die Antwort, ihr ahnt es sicher bereits, soll im folgenden Werk erörtert werden: "Ich würd ja gern - ich hab aber keinen Bock"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Mudder.
Du hast die zwei merkwürdigsten Kinder aller Zeiten großgezogen. Niemand weiß, wie du das angestellt hast, aber ich danke dir dafür.
Diese Seite soll laut Verlag unbedingt leer bleiben.
Darum steht das Inhaltsverzeichnis erst auf der nächsten Seite.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Gewonnen!
Das Vöglein, das noch fliegen lernte
Flasche!
Allzeit bereit – für Einsamkeit
Schüleraustausch of Death
Das zweitbeste Referat der Welt
Urin bei Mondenschein & Knarren aus Polen
Meine Hip-Hop-Karriere und Geburtstag in der Nazikneipe
Extrablatt: Held verhindert Amoklauf
Liebe ist süß, haben sie gesagt
Schwul?
Der Familientherapeut
Fahrlässige Tötung und nette alte Damen
Nein danke, auf die Fresse hatte ich schon
Pumuckl tanzt!
Taschendiebstahl mit Hindernis
Der diskontinuierliche Fortbestand des Glücks und Suizidversuche eines Clowns
Daumen hoch!
Der Waisenjunge
„Bitte waschen Sie Ihre Popo!“
Die Arschmasseuse von Tachov
Mein Freund Rotkart
Ich würd ja gern - ich hab aber keinen Bock
Ich bin ein furchtbarer Mensch
Die Öffi-Chroniken – Ein Monat in der Hölle
Oma nackt
Ganz allein auf der Welt wär‘s doch auch ganz schön
Realität ist kacke
Familienspaß und furzende Ärsche
Freundschaft zwischen Mann und Frau: Seien wir doch mal ehrlich
Bürgerkrieg in der Bimmelbahn und Polygamie wider Willen
Hochzeitsplanungen. Geil.
Ein Ring, sie zu knechten
Die Floskeln unserer Nachkommenschaft: Essenz der Reinheit oder rassistische Parolen?
Der Hippokratische Eid
Ich gehöre nicht dazu
Endlich normale Leute!
Liebeserklärung an das Zwielicht
Der Ton wird rauer
Chaos in der Dorfsparkasse
Das eskalierte schnell
Ein Traum wird wahr!
Ich bin zu alt für diesen Scheiß
Menschen, Tiere und andere Störfaktoren des Lebens
Epilog
Epilog-Epilog
Vorwort
„Alter, hab dein Buch gelesen! Scheinst ja ordentlich was zu vertragen, lass mal saufen gehen!“
„Naja, was ich mit dem Buch eigentlich aussagen wollte, war...“
„SAUFÖÖÖÖÖN!!“
Und damit ein herzliches: Willkommen zurück!
Liebe Leserschaft,
der Wahnsinn lässt mich einfach nicht los. Seien es Begebenheiten, die sich zeitlich vor, während oder nach dem literarischen Vorgänger „Frontal“ ansiedeln. Der Wahnsinn - oder zumindest das, was ich als solchen wahrnehme - ist allgegenwärtig und verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Hochnäsige Pferde, Zauberer mit Epilepsie, raffgierige Sanitäter, Gladiatorenkämpfe vor dem Kinosaal, zehnjährige Kettenraucher oder Kuscheltiere, die zu Rammstein tanzen: All das und leider noch viel mehr kann, darf und will sich der geneigte Leser auf den kommenden Seiten zu Gemüte führen.
"Wenn mer was macht, dann macht mer‘s gscheit!", war ein Motto, das mir mein Vater zeit seines Lebens immer wieder ziemlich eindringlich ans Herz gelegt hat. Schon sehr bald legte ich die Quintessenz dieser Lebensweisheit auf das "Wenn". Das war zwar nicht die Kernaussage, die ich damit ursprünglich verinnerlichen sollte, aber warum etwas tun, wenn es lediglich im unwahrscheinlichen Fall seiner Perfektion einen Wert hat? Ohne es zu wissen habe ich in diesem frühen Augenblick der Erleuchtung vermutlich zum ersten Mal an der Oberfläche vom Sinn des Lebens gekratzt und diesen Gedanken seitdem nie verloren, sondern kontinuierlich weiterentwickelt.
Was ist denn überhaupt die Definition von „perfekt“? Ohne Ecken und Kanten? So wie geplant? Über das Ziel hinaus? Und wer hat überhaupt festgelegt, dass „Perfektion“ als positiver Begriff wahrzunehmen ist?
Ob die Unvollkommenheit nicht doch irgendwie aufregender und lebendiger ist, ob das Glück ohne Unglück überhaupt existieren könnte und ob zwei Frauen im Bett wirklich besser als eine sind: Die Antworten auf diese und weitere Fragen, die nie jemand gestellt hat erwarten euch, liebe Leserinnen und Leser, auf den kommenden Seiten.
Der Wahnsinn lässt mich einfach nicht los. Vielleicht sollte ich auch einfach anfangen, so wie die meisten, den Wahnsinn als das anzuerkennen, was er ist: Alltag. Doch ich weigere mich.
Ich würd ja gern - ich hab aber keinen Bock.
Gewonnen!
„Du Fliegenpilz!“
„Du Totenkopf!“
„Elefantenpups!“
„Gewitterwolke!“
Wir schreiben das Jahr 1994. Mama und ich liegen auf dem Sofa und necken uns kichernd mit Schimpfwörtern, die uns sporadisch einfallen. Ich bin etwa sechs oder sieben Jahre alt. Dementsprechend kindlich und unbefleckt sind die Namen, die wir einander geben.
„Du alter Babypopo!“
„Schlammpfütze!“
„Spiegelei!“
„Du Zirkusclown!“
Was haben wir für einen Spaß! Nun bin ich wieder an der Reihe. Doch dieses schnelle Überlegen, Reagieren und Antworten liegt mir einfach nicht. Triumphierend sieht mich meine Mutter an, als ich zögere. Ich muss schlagfertiger werden und dieses Spiel um jeden Preis gewinnen! Wie war nochmal dieses witzige Wort, das mir mein Klassenkamerad Erich neulich nach dem Sportunterricht beigebracht hat?
Erich – eines dieser psychisch frühreifen Kinder mit einem älteren Bruder. Der Schrecken aller Eltern, die ihren unbefleckten Sprössling plötzlich aus der heilen Welt mit solch einem verdorbenen Balg in die Schule schicken müssen.
Kennt ihr das, wenn ihr unabsichtlich Grenzen überschreitet und es erst merkt, wenn es bereits zu spät ist? Der Augenblick, in welchem man sich wünscht, einfach mal zehn Sekunden zurückspulen zu können? Ein Zustand unergründlicher Verzweiflung und Hilflosigkeit – und es ist nicht das erste, doch leider auch nicht das letzte Mal, dass ich kurz vor solch einem Moment stehe.
Nun fällt mir wieder ein, wie das Wort lautet. Es klingt genau so witzig wie „Elefantenpups“ und wird mich in unserem Spiel sicher in die nächste Runde bringen, also entgegne ich laut mit einem heroischen Unterton in der Stimme: „Du Hurensohn!“
Stille. Das Lächeln auf dem Gesicht meiner Mutter verschwindet. Sie steht auf und geht.
Ich glaube, ich habe gewonnen.
Das Vöglein, das noch fliegen lernte
Was wie eine leerreiche Kinderfabel klingt, ist eine Begebenheit aus meiner Kindheit, deren Moral sich bis heute fest in mich eingebrannt hat.
An einem nassen Herbstwochenende Anno 95 rettete unser Vater einen abgestürzten jungen Vogel in unserem Garten. Er war Minuten zuvor gegen eine unserer Fensterscheiben geprallt und lag nun in einer Art Schockstarre hilflos auf unserer Terrasse. Unser Vater rief in weiser Voraussicht seine beiden Söhne aus ihren Zimmern, denn was sich hier bot, war ein potentielles Vater-Sohn-Erlebnis der Extraklasse. Wir kümmerten uns gemeinsam rührend um den kleinen Vogel. Er war offensichtlich verängstigt, doch abgesehen davon schien ihm nichts weiter zu fehlen. In den darauffolgenden Stunden hielt unser Vater ihn schützend in seinen Händen, während wir ihn vorsichtig streichelten, ihm Wasser in einer Schale bereitstellten und ihn sogar ein paar Körner picken ließen. Mit der Zeit entspannte sich der Piepmatz spürbar und stand irgendwann sogar wieder auf beiden Beinen, ja, machte obendrein ein paar Hüpfer über unseren Wohnzimmertisch. Wir hatten dem kleinen Racker das Leben gerettet und das fühlte sich überragend an! Wir bildeten uns sogar ein, aus den Blicken des kleinen Vögelchens ein Fünkchen Dankbarkeit herauszulesen. Hätten wir nicht eingegriffen, hätte sich früher oder später unsere Katze „Sushi“ um ihn gekümmert. Wir waren Lebensretter! Was für ein Gefühl!
Wäre es nach meinem Bruder und mir gegangen, hätten wir den Piepmatz einfach behalten und als Familienmitglied willkommen geheißen – doch unser Vater gab uns zu verstehen, dass es nun Zeit sei, ihn zurück in seine Welt zu entlassen. Denn Vögel haben Flügel, um sie zu benutzen, um frei zu sein. Nur dann hätten wir ihn wirklich gerettet. Gemeinsam trugen wir ihn zurück auf die Terrasse und sagten Lebewohl. Ein denkwürdiger und emotionaler Moment. Wir standen also zu dritt nebeneinander vor unserem Garten, unser Vater öffnete seine Hände und entließ den Vogel mit einem kräftigen Schwung in die Freiheit.
Die Schönheit und Einzigartigkeit dieses Augenblickes erfüllte jeden von uns. Hand in Hand standen wir da, als der Vogel seine Flügel ausbreitete, etwa einen Meter durch die Luft segelte und schließlich im Sturzflug, wie ein Stein, auf die Erde zurücksegelte, wo er endgültig leblos liegen blieb. Schade eigentlich.
Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber ich glaube, ich habe an diesem Tag irgendetwas über das Leben gelernt.
Flasche!
Kennt ihr diese Sportart namens „Handball“? Wird auf Hallenboden statt Wiese gespielt, nur sechs oder sieben Spieler pro Mannschaft, die Tore sind winzig klein und wenn Deutschland Europa- oder Weltmeister wird, erfährt man das meistens auf der fünften Seite der Tageszeitung. Ach, und man benutzt hauptsächlich die Hand, um den Ball fortzubewegen - ist das nicht irre? Quasi das Gegenteil von Fußball, für Zuschauer allerdings genauso langweilig.
Handball ist eine Sportart, die in der Familie Kiesewetter eine ehrwürdige Tradition darstellt. Mein Vater war in seiner Kindheit und Jugend ein ganz ordentlicher regionaler Torhüter gewesen, ebenso wie sein Vater und dessen Vater. Keine Frage, dass ich als zehnjähriger Stammhalter schließlich auch ranmusste. Ich kann im Nachhinein gar nicht mehr genau sagen, was hierbei das größere Problem darstellte: Meine noch nicht erkannte Abneigung gegen Personengruppen aller Art oder meine Inkompetenz in jeglichen Sportarten, deren Ursprung sich irgendwo zwischen meiner Lustlosigkeit und meiner diagnostizierten ADHS-Erkrankung fand. Reichte es nicht, dass ich schon fünf Tage in der Woche zur Schule und anschließend noch Hausaufgaben machen musste? Dienstags war die Ergotherapie dran, am Wochenende gingen wir meist mit Nachbarn in der fränkischen Schweiz wandern und später kam sogar noch tägliches Schlagzeugüben dazu. Zugegeben: Heute sind das teils ganz nette Kindheitserinnerungen, doch damals stellte all das für mich nichts weiter als unnötige Zeitverschwendung dar. Nun pflanzte man diese zusätzliche, regelmäßige Verpflichtung in mein Leben, die ziemlich schnell zu einer wirklich lästigen Angelegenheit heranwuchs.
Beginnen wir beim offensichtlichsten Problem: Ich war wirklich unfassbar schlecht in dieser Sportart. Vollkommen ungeeignet. Es ist schwer zu sagen, ob es jemals jemanden gab, der mit dem Ablauf und den Regeln dieses Spieles so sehr überfordert war wie ich. Viele können es nicht gewesen sein. Dass der Ball beispielsweise nicht einfach getragen, sondern gedribbelt werden musste, während man ihn besaß, machte das Ganze doch nur unnötig kompliziert, weswegen ich diese Regel nur sehr sporadisch berücksichtigte. Dass der Ball auch mal abgespielt wird, unter anderem an mich, war mir ebenfalls völlig unverständlich. Was soll das? Kann man sich nicht einfach freuen, den Ball zu besitzen und dabei irgendwie versuchen, ihn ins Tor zu werfen, ohne dabei seinen Mitspielern auf den Sack zu gehen? Verfluchte Wegwerfgesellschaft! Wenn also jemand den Ball in meine Richtung warf, ignorierte ich das entweder gekonnt oder duckte mich schon alleine deshalb weg, weil ich absolut nicht nachvollziehen konnte, aus welchen Gründen man gerade MIR den Ball abspielen sollte. Ein weiteres Problem war meine Konzentrationsschwäche, die es mir oftmals unmöglich machte rechtzeitig zu verstehen, was man von mir verlangte.
„Du schaffst das“, ermutigte man mich wieder und wieder. „Ich weiß, dass du das kannst. Beim nächsten Mal wird es besser“, versprach man mir. Das war so lieb gemeint und doch so falsch, da ich es eben NICHT konnte und es, so sehr ich es ihnen auch beweisen wollte, NICHT schaffte, besser zu werden. Das fügte der Frustration noch eine saftige Portion Gewissensbisse hinzu, weil ich das Versprechen meiner Eltern nicht halten konnte.
Dass ich im Handball offensichtlich nicht ganz so sehr glänzte wie meine Vorfahren, enttäuschte nicht nur meinen Vater, sondern auch meine Mannschaft, die mich das recht bald auch ziemlich deutlich spüren ließ. In einer geheimen, konspirativen Absprache muss man beschlossen haben, dass das Wort „Flasche“ recht passend für mich wäre und so begann man damit, mir diesen Begriff wieder und wieder an den Kopf zu werfen. „Flasche, Flasche, Flasche!“ flüsterte es von nun an regelmäßig und kontinuierlich in der Umkleide, beim Aufwärmen, während des Trainings, teils sogar während der gemeinsamen An- und Abfahrt von allen Seiten. Dass man mir damit nicht sagen wollte, was für ein toller Typ ich war, leuchtete mir sogar ein. Trotzdem hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt das Wort „Flasche“ nie mit etwas Negativem assoziiert, weswegen ich meinen Vater eines Abends beim Zubettgehen fragte:
„Papa, was ist eine Flasche?“
Mein Vater, belesen und weitsichtig, runzelte die Stirn, sah kurz mich und dann die Wasserflasche neben meinem Bett an und antwortete:
„Mein Sohn, du wirst ja wohl wissen, was eine Flasche ist.“, deckte mich zu und verließ kopfschüttelnd den Raum.
„Was hab‘ ich bloß mit diesem Jungen falsch gemacht? Was für eine Flasche!“ wird er sich beim Hinausgehen gedacht haben.
Es war nicht so, dass mir meine Mannschaftskameraden und deren Meinung überdurchschnittlich viel bedeuteten, doch sich unfreiwillig an einem Ort zu befinden, an dem einen niemand haben möchte, ist schon so eine Sache, die selbst das introvertierteste Kind nicht kalt lässt und mich bis heute in meinen Albträumen verfolgt. Auf das Thema angesprochen gab mir schließlich irgendjemand den Rat, mich doch mal in aller Deutlichkeit zur Wehr zu setzen. Und das tat ich. Wir standen gerade aufgereiht vor dem Tor und übten Würfe. Die beiden Kinder vor und hinter mir verloren sich gerade wieder in ihrem dezenten „Flasche, Flasche, Flasche“ – Singsang, als ich mit dem rechten Bein ausholte und einem von beiden einen kräftigen Tritt in den Arsch verpasste. Was für ein unbeschreibliches Gefühl, als der Gesang augenblicklich verstummte und man mich von allen Seiten schockiert ansah. Weil die Aktion eine so tolle Wirkung gezeigt hatte, trat ich gleich noch einmal zu, um meinen Taten noch etwas Ausdruck zu verleihen. Und noch einmal. Das Kind verpetzte mich daraufhin beim Trainer und ich bekam im Anschluss von mehreren Seiten einen Mordsärger, weil ich meine Teamkameraden terrorisierte und so den Zusammenhalt gefährdete. Wenn ich einmal sterbe und mir aufgrund meiner Sünden meine persönliche Hölle zugewiesen werden sollte, lande ich vermutlich wieder genau dort in einer Endlosschleife.
Ich erinnere mich nicht mehr so wirklich daran, wie ich schließlich aus diesem Verein herausgekommen bin, ich weiß allerdings noch, dass mein Bruder einige Jahre später die Familienehre rettete, indem er einen bemerkenswert guten Torwart abgab und seine Mannschaft durch viele erfolgreiche, überregionale Turniere brachte. Wer jetzt denkt, ich hätte nun das Gröbste hinter mir gelassen, der irrt. Meine Mutter sowie deren Mutter und Großmutter hatten die beste Zeit ihrer Kindheit bei den Pfadfindern verbracht. Lagerfeuer, Zelten, Wanderungen, Wochenendausflüge, Übernachtungen, gemeinsames Singen. Schon nächste Woche sollte es losgehen. Man freute sich schon auf mich.
Das mit den Suizidgedanken ging bei mir schon recht früh los.
Allzeit bereit – für Einsamkeit
Wie sehr ich mich auch wehrte, wie sehr ich auch protestierte, weinte und schrie – aus der Pfadfindernummer kam ich nicht heraus. Ich hätte mir aus Protest vermutlich die Pulsadern aufschneiden oder die Augen ausstechen können, doch dass man mich zu den Pfadfindern schickte, war in Stein gemeißelt. So kannte ich meine Mutter gar nicht. Normalerweise ließ sie immer mit sich verhandeln und respektierte meine Wünsche, doch hier gab es keine Diskussion. Ich schätze, aufgrund meiner Abneigung gegen so ziemlich alles, nahm man meine Meinung bezüglich des neuen Hobbys nicht so wirklich ernst.
Die erste Gruppe, zu der man mich schickte, residierte in einem kahlen, heruntergekommenen Gebäude. Ich hatte irgendwie erwartet, bei den Pfadfindern auf ein paar langweilige, wohlerzogene Jungen und Mädchen in einheitlicher Kleidung zu treffen, denen man bislang verschwiegen hatte, dass Spielekonsolen existierten. Man würde den ganzen Tag durch Wälder stapfen, singen, zelten, Händchen halten und wahrscheinlich irgendwann eins mit der Natur werden oder so. Überraschenderweise erwartete mich genau das Gegenteil: ein paar lustlose, abgeklärte Kids, die in einem kleinen Raum um einen Tisch saßen, und „Risiko“ spielten. Natürlich kannten sich alle untereinander, die meisten waren, schon vor Eintritt, privat befreundet und dann war da ich. Man behandelte mich nicht wirklich unhöflich, sondern begegnete mir mit demselben Enthusiasmus, den ich der Sache entgegenbrachte: Keinem. Das war nicht sonderlich schlimm, so musste ich wenigstens nicht mit irgendjemandem reden – aber die Zeit, bis ich endlich wieder allein zuhause Rammstein hören und meine Koalabär-Kuscheltiere dazu tanzen lassen konnte, zog sich dadurch nur noch mehr. Wenn ich so darüber nachdenke, war meine Kindheit sowieso schon merkwürdig genug auch ohne die Bürde, sich durchgehend vor der aufgezwungenen Außenwelt abschirmen zu müssen. Wenn der Gruppenführer nicht im Zimmer war, gaben die Kids ein paar ziemlich eindeutig ausländerfeindliche Liedtexte zum Besten, die am Ende tatsächlich der Grund waren, warum ich kein zweites Mal dort hinmusste.
Das war ja einfach. Ich hatte schon überlegt, ob ich mir körperliche Züchtigung oder einen sexuellen Übergriff ausdenken sollte, um irgendwie einen Ausweg aus dem Schlamassel zu finden, doch schlussendlich rettete mich die gute alte Wahrheit. Merkt euch das, liebe Kinder.
Für etwa eine Woche dachte ich tatsächlich, ich hätte es geschafft. Doch leider hatte ich die Hartnäckigkeit meiner Mutter immens unterschätzt. Sie hatte innerhalb kürzester Zeit einen anderen Pfadfinderstamm finden können, der noch freie Plätze hatte. Und so wiederholte sich das Spiel: Ich tobte, ich brüllte, ich kündigte sogar an, mir selbst Knochen zu brechen, um meine Zeit lieber unter Schmerzen im Krankenhaus als bei diesen halstuchtragenden Arschlöchern zu verbringen – doch meine Mutter wusste wohl, dass ich dafür nicht die Eier hatte.
Auf jeder neuen Hinfahrt dankte ich dem Herrn für die Gnade einer roten Ampel oder eines Staus auf der Autobahn – doch es nützte alles nichts. Für die nächsten Monate war ich gefangen in den Abgründen der Pfadfinderschaft.
Zugegeben: Meine neue Gruppe hatte etwas festere Strukturen und der Gruppenführer hatte seine Kinderschar etwas besser im Griff. Trotzdem waren wir ein Trupp aus etwa zehn Kindern, von denen vielleicht zwei nicht schwer verhaltensauffällig waren. Es kam mir langsam so vor, als würden Eltern ihre Kinder nicht etwa wegen der frischen Luft und den wertvollen Erfahrungen zu den Pfadfindern schicken, sondern um ihre Mistblagen zumindest ein paar wertvolle Stunden in der Woche aus dem Haus zu haben. Unsere Tätigkeiten schwankten zwischen körperlicher Betätigung wie Fußball oder „Capture the Flag“ und Gruppenstunden, bei denen man uns diverse Pfadfinderknoten oder die Scheiße von Tieren unterscheiden ließ. Interessanterweise und für mich damals wie heute nicht nachvollziehbar hatten sogar die „Problemkinder“ unserer Gruppe meistens Bock auf diesen Müll und irgendwie beneidete ich sie etwas dafür.
Einen traurigen Höhepunkt erreichte mein Leidensweg, als sich unser Stamm für eine größere Lagerfreizeit mit dem Thema „BOCK AUF ABENTEUER“ registrierte. Unzählige weitere Pfadfindergruppen aus ganz Bayern hatten sich hierfür zusammengeschlossen, um uns eine unvergessliche Woche voller Natur, Eindrücke und „Fun“ bieten zu können. Ich fühle mich im Nachhinein fast etwas schlecht, dass ich allen dafür Verantwortlichen einen grausamen Tod gewünscht habe, aber dieser Dauerzustand der Machtlosigkeit holte regelmäßig das Schlimmste in mir hervor.
Dort angekommen bot sich mir endlich das, was ich von Beginn an erwartet hatte: Geschichten am Lagerfeuer, Wanderungen, gebetsartig aufgesagte Pfadfindergrüße und eine Überdosis Kumbaya.
Mein Bruder dachte damals übrigens, „Kumbaya“ wäre der Song von den Guano Apes, die diesen allerdings zur damaligen Zeit lediglich in einer ziemlich schnellen und harten Version gecovert hatten. Dementsprechend beeindruckt war er, als ich ihm davon erzählte und dachte bereits über einen Beitritt nach. In seinem Kopf muss das so ausgesehen haben, als würden hundert Kinder völlig in Rage und aggressiv um sich schlagend um ein riesengroßes Feuer springen, während dieser Song aus meterhohen Boxentürmen dröhnt. Die Welt könnte so ein wunderschöner Ort sein, doch die Realität sah im Moment leider anders aus:
Gleichaltrige profilierten sich vor mir mit ihren Abzeichen für simple Leistungen wie Schwimmen, Kochen oder Feuermachen oder solche, die sie für das bloße Teilnehmen an weiteren solcher Idiotenparaden erhalten hatten. Einer lachte mich sogar aus, da ich noch nicht einmal eine sogenannte Kluft, die traditionelle Bekleidung der Pfadfinder, besaß - was irgendwie ironisch war, da ich auf diese Weise mit wenig Aufwand und Stolz nach außen präsentieren konnte, keiner von ihnen zu sein. Das war, als würde man damit angeben, eine Flasche Wodka exen zu können und anschließend Albert Einstein auslachen, weil er Nobelpreisträger ist.
Vermutlich war ich durch meine Einstellung selbst daran schuld, aber nach kürzester Zeit sprach wirklich niemand auf dem Zeltplatz mehr mit mir und obwohl ich mir bis dahin nichts anderes gewünscht hatte, verlangsamte das die Zeit bis zur Erlösung natürlich noch weiter. Vermutlich hätte ich mehr aus der Sache machen können.
Nach einem weiteren Disput mit einem Kameraden bezüglich meines Kenntnisstandes des Pfadfinderkodex tat ich dasselbe, was mir bereits im Handball die emotionale Freiheit geschenkt hatte: Als ich zu sehr in Bedrängnis geriet, nahm ich mir den Jungen zur Seite und trat ihm mit voller Wucht in den Hintern. Auch dieses Mal läutete dieser Akt der Verzweiflung das Ende eines weiteren Zwangshobbys ein. Man nahm mich direkt danach wieder aus der Gruppe, ich konnte mich nicht einmal von meinen Kameraden verabschieden. Ich bin sicher, sie alle waren bestürzt und ich fehle ihnen sehr.
Wer jetzt auf ein Happy End hofft, den enttäusche ich nur ungern. Meine nächste Station im Zwangsbeschäftigungskarussell war die große Kunst des Tischtennis. Weil das bislang am wenigsten an meinem Gemütszustand zehrte und niemand so recht kontrollierte, ob ich dort wirklich Tischtennis spielte, beließ ich es vorerst dabei und gründete als Ausgleich mit meinem Bruder einige Zeit später die Band BLUT UND TOD. Doch dazu später mehr.
Eines möchte ich an dieser Stelle festhalten: Meine Mutter war und ist einer der liebsten und selbstlosesten Menschen, die kenne. Es gibt fast nichts, das sie aus purem Eigennutz tun würde und dass sie mich zu den Pfadfindern geschickt hatte, war einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass sie die besten Tage ihrer Kindheit dort verbracht hatte und mir von Herzen dasselbe wünschte. Für ihr Durchhaltevermögen und ihre Unermüdlichkeit im „Sohn Beschäftigen“ würde man ihr bei den Pfadfindern bestimmt ein Abzeichen verleihen.
Es ist schwer zu beurteilen, ob man Kinder nicht einfach mal machen lassen sollte, selbst wenn das bedeutet, dass sie sich am liebsten in ihrem Zimmer verschanzen und heimlich Musik hören, die man ihnen eigentlich verbietet. Die Sorge, dass ein heranwachsender Mensch nie seine Talente findet und nutzt, nagt an Eltern bestimmt ordentlich. Überhaupt stelle ich mir das Elterndasein wie eine jahrelange Geisterbahnfahrt vor: Obwohl man weiß, dass höchstwahrscheinlich alles gut wird, hat man durchgehend Angst und erschreckt sich vor jedem Scheiß.
„Das verstehst du, wenn du selbst mal Kinder hast“, würde mein Chef jetzt vermutlich sagen. Sein Lieblingsspruch. Toller Typ. Ich glaube, er war mal Pfadfinder.
Schüleraustausch of Death
Zu den vielseitigsten und lehrreichsten Erfahrungen junger Menschen gehört zweifellos, an einem Schüleraustausch teilzunehmen. Gleichaltrige aus anderen Ländern bei sich zuhause aufnehmen, die gerade ebenso vor Hormonen sprühen und durch eine mächtige Sprachbarriere von einem getrennt sind - was soll da schon schiefgehen? Mein jüngerer Bruder Martin hat es seinerzeit ganz gut erwischt. Da wohnte etwa zwei Wochen ein Franzose Namens Lucas bei uns, mit dem man tatsächlich einigermaßen klarkam. Martin brachte ihm das Wort "Brausestäbchen" bei und erklärte ihm, es handele sich hierbei um das schlimmste deutsche Schimpfwort, das es gäbe. Von einem dreizehnjährigen Buben mit französischem Akzent voller Überzeugung regelmäßig als "Brausestäbchen" diffamiert zu werden, ist eine der tollsten Erinnerungen, die ich an diesen Zeitabschnitt habe. Mein Bruder wurde anschließend von Lucas‘ Familie in Frankreich aufgenommen, ging dort auf seine erste richtige Party und hatte dort beim Karaoke zwischen schönen Mädchen und guten Freunden seinen ersten richtigen Vollsuff. Erinnerungen, von denen ich wünschte, sie wären die meinen. Meinen ersten Vollrausch hingegen hatte ich in einer Nazikneipe, kurz bevor ich realisierte, dass ich in einer solchen saß und eine Gruppe Türken die Kneipe stürmte, aus Rache für einen vermöbelten Cousin. Gab ganz schön auf die Fresse. Aber dazu kommen wir noch. Zwei Jahre vor Martins Franzosen, ich muss etwa 13 gewesen sein, wurde mir ein Austauschschüler aus der Schweiz namens Bruno zugeteilt.
Der Typ war die menschgewordene Langeweile und ein riesengroßes Arschloch. Selbst wenn man ihn direkt ansprach: er kommunizierte einfach nicht mit uns. Weder mit mir noch dem Rest meiner Familie. Jetzt ist die Sprachbarriere von Schweizern und Deutschen ja nun wirklich nicht so hoch, aber vielleicht hätten wir bei deren Ankunft in unserer Schule auch nicht Tränen lachen und dabei von den Stühlen fallen dürfen, als sie sich nacheinander in ihrer lustigen Babysprache vorstellten.
Wir stellten Bruno bei uns zuhause ein kleines Gästezimmer zur Verfügung, in welchem er sich den ganzen Tag einschloss und mit Chips und Schokolade vollfraß, um keinen Hunger für ein gemeinsames Abendessen zu haben. Seinen Müll warf er einfach aus dem Fenster, bis die ganzen leeren Coladosen und Plastikverpackungen irgendwann die Regenrinne verstopften.
Auch bei meinen Klassenkameraden schien es nicht so wirklich glatt zu laufen. Schon bald bildeten sich zwei Fronten aus diesem fehlgeschlagenen gemischtrassigen Hauptschulexperiment heraus: Eine deutsche und eine schweizerische. Das gipfelte sogar irgendwann in einer Konfrontation auf unserem Schulhof, in welcher sich unsere Klasse und die der Austauschschüler gegenüberstanden, sich Prügel androhten und beschimpften. Natürlich haben wir dabei wieder Tränen gelacht, was den Konflikt nicht so recht entspannte. Mithilfe der unendlichen Weisheit des Internets habe ich einen Teil dieses Schlagabtausches rekonstruieren können:
"Dummä Siäch, ih hoff, das dini Mueter dir no spätzytig abtribt! Heb d’Schnurrä!"
Man bat uns quasi, auf unser vorlautes Mundwerk zu achten und empfahl dabei unseren Müttern, eine Art nachträglichen Schwangerschaftsabbruch an uns zu vollziehen. Dabei sagt man den Schweizern doch nach, ein friedliebendes Volk zu sein. Das ist, als würde Rolf Zuckowski plötzlich Punkrock produzieren. Verstörend. Um diesem Typen, der unser Gästezimmer bewohnte, heimzuzahlen, dass er nicht so war wie ich ihn mir ursprünglich vorgestellt hatte, stibitzte ich ihm eines Abends seinen analogen Fotoapparat, in den tatsächlich noch ein richtiger Film eingelegt war und machte damit vor dem Spiegel ein paar Fotos von meinem nackten Hintern. Das hatte ich mir von Bart Simpson abgeguckt, der das in der bekannten Zeichentrickserie regelmäßig tat und damit nicht selten für Furore und Lacher sorgte. Ich knipste also so lange vor mich hin, bis der Film voll war und legte die Kamera dann wieder zurück an ihren Platz. Der doofe Schweizer würde sich wundern, wenn er die Bilder entwickeln ließ. Dem hatte ich es gezeigt! Natürlich ahnte ich nicht, dass das für mich ziemlich nach hinten losgehen könnte. Als der Austausch eine Woche später sein Ende fand, atmete vermutlich jeder Beteiligte erleichtert auf und ging seiner Wege. Unser Schulleiter hielt es allerdings aus unerfindlichen Gründen für eine gute Idee, jeden von uns dazu zu verpflichten, postalisch in Kontakt zu bleiben. An den Inhalt dieser aufgezwungenen Brieffreundschaft kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern, allerdings an die beigefügten Fotos und Negative aus der Kamera meines Austauschschülers. Fast jeder aus meiner Klasse bekam ein Exemplar zugeschickt. Schade, dass mein Arsch auf den Bildern so unschön getroffen war. Faltig, haarig, unvorteilhaft belichtet und die Backen viel zu weit gespreizt. Doof für mich. Selbstverständlich machten die Bilder in den darauffolgenden Tagen an meiner Schule ziemlich die Runde - dagegen war ich relativ machtlos - also tat ich so, als wäre es mir egal und meine idiotischen pickeligen Mitschüler fielen voll darauf rein. Bereits nach zwei Wochen krähte kein Hahn mehr nach der Geschichte. Dazu kam, dass in dieser unreifen Teenagerwelt ständig irgendetwas vermeintlich Skandalöses passierte, weswegen ich mit meinen Arschfotos nur einer von Vielen war, der kurzzeitig mal im Fokus des pubertären Gelächters stand.
Nur wenige Monate später kamen die ersten Kamerahandys auf den Markt und immer, wenn ich mir diese Tatsache rückblickend mal durch den Kopf gehen lasse, komme ich zu der Erkenntnis, dass ich mich eigentlich ziemlich glücklich schätzen kann. Ich behaupte sehr oft, in die falsche Zeit hineingeboren zu sein. Eine Jugend in den wilden Siebzigern, als junger Erwachsener in den frühen Achtzigern, Kinder kriegen in den Neunzigern und ab den Zweitausendern dankbar dafür sein, dass man die letzten tollen Jahrzehnte der Welt noch aktiv miterleben durfte – das wäre was gewesen. Wenn ich mir allerdings vorstelle, ich hätte auch im Zeitalter von Social Media und WhatsApp aufwachsen können und mir ausmale, wie diese Geschichte wohl heutzutage ausgegangen wäre, dann hab‘ ich es mit meinem Baujahr 1988 noch ganz gut erwischt.
Meinen Arsch habe ich übrigens seitdem nie wieder auch nur eines Blickes gewürdigt. Echt nicht schön, das Teil.
Das zweitbeste Referat der Welt
Referate. Als es damit in der Schule losging, waren vermutlich die Wenigsten davon begeistert. Viel Arbeit in etwas stecken, das du anschließend frei und überzeugend vor Menschen vorzutragen hast, die nur darauf warten, dass du einen Fehler machst.