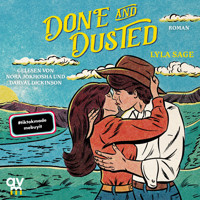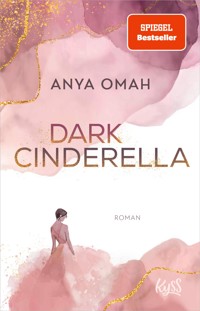9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist eine der bekanntesten Patientinnen des 20. Jahrhunderts: Dora, das jüdische Mädchen mit der ‹petite hystérie› und einer äußerst verschlungenen Familiengeschichte. Dora, die kaum achtzehn war, als sie es wagte, ihre Kur bei Sigmund Freud vorzeitig zu beenden, und ihn, wie er es fasste, «um die Befriedigung [brachte], sie weit gründlicher von ihrem Leiden zu befreien». Für Katharina Adler war die widerständige Patientin lange nicht mehr als eine Familien-Anekdote: ihre Urgroßmutter, die – nicht unter ihrem wirklichen Namen und auch nicht für eine besondere Leistung – zu Nachruhm kam und dabei mal zum Opfer, mal zur Heldin stilisiert wurde. «Nach und nach wuchs in mir der Wunsch, dieses Bild von ihr zu ergänzen, ihm aber auch etwas entgegenzusetzen. Ich wollte eine Frau zeigen, die man nicht als lebenslängliche Hysterikerin abtun oder pauschal als Heldin instrumentalisieren kann. Eine Frau mit vielen Stärken und auch einigen Schwächen, die trotz aller Widrigkeiten bis zuletzt um ein selbstbestimmtes Leben ringt.» Von ihr, von «Ida», handelt dieser mitreißende Roman. Mit großem gestalterischem Weitblick und scharfem Auge für jedes Detail erzählt Katharina Adler die Geschichte einer Frau zwischen Welt- und Nervenkriegen, Exil und Erinnerung. Eine Geschichte, in die sich ein halbes Jahrhundert mit seinen Verwerfungen eingeschrieben hat. «Ida» ist ein Plädoyer für die Wahrheit der Empfindung und die Vielfalt ihrer Versionen. Der Roman eines weitreichenden Lebens, das – mit Freuds Praxistür im Rücken – erst seinen Anfang nahm.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Katharina Adler
Ida
Roman
Über dieses Buch
Sie ist eine der bekanntesten Patientinnen des 20. Jahrhunderts: Dora, das jüdische Mädchen mit der «petite hystérie» und einer äußerst verschlungenen Familiengeschichte. Dora, die kaum achtzehn war, als sie es wagte, ihre Kur bei Sigmund Freud vorzeitig zu beenden, und ihn, wie er es fasste, «um die Befriedigung [brachte], sie weit gründlicher von ihrem Leiden zu befreien».
Für Katharina Adler war die widerständige Patientin lange nicht mehr als eine Familien-Anekdote: ihre Urgroßmutter, die – nicht unter ihrem wirklichen Namen und auch nicht für eine besondere Leistung – zu Nachruhm kam und dabei mal zum Opfer, mal zur Heldin stilisiert wurde. «Nach und nach wuchs in mir der Wunsch, dieses Bild von ihr zu ergänzen, ihm aber auch etwas entgegenzusetzen. Ich wollte eine Frau zeigen, die man nicht als lebenslängliche Hysterikerin abtun oder pauschal als Heldin instrumentalisieren kann. Eine Frau mit vielen Stärken und auch einigen Schwächen, die trotz aller Widrigkeiten bis zuletzt um ein selbstbestimmtes Leben ringt.»
Von ihr, von «Ida», handelt dieser mitreißende Roman. Mit großem gestalterischem Weitblick und scharfem Auge für jedes Detail erzählt Katharina Adler die Geschichte einer Frau zwischen Welt- und Nervenkriegen, Exil und Erinnerung. Eine Geschichte, in die sich ein halbes Jahrhundert mit seinen Verwerfungen eingeschrieben hat. «Ida» ist ein Plädoyer für die Wahrheit der Empfindung und die Vielfalt ihrer Versionen. Der Roman eines weitreichenden Lebens, das – mit Freuds Praxistür im Rücken – erst seinen Anfang nahm.
Vita
Katharina Adler wurde 1980 in München geboren, wo sie nach Stationen in Leipzig und Berlin heute wieder lebt. Für das Manuskript ihres ersten Romans, «Ida», erhielt sie das Literaturstipendium des Freistaats Bayern und wurde 2015 für den Döblinpreis nominiert.
Impressum
Die Entstehung dieses Romans wurde gefördert durch ein Literaturstipendium des Freistaats Bayern.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Umschlagabbildung: Mit freundlicher Genehmigung von Nancy Adler Montgomery (aus: Kurt Herbert Adler and the San Francisco Opera: Oral History Transcripts / 1994. University of California Libraries, Call number ucb_banc:GLAD117869299)
ISBN 978-3-644-04711-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für die Adlers
und für Benjamin Fröhlich
I
New York City, 1941
Ankunft
Ida sah nichts außer Rücken, Hüten, Haaren und Himmel, als kurz vor Ellis Island Hunderte Passagiere an Deck der Serpa Pinto drängten. Statt sich um einen besseren Blick zu bemühen, zündete sie sich eine Ankunftszigarette an.
Am New York Harbor kamen die Ärzte an Bord. Name? Ida Adler. Alter? 58, Hautfarbe, medium, Haarfarbe, grey. Sie steckten Ida ein Thermometer in den Mund und prüften, ob ihre Augen klar waren. Dann trugen sie unter dem Punkt physischer und mentaler Gesundheitszustand good ein, worüber Ida lachen musste. Diese Ärzte, die von nichts eine Ahnung hatten.
Ein Beamter fragte sie nach ihrem Herkunftsort, Vienna, letzter Wohnort, Montauban, welche Sprachen sie spreche, German/English/French/Italian, ob sie Polygamistin sei, also wirklich nicht, Anarchistin, konnte man auch nicht behaupten. Sozialdemokratin, sagte sie stolz, aber der Beamte sah sie gleichgültig an. Er klassifizierte sie als Hebrew und schickte sie zu einem Kollegen von der Einreisebehörde. Der fragte, ob sie schon einmal in den Vereinigten Staaten gewesen sei, nein. Ihre Nationalität? Staatenlos, die Staatsbürgerschaft habe sie in Frankreich abgelegt, als es zu gefährlich geworden sei. Ihre Einreiseerlaubnis?
Ida gab sie ihm, er zeichnete das Visum ab und wandte sich mit einem geleierten Welcome to America dem Nächsten zu.
Am Ausgang wurde gedrückt und geschoben. Ida hielt ihren Koffer umklammert und beeilte sich, die Gangway hinunterzukommen, um sich eine weitere Zigarette anzustecken, die erste auf festem Boden nach dreizehn Tagen Überfahrt. Vor ihren Augen schwankte es, als habe sie immer noch Meer unter den Füßen. Mit jedem Zug hoffte sie, dass der Schwindel sich bessern würde.
In der Nähe hatten sich ein paar Fotografen versammelt, um die Ankommenden zu beobachten, wohl in der Hoffnung, dass sich ein Prominenter unter den Flüchtlingen auf dem Dampfer befunden hatte. Von ihr nahm keiner Notiz.
Sie schnippte ihre Zigarette zu Boden. Der Schwindel war nicht vergangen, aber es half ja nichts. Kurt hatte ihr gekabelt, dass er sie nicht werde abholen können, er habe jeden Abend Dienst in der Oper, aber er wolle zusehen, dass einer komme, der sie zum Zug nach Chicago bringen werde.
Ida suchte in der Menge nach einem bekannten Gesicht – sie rechnete mit einem der Genossen –, als ihr ein schlanker Mann ins Auge fiel. Er war in Kurts Alter, hielt einen Nelkenstrauß in Händen und ein Papier, auf dem ihr Name stand.
Keiner der Genossen würde Blumen bringen, überlegte sie. Das wäre Geldverschwendung.
«Es sieht aus, als warteten Sie auf Ihre Liebste», sagte sie dann auf Deutsch. «Aber da haben Sie leider den falschen Namen auf Ihrem Papier.»
«Frau Adler!» Der Mann hob seinen Hut. «Hocherfreut, gnädige Frau. Magner, mein Name, Martin Magner. Kurt schickt mich.»
Er reichte ihr den Blumenstrauß und bückte sich, um ihr den Koffer abzunehmen. Sie überließ ihn ihm nur zögerlich.
«Und wer sind Sie genau, wenn ich fragen darf?»
Magner setzte den Koffer auf dem Boden ab, um das Blatt mit Idas Namen einzustecken. «Ein ehemaliger Kollege aus der Zeit in Reichenberg, und mittlerweile darf ich mich hoffentlich auch Freund nennen.»
«Ein Freund, aha», wiederholte Ida.
«Ihr Sohn ist ein großherziger Mann. Er hat dafür gesorgt, dass ich hierherkommen konnte.» Magner sah sie direkt an. «Kurt hat mich gerettet.»
Ida nahm den Koffer wieder selbst in die Hand. «Na, da hatten Sie Glück, lieber Herr Magner. Bei seiner Mutter hat er sich mehr Zeit gelassen.» Sie atmete tief ein und spürte, wie ihr die Kehle eng wurde. «Um ein Haar hätt’s nicht gereicht.»
Magner lächelte ihre Worte fort. «Aber jetzt sind Sie hier, und ich sorge dafür, dass Sie gut auf den Weg nach Chicago kommen.»
Er bot ihr den Arm. Kurz stutzte sie, verstand nicht recht, was er ihr mit der Geste bedeuten wollte. Verstand dann doch. Sie war wirklich zu lange von jeglichem zivilen Umgang abgeschnitten gewesen.
Sie hakte sich unter und ließ sich von Magner aus dem Hafengelände führen. Noch eine Lockerungszigarette, während sie gingen. Magner sah auf die Uhr.
«Wir haben drei Stunden. Wollen Sie vielleicht etwas zu sich nehmen?»
«Was schlagen Sie vor?»
«Hier in der Nähe gibt es einen chinesischen Imbiss.»
«Chinesisch!» Ida lachte ungläubig. «Solange es keine Linsen sind. Die habe ich in Marokko zur Genüge gehabt.»
«Sie müssen meine Neugier entschuldigen», sagte Ida nach einem langen Blick in ihren Suppenteller. «Am Reichenberger Theater haben Sie sich kennengelernt, sagen Sie? Weshalb habe ich nie von Ihnen gehört? Obwohl», sie griff nach dem Suppenlöffel, «wundern darf es mich nicht. Bei meinem Sohn kann ich schon froh sein, wenn er mir die Ehefrau vor der Hochzeit vorstellt.»
Resolut bugsierte sie eine bleiche Teigtasche in ihren Mund.
«In meinem Fall dürfen Sie Kurt keinen Vorwurf machen. Wir kannten uns zu der Zeit nur flüchtig.»
Ida hob den Blick. «Und was haben Sie da am Theater gemacht? Wie ein Musiker sehen Sie mir nämlich nicht aus.»
«Sie haben recht. Als Regisseur war ich dort.»
Ida nickte zufrieden. Nicht schlecht, dieses chinesische Maultascherl, wirklich, und die Brühe war auch schön kräftig.
«Haben Sie hier nun auch ein Haus gefunden, an dem Sie arbeiten können?»
«Nicht ganz. Zum Radio hat es mich verschlagen.»
«Ist Ihr Englisch denn dafür gut genug?»
«Ganz und gar nicht.» Magner schmunzelte.
Ida nahm ihr Gegenüber noch einmal ins Visier. Die hellen, klugen Augen, das sympathische Gesicht. Aber ungewöhnlich große Ohren hatte er, dieser Martin Magner.
«Wegen Ihres Aussehens wird man Sie wohl kaum genommen haben.»
Jetzt lachte Magner frei heraus. «Nein, nein, ich führe schon immer noch Regie. Bei einer Radioserie.»
Ida sah ihn fragend an.
«Das können Sie sich vorstellen wie ein kurzes Theaterstück mit täglicher Fortsetzung», erläuterte er, «nur eben nicht auf der Bühne, sondern im Hörfunk.»
«Aber wofür braucht es denn einen Regisseur, wenn nichts zu sehen ist?»
«Da gibt es genug zu tun», erwiderte Magner. «Wenn Sie wieder einmal hierherkommen, können Sie mich gern im Studio besuchen.»
Ida faltete die Hände vor ihrem Bauch. Wohlig warm fühlte der sich an. Und wie lange war es her, dass sie so ohne irgendeine Sorge hatte plaudern können?
«Am Ende stehe ich früher in Ihrem Studio, als Ihnen lieb sein kann», erwiderte sie.
Magner hob die Hand, um nach der Rechnung zu bitten. «Das würde mich freuen. Nur jetzt, fürchte ich, müssen wir zum Zug.»
Kurt hatte im Schlafwagen reserviert. Als sie das richtige Abteil gefunden hatten, stemmte Magner ihren Koffer in die Ablage über der Pritsche. Ida war ans Waschbecken getreten. Sie steckte den Pfropfen in den Abfluss und ließ Wasser ein, doch es floss ab. Sie raffte ihre Ärmel, drückte den Pfropfen noch tiefer ins Becken. Es half nichts, das Wasser verrann weiter.
«Ich fürchte, die Blumen werde ich nicht mitnehmen können.»
«Doch, doch, ich bestehe darauf», sagte Magner. Er zog sein Stofftaschentuch aus der Hosentasche, befeuchtete es, umwickelte damit die Blumenstiele und legte den Strauß ins leere Becken. «Ich sollte langsam … Kann ich noch etwas für Sie tun?»
Ida gab ihm die Hand. «Hat mich gefreut, auf Wiederschauen», sagte sie. Aber dann ließ sie seine Hand nicht los. Die war so weich, so freundlich.
Sie spürte seine Hand noch in ihrer, als der Zug schon abgefahren war, sah die Blumenköpfe über dem Beckenrand wippen, war jetzt doch froh, den Strauß dabeizuhaben. Blumen konnten sie beruhigen, wie sonderbar. Es waren wohl wirklich neue Zeiten angebrochen. Eine ganze Weile starrte sie so vor sich hin. Aus dem Fenster wollte sie nicht sehen, hinaus nach Amerika, das auch wieder nur eine Landschaft war wie das Meer. Vor über zwei Jahren hatte sie Wien verlassen, seit vier Monaten war sie unterwegs. Sie war so erschöpft.
Wenn die letzten Stunden vor einer Ankunft plötzlich quälender scheinen als die Wochen und Tage zuvor. Wenn ein Abteil zum Käfig wird, aber man nicht einmal die Kraft hat aufzustehen. Wenn man sich zu erinnern versucht an dieses New York, aber da nichts ist außer dem feinen Lächeln eines Martin Magner und dem Geschmack von chinesischem Essen. Wenn dieses fremde Essen eigentlich eine gute Stärkung war, aber der Körper nicht nur schwankt, sondern bis hinter die Augen vibriert, und keine Zigarette etwas dagegen ausrichten kann und noch eine nicht und eine weitere auch nicht. Wenn man einschläft und wieder hochschreckt und es immer noch Stunden sind. Wenn man sich die Zeit vertreiben will und an den eigenen Sohn denken, aber da nur sein Kindergesicht erscheint, nicht das des erwachsenen Mannes, und Hände, die einen Takt suchen, keinen finden, wie wild wirbeln. Wenn der Sohneswirbel die Luft im Abteil so verdickt, dass kaum noch etwas in Mund und Nase passt.
«Mama!», rief Kurt. «Mama, ist Frühstück vor der Ankunft erwünscht?»
Das war der Schaffner. Ma’am, hatte er gesagt, nicht Mama.
Kurze Zeit später stand eine wahre Käfigmahlzeit vor ihr. Ein Toast mit ranziger Butter und wässriger Kaffee.
«Mama!», rief Kurt. Idas Fuß suchte nach dem Bahnsteig. Über ihre Schulter sah sie sein Gesicht. Ein Schub Freude ging wie ein heller Lichtstrahl durch sie hindurch. Gleich würde sie ihn umarmen können. Ihre Schuhspitze ertastete festen Boden. Sie kam mit beiden Sohlen auf dem Bahnsteig auf und drehte sich zu ihm. Aber an Kurts Stelle stand eine junge Frau.
Ida blickte an ihr hoch, auf ihren langen Hals, den Puppenkopf mit zurückgebundenem Haar und daneben, um einiges kürzer, Kurt.
«Darf ich vorstellen, Mama. Das ist Diantha», sagte er und wechselte ins Englische. «This is my mother, dear.» Er schob seinen Arm in den Rücken der jungen Frau und griff um ihre Hüfte.
Der Lichtstrahl in Ida verblasste. Sie hatte gehofft, dass er sie nicht mitbringen würde, wenigstens nicht zu ihrem ersten Wiedersehen. Sie ignorierte die Hand, die Diantha ihr entgegenstreckte, trat einen Schritt zur Seite.
«Wo geht es zum Ausgang, zum Ausgang müssen wir, oder gibt es nur einen Eingang, einen Eingang, aus dem wir hinausmüssen?»
Sie hastete los. Kurt und Diantha folgten ihr.
«Ist das hier richtig?», fragte Ida. «So hilf mir doch, Kurt! Du lebst hier, du solltest vorausgehen.»
Kurt überholte sie, Diantha blieb zurück.
«In New York mir einen Wildfremden an die Seite schicken! Ich war davon ausgegangen, du würdest einem der Genossen meine Ankunft übermitteln.»
«Ich dachte, wir müssen die Hilfe der Genossen nicht weiter strapazieren.» Kurt sah sich über die Schulter um. «Außerdem hat mir Martin berichtet, dass ihr erfreuliche Stunden verbracht habt.» Er kehrte ihr wieder den Hinterkopf zu.
«Natürlich haben wir das», rief Ida über den Gleislärm hinweg. «Ich werde doch einen Freund meines Sohnes nicht brüskieren … Er sagt, du hast ihn gerettet.»
«Ach was, ein paar Behördengänge, mehr nicht.»
«Bei deiner Mutter hast du dich schwerer getan …»
Jetzt drehte Kurt sich nicht um. «Mama, bitte!», rief er. «Außerdem bist du ja jetzt da und, wie ich sehe, auch sehr munter.»
Ida spürte die lange Frau in ihrem Rücken. Kurt vor ihr federnden Schritts und mit einer Leichtigkeit, die der Situation ganz und gar nicht angemessen war. Immer noch stiegen Passagiere aus dem Zug.
Sie schaute auf den welken Strauß. «Blumen auf der Durchreise übrigens. Eine selten unpraktische Idee.»
Diantha rief, über Idas Kopf hinweg: «Her suitcase, Kurt. Don’t let her schlep that thing by herself!»
Kurt griff nach dem Koffer. «Ich besorge euch ein Taxi, Diantha zeigt dir unsere Wohnung, und du kannst dich ausruhen. Ich muss noch ins Theater.»
Da packte Ida ihn am Handgelenk und sah ihm streng in die Augen. «Ich komme mit dir.»
«Du bist doch sicher müde.»
«Im Zug habe ich genug geschlafen.»
«Es ist nur eine Probe.»
Diantha hatte zu ihnen aufgeschlossen und sah Kurt fragend an.
Ida hob die Hände zum Himmel. «Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als in einer Stadt mit Musik empfangen zu werden.» Gib mir wenigstens das, wenn du unser Wiedersehen schon mit dieser neuen Ehefrau vermasselst. Das dachte sie nur.
«Bei einer Probe kann man doch kaum von einem musikalischen Willkommensgruß sprechen, ständig wird unterbrochen, ständig wiederholt.»
Idas Unterkiefer begann zu zittern. «Du willst deine Mutter nicht dahaben. Sag es doch einfach!»
Kurt warf Diantha einen kurzen Blick zu und holte tief Luft. «Aber beschwer dich nicht, wenn ich dich hinten in den obersten Rang setze. Ich kann nicht einfach Familie mitbringen, wie es mir passt.»
«Glaub mir», Ida hob die Hand vors Gesicht, «wenn ich etwas die letzten Jahre gelernt habe, dann, wie man sich unsichtbar macht.»
Im Taxi zwischen Kurt und Diantha auf der Rückbank. Ida steckte sich eine Zigarette an und legte ihre Hand, die brennende Zigarette zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, mütterlich auf Dianthas Knie.
«Sie sind also die neue Frau meines Sohnes.»
Diantha kurbelte das Taxifenster hinunter und nickte.
«Die zweite.» Ida hob die Stimme. «Du hast ihr doch gesagt, dass du schon einmal verheiratet warst?» Und zu Diantha: «Ganz wunderbare Person, die Trudi. Sängerin.»
Kurt erwiderte ungerührt: «Diantha schreibt. Sie hat Short Storys veröffentlicht. Außerdem spielt sie hervorragend Viola und ficht.»
Ida ließ die Zigarette, die sich einfach nicht familiär rauchen lassen wollte, über Dianthas Oberschenkel abbrennen.
«Die Feder, die Viola und das Florett, drei elegante Waffen.»
Diantha blickte auf die Zigarette hinunter und begann, mit dem Oberschenkel zu wippen.
Sie betrachte sie lieber als Instrumente, entgegnete sie.
Kopfschüttelnd beugte Ida sich vor, um die Asche neben Diantha am Fensterrand abzustreifen. Zu Kurt sagte sie auf Deutsch: «Ich verstehe deine neue Frau nicht.»
Kurt deutete nur durch die Windschutzscheibe nach vorn. «Das Opernhaus.»
Ida vergaß, was sie eben noch hatte sagen wollen. Sie schluckte. Endlich wieder ein Theater.
Der Zuschauerraum lag im Dunkeln. Ein Männerchor stand in Alltagskleidung auf der erleuchteten Bühne. Davor eine Reihe Solisten auf Stühlen. Kurt ging zwischen den Sängern hin und her, gab Anweisungen. Dann nickte er dem Dirigenten im Orchestergraben zu, er könne nun die Stelle zusammen mit den Instrumentalisten proben.
Über dreitausend Sitze hinweg die Stimme des Sohnes im Ohr. Ida schloss die Augen. Der Gesang und der volle Klang des Orchesters. Das war eine Wohltat, die sie viel zu lange hatte vermissen müssen. Bald mischten sich in die Musik aber Misstöne. Erinnerungen, Bilder, die da nicht hingehörten. Sie versuchte, sie zu verscheuchen, doch sie blieben: Lautsprecherdurchsagen, das Blut geschlachteter Ziegen, Männerhände, die sie wuschen und pflegten …
Eine Berührung an der Schulter. Sie schreckte auf. Da war sie wieder, die neue Frau. Die behauptete, sie sei eingeschlafen. Eigentlich habe sie sie nicht wecken wollen. Aber dann habe sie doch zu laut geschnarcht.
Chicago, 1941
Das Täschchen
Die Avenue nahm in beide Richtungen kein Ende. Ida sah sich verwirrt um. Wie war das möglich, sich hier zu verlaufen, auf einer Straße, die so gerade war wie keine in ganz Europa?
Sie schnappte nach Luft. Und war es nicht auch viel zu warm für einen Tag im November?
Auf der Suche nach dem nächstbesten Halt stützte sie sich auf den Griff einer Ladentür. Die Tür gab nach, und Ida fiel in den Laden. Ein weiß bekittelter Verkäufer kam heran, grüßte.
Ida grüßte nicht zurück, hielt sich noch immer am Türgriff fest und suchte nach Orientierung. Gürtel sah sie über einem Tresen hängen und Koffer, die sich in Regalen türmten. In so einen Laden wollte sie nicht, aber der unendlichen Avenue entgehen, das schon.
Ob sie plane zu verreisen, drang es an ihr Ohr.
Hatte das der Koffer gefragt, oder war es von dem weißen Kittel gekommen?
Ida schüttelte energisch den Kopf. Reisen, nirgends einmal angekommen sein. Nein. An eine neuerliche Reise wollte sie wirklich nicht denken.
Ob sie sich nicht erst einmal setzen wolle?
Sie fasste nach dem Arm, der sich ihr bot, und ließ sich zu einem Sofa in der Mitte des Geschäfts führen. Warm war es in dem Laden, noch wärmer als auf der Straße. Das Mädchen, das hinter dem Tresen Handschuhe sortierte, hatte die Blusenärmel aufgekrempelt.
Der Kittel half ihr, sich zu setzen. Sein Gesicht glänzte. Ob er ihr einen Kaffee anbieten dürfe, fragte er.
Ida nickte. Ein starker Kaffee war bestimmt das Richtige, um wieder zu Kräften zu kommen. Sie sah dem Mädchen nach, das beim Tresen in ein Hinterzimmer verschwand. Sie wäre lieber nicht mit dem Mann allein geblieben. Unwillkürlich prüfte sie, ob der Laden Rollbalken hatte, die er herunterlassen könnte.
Da streckte ihr der Kittel eine kleine Tasche entgegen: Ob sie sehe, was das Besondere hieran sei?
Er streichelte über das Leder. Ida sah ihn verständnislos an. Das Mädchen war mit einem Tablett herangekommen und lächelte ihr zu.
Dankbar nahm Ida Tasse und Untertasse entgegen und trank einen Schluck. Der Kaffee belebte sie, aber er trieb ihr auch den Schweiß auf die Stirn.
Das Mädchen bot an, ihr den Mantel abzunehmen. Doch der Kittel wollte ihr selbst beim Ablegen helfen. Dabei schmuggelte er die Tasche in ihre freie Hand.
Diese hier, er deutete auf die Tasche, sei für den täglichen Gebrauch, sehr handlich, dabei aber doch elegant. Er sagte es in einem Ton, als könnte man mit der richtigen Tasche den Weltenlauf beeinflussen.
Ida streckte sie ihm wieder entgegen. «Vielen Dank, aber ich bin nicht interessiert.»
«Oh, ich sehe, nicht elegant genug? Vielleicht kann ich Sie für die Ausführung in Krokodilleder begeistern?»
«Wie bitte?», fragte Ida. «Sie müssen schon entschuldigen.»
«Diese Tasche hier», sagte der Kittel überdeutlich, «ist aus dem Leder eines Krokodils.»
Ida schüttelte wieder den Kopf. «Sie verstehen mich falsch. Ich will sagen: Sie haben wohl gar keinen Sinn für die Zeiten, in denen wir leben.»
«Gerade in diesen Zeiten, madam, muss man sich doch auch etwas gönnen», erwiderte der Verkäufer.
Ida legte die Tasche auf ihre Knie, weil er noch immer keine Anstalten machte, sie ihr abzunehmen.
«Wissen Sie», sie räusperte sich. Der Kittel hatte sich zu ihr gebeugt, kam noch näher heran und mit ihm der Geruch von Minzpastillen und gegerbtem Leder. Sie räusperte sich erneut.
«Sie müssen wissen», setzte sie lauter fort, um den Mann wieder auf Abstand zu bringen und diesen Geruch nicht mehr in der Nase haben zu müssen. «Es ist bestimmt, also bestimmt, lassen Sie mich nachrechnen, es ist fast vier Jahrzehnte her, seit ich zum letzten Mal, also dass ich überhaupt eine Tasche getragen habe.»
«Wie bitte, was sagen Sie? Unbelievable», rief der Kittel und setzte sich neben sie.
In ihren Händen begannen Tasse und Untertasse zu klappern. Der Verkäufer rückte noch näher heran und sagte nun etwas von Summer Sale an diesem besonders warmen Novembertag.
«Sie haben sich das Stück noch gar nicht richtig angesehen.» Er deutete auf die Tasche in ihrem Schoß. «Darf ich?» Ohne ihr Einverständnis abzuwarten, öffnete er den Verschluss. Ein rosa Innenfutter kam zum Vorschein. Der Kittel lobte das Material, Wildseide, edel, dabei unempfindlich.
Und dann musste sie zusehen, wie er mit seinen Fingern im Futter zu fuhrwerken begann. Ida zuckte zusammen.
Wildseide, rosa Wildseide, und diese Finger, scheußlich, einfach grauenhaft. Sie wollte aufstehen, schnell hinaus aus diesem Geschäft, sie gab sich einen Ruck. Aber es gelang ihr nicht, das Polster war zu weich, sie kam nicht auf die Beine.
Die Tasche rutschte von ihrem Schoß, sie selbst fiel zurück, wobei ihr auch noch die Tasse entglitt, zu Boden ging und zerbrach.
Entsetzt starrte der Kittel auf die kaffeebesudelte Tasche.
«Verzeihen Sie», entschuldigte sich Ida. «Ich bitte …», erneut versuchte sie aufzustehen. «Ich bitte vielmals …» Das Mädchen zog sie auf die Beine, drückte ihr den Mantel in den Arm.
«Lass», blaffte der Kittel. «Kümmere dich lieber um die Scherben.»
Sie hörte nicht auf ihn, brachte Ida zur Tür, schob sie auf die Straße und vergewisserte sich, dass sie nicht noch einmal auf die Idee käme einzutreten.
Ida kam nicht auf die Idee.
«Im Leben nicht, nie wieder!» Sie hastete los. «Gut, dass dieses Mädel mich hinaushat, am Ende hätte der noch … ich hätte dem auf keinen Fall etwas gezahlt.»
Sie zitterte, versuchte, ihren Mantel wieder anzuziehen, verhedderte sich, stieg auf den Saum. Passanten schauten ihr nach, während sie mit dem Mantel rang.
«Summer Sale im Winter! So ein Schmarren.»
Kurt wartete schon ungeduldig, als sie die Wohnungstür aufsperrte. Der Esstisch im Wohnzimmer war zum Abendessen gedeckt, eine Flasche Champagner stand zwischen den Tellern.
«Wir wollten schon längst gegessen haben, Mama. Ich muss gleich zur Vorstellung.»
«Warum habt ihr nicht ohne mich angefangen?»
«Weil heute ein Freudentag ist. Für uns alle.» Er drückte ihre Hand.
Sie machte sich los. «Davon habe ich nichts bemerkt.»
Diantha hievte in der Küche einen Truthahn aus dem Rohr. «Jetzt ist das Fleisch bestimmt trocken», rief sie unglücklich.
«Das macht doch nichts», erwiderte Kurt gut gelaunt. «Wir spülen es mit Champagner hinunter.»
«Bekommst du mehr Geld am Theater?», fragte Ida mit einem Blick auf die teure Flasche.
«Nein, Mama. Es gibt andere Dinge zu feiern. Die erste Neuigkeit wird einiges einfacher machen, die andere nicht unbedingt. Aber beides ist ganz wunderbar.» Er ging zur Anrichte und nahm ein Papier zur Hand. «Von heute an», verkündete er, «bin ich Amerikaner!»
«Du hast mir gar nicht gesagt …» Ida brach ab und streckte die Hand aus. «Gib mir das.» Sie begutachtete das Certificate of Citizenship und legte es wieder zur Seite.
«Ich gehe davon aus, dass das gut ist», sagte sie so ungerührt wie möglich.
Kurt zog den Korken aus der Champagnerflasche.
«Und ob. Sehr gut sogar. Die Amerikaner lieben frischgebackene Amerikaner.»
Er füllte zwei Gläser, stellte sie vor Diantha und Ida ab, nahm sich, noch immer stehend, ein Stück Fleisch und tunkte es in die Sauciere. «Ich muss los.»
«Kurt, die Staatsbürgerschaft war erst eine Sache. Was ist die zweite?»
Er steckte sich das Truthahnstück in den Mund, «Das kann auch Diantha», verschwand kauend im Flur. Sie hörten die Wohnungstür ins Schloss fallen.
Ida sagte nichts. Diantha auch nicht.
Ida wandte sich dem Fleisch und den Süßkartoffeln zu. Aus dem Augenwinkel sah sie Diantha den Champagner hinunterstürzen. «Well», sagte Diantha und stockte. Schweigend schenkte sie sich ein weiteres Glas ein und bot auch ihr die Flasche an.
Ida lehnte ab.
«Es ist bestimmt nicht leicht, dass Kurt nicht mehr Austrian ist», sagte Diantha nach dem zweiten Glas.
Ida schaute von ihrem Teller auf. «Austrian? Das ist gar nicht mehr möglich. Von mir aus könnte er jetzt auch Turkey werden.»
«Turkish», korrigierte Diantha zerstreut.
Ida packte ihre Gabel. «Kurt und du», sagte sie, «ihr scheint mir wegen eurer Neuigkeiten doch sehr aufgeregt zu sein.» Sie fuchtelte in Dianthas Richtung. «Heraus damit. Geheimniskrämerei ist mir ein Graus!»
«Kurt und ich», Diantha drehte an ihrem Ehering. «Unsere Familie wird sich vergrößern.»
Sie legte eine Hand auf ihren Bauch. Ida folgte der Hand mit dem Blick. Sie nickte, legte langsam ihre Gabel auf den Teller zurück, schwieg. Diantha sah sie erwartungsvoll an.
«Du solltest wissen», sagte Ida schließlich, «dass ich Huhn für das bessere Geflügel halte und jedem Truthahn vorziehe.» Sie nahm ihre Serviette, faltete sie sorgfältig und stand auf. «Ich muss mich hinlegen. Mein Herz will heute nicht richtig.»
In der Tür drehte sie sich noch einmal um. «Kurt werde ich selbstverständlich sagen, dass ich mich freue.»
Chicago, 1942
Der Bauch
Wenn man sich wünscht, die neue Schwiegertochter bilde sich die Schwangerschaft nur ein, und doch meint, zwei Herzen durch die Wände schlagen zu hören, ein großes und ein winzig kleines, unrhythmisch und viel zu laut. Wenn man so müde ist und doch so wach, so schmerzhaft wach. Wenn man noch immer die Augen des Mädchens hinter der Ladentüre sieht und an die Gendarmen denken muss und die überfüllten Züge. Wenn sich alles übereinanderschiebt: Augen, Taschen, Finger. Wenn jede Nacht wie eine viel zu lang währende Reise ist, bei der man zwar weiß, woher man kam, aber sich fürchtet, wohin es geht. Wenn man sich fortwährend sagen muss, dass man gerettet ist, in Sicherheit, und trotzdem bangt. Wenn man sich immer weiter wünscht, die neue Schwiegertochter bilde sich die Schwangerschaft nur ein.
Aber das Wünschen half nicht, bald schon wölbte sich der Bauch. Ida wollte gar nicht hinsehen. Wenn es Trudis Bauch gewesen wäre, dann wäre sie vielleicht gerührt gewesen. Das hatte auch damit zu tun, sagte sie sich, dass jenes Kind an einem anderen Ort, zu ganz anderen Zeiten geboren worden wäre. Eine Unzeit war das. Nur hier in der Leland Avenue meinte der Frühling trotz allem knospen zu können, und die Schwiegertochter ließ trotz allem neues Leben in sich wachsen.
Diantha. Diantha. Jedes Mal brach sie sich fast die Zunge, um den Namen auszusprechen. Kein Wunder, dass es danach bei der Konversation oft schief weiterging. Missverständnisse, ständig. Wenigstens mussten sie beim Kartenspiel nicht reden. Bridge ging leider nicht zu zweit. Canasta war möglich. Ein Kompromiss, den Ida eingegangen war, damit sie überhaupt wieder einmal Karten in die Hand bekam.
Um Geld wollte die Schwiegertochter allerdings nicht spielen. Sie hatte ja gar keine großen Summen vorgeschlagen, aber Diantha hatte nur Knöpfe als Einsatz zugelassen. Ida fand Knöpfe wenig ergiebig, feige geradezu. Irgendwann konnte sie Diantha wenigstens überreden, dass sie um Zigaretten spielten, auch wenn allein Ida sie dann rauchte.
«Kurts Vater muss ein liebenswürdiger Mann gewesen sein», sagte Diantha und schob das Fenster auf.
«Wenn Kurt das so über seinen Vater sagt.»
«Hat er denn Ähnlichkeit mit ihm?»
«Der Kurt mit dem Ernst?»
«Auf einem Foto, das er mir gezeigt hat, sehen sich die beiden durchaus ähnlich.»
«Ich würde meinen, der Kurt sieht höchstens seinem Onkel gleich, sonst ist er ganz sein eigener Mann. Vom Daumen einmal abgesehen.»
«Vom Daumen?»
«Aber ja, die Adler-Daumen mit den kümmerlichen Nägeln. Da müssen wir schon ehrlich sein. Schön sind sie nicht. Geh, Diantha, mach bitte wieder zu. Offene Fenster kann ich so gar nicht leiden.»
Tagein, tagaus war Kurt im Theater. Ida bekam ihn kaum zu Gesicht. Dabei hätte sie ihn so gern begleitet, ganz gleich, was aufgeführt wurde. Nach einer Vorstellung fühlte sie sich erfrischt, konnte auch einmal die nicht enden wollenden Kriegsnachrichten vergessen. Aber nein, nur alle Jubeljahre durfte sie mit ihm in die Oper. Er schien ihr jegliches Vergnügen zu missgönnen.
«Mama, hast du im letzten Monat nach New York telefoniert? Die Rechnung ist horrend.»
«Die Elsa ist doch jetzt dort. Mit der konferiere ich ab und zu.»
«Mit der Elsa? Ich dachte, mit der bist du zerstritten.»
«Schon längst nicht mehr. Wir haben uns in Paris getroffen, im Sozialistenbüro, und das war so ein Glück, da hat sie eingesehen, dass ihr alter Zorn völlig übertrieben war.»
«Das ist ja erfreulich, aber –»
«Ich kann doch nicht einfach auflegen! Sonst reagiert sie wieder empfindlich. Und du weißt ja, sie redet gern ausführlich.»
«Dann soll sie dich anrufen.»
«Unmöglich. So gut sind wir uns auch wieder nicht.»
Kurts spärliches Einkommen machte ihr Sorgen. Noch ein Maul mehr zu stopfen, wie sollte das gehen? Nicht einmal gute Möbel konnte er sich leisten. Wobei Diantha auch besonders scheußliches Mobiliar ausgesucht hatte.
«Deine neue Ehefrau hat einen etwas schmalen Geschmack, findest du nicht?»
«Wie kommst du darauf?»
«Eure Möbel. Das ist doch nicht, wie du dich einrichten würdest.»
«Natürlich nicht, Mama. Diantha aber auch nicht. Wir haben die Wohnung möbliert gemietet.»
«Wie? Das sind nicht einmal deine?»
Was einem nicht gehört, das kann man auch nicht verlieren, versuchte Ida sich einzureden und konnte doch nicht anders, als sich nach einem eigenen Bett zu sehnen. All die Lager der letzten Jahre, sie spürte sie noch in ihren Knochen: die Pritsche in Marseille, die Strohsäcke auf dem Frachter, in Casablanca die Krankenliegen. Als sie mitten in der Nacht erwachte, glaubte sie wie im Fieber, nur ein Bett, das wirklich ihr gehöre, werde ihren Erinnerungen Einhalt gebieten.
Vorher aber müsste wohl eine Wiege her.
Chicago, 1942
Das Enkel
Wie sie über alles hinwegwalzten, das sei nicht zu begreifen!
Kurt dirigierte mit dem Stäbchen eine Phrase. Die ganze Woche hatte er mit dem Chor für die kommende Premiere geprobt, und er ärgerte sich, wie wenig die Sänger von seinen Anmerkungen bisher umgesetzt hatten.
Ida nickte stumm.
Er schlug noch einen Takt und summte, als könnte er alles, was er in der Chorprobe zuvor hatte durchleiden müssen, wenigstens jetzt Korrekturdirigieren. Dann machte er aus dem Taktstock doch noch Besteck und fischte Reis aus seiner Schüssel. Sein Ausdruck wurde weich.
«Morgen kommen Diantha und die Kleine nach Hause.»
Ida tunkte ungerührt ein Dim Sum in die Soße.
«So aufgeweckt ist sie, Mama. Und hübsch, sag ich dir. Wunderhübsch.»
Ida legte die Gabel mit der Teigtasche wieder ab.
«Warum isst du denn nicht?»
Sie hob den Blick nicht vom Teller.
Kurt nahm ihre Hand. «In nächster Zeit wird es einige Partys geben, um Geld für die nächste Opernsaison zu sammeln.»
«Dann wirst du ja viel zu tun haben», sagte sie tonlos.
«Und da Diantha nicht mitkommen wird können, wollte ich dich fragen, ob du nicht … Ich benötige ja eine Begleitung.»
Ida zog ihre Hand weg.
Kurt seufzte. «Würdest du mir den Gefallen tun?»
Ohne ihn anzusehen, erwiderte Ida sehr förmlich: «In der Not stehe ich dir selbstverständlich zur Seite.»
Doch als sie das Enkel dann heimbrachten, half sie nicht gleich, sondern blieb auf dem Bett sitzen und rang die Hände in ihrem Schoß. Sie hörte die Haustür ins Schloss fallen und wartete, bis es klopfte. Sie wollte «Herein» sagen, ein Räuspern gelang ihr.
Die Zimmertür ging auf. Kurt mit dem Säugling im Arm trat zu ihr ans Bett.
Erst waren da nur Kappe und Hemdchen, dann sah sie das Gesichtchen, die geschürzten Lippen, den Flaum der Brauen über den geschlossenen Augen.
Nun, gar so hübsch und gar so aufgeweckt ist sie nicht, sagte sie sich.
Kurt legte ihr den Säugling in den Arm.
Als Erstes prüfte sie die Finger des Mädchens und stellte fest, dass es wohlgeformte Nägel hatte, der Adler-Daumen war ihm erspart geblieben.
Sie rückte den kleinen Körper auf ihrem Unterarm zurecht. Da öffnete das Kind die Augen. Es sah sie direkt an, und Ida konnte mit einem Mal nichts anderes denken als: Wie hübsch sie ist! Wie aufgeweckt! Und in welch feinem Takt ihr kleines Herz hoffentlich schlägt!
Hoffte es auch jetzt, vor der Wiege, die im Wohnzimmer aufgestellt war. Ida spürte den Seidencrêpe des schwarzen Abendkleids an den Waden, strich über die Stickereien an den Schultern.
«Schau, wie elegant deine Großmama endlich wieder einmal ist.» Sie deckte das Kind noch besser zu. «Wo ist der Schmuck, fragst du? Damit kann ich nicht dienen. Ich trage schon lange keinen mehr.»
Der Säugling gähnte.
«Hast recht, das ist nicht weiter schlimm», setzte Ida fort. «Schade ist es nur um die Armbanduhr. Im Pfandhaus hab ich sie gelassen, in Montauban. Warum deine Großmama das getan hat? Damit sie es hierher zu dir schafft! Sonst hättest du womöglich gar keine Großmama mehr.»
«Mama, bitte.» Kurt war ins Zimmer getreten. Ida richtete sich auf. Er reckte ihr den Hals entgegen, damit sie ihm die Fliege binden konnte.
«Sie versteht doch nichts.» Ida nahm die beiden breiten Enden des Stoffstreifens.
«Ich wäre dir dankbar, wenn du so etwas auch nachher nicht ansprichst.»
«Warum denn bitte nicht?» Ida zupfte die Spitzen der Fliege aus und gab ihren Sohn frei.
«Erzähl lieber, wie gern du mit der Kleinen spazieren gehst», sagte Kurt.
«Du willst wohl, dass ich als die langweiligste Person des Abends dastehe.»
Ida sah zu, wie er das Kind aus der Wiege hob und ein Lachen aus ihm herauskitzelte.
«Mother», Diantha hatte, eine Handtasche im Arm, das Zimmer betreten und streckte sie ihr entgegen. «Für deine Zigaretten, dachte ich.»
Unwillkürlich fuhr Ida zurück. «Die brauche ich nicht.»
Diantha setzte die Tasche ab. «Ich lasse sie hier, falls du es dir noch anders überlegst.»
«Da gibt es nichts zu überlegen.»
Kurt übergab Diantha das Kind. «Wir müssen», sagte er und reichte Ida kopfschüttelnd seinen Arm.
«Fang bitte auch nicht von den Sozialisten oder vom Marxismus an», ermahnte Kurt sie im Taxi.
Ida zog sich die Ärmel zurecht und tat so, als hätte sie Kurts Bemerkung nicht gehört.
«Der Diantha hast du erst neulich wieder die Politik vom Onkel Otto erklären wollen, oder nicht?»
«Ja, weil es sie interessiert.»
«Auf der Party interessiert das niemanden.»
«Du traust den Amerikanern wohl gar nichts zu.»
«Ich traue ihnen einiges zu, und deshalb sage ich: Fang nicht damit an. Der Kommunismus hat hier keinen guten Ruf.»
«Mit den Kommunisten habe ich nichts am Hut. Und dein Onkel auch nicht.»
«Mama, ich weiß. Aber hier wird nicht immer so genau unterschieden.»
«Also, das ist doch wirklich alles sonderbar. Dass man für die Oper überhaupt Geld einsammeln muss.» Ida machte eine Pause. «Banausen.»
Kurt rieb sich die Augen.
«Ich sehe schon, mit dir an meiner Seite werden die Spenden nur so auf uns einprasseln.»
Swift & Company, er einer der größten Fleischproduzenten Amerikas, sie eine ehemalige Sängerin aus Deutschland, hatten in ihre Residenz geladen. In der Eingangshalle Marmor und Gold, der Garten ein Park, die Gäste behängt mit Schmuck und kostspieligen Uhren. Alle paar Meter füllte ein Livrierter das Weinglas nach, reichte Spezialitäten des Hauses auf silbernen Tabletts.
Mit Fleisch und Getränken ging es auch weiter, als die Gastgeberin in den Musiksalon bat, wo Kurt schon am Flügel saß. Einen Zylinder auf den blondierten Locken, begrüßte Claire Dux-Swift die Anwesenden zu diesem herrlichen Abend. Zur Einstimmung werde sie eine Händel-Arie zu Gehör bringen.
Die Gäste applaudierten, und die Dux nickte Kurt zu.
Der schlug auf dem Flügel die ersten Noten an, und sie sang, Lascia ch’io pianga, man solle sie weinen lassen, ihr grausames Schicksal beweinen.
Die Gäste lauschten andächtig kauend.
Die Dux sang die Arie überhaupt nicht schlecht, fand Ida. Ein guter Vortrag für eine Sängerin, die schon lange keine mehr war.
Als sie geendet hatte, applaudierte Ida mit den anderen. Und sie lachte mit ihnen, als die Dux ihren Zylinder vom Kopf nahm und sich wie eine Varieté-Musikantin unter das Publikum mischte.
Die Zuhörer schnippten Scheine in den Hut und gaben mit Blicken zu verstehen, dass später ein Scheck folgen werde. Dafür schenkte die Dux ihnen jeweils einen koketten Augenaufschlag.
Nachdem das Geld eingesammelt war, kehrten die Livrierten zurück. Jetzt trugen sie Fleischsalat in kleinen Kristallschalen auf ihren Tabletts. Auch Ida nahm sich eine Schale und sah sich um.
Kurt saß noch am Flügel. Ein Mann, wohl einer der Geldgeber, redete stehend auf ihn ein. Sie sah Kurt Interesse heucheln, den Gesichtsausdruck kannte sie gut. Die übrigen Anwesenden plauderten, in kleine Grüppchen zerstreut. Abgesehen von dem pompösen Haus, der Geldfrage und den Unmengen Fleisch, ging es hier doch eigentlich ganz ähnlich zu wie in ihren eigenen Salons früher, dachte Ida bei sich. Da hatte es auch Musik gegeben, und man hatte sich amüsiert.
Unsere Salons, dachte Ida, waren damals ein besonderes Vergnügen.
Sie stocherte vehement in ihrem Fleischsalat. Den alten Zeiten nachzuhängen, hatte ja doch keinen Sinn.
Als alle aufs Neue mit Getränken versorgt waren, bat die Dux noch einmal um Aufmerksamkeit. Sie gestikulierte jetzt wie ein Conférencier, man möge ihr folgen. Dabei gingen hinter ihr zwei Flügeltüren auf.
«Kommen Sie, Ladies and Gentlemen! Hier gibt es etwas zu sehen, was man nicht unbedingt an einem so heiteren Abend antreffen will. Aber ich muss es Ihnen unbedingt zeigen. Vorhang auf für die Melancholie!»
Ida hob die Augenbrauen und folgte den anderen in ein überdimensioniertes Boudoir. Ein einziges Bild war in dem Raum aufgehängt. Die Dux baute sich davor auf.
«Ein echter Dalí mit meinem Gesicht», rief sie. «Die Farbe ist fast noch feucht. Jetzt sollte ich am besten gleich tot umfallen.» Sie deutete die Pose eines sterbenden Schwans an, während alle noch etwas näher herantraten und staunten.
Ida kannte den spanischen Maler vom Hörensagen. Bilder hatte sie noch keine gesehen. Dieses hier nannte sich Melancholie und es zeigte, ja, die Dux, wie sie hinter einem Schrein hervorlugte, um sie herum Wüste und darüber ein Himmel voller Wölkchen.
Hinter sich hörte Ida eine Dame das Bild ausgiebig loben. Und sehe die Dux nicht großartig aus?
Na, das war keine Kunst, dachte sie. Der Maler hatte die Sängerin bestimmt zwanzig Jahre jünger gemacht.
Sie nahm noch einen Bissen Fleischsalat und überlegte, ob es nicht sogar ein fürchterlicher Kitsch war, dass da auch noch ein lautenschlagender Engel oben auf einem der Wölkchen saß. Hinter ihr wurde weiterdiskutiert. Ida schnappte das Wort Traum auf und dann noch eines, dachte erst, sie höre nicht recht. Vieles hatte sie von dieser Party erwartet, aber das nun wirklich nicht. Ida hörte, wie die Dux sich nun einschaltete: Sie habe selbst gerade mit einer Analysis begonnen und finde es fantastic.
In Idas Ohren begann es zu pfeifen. Und dann: «Sure! No sure! Jeder Mensch von Bildung, nicht wahr, weiß, wer Professor Freud ist.»
Ida nahm noch eine Gabel von ihrem Fleischsalat. Hendl, das wäre das Richtige auf den Schreck. Sie lachte unwillkürlich auf. Damit konnte man doch nicht rechnen, dachte sie. Dass dem Herrn Doktor ein Schatten bis auf einen anderen Kontinent wächst.
Der Salat musste in ihren Händen schlecht geworden sein. Am liebsten hätte sie den letzten Bissen in das Kristall zurückgespuckt. Ida stellte ihre Schale klirrend ab und hastete zurück in den Salon. Kurt stand noch immer am Flügel und ließ den Herrn reden.
«Kurt, mir ist nicht gut.»
Kurts Gegenüber, ein breithüftiger Mann im Smoking, sah sie fragend an.
«Wir müssen nach Hause.»
«Möchtest du dich nicht erst einmal setzen?»
Kurt deutete auf seinen Platz am Flügel.
Sie schüttelte den Kopf und griff ihn am Arm. «Ich möchte gehen.»
Kurt entschuldigte sich bei seinem Gesprächspartner, trat einen Schritt zur Seite. «Ich lasse dir ein Taxi rufen.»
«Du sollst mit.»
Kurt sah sich um. «Ich kann jetzt noch nicht.»
«Du musst!» Ida verschränkte die Arme vor ihrer Brust und begann schwer zu atmen.
Im Taxi keuchte sie noch immer. Kurt sah sie von der Seite an. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Essen schlecht war.»
Ida mied seinen Blick.
«Verdorbenes Fleisch beim Fleischfabrikanten.» Kurt lachte leise.
«Ich habe schon Abwegigeres erlebt, nicht zuletzt heute Abend.»
«Du hast doch hoffentlich nichts Unpassendes gesagt?»
«Musst dich nicht sorgen. Gar nichts hab ich gesagt. Weniger als nichts sogar.»
Sie sah aus dem Fenster. Nach den dunklen Villenauffahrten verdichtete sich die Stadt, die blinkenden Leuchtreklamen blendeten sie.
Wenn man schon längst die Tür hinter einer Sache geschlossen hat, und dann wird sie jäh und ohne dass man es wünscht wieder aufgerissen. Wenn man sich denkt, jetzt ist so viel Leben vergangen, jetzt hat man so viel mitgemacht. Wenn man schon längst die Tür geschlossen hat, wiederholte sie. Wenn man schon längst die Tür … Der Herr Doktor, also dass der einen so langen Schatten wirft … nach so vielen Jahren … wieder bis zu mir.
II
Wien, 1900
Das neue Jahrhundert
Ida trat aus der Berggasse 19 auf das Trottoir hinaus. Die Holztür fiel hinter ihr zu. Sie hob das Kinn. Sie, nur sie, würde ab jetzt über ihr Leben bestimmen. Die Fußgänger und den grauen Himmel über ihr interessierte es nicht, aber sie wusste um ihr gerecktes Kinn. Niemand würde ihr jetzt mehr etwas einreden, nicht der Papa oder der Herr Doktor oder sonst irgendeine Macht. Am 1.1.1901 würde mit einem Jahr Verspätung ein neues Jahrhundert für sie beginnen. 1.1.1901, wiederholte sie feierlich, Berggasse 19.
Einsen und Neunen im Datum und in der Adresse. Eins und neun. Das Alpha und Omega der natürlichen Zahlen! Da war sie wieder ganz bei sich, bei ihren Zahlen, die rein gar nichts mit denen des Herrn Doktors gemein hatten. Allein an ihren Einsen und Neunen und an ihrem neuen Jahrhundert wollte sie sich freuen.
Ida ging die Gasse hinunter, lief aus ihrem alten Leben hinaus, aber ihrem neuen noch nicht entgegen. Erst einmal wollte sie heim, sich akkommodieren. Es waren nun Zwischenstunden, beschloss sie, Stunden mit Fischschwanz und Vogelkopf, gefiederte und geschuppte Stunden, heute um Mitternacht wollte sie dann in ihr neues Jahrhundert fliegen und tauchen. Bei der Berggasse 32 holte sie den Schlüssel aus ihrer Manteltasche und sperrte auf. 32, drei und zwei, an der Portiersloge vorbei.
Der Portier war gerade nicht da. Sie raffte ihre Röcke und nahm die Stiegen jede nächste Stufe überspringend, wie sie das beim Herrn Doktor einmal beobachtet hatte. Dabei fragte sie sich, wie die 32, die Drei und die Zwei, in einen Zusammenhang mit den Einsen und Neunen zu bringen wäre, drei mal drei vielleicht, rechnete sie, eins plus eins wäre möglich.
In der ersten Etage machte sie halt, horchte nach innen, prüfte ihren Puls. Der schlug in einem feinen, geraden Takt. Die Lunge stach auch nicht. Wunderbar. Da machte es nichts, dass sie für die 32 keine sinnvolle Anbindung an ihre Einsen und Neunen errechnen konnte. Eine Brust, die nicht nach nur wenigen Stiegen zu bersten drohte, ein Kopf, den es nicht schon in der ersten Etage schwindelte, zwei Beine, die sich ohne Störung voreinander setzen ließen – das waren in der Summe deutlichere Anzeichen dafür, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte, als wenn sich eine Zahl nicht fügte.
Die Stiegen in die zweite Etage ging sie trotzdem langsam, Stufe für Stufe, um sich keine Ermahnung einzufangen.
Im Flur der Wohnung hieß eine Kälte sie willkommen, als läge Schnee in der Luft. Ida setzte sich auf die Holzbank und schnürte ihre Stiefel auf. Als sie den Flur entlang durch die geöffnete Türe des Speisezimmers in Ottos Stube schaute, saß er mit Mantel und Pelzhut vor dem offenen Fenster, in einer unangreifbaren Konzentration über den Schreibtisch gebeugt. Er schien sich kein Stück bewegt zu haben, seit sie gegangen war. Über seinem Kopf stieg Zigarettenrauch auf. Die Mama musste mit dem Mädchen im Haushaltsraum sein oder mit der Köchin in der Speis. Der Papa war bestimmt noch im Büro.
Ida ging in ihr Zimmer und steckte sich eine Zigarette an. Jetzt würde sie endlich Zeit haben, einen Verein für Damenbildung zu finden. Nur noch den Schreibtisch aufräumen, dann würde sie ihren Studien nachgehen können. Mit gebuckeltem Rücken ahmte sie Ottos Haltung nach. So ungefähr würde ihre Konzentration aussehen. Von Sonnenaufgang bis spät in den Abend würde sie sich lesend die Welt erschließen. Bald schon reiften in der Berggasse 32 gleich zwei junge Gelehrte heran.
Bloß das offene Fenster würde sie nicht akzeptieren wie ihr Bruder. Sie ging hin und machte es zu. Hier bestimmte allein sie. Die Mama mit ihrem Wahn hatte ihr endgültig nichts mehr zu sagen.
Ida löste den Schal, warf ihn zu den Büchern auf den Schreibtisch und ließ sich aufs Bett fallen. Hinter ihren geschlossenen Augen Lichtfäden vor Schwarz. Aber es war ein anderes Schwarz, nicht das Kohlschwarz der letzten Monate. Ihr Mantel drängte sich warm an sie, und in ihrem Rücken war, sie spürte es ganz deutlich, die Holztür der Berggasse 19.
Hanns, Pepina, der Papa. Der Herr Doktor hatte ihr doch allen Ernstes einreden wollen, sie wünsche den Hanns zu heiraten. Nicht nur das! Ihr Blinddarm sei eine phantasierte Schwangerschaft und Entbindung gewesen. Das musste man nur einmal trocken zusammenfassen, und es wurde einem klar, wie verdreht das war. Sie tat schon recht daran, sich das nicht länger anzuhören. Das war keine Kur! Sie würde nun selbst zeigen, was wirklich Heilung brächte: Bildung, Kunstbetrachtung.
Mit einem Mal war sie fürchterlich müde. Warm wurde ihr, aber sie war zu träge, den Mantel auszuziehen. Sie wünschte sich, dass er einfach von ihr abschuppte. Sie wünschte sich, jemand möge ihr die Berggasse 19 aus dem Rücken zimmern. Eine meterlange Konzentrationszigarette wünschte sie sich.
Da rüttelte jemand an ihr. Die Mama. «Ida, alle warten schon. Schau dir das Mädel an, einfach verschlafen.»
In der Kutsche saß sie neben dem Papa. Otto und die Mama hatten gegenüber Platz genommen. Die Mama, so schien es Ida, mied ihren Blick, sah angestrengt an ihr vorbei ins dunkle Verdeck, wo es nach feuchtem Schimmel roch. Die Nacht war hell vom ersten Schneefall des Winters, und die fleckige Röte, die an den Wangen der Mama hochstieg, war gut zu erkennen. Sie fand es peinlich, dass ihre Tochter so verschlafen aussah. Zudem seien sie nun ihretwegen in einer fürchterlichen Hetze. Am Ende verpassten sie noch den ersten Akt.
Der Papa drehte seine Manschettenknöpfe zurecht, beschwichtigte. Sie würden es rechtzeitig schaffen, sagte er.
Auch wenn sie das Theater noch mit Müh und Not erreichten, entgegnete die Mama, habe die Ida doch alle in eine unnötige Hektik versetzt. Gegessen habe sie auch nichts. Dabei habe sie ihr auf ihren Wunsch hin eine Hühnersuppe kochen lassen. Und dem Fiaker müsse man nun auch ein übermäßiges Trinkgeld geben.
Otto bückte sich und legte den Handschuh, der ihr beim Gestikulieren aus der Hand gefallen war, behutsam zurück in ihren Schoß.
«Der Kutscher hat sowieso einige Groschen mehr für den treuen Dienst in der Silvesternacht verdient», bemerkte er.
«Natürlich hat er das», erwiderte die Mama. Nun aber erscheine das Trinkgeld nicht großzügig, sondern wie eine Entschuldigung, dass er sich ihretwegen so habe beeilen müssen.
Ida hob den Arm und griff über sich ins Kutschverdeck. Sie tastete nach dem, was sie gerochen hatte, kratzte Schimmel von der Decke, zerrieb ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann beugte sie sich vor und hielt der Mama ihre Finger unter die Nase.
«Ida!» Die Mama fuhr entsetzt zurück.
«Da hast du noch etwas, worüber du dich empören kannst», sagte Ida. «Wo dir das so sichtlich Vergnügen bereitet.»
Die Mama packte ihre Hand und wischte ihr grob mit dem Handschuh die Finger sauber.
Die Gattin müsse auch sehen, dass die Kur beim Herrn Doktor Freud für die Tochter anstrengend sei, sagte der Papa.
«Ja, ja», erwiderte die Mama. «Der Gatte soll sie nur in Schutz nehmen.» Dann schaute sie starr hinaus in den fallenden Schnee, bis die Kutsche vor dem Theater zum Halten kam.
Gerade eilten die letzten Besucher über die Treppen hinein. Otto reichte der Mama den Arm. Sie stieg aus der Kutsche mit einem Gesicht, als führe man sie zum Schafott. Der Papa griff nach Idas Schulter, damit sie ihm aus dem Gefährt hinaushelfe, während Otto den Fiaker entlohnte, der, erfreut über das großzügige Trinkgeld, noch ein «Masel tov fürs neue Jahr» hinterherschickte.
Das Foyer hatte sich bereits geleert. Otto nahm ihre Mäntel, ein Logendiener winkte. Im Zuschauersaal wurden gerade die Lichter gelöscht. Onkel Ludwig, Onkel Karl und die Cousinen Elsa und Frieda saßen schon auf ihren Plätzen. Ida musste sich an ihnen vorbeidrücken.
«Da seid ihr endlich», flüsterte Elsa. «Ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr. Ist was geschehen?»
Ida rollte nur stumm mit den Augen.
Der Dirigent hatte sich gezeigt und hob nach einer Verbeugung ins Publikum zur Ouvertüre an. Otto schlüpfte im letzten Moment auf seinen Platz.
Ida spürte immer noch Elsas neugierigen Blick. Auf das Bühnengeschehen konnte sie sich kaum konzentrieren, zu viel ging ihr durch den Kopf. Sie würde dem Papa sagen müssen, dass sie künftig nicht mehr zu der Kur ginge. Heute Nacht noch wollte sie das tun. In der Neujahrslaune würde er es hoffentlich besser aufnehmen.
Aber noch andere Dinge störten ihre Konzentration. Oh, wie sie sich schon wieder über ihn und die Mama ärgern musste! Die beiden amüsierten sich viel zu sehr, als die Frau von Eisenstein dort oben auf der Bühne den aufdringlichen Verehrer empfing. Das konnte sie alles nicht lustig finden.
Und der Geruch von Schimmel lag ihr auch noch in der Nase. Zum Speiben. Wieso hatte sie sich von der Mama nur so provozieren lassen? Sie hätte ruhig bleiben müssen, wie Otto. Der schaffte es, seinen Willen zu bekommen, ohne die Eltern wirklich gegen sich aufzubringen. Eine hohe Kunst war das, die er da beherrschte.
Unter solchen Überlegungen war der erste Akt schnell verflogen. In der Pause ging Ida zu den Erfrischungsräumen.
«Sag, hast das Täschchen gar nicht dabei?» Elsa hatte sich hinter ihr hereingedrückt.
«Ach das.» Ida versuchte, beiläufig zu klingen. «Es gefällt mir doch nicht mehr so gut.»
«Du fandest es neulich doch noch wunderhübsch, als wir’s gekauft haben», insistierte Elsa.
Ida verzog das Gesicht und streckte ihr den Zeigefinger unter die Nase. «Da. Riechst du das?»
Elsa schob ihren Finger weg. «Geh, sei nicht so vulgär.»
Arm in Arm gingen sie zurück ins Foyer. Dort schimpfte die Mama gerade ausführlich über die unzuverlässige Tochter. Einfach eingeschlafen. Um ein Haar hätten sie ihretwegen den Anfang verpasst.
«Besser, als wenn ich hier im Theater plötzlich anfange zu schnarchen, oder nicht?», entgegnete Ida.
Wenigstens Onkel Ludwig musste darüber schmunzeln.
Schon beim ersten Klingeln hatte die Mama sie alle zurück in den Zuschauersaal gedrängt. Sie wollte auf jeden Fall pünktlich sein. Nun saßen sie da, während das restliche Publikum gemächlich hereinströmte, mussten auch immer wieder umständlich aufstehen, um andere Zuschauer zu ihren Plätzen zu lassen. Ewig dauerte es, bis es zum letzten Mal klingelte und das Stück weiterging.
Die zweite Hälfte gefiel Ida besser, zumindest wurden zum Ende hin die Lügen aufgedeckt, und alle konnten einander wieder gut sein. Wobei, in dieser Hinsicht unterschied sich das Leben doch sehr. Sie würde niemandem verzeihen. Weder dem Papa noch der Mama, und dem Hanns und der Pepina gleich gar nicht.
Als nach dem Schlussapplaus der Vorhang fiel, blieb noch eine knappe Stunde bis Mitternacht. Ein Salonorchester spielte in einem der Foyersäle zum Tanz. Ida war mit den Gedanken nur beim Buffet. Vor der Mama würde sie es niemals zugeben, aber sie hatte großen Hunger.
Elsa reichte ihr ein Glas.
«Wo ist eigentlich dein Verlobter?», fragte Ida und nahm einen Schluck.
«Bei seiner Familie natürlich», erwiderte Elsa. «Zusammen feiern wir, wenn wir verheiratet sind.»
«Also nie», bemerkte Ida trocken.
Elsa zwickte die Augen zusammen. «Was ist denn der lieben Cousine jetzt schon wieder für eine Laus über die Leber? Hast wohl vorm Theater nicht ausschlafen können?»
Das Buffet war noch nicht eröffnet. Hier und da wurden schon Beschwerden laut. Ida reckte den Hals, sie meinte, jetzt doch jemanden mit einem Teller gesehen zu haben.
Elsa deutete mit dem Kopf auf ihre Schwester, die sich gerade mit einem jungen Herrn in Uniform unterhielt. «Schau», sagte sie, «die Frieda kümmert sich auch um ihren Verbleib.»
Ida zuckte mit den Schultern. «Soll sie doch. Ich werd mich im Leben nicht verloben.»
«Ist schon recht, Ida. Du wärst eh jedem viel zu schlau.»
Ida nickte geschmeichelt.
«Aber der Offizier bei der Frieda sieht schon fesch aus. Findest nicht?», setzte Elsa nach.
«Ich interessiere mich mehr für eine anständige Mahlzeit», erwiderte Ida und machte sich auf zum Buffet.
Um nicht um Mitternacht mit einem Teller in der Hand dazustehen, hatte Ida schnell aufgegessen. Dann wurde das Jahr auch schon ausgezählt. Hinter den Fenstern explodierten die ersten Feuertöpfe ins Kirchengeläut hinein. Idas Herz begann zu klopfen. Da war es also, ihr neues Jahrhundert.
Um sie herum Prosits und gute Wünsche, die ersten Paare drehten sich im Walzertakt. Sie sah, wie Otto sich vor der Mama verneigte, die lächelte. Ein seltener Anblick. Der Papa schüttelte derweil den Brüdern die Hände. Gerade als sie auf ihn zu springen, ihm in der Euphorie des Jahresbeginns ihre Neuigkeiten unterjubeln wollte, packten Elsas Arme sie von hinten.
Ida drehte sich um und erwiderte die Umarmung. Elsa wünschte ihr ein großartiges Jahr, und Ida wollte zum ersten Mal seit langer Zeit daran glauben. Sie gab ihrer Cousine einen Schmatzer auf die Wange. Nun aber schnell zum Papa!
Doch jetzt waren Geschäftsfreunde an ihn herangetreten. «Auf gute Beziehungen», der Papa erhob sein Glas. Er hoffe, dass ihnen dieses Jahr die langen Streiks erspart bleiben würden. Er deutete auf den Onkel Karl. Nur seinetwegen, sagte er, dank seines Verhandlungsgeschicks hätten sie letzte Saison wieder in Produktion gehen können.
Nähe zum Arbeiter, schön und gut, entgegnete daraufhin einer der Geschäftsfreunde, aber vom Sohn höre man ja schon Sachen. Von sozialdemokratischen Flausen höre man.
Der Papa sah gequält zu Otto hinüber, der noch bei der Mama stand, und brummte etwas, das Ida nicht verstand. Onkel Karl sprang ihm bei. Der Neffe sei ein hochintelligenter junger Mann, er studiere Jus und Philosophie, und ja, er engagiere sich in der Politik. Aber was könne denn daran schlecht fürs Geschäft sein, wenn er sein Ohr an der aufstrebenden Arbeiterbewegung habe?
Der Geschäftsfreund wiegte skeptisch den Kopf, und der Papa, so schien es Ida, war auch nicht so recht überzeugt. Er entschuldigte sich und ging hinüber zum Buffet.
Ida folgte ihm. Mit einem Teller in der Hand würde der Papa sicherlich besser aufnehmen, dass sie die Kur beim Doktor Freud beendet hatte. Sie nahm gleich noch ein Glas Champagner für ihn mit, damit er die Neuigkeiten umso leichter schluckte.
Wien
1901
Jänner. Am Morgen nach der Silvesternacht konnte Ida sich kaum rühren. Sie lag im Bett, ein schriller Geruch in ihrer Nase, dazu die dunkle Erinnerung, vor dem Zubettgehen den Schimmelfinger in ein Parfümflakon getunkt zu haben. Rosenessenz und Jasmin.
Aber sie hasste doch Düfte. Die von Blumen und Parfüm. Und diesen Duft, den der Papa ihr geschenkt, aber ganz bestimmt die Pepina ausgesucht hatte, den hasste sie besonders.
Die Tageszeit war im Fenster nicht zu erkennen. Es hatte aufgehört zu schneien. Der Himmel war stumm. Da wurde es plötzlich dunkel und warm über ihrem Ohr.
«Mein Äuglein», flüsterte die Wärme. «Mein liebes, liebes Äuglein, sag mir, dass ich mich verhört habe. Du hast die Kur nicht eigenmächtig beendet, das hast du nicht, das machst du nicht. Nicht in deinem Zustand. Ich habe mich verhört, nicht wahr? Du bist doch gescheit. Der Herr Doktor wird es dir nachsehen. Ein Scherz ist ihm nicht fremd. Dreh dich nicht weg, Ida! Du hörst mir jetzt zu. Schaust du mich an? Schau mich an! Mit einem Hinterkopf konversiere ich nicht. Eines sage ich dir: Du kommst mir nicht aus, aber ganz bestimmt nicht.»
Dann wurde es wieder kalt an ihrem Ohr. Die Tür schlug zu. Das ist er also, dachte Ida, der Anfang von meinem neuen Jahrhundert. Mit einem Mal meinte sie, unglaublich alt und gebrechlich zu sein, und das Herz ging ihr auch wieder aus dem Takt.
Feber. Die Tage im kürzesten Monat waren so lang wie ein nimmer endendes Jahr. Der Schreibtisch, an den sie sich täglich hatte setzen wollen, unerreichbar. Sie war wieder heiser, kein Ton kam aus ihrem Hals. Nur Röcheln und rasselnde Brusttöne.
Zu allem Überfluss auch noch die Neuigkeiten von Elsa. Sie wollte sich doch tatsächlich vermählen. Und schon im April! Eine verheiratete Elsa, eine Elsa, die ihren eigenen Hausstand einrichtete. Dabei war sie nur ein paar Monate älter. Und dann heiratete sie auch noch einen namens Hans. Der war im Grunde ein freundlicher Mensch, kein Vergleich mit dem Hanns Zellenka. Aber Ida wollte die Elsa nicht verlieren. Sie hatten es doch immer so lustig. Eine Ehe bedeutete aber, dass der Spaß vorbei war.
Mit dem Herrn Doktor hätte sie darüber sprechen können, überlegte sie, korrigierte sich jedoch sogleich. Er hätte es doch nur zum Anlass genommen, ihr irgendetwas mit dem Hanns Zellenka nachzuweisen. Sie ging da nicht wieder hin. Da konnte der Papa noch so oft versuchen, sie weiter zum Herrn Doktor zu drängen, es würde ihm nicht gelingen.
Obwohl ihr Hals brannte und ihr Husten so heftig wie lange nicht mehr war. Selbst das Weinen schmerzte. Ach, sie fühlte sich allein. So einsam wie lange nicht mehr.
März. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich ohne Begleitung auf den Weg machte, und doch schien es ihr nach so langer Zeit wie ein gewaltiger Schritt. Die Tür fiel hinter ihr zu, so endgültig wie der letzte Vorhang im Theater. Ihre hallenden Schritte im Stiegenhaus hätten auch einer Kriminalgeschichte entnommen sein können. Doch was dann vor der Tür geschah, hatte Ida noch in keinem Buch gelesen und auf keiner Bühne aufgeführt gesehen: Die Fassaden der Häuser neigten sich bei jedem ihrer Schritte und drohten, auf sie niederzustürzen, der Laternenpfahl wollte sie aufspießen, ihr eigener Schal strangulierte sie, und der Hut garte ihr das Hirn.
Ida brauchte Tage, um sich zu erholen. Wie sie zurück in ihr Zimmer gelangt war, konnte sie nicht sagen. Aber wenn sie jetzt rauchend von ihrem Fenster aus auf die Gasse sah, blieben die Fassaden an den Häusern, die Laterne beleuchtete ruhig die Gasse, und auch Schal und Hut hingen friedlich an der Ankleide.
Die Woche darauf wagte sie einen weiteren Versuch. Nur ein paar Schritte die Berggasse hinauf. In eine andere Richtung konnte sie nicht, denn da waren die Türkenkaserne mit den unverschämten Offizieren und die niederen Gestalten vom Tandelmarkt. Dann aber, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, packte sie mit einem Mal die Furcht, der Herr Doktor könnte aus seiner Haustür treten, oder, noch schlimmer, der Hanns ginge ihr wieder einmal nach.
Ida beeilte sich, zurück nach Haus zu kommen. Lang ausgestreckt starrte sie ins Dunkel und ärgerte sich. Dumme Ida, dumme Nuss.
April. Da stand die Elsa nun im Tempel. Hübsch sah sie aus, das musste Ida zugeben. Wobei der gebauschte Tüll um ihren Kopf zu einem Imker wohl besser gepasst hätte als zu einer Braut.
Der Hans Foges neben ihr machte eine stattliche Figur. Nur aus der Frieda rannen Rotz und Wasser, als die Elsa Ringe tauschte. Aber nicht aus Rührung weinte die Schwester, sondern aus Eifersucht, da war Ida sich sicher. Wobei es wirklich keinen Grund dafür gab. Heiraten, nein, also nein.
Mai. Sie hatte wirklich nur vorgehabt, der Pepina und dem Hanns ihr Beileid auszusprechen. Wirklich nur das. Ein Anliegen war es ihr gewesen, weil sie doch selbst so um die kleine Klara trauerte. Für einen kurzen Besuch, hatte sie geglaubt, könnte alles andere vergessen sein.