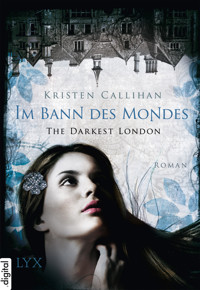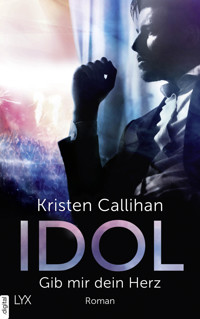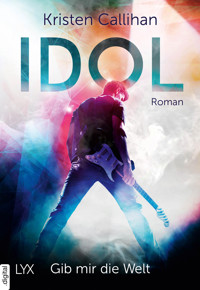
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: VIP-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er ist ein Rockstar. Die Welt liegt ihm zu Füßen. Doch er will nur sie.
Ruhig, unaufgeregt, zurückgezogen - so würde Libby Bell ihr Leben beschreiben. Doch das ändert sich, als sie eines Morgens einen fremden Typ in ihrem Vorgarten findet. Killian ist sexy und charmant - und ihr neuer Nachbar. Obwohl Libby sich nach dem Tod ihrer Eltern geschworen hat, niemanden mehr an sich heranzulassen, berührt Killian ihr Herz auf eine ganz besondere Art und Weise. Was Libby nicht weiß: Sie ist drauf und dran, sich in niemand anders als Killian James zu verlieben - Leadsänger und Gitarrist der erfolgreichsten Rockband der Welt ...
"Dieses Buch ist fantastisch! Die ultimative Rockstar Romance!" Aestas Book Blog
Band 1 der VIP-Reihe von New-York-Times-Bestseller-Autorin Kristen Callihan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungPlaylistProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. KapitelEpilogAnmerkung der AutorinDanksagungDie AutorinKristen Callihan bei LYXImpressumKRISTEN CALLIHAN
IDOL
Gib mir die Welt
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anika Klüver
Zu diesem Buch
Seit dem Tod ihrer Eltern hat die fünfundzwanzigjährige Libby Bell sich von der Welt zurückgezogen. Sie arbeitet von zu Hause aus und verlässt die kleine Farm in North Carolina nur selten. Doch ihr Leben wird gehörig durcheinander gewirbelt, als eines Morgens ein betrunkener Typ mit seinem Motorrad durch den Gartenzaun kracht und in ihrem Vorgarten landet. Libby ist überhaupt nicht begeistert, vor allem als sich herausstellt, dass der attraktive Fremde ihr neuer Nachbar ist. Eigentlich hatte Libby nicht vor, ihr Einsiedlerleben in naher Zukunft aufzugeben – die Menschen, die sie am meisten auf der Welt geliebt hat, wurden ihr bereits genommen, und sie hat sich geschworen, niemanden mehr an sich heranzulassen oder gar ihr Herz zu öffnen. Doch je mehr Zeit sie und Killian miteinander verbringen, desto mehr gerät ihr Entschluss ins Wanken. Nicht nur teilt er ihre Liebe für die Musik – da ist auch diese Anziehungskraft, die mit jedem Moment stärker wird, den sie in seiner Nähe verbringt. Aber Libby ahnt nicht, dass Killian nicht irgendein Mann ist – sondern Killian James, Leadsänger und Gitarrist von Kill John, der erfolgreichsten Rockband der Welt …
Für Cobain, Bowie und Prince – Rockidole, die den Soundtrack meines Lebens mitgeprägt haben. Sie wurden uns zu früh genommen.
Playlist
Django Reinhardt – Limehouse Blues
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
The Black Keys – You’re the One
Sinead O’Connor – The Last Day of Our Acquaintance
The Beatles – In My Life
Bon Jovi – Wanted Dead or Alive
Pearl Jam – Indifference
Alice in Chains – Man in the Box
The Beatles – Ob-La-Di, Ob-La-Da
Mary J. Blige – Right Now
Nirvana – Heart-Shaped Box
Prince – Cream
Prince – Darling Nikki
Wilco – I Am Trying to Break Your Heart
Cat Power – Sea of Love
The White Stripes – Hotel Yorba
Prolog
Musik kann dein Freund sein, wenn du keinen hast, dein Liebhaber, wenn dich die Lust überkommt. Deine Wut, deine Trauer, deine Freude, dein Schmerz. Deine Stimme, wenn du deine eigene verloren hast. Ein Teil davon zu sein, der Soundtrack für jemandes Leben zu sein, ist wunderschön.
– Killian James, Leadsänger und Gitarrist von Kill John
Die Vergangenheit
Killian
Das Tier ist ein temperamentvolles Biest. Es kann einen im einen Moment lieben und im nächsten hassen, und man weiß nie, welche Seite von ihm man sehen wird, bis es sich auf einen stürzt. Wenn es einen hasst, kann man nichts tun, außer es zu ertragen und zu hoffen, dass man überlebt, ohne komplett zerfetzt zu werden, bis man entkommen kann. Aber wenn es einen liebt?
Verdammt, das ist das beste Gefühl auf der Welt. Man sehnt sich nach dieser Zeit mit dem Tier. Man lebt für jede Begegnung. Es wird zum Lebensinhalt. Zum einzigen Zweck. Zur ganzen Welt. Und weil man so abhängig von ihm wird, fängt man an, es auch ein klein wenig zu hassen.
Liebe. Hass. Keine Pause. Kein Mittelweg. Nur Höhen und Tiefen.
Es ist jetzt gerade dort draußen und wartet auf mich. Sein Knurren baut sich langsam und grollend auf. Ich spüre es in meinen Knochen, in der kaum wahrnehmbaren Veränderung, die die Luft erfüllt, und im Beben unter meinen Füßen.
Mein Herz schlägt schneller, und das Adrenalin rauscht bereits durch meinen Körper.
»Seid ihr bereit, mit dem Teufel zu tanzen?«, fragt Whip niemand Spezielles. Er stürzt eine Flasche Wasser hinunter. Mit der freien Hand klopft er rhythmisch auf sein Knie.
Teufel, Tier, Geliebte – wir alle haben unseren Namen dafür. Es spielt keine Rolle. Es nimmt uns gefangen, und für eine Weile nehmen wir es gefangen.
Das Grölen wird lauter, und gleich darauf folgt ein beständiges Pochen. Mein Name. Es ruft nach mir.
Killian. Killian.
Keuchend stehe ich auf. Ein Schauer zuckt über meine Haut, und alles in mir spannt sich an.
Ich folge seinem Ruf, und eine Welle aus Geräuschen und reiner Energie bricht über mir zusammen, als ich ins Licht trete.
Es ist heiß und blendend.
Das Tier schreit. Nach mir.
Und ich bin derjenige, der es kontrolliert. Ich hebe die Arme und gehe zum Mikro. »Hallo, New York!«
Die Schreie, die mir entgegenschlagen, sind so laut, dass ich zurücktaumele.
Jemand gibt mir eine Gitarre in die Hand. Das Gefühl des glatten Halses ist auf vertraute Weise beruhigend und verschafft mir gleichzeitig einen Adrenalinschub. Ich schlinge den Gurt über meinen Kopf. Whip fängt an zu trommeln, und mein Körper bewegt sich in dem pochenden Rhythmus. Jax und Rye schließen sich ihm an. Ihre Riffs weben ein kompliziertes Muster. Harmonie. Klangpoesie. Ein trotziger Schrei.
Ich fange an zu spielen und hebe die Stimme. Musik fließt durch meine Venen. Sie strömt aus mir heraus wie Lava, entzündet die Luft und feuert einen Aufruhr aus erwartungsvollen Schreien an.
Macht. So viel Macht. Das Tier reagiert, seine Liebe ist so stark, dass ich hart werde und sich meine Nackenhaare aufstellen. Ich lege alles, was ich bin, in meine Stimme und mein Gitarrenspiel.
In diesem Augenblick bin ich Gott. Allmächtig. Endlos.
Nichts – nichts – auf der Welt setzt mich so sehr unter Strom. Es gibt nichts Vergleichbares. Das ist das Leben.
Aber das Leben kann sich innerhalb einer Sekunde ändern.
Ein einziger Augenblick genügt.
Und
alles …
endet.
Die Zukunft
Libby
»Über Ihre Beziehung mit Killian James wurde so viel geschrieben. Aber Sie und James haben sich in Bezug auf dieses Thema recht bedeckt gehalten.« Die Reporterin schenkt mir ein kleines, aber ermutigendes Lächeln, und eine blaue Strähne rutscht ihr über ein Auge. »Würden Sie uns in Hinblick auf den Auftritt von gestern Abend einen kleinen Happen zur Verfügung stellen?«
Ich sitze bequem auf einem Hotelzimmerstuhl aus Leder und Chrom, habe der New Yorker Skyline den Rücken zugewandt und muss angesichts dieser Frage, die ich nun schon etwa tausendmal gehört habe, beinahe lächeln.
Doch dazu bin ich zu gut vorbereitet. Ein Lächeln würde entweder meine Zustimmung ausdrücken oder verschämt wirken. Ich will keinen »kleinen Happen« anbieten, und egal, was die Kritiker sagen, Killian und ich waren nie verschämt. Wir wollten nur nie die Öffentlichkeit an unserer Beziehung teilhaben lassen. Der Killian, den ich kannte, gehörte mir, nicht ihnen.
»Ich kann nicht viel erzählen, was die Welt nicht bereits weiß.« Das ist nicht wirklich wahr. Aber wahr genug.
Nun wirkt das Lächeln der Reporterin angespannt – wie das eines Barrakudas, der im Wasser nach Blut sucht. »Oh, also da bin ich mir nicht so sicher. Immerhin kennen wir Ihre Version der Ereignisse nicht.«
Ich widerstehe dem Drang, am Ärmel meiner weißen Kaschmirjacke zu zupfen. Gott, dieses Oberteil – verdammt, selbst meine Unterwäsche – hat mehr gekostet, als ich in einem ganzen Jahr ausgegeben hätte, bevor er in mein Leben trat.
Ich drehe den Kopf und erhasche einen Blick auf die Wasserflaschen, die in einem silbernen Eiskübel stehen. Eine Flasche ist dunkelgrün, eine andere golden und eine weitere ist mit Kristallen besetzt. Zuvor verkündete ein Assistent stolz, dass die Sorte in der grünen Flasche, die angeblich aus Japan stammt, mehr als vierhundert Dollar pro Flasche koste. Für Wasser.
Plötzlich will ich lachen. Über die Absurdität meines Lebens. Darüber, dass ich nun Designer- statt Leitungswasser trinke. Über die Tatsache, dass diese Penthousesuite für mich die neue Normalität ist.
Und dann will ich weinen. Weil ich ohne ihn nichts davon hätte. Und absolut nichts davon hat irgendeine Bedeutung, wenn ich es nicht mit ihm teilen kann.
Die Leere droht mich vollständig zu verschlucken. Ich fühle mich gerade so einsam, dass ein Teil von mir die Hand dieser Frau ergreifen will, nur um den Kontakt zu einem anderen Menschen zu spüren.
Ich muss reden. Ich muss mir Gehör verschaffen. Nur ein einziges Mal. Und vielleicht, nur vielleicht werde ich mich dann nicht mehr so fühlen, als würde ich die Kontrolle verlieren.
Ich hole tief Luft und richte meinen Blick wieder auf die Journalistin. »Was wollen Sie wissen?«
1. Kapitel
Die Gegenwart
Liberty
Da ist ein Penner auf meinem Rasen. Vielleicht sollte ich einen besseren Begriff verwenden, etwas, das politisch korrekter ist. Ein Obdachloser? Ein Landstreicher? Nein, ich bleibe bei Penner. Denn ich bezweifle, dass er tatsächlich obdach- oder mittellos ist. Sein derzeitiger Zustand scheint eher das Ergebnis einer freien Entscheidung als einer Notsituation zu sein.
Die große schwarze und chromfarbene Harley, die meinen armen Gartenzaun gerammt hat, ist Beweis genug für einen gewissen Wohlstand. Das Ding hat bei seinem Sturz einen Großteil meines Rasens aufgerissen. Aber das Motorrad kann nichts dafür.
Ich starre den Penner wütend an. Nicht dass er das mitbekommen würde.
Er liegt ausgestreckt auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet und ist eindeutig völlig am Ende. Ich könnte mich fragen, ob er tot ist, aber seine Brust hebt und senkt sich im gleichmäßigen Rhythmus seines Tiefschlafs. Vielleicht sollte ich mir Sorgen um seine Gesundheit machen, aber ich habe so etwas schon oft gesehen. Zu oft.
Gott, er stinkt. Der Grund für seinen Gestank ist offensichtlich. Schweiß bedeckt seine Haut. Und sein schwarzes T-Shirt ist mit Spuren von Erbrochenem befleckt.
Ich verziehe angewidert den Mund und schlucke schnell, um nicht würgen zu müssen. Ein Gewirr aus langem dunkelbraunem Haar bedeckt sein Gesicht, aber ich schätze, dass dieser Kerl recht jung ist. Sein Körper ist groß, aber drahtig und die Haut an seinen Armen fest. Was ihn irgendwie noch deprimierender wirken lässt. Er steht in der Blüte seines Lebens und ist sturzbetrunken. Wundervoll.
Ich gehe um ihn herum und murmele etwas über Arschlöcher, die sich betrunken ans Steuer setzen. Dann marschiere ich mit dem Gartenschlauch in der Hand zurück und ziele sorgfältig. Wasser schießt mit hoher Geschwindigkeit aus dem Schlauch und trifft mit einem befriedigenden Zischen und Platschen auf sein Ziel.
Der Penner zuckt zusammen und richtet sich auf. Er prustet und rudert mit den Armen, während er nach der Quelle seiner Folter sucht. Ich lasse nicht locker. Ich will, dass der Gestank verschwindet.
»Runter von meinem Rasen.« Weil er überall schmutzig ist, ziele ich tiefer und durchnässe seine Hose und seinen Schritt.
»Verdammte Scheiße!« Er hat eine tiefe, heisere Stimme. »Würdest du verflucht noch mal damit aufhören?«
»Das kannst du vergessen. Du riechst widerlich. Und ich hoffe ernsthaft, dass du dir nicht tatsächlich in die Hose gemacht hast, Kumpel, denn sehr viel tiefer kann man kaum noch sinken.«
Ich bewege den Wasserstrahl an seinem drahtigen Körper hinauf zu seinem Kopf. Langes, dunkles Haar wirbelt in alle Richtungen, und er prustet wieder.
Und dann brüllt er. Der Laut hallt in meinen Ohren wider und sollte mir eigentlich eine Heidenangst einjagen. Aber er ist zu schwach zum Stehen. Allerdings schwingt er einen muskulösen Unterarm nach oben und wischt sich die nassen Haarsträhnen aus dem Gesicht.
Ich erhasche einen Blick auf dunkle Augen, in denen verwirrte Wut aufblitzt. Zeit, das hier zu beenden. Ich lasse die Wasserdüse los und senke meine Waffe. »Wie ich schon sagte: runter von meinem Rasen.«
Sein Kiefer zuckt. »Bist du vollkommen irre?«
»Ich bin nicht diejenige, die voller Kotze ist und auf dem Grundstück einer Fremden liegt.«
Mein Rasenpenner schaut sich um, als wäre ihm gerade erst klar geworden, dass er auf dem Boden liegt. Seinen Klamotten schenkt er keine Beachtung. Da sie klitschnass sind und an seiner Haut kleben, ist ihm ihr Zustand vermutlich sehr bewusst.
»Ich habe einen Tipp für dich«, sage ich und werfe den Schlauch weg. »Sei nicht so ein Klischee.«
Er stutzt sichtbar und blinzelt mich an. Wasser läuft ihm in kleinen Strömen über die Wangen und in seinen dichten Bart. »Du kennst mich nicht gut genug, um mich in eine Schublade zu stecken.«
Ich schnaube. »Du warst wortwörtlich sturzbetrunken und hast dein Motorrad zu Schrott gefahren – von dem ich übrigens vermute, dass du es lediglich an den Wochenenden fährst. Dein Haar ist zu lang, und dein Gesicht sieht aus, als hätte es seit Wochen keinen Rasierer mehr gesehen – auch dahinter steckt vermutlich der Wunsch, dass dich die Welt für einen echt harten Kerl halten soll.« Ich schaue auf seine Arme und die starken, sehnigen Muskeln. »Das Einzige, was ich nicht sehe, sind Tattoos, aber vielleicht hast du ›Mom‹ auf deinem Hintern stehen.«
Er gibt ein empörtes Geräusch von sich. Es ist fast ein Lachen, klingt dafür aber zu wütend. »Wer bist du?«
Es ist schon beeindruckend, wie es ihm gelingt, so viele Schichten aus Verachtung in diese eine Frage zu legen. Vor allem wenn man bedenkt, in welchen Zustand ich ihn gefunden habe. Demut ist offenbar keine seiner starken Eigenschaften. Leider gilt das nicht für seinen Gestank.
»Die Person, deren Grundstück du zerstört hast. Ich würde dir ja eine Rechnung um die Ohren hauen, aber ich will diesem Gestank nicht zu nah kommen.« Ich wische mir die nassen Hände an meiner Jeans ab und funkle ihn noch ein letztes Mal böse an. »Und jetzt verschwinde, bevor ich die Polizei rufe.«
Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass ich nun richtig wütend bin. Ich marschiere über die lange Einfahrt zu meinem Haus zurück, anstatt mich mit ruhiger Würde fortzubewegen, wie ich es geplant hatte. Aber es fühlt sich gut an. Mein Tempo ist befreiend. Ich bin in den vergangenen Monaten so ruhig gewesen. So verschlossen.
Also sollte ich diesem arroganten Säufer vielleicht dankbar sein.
Allerdings geht meine Nächstenliebe nicht so weit, dass ich zulasse, dass er mir folgt. Was er tut. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er aufsteht. Er schwankt, findet dann sein Gleichgewicht, zieht sein T-Shirt aus und schleudert es auf den Boden.
Eine Stripshow. Toll.
Ich gehe schneller und fluche darüber, dass meine Einfahrt so lang ist – vom Bordstein bis zur Haustür sind es mindestens sechzig Meter.
Ich nehme eine weitere Bewegung wahr und stelle fest, dass er einen Stiefel in meine Richtung geworfen hat. Ein wenig beunruhigt schaue ich hinter mich. Und jetzt zieht er seine Hose aus. Ein gut eins achtzig großer, wütender, nackter Mann macht sich daran, hinter mir herzustapfen. Ich entdecke die Tattoos, die ich vermutet hatte. Oder genauer gesagt, ein riesiges Tattoo aus geschwungenen, sich überschneidenden Linien, das seinen linken Oberarm und seinen Oberkörper bedeckt.
Ich konzentriere mich darauf, statt auf den großen, langen Schwanz, der zwischen seinen Beinen hängt und mit jedem Schritt, den er auf mich zukommt, wie ein Pendel hin- und herschwingt.
Ich funkele ihn über meine Schulter hinweg böse an. »Wenn du noch einen Schritt weiter in meine Einfahrt kommst, werde ich dich erschießen.«
»War ja klar, dass jemand wie du eine Schrotflinte hat, Elly May«, schnauzt er zurück. »Was für ein Klischee. Jetzt brauchst du nur noch einen Overall und einen Strohhalm, auf dem du herumkauen kannst.«
Ich kann nicht anders. Ich wirbele herum. »Hast du mich gerade etwa als Landei bezeichnet?«
Er bleibt ebenfalls stehen. Der Penner von meinem Rasen steht da, hat die Hände in die Hüften gestemmt und scheint sich nicht im Geringsten für seine Nacktheit zu schämen. Er starrt mich an, als würde ihm die Welt gehören. »Willst du behaupten, dass du keins bist, Schnuckiputzi?«
Hitze wabert über meine Haut. Ich marschiere direkt auf ihn zu – nun ja, nicht zu nah heran, da ich mich immer noch vor dem Gestank ekele. Aus der Nähe muss ich zugeben, dass er nicht schlecht aussieht. Wenn man über den ganzen Dreck, die blutunterlaufenen dunklen Augen und die teigige Haut, die einer durchzechten Nacht geschuldet ist, hinwegsieht, hat er kantige, aber gleichmäßige Gesichtszüge und Wimpern, die lang genug sind, um eine Frau neidisch zu machen. Das macht mich nur noch wütender.
»Hör zu, Kumpel: Eine Frau zu verfolgen, während man nackt ist, kann als sexuelle Belästigung ausgelegt werden.«
Er schnaubt. »Das sagt einiges über dein Sexleben aus, Elly May. Aber keine Sorge. Selbst wenn ich das geringste Interesse daran hätte, es dir zu besorgen, bin ich momentan so betrunken, dass ich ohnehin keinen hochkriegen würde.«
»Das passiert öfter, was?« Ich rümpfe die Nase und weigere mich, nach unten zu schauen. »Und du redest über meine sexuellen Unzulänglichkeiten.«
Ein Funkeln tritt in seine Augen, und ich könnte schwören, dass er lachen will. Doch stattdessen schmunzelt er und verzieht verärgert die Lippen. »Gib mir eine Stunde und etwas Kaffee, und dann können wir so viel darüber reden, wie du willst.«
»Als Nächstes verlangst du wohl auch noch Frühstück, was?«
Ein freches Lächeln bringt ihn zum Strahlen. »Tja, nun, da du es erwähnst …«
»Weißt du, was mich am meisten ärgert?«, schnauze ich.
Er zieht die dichten, dunklen Augenbrauen zusammen, als wäre er verwirrt. »Was?«
Er sagt es tatsächlich so, als hätte er mich nicht richtig verstanden, nicht als Erwiderung auf meine Frage. Aber ich antworte ihm trotzdem.
»Du hättest jemanden verletzen können. Du hättest mich oder eine andere arme Seele verletzen können, weil du betrunken Motorrad gefahren bist.« Trauer bohrt ihre Finger in mein Herz. »Du hättest Leben zerstören und Menschen hinterlassen können, die die Scherben aufsammeln müssten.«
Er wird blass, und seine albernen Wimpern streichen über seine Wangen, als er blinzelt.
»Willst du dich umbringen?«, schimpfe ich. »Dann tu es gefälligst auf eine andere Weise …«
Ich verstumme, als er knurrt und allen Ernstes die Zähne fletscht. Er macht einen entschlossenen Schritt auf mich zu, als würde er mich tatsächlich angreifen wollen. Doch dann hält er sich zurück. »Wag es ja nicht … Du hast verdammt noch mal keine Ahnung, was ich …« Sein Gesicht wird grau, als er von oben auf mich herabschaut.
Wir starren einander an, während er einfach nur schwankend dasteht. Er ist ganz blass und zittert. Seine Wut brodelt so dicht unter der Oberfläche, dass sie in seinen Augen schimmert.
Und diese schmerzerfüllte Wut lockt mich in die Falle und lenkt mich so sehr ab, dass ich die Warnsignale übersehe.
»Du hast keine Ahnung …« Er schluckt krampfhaft.
Erst da wird mir klar, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Ich springe zurück, doch es ist zu spät. Mein Rasenpenner beugt sich vor und übergibt sich. Und alles landet auf mir.
Für einen entsetzlichen Augenblick stehe ich vor lauter Schock wie angewurzelt da. Dann nehme ich den Gestank aufs Neue wahr. Ich zwinge mich, aufzuschauen und meinen Peiniger anzusehen. Eintausend Flüche rauschen durch meinen Kopf, aber ich bringe nur einen Satz durch meine zusammengebissenen Zähne heraus.
»Ich hasse dich.«
Killian
Wenn eine Frau einem mit einem kalten, toten Blick in den Augen mitteilt, dass sie einen hasst, bemüht sie sich normalerweise darum, jeglichen weiteren Kontakt zu vermeiden.
Doch bei Elly May, der Frau mit dem Gartenschlauch aus der Hölle, ist das nicht so.
Okay, ich habe sie gerade vollgekotzt, also könnte sie einen Grund haben, mich zu hassen. Einen sehr guten Grund.
Ich habe mich seit Jahren bei niemandem mehr entschuldigt. Eine kleine Stimme in meinem Kopf sagt mir, dass ich es nun tun sollte. Aber der Whisky, der immer noch durch meinen Kopf schwappt, ertränkt diese Stimme. Scheiße, alles schwappt gerade – der Boden, mein Gehirn, mein Blut. Meine Ohren klingeln.
Ich falle um. Ich weiß es. Ich bin ein wenig überrascht, als meine Peinigerin vortritt, anstatt sich von mir wegzubewegen, und ihre Arme um mich schlingt. Sie hält mich fest.
Viel Glück dabei, Schätzchen.
Ich höre sie fluchen und spüre, wie ihre Knie unter meinem Gewicht nachgeben. Wir fallen zusammen um. Ich glaube, ich lache. Ich bin nicht sicher. Alles verschwimmt. Das ist genau das, was ich will.
Die Welt ist ein unscharfer Fleck. Wasser schießt in mein Gesicht. Schon wieder. Verdammte Scheiße, das nervt.
Prustend versuche ich, über mein Gesicht zu wischen, aber meine Arme funktionieren nicht richtig. Alles fühlt sich gummiartig und schwer an.
»Hör auf, um dich zu schlagen, du unfassbare Nervensäge«, keift eine Frau.
Elly May. Mir ist egal, dass ihre Stimme wie Vanillecreme auf Eis klingt, sie ist der Teufel. Ein Wasserteufel. Vielleicht brennt man in der Hölle gar nicht. Vielleicht ertrinkt man dort einfach.
»Du wirst nicht ertrinken«, sagt sie und spritzt mich erneut nass.
Ich pruste und spucke einen Mund voll Wasser aus, der nach Kotze und Whisky schmeckt. Abgesehen von der gottverdammten Sintflut kann ich nichts sehen. »Was ist das nur mit dir und Wasser?«, bringe ich hervor, bevor mich eine weitere Ladung trifft.
»Es hat diese magische Fähigkeit, Schmutz wegzuwaschen«, erwidert sie gedehnt, während sie mit der Hand über meine Brust reibt. Es fühlt sich nicht beruhigend, sondern hart an, als würde sie versuchen, meine Haut abzureiben. Ich sehe Seifenblasen. Es riecht nach Grapefruit und Vanille. Mädchenseife.
»Ja, Seife. Wasser und Seife reinigen«, fährt sie fort, als wäre ich ein Kleinkind. »Ich weiß. Verrückt, oder?«
Sarkasmus. Dafür bin ich Experte. Zumindest wenn ich nicht so betrunken bin, dass ich nicht mal die Augen aufmachen kann.
Harte Hände bewegen sich über meine Kopfhaut. Finger verfangen sich in meinem Haar.
»Herrgott, wann hast du diesen Mopp zum letzten Mal gebürstet?«
»Bei meiner Geburt. Und jetzt lass los. Lass mich aufstehen.«
»Du hast Erbrochenes im Haar. Ich wasche es raus.«
Ich lasse mich von ihr waschen und lausche ihrem Geschimpfe, von dem ich mal mehr und mal weniger mitbekomme. Sie ist nie sanft. Das spielt keine Rolle. Mit Sanftheit kann ich ohnehin nicht umgehen.
Ich werde abgetrocknet und mitgezerrt. Immer noch dreht sich alles. Es neigt sich, es schwankt, es dreht sich. Egal was ich tue, um zu entkommen, höre ich doch immer noch den Rhythmus meines Lebens.
»Ich höre nur dein Brabbeln«, sagt sie. Ihr Gesicht schwebt wie ein verschwommener Heiligenschein über mir.
Unter mir ist etwas Weiches. Kühle Laken. Schwere Decken.
Sie rollt mich auf die Seite und stopft Kissen hinter meinen Rücken. »Wenn du wieder kotzt, bist du auf dich allein gestellt, Kumpel.«
Das bin ich immer, Schätzchen.
2. Kapitel
Killian
Das Kissen unter meinem Kopf ist … verdammt fantastisch. Ich meine, das ist es wirklich. Wie eine fluffige Wolke oder so was. Was seltsam ist. Warum fahre ich so sehr auf ein Kissen ab?
Dieser verrückte Gedanke lässt mich wach genug werden, um die Augen zu öffnen. Das Sonnenlicht brennt, und ich verziehe das Gesicht und kneife für eine Sekunde die Augen zusammen. Das Zimmer ist weiß. Geweißte, mit Holz verkleidete Wände, weiße Laken, weiße Vorhänge. Letztere wehen in der sanften Brise, die durch ein offenes Fenster hereinkommt.
Ich presse mein Gesicht gegen das kühle Kissen, das sich wie eine Wolke anfühlt, und atme ein. Eine Axt aus Schmerz spaltet meinen Schädel. Mein Mund schmeckt nach verbranntem Toast.
Auf dem Nachttisch steht ein großes Glas mit einer roten Flüssigkeit darin. Es ist mit frischem Eis gefüllt, und an der Außenseite bilden sich Kondenstropfen, als hätte es jemand gerade erst hereingebracht. Daneben liegen vier blaue Tabletten und eine Nachricht:
Für den sträflich Dummen.
Obwohl Bewegung dazu führt, dass mein Magen rebelliert, schnaube ich. Erinnerungen an die scharfe Zunge und die groben Hände meiner Gastgeberin fluten meinen Geist. Ich ignoriere sie – denn ich will mich wirklich nicht daran erinnern, wie betrunken ich war – und greife nach dem Glas.
Das Getränk riecht vage nach einer Bloody Mary, aber auch nach etwas Scharfem und Zitrusartigem. Ich will es nicht probieren, aber die Axt bohrt sich tiefer in meinen Schädel, und ich habe verdammt großen Durst.
Ich bekomme es nur schwer runter und würge die ganze Zeit über. Die Tabletten, die ich dazu nehme, bleiben mir beinahe im Hals stecken. Das Gebräu ist kohlensäurehaltig, was mich überrascht. Ich vermute, es ist eine Bloody Mary gemischt mit Ingwerlimonade und Zitronen – aber verdammt, vielleicht ist auch Arsen darin. Als ich ausgetrunken habe, genieße ich den Geschmack irgendwie und habe das Gefühl, dass ich vielleicht überleben könnte.
Ich lege mich zurück auf das weiße Wolkenbett, rieche den Anflug von Salzwasser in der Luft und lausche den Windspielen. Bis das Klappern von Töpfen und das Schlagen einer Schranktür meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Elly May.
Falls ihr Name tatsächlich Elly May lautet, werde ich mich totlachen. Aber Elly May klingt eher nach einer sexy Tussi vom Land. Die Sorte, die einen bis auf den letzten Tropfen melkt und einem dann Kuchen anbietet. Meine Elly May ist ganz anders.
Der gestrige Tag ist verschwommen, aber an sie erinnere ich mich deutlich: eine gerunzelte Stirn, ein freches Mundwerk.
Jetzt höre ich es erneut in Form eines unterdrückten »Verdammt« und eines weiteren Schlagens einer Tür.
Ächzend setze ich mich auf und hole ein paarmal tief Luft, während sich das Zimmer dreht. Ich bin splitterfasernackt und muss angesichts dieser Tatsache lächeln. Das war die interessanteste Dusche, die ich seit einer Weile hatte, und ich bin nicht mal gekommen.
Ich brauche ewig, um aufzustehen, und sogar noch länger, um meine Klamotten zu erreichen. Ich finde sie ordentlich gefaltet auf einem Stuhl vor. Sie riechen nach Tide-Waschmittel. Meine Oma benutzte Tide. Ich ziehe mich schnell an und gehe zur Tür.
Offensichtlich habe ich im Hinterzimmer eines alten Farmhauses geschlafen. Ich erinnere mich nicht mal daran, wie es von außen aussieht, aber innen ist es spärlich im ländlichen Stil eingerichtet, mit Parkettböden und abgenutzten Möbeln.
Eine hübsche, oft benutzte Martin-Akustikgitarre lehnt an einer Wand, die komplett mit Regalen voller alter LPs bedeckt ist. Sie muss ein paar Tausend Schallplatten haben. Abgesehen von ein paar DJs, denen ich begegnet bin, kenne ich niemanden, der noch echte Vinylschallplatten besitzt. Sie verleihen dem Raum einen muffigen Geruch.
Also habe ich es mit einer Gitarre spielenden Musikliebhaberin zu tun. Bitte, Gott, lass diese Tussi nicht so eine Art Annie-Wilkes-Psycho sein. Doch dann erinnere ich mich daran, wie wütend sie mich gestern Abend angestarrt hat. Ich bezweifle, dass sie mein größter Fan ist.
Ich folge dem Lärm und finde sie in der Küche vor, einem großen quadratischen Raum, in dessen Mitte einer dieser klassischen Farmtische steht, an denen zwölf Leute Platz finden.
Sie ignoriert mich, als ich mich mit langsamen und schmerzvollen Bewegungen an den Tisch setze. Verdammt noch mal. Ich werde nie wieder so viel trinken. Nie. Wieder.
In der Stille beobachte ich, wie sie etwas in einem Topf auf dem Herd umrührt, als würde sie versuchen, dem Inhalt Gehorsam einzuprügeln. Sie ist definitiv kein heißes Landei. Diese Frau trägt ganz sicher keine Hotpants aus Jeansstoff. Ihren prallen Hintern versteckt sie unter einer abgewetzten Jeans mit Löchern an den Knien, während sie in schweren schwarzen Stiefeln durch die Küche stapft, die besser zu meinem Motorrad passen würden – meinem Motorrad, das mit ziemlicher Sicherheit um ihren Zaun gewickelt ist. Ich erinnere mich nicht an den Unfall und ich habe keinen Kratzer abbekommen. Der Wille des Universums ist schon seltsam. Ich habe keine Ahnung, warum es mich ausgerechnet zu ihr geführt hat.
Meine Gastgeberin schaltet den Herd aus. Dabei kommt ihr Profil in mein Blickfeld. Sie hat langes, glattes Haar in der Farbe von nassem Sand, graue Augen und ein ovales Gesicht, das eigentlich aus sanften Winkeln bestehen sollte, aber irgendwie scharfkantig und hart aussieht: Elly May ist recht unscheinbar. Bis sie den Mund aufmacht.
Dann folgt jedes Mal ein langer Schwall aus fantasievollem Geschimpfe.
Es ist Jahre her, dass mich eine Frau in einem solchen Ausmaß getadelt hat. Wenn mich das gestrige Übergießen mit eiskaltem Wasser nicht schon geschockt hätte, hätte diese Standpauke definitiv ausgereicht.
Ja, sie ist wirklich nicht auf den Mund gefallen. Doch momentan benutzt sie ihn nicht. Das finde ich sogar noch beunruhigender.
»Hey.« Meine Stimme klingt wie zerbrochenes Glas. »Ich, ähm, danke für … äh …« Ich schlucke. »Na ja, danke.«
Und die Leute bezeichnen mich als Poeten.
Sie schnaubt, als würde sie gerade das Gleiche denken. Ich versuche, sie mit reiner Gedankenkraft dazu zu bewegen, sich herumzudrehen und mich anzusehen.
Und sie tut es. In ihrer Miene spiegelt sich Abscheu. »Hast du das, was ich dir dagelassen habe, getrunken?«
»Ja, Ma’am.« Ich salutiere und unterdrücke ein Grinsen.
Sie starrt mich einfach nur an. Dann schnappt sie sich eine Schüssel und füllt sie. Ihre Stiefel klappern dumpf, als sie zu mir herüberstapft und die Schüssel vor mich stellt. Daraus starrt mich ein Klumpen aus stückigem weißem Zeug an.
»Das ist Hafergrütze«, sagt sie, bevor ich das Wort ergreifen kann. »Ich will keine dummen Kommentare hören. Iss sie einfach.«
»Bist du immer so freundlich?«, frage ich und nehme den Löffel entgegen, den sie mir vor die Nase hält.
»Zu dir? Ja.« Sie nimmt ihre eigene Schüssel und setzt sich weit von mir weg.
»›Und ist entsetzlich wild, obschon so klein.‹« Elly May mag einen üppigen Hintern haben, aber sie kann nicht größer als eins sechzig sein, und sie ist zierlich.
Ihr Stirnrunzeln nimmt epische Ausmaße an. »Hast du gerade Shakespeare zitiert?«
»Das habe ich mal als Tattoo gesehen«, lüge ich, einfach nur weil es Spaß macht, sie zu necken. »Vielleicht stand noch etwas davor.« Ich kratze mein bärtiges Kinn. »So was wie … ›Oh, sie hat arge Tück in ihrem Zorn!‹«
»Den Teil habe ich noch nie als Tattoo gesehen«, murmelt sie und wirft mir einen skeptischen Blick zu, bevor sie einen Happen von ihrer Hafergrütze isst.
Ich schenke ihr einen unschuldigen Blick, dann essen wir. Die Hafergrütze ist gut, geschmacklich betrachtet. Die Konsistenz hilft allerdings nicht, meine Übelkeit zu bekämpfen.
»Das Getränk hat geholfen«, sage ich, um die Stille zu füllen. Einst dachte ich, ich würde Stille lieben. Wie sich gerade herausstellt, hasse ich sie.
»Ein altes Katerheilmittel von meinem Dad.«
Ein Küchenwecker klingelt, und sie steht auf. Dann rieche ich die Kekse, und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wie ein hungriger Hund verfolge ich ihre Bewegungen, während sie das Backblech aus dem Ofen zieht und die goldenen Häufchen auf einen Teller legt.
Sobald sie den Teller auf den Tisch stellt, stürze ich mich darauf. Ich verbrenne mir die Fingerspitzen, und meine Zunge schmerzt. Es ist mir egal. Sie sind zu gut. Himmlisch.
Sie beobachtet mich mit schrägen Lippen, als wäre sie zwischen einem Lächeln und einem Stirnrunzeln gefangen. Sie hat hübsche Lippen, das muss ich ihr lassen. Ich glaube, man nennt sie Amorlippen. Die Sorte, die zwar klein, aber wie ein Kuss geformt ist.
»Willst du Butter dazu?«, fragt sie.
»Ist die Frage ernst gemeint?«, bringe ich zwischen zwei Bissen hervor.
Sie steht auf, holt ein Gefäß, das, wie sich herausstellt, mit Honigbutter gefüllt ist – verdammt, ist das gut –, und besorgt uns jeweils eine Tasse Kaffee. Sie kippt Sahne in beide, ohne zu fragen, ob ich das mag. Normalerweise trinke ich meinen Kaffee schwarz und süß, aber momentan werde ich mich auf keinen Fall beschweren. Nicht wenn sie mir die Kekse wegnehmen könnte, falls ich es tue.
Ich schlucke einen weiteren himmlischen Bissen hinunter. »Wie heißt du?«
Ich kann diese Frau nicht weiterhin Elly May nennen. Andererseits bin ich nur auf der Durchreise, also spielt es eigentlich keine Rolle. Aber ich will es trotzdem wissen. Ob sie nun mürrisch ist oder nicht, sie hat sich um mich gekümmert, und zwar in einer Situation, in der ich an ihrer Stelle die Bullen gerufen hätte.
Sie stellt ihre Tasse ab und schaut mir direkt in die Augen. »Liberty Bell.«
Ich frage mich, ob sie mich verarscht, doch der streitbare Ausdruck in ihrem Gesicht verrät mir, dass sie es vollkommen ernst meint.
»Das ist … patriotisch.«
Sie schnaubt und trinkt ihren Kaffee. »Es ist lächerlich. Aber meine Eltern haben den Namen geliebt, und ich habe meine Eltern geliebt, also …« Sie zuckt mit den Schultern.
Geliebt. Vergangenheit.
»Dann bist du allein?« Ich verziehe das Gesicht, sobald die Worte meinen Mund verlassen haben, denn sie verspannt sich, und ihre weichen grauen Augen werden wieder hart.
Liberty stößt sich vom Tisch ab. »Ich habe dein Motorrad heute Morgen abschleppen lassen. Ich werde dich in die Stadt fahren, damit du die Angelegenheit mit den Mechanikern klären kannst.«
Ich stehe ebenfalls auf, schnell genug, dass der Boden zur Seite kippt. »Hey, warte.« Als sie innehält, um mich anzusehen, fällt mir nichts ein. Das ist mir noch nie passiert. Ich fahre mit einer Hand durch mein verheddertes Haar und erinnere mich daran, dass sie es gewaschen hat. »Willst du gar nicht wissen, wie ich heiße?«
Verdammt, das ist die letzte Information, die ich ihr geben will. Aber mich ärgert, dass sie mich bereits zur Tür hinausschiebt. Und ich will verdammt sein, wenn ich wüsste, warum mich das ärgert.
Sie mustert mich von oben bis unten. Diese sorgfältige Betrachtung sorgt dafür, dass meine Haut juckt und anschwillt. Es ist kein abschätzender Blick, es ist eine Musterung. Und ich werde eindeutig als mangelhaft befunden. Das ist mir ebenfalls noch nie passiert.
Ihr Haar schwingt und fängt das Sonnenlicht auf, als sie den Kopf schüttelt. »Nein. Nein, will ich nicht.«
Und dann lässt sie mich mit einer Tasse kalt werdendem Kaffee und einem Teller Kekse zurück.
Liberty
Ich war zu lange allein. Ich weiß nicht mehr, wie man sich in der Gegenwart anderer Menschen verhält. Vor allem nicht in der Gegenwart dieses Kerls. Gestern war er abstoßend. Betrunken und zu weggetreten, um zu funktionieren. Ich hätte ihn auf meiner Veranda lassen, die Polizei rufen und mich sauber machen sollen, während sie ihn fortgeschafft hätten.
Aber das konnte ich nicht. Nicht alle Trinker sind bösartig. Manche sind nur vom Weg abgekommen. Ich habe keine Ahnung, was dieser Kerl für ein Problem hat. Ich weiß nur, dass ich es nicht übers Herz bringen konnte, ihn allein zu lassen, als ich vor der Entscheidung stand.
Also zerrte ich ihn in mein Bad und wusch ihn sauber. Die Handlung hatte nichts Sexuelles an sich. Er stank ganz furchtbar und war so sturzbetrunken, dass ich mich zusammenreißen musste, um ihm für seinen Leichtsinn nicht den Hals umzudrehen.
Ganz zu schweigen davon, dass ich sauer war, weil ich diesem Idioten mein Bett überlassen musste. Ich wäre niemals in der Lage gewesen, ihn die Treppe hoch zu den Gästezimmern zu hieven.
Doch nun, im Tageslicht, bin ich in Bezug auf meinen betrunkenen Penner vollkommen ratlos. Seine Präsenz in meinem Haus ist immens. Als ob ihn ein bloßes Zimmer niemals halten könnte.
Präsenz. Meine Mom sagte immer, dass es Leute gebe, die sie einfach hätten. Heute verstehe ich zum ersten Mal, was sie damit meinte. Denn obwohl er nach Worten ringt und eindeutig verkatert ist, strahlt dieser Kerl Lebenskraft aus. Sie durchzieht die Luft wie ein Parfüm, sickert in meine Haut und führt dazu, dass ich mich mit meinem ganzen Körper an ihm reiben will, nur um ein wenig mehr von diesem Gefühl zu bekommen – als ob ich durch die bloße Nähe zu ihm ebenfalls etwas Besonderes sein könnte.
Es ergibt keinen Sinn. Allerdings ergibt das Leben für mich selten Sinn.
Und nun, da er nicht mehr völlig betrunken und verdreckt ist, kann ich seine Schönheit erkennen. Sein Körper ist lang und fest und verfügt über eine Art knochige Stärke aus sehnigen Muskeln und scharfen Bewegungen. Sein Haar ist immer noch ein zerzaustes Durcheinander, das ihm über die Schultern fällt. Es hat die Farbe von starkem, dunklem Kaffee. Ein dichter ungepflegter Bart bedeckt einen Großteil seines Gesichts, was … ärgerlich ist. Denn er verbirgt zu viel.
Aber das, was ich sehen kann, deutet auf einen attraktiven Mann hin. Seine Nase ist kühn und hat eine Beule im oberen Bereich des Nasenrückens, als ob sie mal gebrochen gewesen wäre. Aber die Form passt zu seinem Gesicht. Hervorstehende Wangenknochen und etwas, das unter diesem ganzen Bartwuchs wie ein trotziges Kinn aussieht, verleihen ihm eine Ausstrahlung reiner Männlichkeit.
Seine Augen sind hingegen regelrecht hübsch. Unter den dunklen Brauen, die sie zusätzlich betonen, schimmern sie wie Obsidian.
Wer könnte davon nicht berührt sein? Der Blick aus diesen Augen hat vorhin in der Küche jede meiner Bewegungen verfolgt. Und mich verunsichert.
Ich stellte ihm Essen hin, nur damit er den Blick anwenden würde. Doch das tat er nicht. Selbst als er meine Kekse inhalierte, als wäre er am Verhungern, beobachtete er mich. Jedoch nicht auf sexuelle Weise, sondern eher so, als wäre ich ein Durcheinander, in das er unabsichtlich hineingestolpert wäre. Die Ironie sorgte dafür, dass ich lachen wollte.
Jetzt will ich nur noch weg von ihm. Über meine Eltern zu reden hat mich daran erinnert, warum ich diesen Kerl hassen sollte – diesen Fremden, der sich betrunken ans Steuer gesetzt hat, womit er nicht nur sein eigenes, sondern auch die Leben aller anderen, mit denen er sich die Straße teilte, in seine unsicheren Hände genommen hat. Mein Leben wird wegen eines betrunkenen Fahrers nie wieder dasselbe sein, und ich habe nur wenig Respekt vor Menschen, die so etwas tun. Selbst wenn sie Shakespeare zitieren und ein freches, irgendwie süßes Lächeln haben.
Ohne zurückzublicken, schnappe ich mir meine Schlüssel. Er ist jedoch nicht weit hinter mir. Seine Stiefel stapfen ebenso laut wie meine und hallen durch den Flur im Eingangsbereich. Er hat einen frischen Keks in der Hand und kaut auf den Überresten eines anderen herum. Ich weigere mich, das liebenswert zu finden.
»Willst du wirklich nicht wissen, wie ich heiße?«, ruft er.
Ich greife nach meiner Sonnenbrille. »Warum stört dich das? Es ist ja nicht so, als würden wir einander wiedersehen.«
Sein Stirnrunzeln vertieft sich. »Das gebietet schon allein die Höflichkeit.«
»Ich denke, dass wir die grundlegende Etikette nach dieser Dusche hinter uns haben.«
Seltsamerweise bringt ihn das zum Lächeln. Und, oh Mann, dieses Lächeln ist, als würde die Sonne mit all ihrer Helligkeit und unverhohlenen Freude durch Sturmwolken brechen. Es blendet mich regelrecht, und ich muss blinzeln und mich abwenden.
»Siehst du, das meine ich.« Er deutet mit seinem Keks auf mich, bevor er einen großen, geräuschvollen Bissen davon nimmt. »Du hast mich nackt gesehen …«
»Sprich nicht mit vollem Mund. Das ist ekelhaft.«
Er kaut weiter. »Du hast meinen Schwanz gewaschen …«
»Hey, ich bin nicht mal in die Nähe deines Gehänges gekommen, Kumpel.«
Sein Grinsen breitet sich um den Keks herum aus. »In meiner Erinnerung bist du das. Und du hast meine Haare gewaschen. Du kannst einem Mann nicht die Haare waschen, ohne seinen Namen zu kennen. Das bringt Unglück.«
»Unglück?« Ich versuche, nicht zu lachen, während ich auf die Tür zugehe. »Du bist immer noch betrunken.«
»Ich bin vollkommen klar im Kopf, Libby.« Er ist direkt hinter mir und folgt mir auf dem Fuße. »Jetzt frag mich nach meinem Namen.«
Ich bleibe stehen und drehe mich um, und meine Nase stößt gegen die Mitte seiner Brust. Der Körperkontakt rauscht durch mich hindurch wie eine vibrierende Welle. Ich trete zurück und neige den Kopf.
Er wirft mir einen leicht selbstgefälligen, komplett feindseligen Blick zu. Doch dann senkt er die Stimme, sodass sie süß und schmeichelnd klingt. »Komm schon. Frag mich.«
Gott, diese Stimme. Ich habe versucht, sie zu ignorieren, weil es die Art von Stimme ist, die einen hypnotisieren und dafür sorgen kann, dass man seinen Gedankengang verliert. Sie ist leise und tief und kraftvoll. Wenn er redet, ist das wie eine Melodie.
Nun starrt er mich mit seinen dunklen Augen erwartungsvoll an und wartet. Der Anblick führt dazu, dass mein Herz heftig in meiner Brust pocht. Ich habe sehr lange nicht mehr so nah an einer anderen Person gestanden.
Ich schlucke und finde meine Stimme wieder. »Also gut, verrate ihn mir.«
Doch er sagt nichts. Er erstarrt, als wäre er erwischt worden, und ist plötzlich misstrauisch.
»Du willst mich auf den Arm nehmen, oder?« Ich lache, doch ich finde das ganz und gar nicht lustig. »Du nervst mich die ganze Zeit damit, dass ich dich nach deinem Namen fragen soll, und jetzt machst du auf Rumpelstilzchen?«
Er blinzelt, als würde er sich aus einer Trance befreien, und starrt mich dann an. »Keine Sorge, dein Erstgeborenes ist sicher vor mir.« Er atmet ein und streckt mir seine Hand entgegen. »Killian.«
Ich beäuge seine Hand. Sie ist groß und breit, und die Fingerspitzen sowie die obere Kante seiner Handfläche sind schwielig. Er ist irgendein Musiker. Vermutlich Gitarrist. Ich fahre mit dem Daumen über meine eigenen rauen Fingerspitzen. Er wartet wieder und runzelt die Stirn, als hätte ich ihn beleidigt, indem ich nicht nach seiner Hand greife.
Also tue ich es. Sie ist warm und fest. Er drückt meine Hand stark genug, um meine Knochen zu biegen. Doch ich glaube, er weiß nicht, wie fest sein Griff ist. Definitiv ein Musiker.
»Freut mich, dich kennenzulernen, Liberty Bell.« Das Lächeln unter seinem dichten Bart ist freundlich, fast jungenhaft. Zuvor dachte ich, dass er in den Dreißigern wäre. Aber jetzt schätze ich ihn eher auf mein Alter, Mitte bis Ende zwanzig.
Ich lasse seine Hand los. »Ich würde unsere Begegnung nicht unbedingt als erfreulich bezeichnen.«
»Oh, du musst schon zugeben, dass ich gut zielen kann.« Er stupst mich an, und ich verdrehe die Augen.
»Lass uns nie wieder darüber reden.«
»Worüber reden?« Sein Tonfall ist locker, als er mir nach draußen folgt.
Ich gehe zu meinem Truck, doch er hält mich mit einer Berührung am Ellbogen auf. Sein Blick ist auf Mrs Cromleys Haus auf der anderen Straßenseite gerichtet. Mrs Cromley ist vor sechs Monaten gestorben, und ihr Neffe George hat das Haus übernommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass er in den Vierzigern ist und eine Frau und Kinder hat. Ich bezweifle, dass er hier einziehen wird. Das Haus befindet sich am Rand zum Nirgendwo, und unsere kleine Insel vor der Spitze der Outer Banks hat nicht mal eine Schule.
Andererseits parkt ein Wagen von Als Lebensmittelladen vor dem Haus, und auf der Veranda stehen zwei große Kisten. Killian schaut sich um und betrachtet das wehende Gras, das mit Anbruch des Herbstes langsam braun wird, den Gipfel des Hügels und den winzigen Streifen aus Blau, wo der Atlantik ans Ufer brandet.
Killian kratzt sich am Kinn, als würde sein Bart jucken. »Dieses Haus dort drüben. Weißt du, ob das George Cromley gehört?«
Ein banges Gefühl zieht an meinen Eingeweiden. »Ja«, sage ich langsam.
Killian nickt und fängt meinen Blick auf. Sein Lächeln ist genauso langsam und selbstgefällig wie immer. »Dann werde ich wohl doch keine Mitfahrgelegenheit in die Stadt brauchen, Nachbarin.«
3. Kapitel
Killian
Ich habe ihr meinen Namen verraten, und sie hat mich nicht erkannt. Es ist so lange her, dass mich jemand in meinem Alter angesehen hat, als wäre ich ein vollkommen Fremder, dass es sich nun seltsam beunruhigend anfühlt. Und ist das nicht verkorkst? Ich habe große Mühen auf mich genommen, um den Fans und den Leuten zu entkommen, die mir entweder den Hintern küssen oder etwas von mir haben wollen. Und nun, da ich eine Frau getroffen habe, der es eindeutig lieber wäre, wenn ich einfach verschwinden würde, bin ich irritiert.
Ich schnaube, trinke einen Schluck von dem brühend heißen Kaffee und lehne mich auf dem altmodischen Schaukelstuhl zurück. Von meinem Platz auf der Veranda aus habe ich einen guten Blick auf Libertys Haus. Es ist ein zweigeschossiges, weiß verkleidetes Gebäude. Die Sorte, die man auf Gemälden von Edward Hopper sieht. Wenn man daran vorbeifährt, würde man vermuten, dass darin eine kleine, alte Frau wohnt, die gerade Kuchenteig knetet. Ich wette, Liberty macht tollen Kuchen, aber bevor ich ihn probieren könnte, würde sie mir vermutlich mit dem Nudelholz eins überbraten, weil ich sie geärgert habe.
Die Narbe, die mein Motorrad in das Gras gerissen hat, ist eine hässliche Erinnerung an das, was ich an jenem Abend getan habe. Ich bin betrunken gefahren. Das passt nicht zu mir. Ich war immer derjenige, der die Jungs unter Kontrolle gehalten hat. Ich habe sie davon abgehalten, dem harten Stoff zum Opfer zu fallen – zu Klischees zu werden, wie Liberty es ausdrückt.
Etwas Starkes und Hässliches macht sich in meiner Brust breit. All meine Bemühungen haben Jax nicht helfen können. Bilder seines schlaffen Körpers blitzen in lebhaften Farben vor meinen Augen auf: die grau werdende Haut auf den weißen Fliesen, das gelbe Erbrochene, die grünen Augen, die ins Nichts starren.
Ich beiße die Zähne zusammen, und meine Finger schmerzen, weil ich die Tasse so fest umklammert halte.
Verdammter Jax. Idiot.
Der Schmerz erschwert mir das Atmen. Mein Körper zuckt, weil er das Bedürfnis hat, sich zu bewegen. Irgendwo anders hinzugehen. In Bewegung zu bleiben, bis mein Geist leer ist.
Das Schlagen einer Fliegengittertür lässt mich zusammenzucken, und heißer Kaffee schwappt über den Rand meiner Tasse.
»Mist.« Ich stelle die Tasse auf den Boden und sauge an meinem verbrannten Finger.
Auf der anderen Seite der Straße stapft Liberty die Stufen ihrer Veranda herunter. Sie ist auf dem Weg zu einem Gemüsegarten hinter einem hohen Zaun. Ich muss lächeln. Diese Frau geht nie nur einfach. Egal wo sie hingeht, es wirkt immer, als befände sie sich auf einem Kreuzzug.
Sie bewegt sich durch eine Stelle, die von Sonnenlicht durchflutet wird, und ihr Haar nimmt die Farbe von gebräunter Butter an. Ich verspüre den Drang, den Augenblick festzuhalten, eine Textzeile aufzuschreiben. Der Gedanke lässt mich so panisch werden, dass ich aufstehe und herumlaufe.
Ich sollte ins Haus gehen. Und was dann? Soll ich mich auf die antike Couch mit dem hässlichen blauen Rosenmuster legen? Den Tag vertrinken?
Kisten mit meinem Zeug sind angekommen. Darunter drei meiner liebsten Gitarren. Scottie, dieser elende Mistkerl, hat sie mitgeschickt, obwohl ich nie um sie gebeten habe. Denkt er, dass ich hier etwas komponieren werde? Ein Lied schreiben werde? Auf keinen Fall. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Scotties tolle Idee, dass ich mich auf einer Insel verstecken sollte, auf der fast niemand von mir gehört hat, ist dämlich. Das habe ich nun davon, dass ich auf ihn gehört habe, als ich betrunken war.
Vielleicht hat Scottie übernatürliche Fähigkeiten, denn mein Handy klingelt. Und nur eine Handvoll Leute haben diese Nummer. Ich beobachte Libby, die zwischen Reihen aus Grünzeug kniet, während ich ans Telefon gehe. Nur dass es nicht Scottie ist.
»Hey, Mann«, sagt Whip.
Ich habe seine Stimme fast ein Jahr lang nicht mehr gehört. Der vertraute Klang ist wie ein Tritt vor den Bug. Ich lasse mich auf meinen Stuhl zurücksinken. »Hey.« Ich räuspere mich. »Was gibt’s?«
Herrgott, lass es nicht um Jax gehen. Meine Finger werden kalt, und Blut rauscht in meine Schläfen. Ich hole tief Luft.
»Stimmt es, dass du irgendwo in der Wildnis von North Carolina herumlungerst?«
Ich stoße ein Knurren aus. »Ist er in Ordnung?«
Eine Pause entsteht. Dann flucht Whip. »Scheiße, Mann, ich hab nicht nachgedacht. Ja, er ist in Ordnung.« Whip seufzt hörbar. »Es geht ihm sehr viel besser. Er macht eine Therapie.«
Gut. Toll. Schön, dass Jax angerufen hat, um mir das zu erzählen. Ich reibe mir mit einer Hand übers Gesicht und schließe die Augen. »Also, was ist los?«
»Ich habe nur nachgedacht.« Whips Stimme klingt abwesend. »Wir haben uns in alle vier Winde zerstreut. Und … verdammt, ich wollte einfach reden. Mal hören, wo du dich so rumtreibst.«
Jax ist derjenige, der uns zerstreut hat. Er hat uns an jenem Tag so effektiv zerbrochen, als hätte er einen Felsbrocken in ein Fenster geworfen. Und während Jax und ich normalerweise die Mutter- und Vaterrollen in der Gruppe übernahmen, ist Whip schon immer der Anker gewesen, unser Leim. Er würde mir eine reinhauen, wenn ich ihm das ins Gesicht sagen würde, aber Whip ist auch der Sensibelste. Ich weiß, dass er leidet.
Ich schaue wieder zu Libby hinüber. Ihr praller Hintern schwingt hin und her, während sie Unkrat zupft. Der Anblick entlockt mir beinahe ein Lächeln. Sie würde es hassen, wenn sie wüsste, dass ich sie beobachte. Dann finde ich meine Stimme wieder. »Hast du mit den anderen geredet?«, frage ich Whip.
»Ich habe Rye gesehen. Wir haben ein wenig Material produziert.«
Das ist neu. Normalerweise sind Jax und ich diejenigen, die schreiben. Ich setze mich ein wenig aufrechter hin und versuche, mich zu konzentrieren. Ich muss ihn unterstützen. Das weiß ich. Aber es fällt mir schwer, Begeisterung aufzubringen. Trotzdem sage ich, was gesagt werden muss. »Habt ihr irgendwas aufgenommen, das ich mir anhören kann?«
»Ja, klar. Ich schicke es dir zu.« Whip hält inne und fügt dann beiläufig hinzu: »Vielleicht kannst du dem Material den letzten Schliff geben. Ein bisschen was hinzufügen.«
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin nicht sauer. Mir gefällt die Vorstellung, dass sie komponieren. Aber etwas regt sich in mir: Ich will dem ausweichen, am liebsten ganz verschwinden und vor allem dieses Telefonat beenden.
Aber Whip ist noch nicht fertig. »Oder vielleicht kommst du zurück und arbeitest mit uns.«
Ich bin wieder aufgestanden und gehe zu dem Fliegengitter, das die gesamte Veranda umgibt. Ich lehne meine Stirn gegen die zerbrechliche Wand. »Noch nicht. Aber bald, Mann.«
»Ja. Klar.« Whip klingt in etwa so aufrichtig wie ich.
»Ich melde mich«, sage ich. Es mag eine Lüge sein oder auch nicht. Ich habe meine Gitarre fast ein Jahr lang nicht mehr angerührt und verspüre kein Bedürfnis, es jetzt zu versuchen.
»In Ordnung.«
Als er auflegt, klingelt die Stille in meinen Ohren. Ich weiß nicht mehr, wie ich ich selbst sein soll, und ich weiß nicht, wie ich ein Teil von Kill John sein soll. Wie machen wir weiter? Machen wir es ohne Jax? Mit ihm? Und schauen wir dann die ganze Zeit über unsere Schultern, weil wir fürchten, dass er es erneut versuchen wird?
Bei einem Teil davon geht es noch nicht mal um Jax. Ich bin müde. Uninspiriert. Und deswegen fühle ich mich verdammt schuldig.
Obwohl ich auf einer Veranda stehe, bedrängen mich die Wände und nehmen mir die Luft zum Atmen. Ich sollte ins Haus gehen und … irgendetwas tun. Meine Füße tragen mich jedoch in die entgegengesetzte Richtung, weg von meiner Veranda und direkt zu Liberty.
Sie hockt vornübergebeugt über einer Reihe Kräuter und schaut nicht auf, als ich meine Hände gegen das obere Ende des Zauns stütze, das sich auf Kinnhöhe befindet. Ich sehe ihr bei der Arbeit zu und störe mich nicht an der Stille. Die Art, wie sie mich ignoriert, ist amüsant, weil sie es nicht besonders gut macht. Ihr ganzer gelassener Mir-ist-scheißegal-dass-du-hier-bist-Ausdruck verrät mir nur, dass es ihr keineswegs scheißegal ist. Sie wünscht sich lediglich, dass es so wäre.
Der Gedanke entlockt mir ein Grinsen. Das Ganze hat etwas so Normales an sich. »Weißt du, vor mir haben schon sehr oft Frauen gekniet. Aber normalerweise lächeln sie dabei.«
Sie schnaubt. »Ich wäre beeindruckter, wenn du derjenige wärst, der kniet. Ich mag Geber, keine Nehmer.«
Herrgott. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sie mit weit gespreizten üppigen Schenkeln vor mir liegt und diesen herrischen Tonfall benutzt, um mir zu sagen, was ihr am besten gefällt, während ich sie mit meinem Mund verwöhne. Ich verlagere meine Hüften und wende sie vom Zaun ab. Die wachsende Beule in meiner Hose muss sie nicht sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich zu ihr hingezogen fühle oder plötzlich zum Masochisten geworden bin. »Was ist mit Geben und Nehmen? Kommst du damit klar?«
Noch während ich scherze, überkommen mich Schuldgefühle. Wann habe ich eigentlich zum letzten Mal etwas gegeben? Denn sie hat recht. Ich bin faul geworden und saß wie ein König herum, während mir irgendwelche Frauen einen bliesen und ich mir Liedtexte überlegte oder das nächste Album plante. Irgendwann erreichte ich einen Punkt, an dem mir vollkommen egal war, was diese Frauen machten oder wohin sie verschwanden, sobald ich gekommen war.
Nun starrt Liberty zu mir hoch. »Was genau machst du hier eigentlich? Arbeitest du nicht?«
Gott, ich will darüber lachen. Ich beiße mir auf die Unterlippe. »Und was ist mit dir? Ist heute nicht Dienstag?«
»Heute ist Mittwoch, und ich arbeite von zu Hause aus, vielen Dank auch.«
»Was machst du?«
»Wenn ich wollte, dass du das weißt, hätte ich es wohl gesagt.«
»Bist du DJ?«
»DJ?« Sie starrt mich mit offenem Mund an. »Ist das dein Ernst? Wo sollte ich denn auflegen? In der Kirche?«
Ich laufe tatsächlich rot an. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie vor Verlegenheit rot angelaufen. Ich schaue zum Himmel hoch, um zu sehen, ob dort irgendwelche Schweine herumfliegen, und murmle: »Du hast diese ganzen Schallplatten.«
»Ah.« Sie nickt knapp. »Die haben meinem Dad gehört. Er war in seiner Collegezeit als DJ tätig.«
»Das ist eine beeindruckende Sammlung.«
»So ist es.«
»Und die Gitarre?«
Sie krümmt die Schultern. »Die gehörte ebenfalls meinem Dad.«
Jetzt weiß ich, wie sich Reporter fühlen, wenn sie mich interviewen. Ich kann mich in sie hineinversetzen. Diese Frau hat mir in Bezug auf Ausweichmanöver einiges voraus.
»Wirst du es mir wirklich nicht verraten?« Ich weiß nicht, warum ich so drängele. Aber ihre Entschlossenheit, mich abzuwimmeln, amüsiert mich.
»Ich schätze, nicht.« Sie zieht eine Schere hervor und schneidet Büschel aus Salbei, Thymian und Rosmarin ab. Meine Großmutter hatte einen Kräutergarten. Es war eine kleine Kiste, die sie an ihrem Küchenfenster in der Bronx aufgestellt hatte. Als ich klein war, bettelte ich sie immer an, abschneiden zu dürfen, was sie brauchte. Und sie erinnerte mich daran, die Blätter nicht zu quetschen.
Ich schüttle die alten Erinnerungen ab, bevor sie mich erdrücken. »Schön. Dann überlasse ich das eben meiner Fantasie.« Ich kratze mich am Kinn, das nun bartlos und glatt ist – das verdammte Ding hat zu sehr gejuckt, um es in dieser Hitze zu behalten. »Ich tippe auf Telefonsexmitarbeiterin.«
Libby legt ihre Kräuter in ihren Korb und lehnt sich auf den Fersen zurück. »Das ist einfach nur lächerlich. Klinge ich wie eine Telefonsexmitarbeiterin?«
»Irgendwie schon.« Ich räuspere mich, weil ich praktisch hören kann, wie sie mit ihrer cremigen Eisstimme Forderungen stellt. »Ja, das tust du.«
Sie runzelt die Stirn und schaut mir schließlich wieder in die Augen. Was auch immer sie in meiner Miene sieht, sorgt dafür, dass sie die Stirn noch stärker runzelt und errötet. Schnell wendet sie sich wieder ihrer Gartenarbeit zu. »Ich habe zu tun. Willst du den ganzen Tag lang hier stehen und mir zusehen? Oder gibt es vielleicht eine Flasche, die du bis auf den letzten Tropfen leeren willst?«
»Süß. Und nein. Für mich gibt es keine Alkoholexzesse mehr.«
Sie gibt einen zweifelnden Laut von sich.
Ich sollte gehen. Ich schaue zu meinem Haus zurück. Es ragt wie ein Klumpen aus dem Grundstück hervor und wirkt verloren und still. Erneut regt sich dieses scheußliche juckende Gefühl in meiner Brust. Ich muss mich anstrengen, um nicht daran zu kratzen. Libby schaut jedoch nicht hin. Sie zupft Unkraut. Seufzend räuspere ich mich. »Kann ich helfen?«
Libby
Er geht nicht weg. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es quält mich, mich ihm gegenüber so ungastlich zu verhalten. Mit jedem knappen Wort, das ich ihm entgegenschleudere, kann ich fühlen, wie sich meine Großmutter im Grab herumdreht. Ich wurde dazu erzogen, vor allem immer höflich zu sein. Aber Killian geht mir aus zahlreichen Gründen auf die Nerven.
Ich habe natürlich damit gerechnet, ihn wiederzusehen. Immerhin sind wir Nachbarn. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er mich sofort aufsuchen und in meiner Nähe bleiben wollen würde. Und obwohl ich nicht besonders freundlich gewesen bin, scheint ihn das nicht zu stören. Er erinnert mich irgendwie an diese Jungs in der Grundschule, die Freude daran hatten, die Mädchen an den Zöpfen zu ziehen.
Und die nüchterne Wahrheit ist, dass sich Kerle, die wie Killian aussehen, einfach nicht für mich interessieren. Das haben sie nie. Also warum jetzt? Ist ihm langweilig? Will er sich unters gemeine Volk mischen?
Was auch immer der Fall ist, seine Anwesenheit beunruhigt mich, aber ich bin auch auf irritierende Weise neugierig, was es mit diesem Kerl auf sich hat.
Killian sollte kleiner wirken, während er auf Händen und Knien auf dem Boden hockt und Unkraut zupft. Doch wenn überhaupt, wirkt er nun sogar noch größer. Seine Schultern sind breiter, während sie sich unter seinem ausgebleichten Captain-Crunch-T-Shirt bewegen. Sein dunkles kaffeefarbenes Haar fällt ihm in Zotteln über die Schultern, und ich verspüre den Drang, ihm einen Haarschnitt anzubieten. Ich habe nichts gegen lange Haare, aber Killians sind einfach nur ein wirres Durcheinander. Ich schwöre, dieser Mann besitzt nicht mal eine Bürste.
Aber er hat sich rasiert. Anfangs hat mich der Anblick verwirrt, weil ich diesen Hinterwäldlerbart erwartet hatte, als ich seine Stimme hörte. Doch anstelle eines struppigen Gesichts begrüßten mich ein glatter, kantiger Kiefer, ein trotziges Kinn und ein breites Grübchenlächeln. Wie soll irgendjemand dem widerstehen können?
»Wie hast du den Unterschied zwischen Unkraut und Nutzpflanzen gelernt? Seine tiefe samtige Stimme hüllt mich ein, aber er schaut nicht von seiner Arbeit auf. Die kleine Konzentrationsfalte zwischen seinen Augenbrauen ist irgendwie liebenswert. »Denn für mich sieht das alles gleich aus.«
»Das hat mir meine Großmutter beigebracht.« Ich räuspere mich und ziehe an einem besonders hartnäckigen Unkraut.
»Darin sind Großmütter gut.«
Ich kann mir nicht vorstellen, wie er Zeit mit einer Großmutter verbringt. Oder vielleicht kann ich es doch. Sie würde ihm vermutlich Milch und Kekse bringen und ihn schelten, dass er besser auf sich achtgeben soll. Ich deute auf ein weiteres Unkraut. »Irgendwann wird es leichter, sie zu entdecken.«
»Wenn du das sagst.« Er klingt nicht allzu glücklich, arbeitet aber weiter.
Wir schweigen wieder und gehen unseren Angelegenheiten nach.
»Geheimagentin?«
Ich hebe ruckartig den Kopf, als Killian diese Frage stellt. »Was?«
Er wackelt mit seinen dunklen Augenbrauen. »Deine Arbeit. Ich versuche immer noch herauszufinden, was du machst. Bist du eine Spionin?«
»Du hast mich durchschaut. Jetzt komm mit.« Ich deute mit dem Kopf in Richtung Haus. »Ich will dir drinnen etwas zeigen.«
Er senkt seine weißen Zähne in seine volle Unterlippe. »Ich komme nur mit, wenn es etwas mit Hinternversohlen zu tun hat.«
Ich muss gegen meinen Willen prusten.
»Sexspielzeugtesterin?«
»Äh, nein.«
»Erotikschriftstellerin?«
»Warum haben plötzlich alle Optionen etwas mit Sex zu tun?«
»Weil die Hoffnung zuletzt stirbt.«
»Du solltest lieber hoffen, dass ich dir nicht versehentlich mit Absicht einen Kopfstoß verpasse.«
»Schon gut, schon gut. Homeshopperin?«
»Ich hasse Shoppen.«
»Ja, das sieht man.«
Wieder hebe ich den Kopf. »Was soll das heißen?«
Er zuckt mit den Schultern und zeigt keinerlei Reue. »Eine Frau, die in abgenutzten Doc Martens herumstapft, ist normalerweise nicht der Typ Frau, der angesichts einer neuen Verkaufsaktion zu quietschen anfängt.«
Ich lehne mich auf den Absätzen der besagten Docs zurück. »Okay, ich hab’s nicht so mit Mode. Aber das muss nicht bedeuten, dass ich nicht gern shoppe.«
»Du hast gerade gesagt, dass du Shoppen hasst. Also wirklich gerade eben.«
»Ja, aber du solltest nicht in der Lage sein, das zu erkennen, indem du mich einfach nur ansiehst.«
Er zieht die Nase kraus und kratzt sich am Hinterkopf. »Ich bin verwirrt.«
»Vielleicht bin ich süchtig danach, Puppen zu kaufen. Vielleicht habe ich hinten im Haus ein ganzes Zimmer voll mit Puppen.«
Killian erschauert am ganzen Körper. »Über so was solltest du keine Witze machen. Ich werde monatelang Chucky-Albträume haben.«
Ich stelle mir ein Zimmer voller Puppen vor, die mich anstarren, und schaudere ebenfalls. »Du hast recht. Keine Puppen. Niemals.«
Er zwinkert mir zu. Ich habe keine Ahnung, wie er das hinbekommt, ohne wie ein schmieriges Arschloch zu wirken, aber stattdessen ist es niedlich. »Siehst du?«, sagt er. »Keine Shopperin.«
»Und was bist du? Ein Detektiv?«
Er lehnt sich ebenfalls auf seinen Absätzen zurück. »Wenn ich einer wäre, wäre ich ein ziemlich schlechter, da ich nicht herausfinden kann, was du beruflich machst.«
Wir starren einander an. Sein dunkler, erwartungsvoller Blick bohrt sich in meinen. Das ist überraschend effektiv, denn ich schwöre, dass ich anfange zu schwitzen.
»Schön«, platzt es aus mir heraus. »Ich bin Designerin für Buchcover.«
Er blinzelt, als ob ihn das überraschen würde. »Wirklich? Das ist … Nun ja, das Letzte, was ich vermutet hätte, aber total cool. Kann ich deine Arbeit sehen?«
»Vielleicht später.« Ich zupfe weiter Unkraut, aber eigentlich hacke ich immer und immer wieder an derselben Stelle. Dort ist nur noch eine dunkle Narbe aus Erde übrig. Ich streiche mit einer Hand über die kühle Erde und mustere ihn. »Und was machst du?«
Er ist gut. Er zuckt kaum zusammen, bevor er es mit einem breiten und leichtfertigen Lächeln überspielt. »Momentan bin ich arbeitslos.«
Ich will gerade fragen, was er vorher gemacht hat, aber in seinen kaffeefarbenen Augen liegt ein zerbrechlicher und schmerzerfüllter Ausdruck, und ich bringe es nicht übers Herz. Gestern lag er betrunken auf meinem Rasen. Ich denke, für ihn läuft es momentan nicht so gut, und ich verspüre nicht den Wunsch, in dieser Wunde zu bohren.