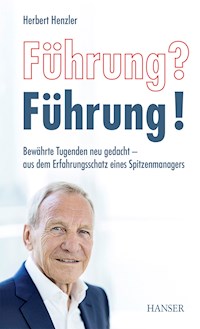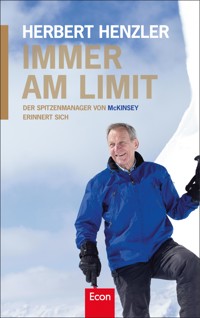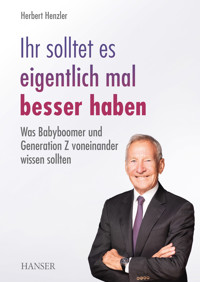
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
„Ihr solltet es mal besser haben!“ – Heute kaum mehr als leere Worte
Die Babyboomer, die bis heute unsere Unternehmen geprägt haben, verlassen nach und nach den Arbeitsmarkt, die Nachrückenden sind wesentlich weniger, bringen andere Erwartungshaltungen mit und stehen anderen Perspektiven gegenüber. Dies bringt für Unternehmen, für die Gesellschaft, aber auch für jeden einzelnen Menschen enorme Herausforderungen mit sich.
Herbert Henzler, den das Manager Magazin einst zu den 50 mächtigsten Managern Deutschlands zählte, hat sich vom einfachen Lehrling hochgearbeitet an die Spitze von McKinsey, wo er fast 20 Jahre erfolgreich die Geschicke dieses Unternehmens lenkte. Heute lehrt er an verschiedenen Universitäten und ist in der Beratung tätig. Er weiß also ganz genau, was Unternehmen zum Erfolg führt und wie Zusammenarbeit erfolgreich funktioniert. In diesem Werk analysiert er die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen vor allem der Generation Z im Vergleich zu den Babyboomern, zeigt, was das für die jeweilige Weltsicht, aber auch für die Arbeitseinstellung bedeutet, spannt dabei einen geschichtlichen, gesellschaftlichen und politischen Bogen, legt manchmal auch den Finger in die Wunde, plädiert dabei stets für mehr Verständnis füreinander und gibt auch konkrete Hinweise, wie die Zusammenarbeit besser funktionieren kann.
- Liefert Handlungsfelder für ein gewinnbringendes Miteinander der unterschiedlichen Generationen
- Veranschaulicht, was die Babyboomer und die Generation Z ausmacht
- Zeigt, worauf es bei der Zusammenarbeit wirklich ankommt und wie es auch in Zukunft erfolgreich weitergehen kann
- Von einem der renommiertesten Autoren im deutschsprachigen Raum
- Differenziert, kritisch und wohlwollend zugleich
„Prof. Dr. Herbert Henzler kennt die deutsche Wirtschaft wie kaum ein Zweiter, verfügt über herausragende unternehmerische Expertise und ist einer der profundesten Managementexperten. In seinem Buch gibt er auf Grundlage dieser einzigartigen Erfahrungen spannende Einblicke, wie in Unternehmen die Generationen erfolgreich miteinander arbeiten können. Lesenswert für alle mit Interesse an aktuellen unternehmerischen Herausforderungen und an generationsübergreifenden Lösungsansätzen!“
Basti Nominacher, Celonis
„Der Herbert hat den Überblick. So wie wir in den Bergen sieht er in unserer Gesellschaft Zusammenhänge wie wenig andere und es zahlt sich aus zuzuhören, wenn er was zu sagen hat. Denn er kann Brücken über Räume und Zeit bauen und damit Generationen verbinden.“
Alexander Huber
„Deutschland verliert an wirtschaftlicher Stärke und an Wettbewerbsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund stellt Herbert Henzler das eherne Narrativ, nach dem es der nächsten Generation besser gehen soll, auf den Prüfstand.
Mit diesem Buch leistet er einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der Generationen untereinander und damit zur Generationengerechtigkeit.“
Günther Öttinger
„Herbert Henzlers überaus lesenswertes Buch baut Brücken für drei Generationen über vermeintliche und tatsächliche Abgründe. Ihre Stabilität gewinnt das gedankliche Bauwerk dank dreier Pfeiler, die Henzler wie nur wenige personifiziert: Erfahrung, Neugierde und Zuversicht. Er entlarvt Illusionen, deckt schonungslos Fassaden und Schwächen auf, und legt damit Potenziale für die Jungen unserer Gesellschaft frei, die letztlich allen zugute kommen. Unbedingt zu empfehlen.“
Karl-Theodor zu Guttenberg
„Manchmal macht es Sinn, den Alten zuzuhören, vor allem wenn sie Herbert Henzler heißen. Henzler schreibt mit großer Erfahrung über unterschiedliche Generationen – nicht um über sie zu urteilen, sondern um sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Ein kluges Buch, das Hoffnung macht.“
Sophia Bogner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert Henzler
Ihr solltet es eigentlich mal besser haben
Was Babyboomer und Generation Z voneinander wissen sollten
Print-ISBN: 978-3-446-48012-4E-Book-ISBN: 978-3-446-48180-0E-Pub-ISBN: 978-3-446-48494-8
Alle in diesem Werk enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen zusammengestellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Werk enthaltenen Informationen für Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht. Ebenso wenig übernehmen Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.
Die endgültige Entscheidung über die Eignung der Informationen für die vorgesehene Verwendung in einer bestimmten Anwendung liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Werkes, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 UrhG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Zwecke des Text- und Data Mining nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
© 2025 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, MünchenKolbergerstraße 22 | 81679 München | info@hanser.dewww.hanser-fachbuch.deRedaktion: Ralf Isau, Regina CarstensenLektorat: Lisa Hoffmann-BäumlHerstellung: Carolin BenedixCovergestaltung: Max KostopoulosTitelmotiv: © Foto-Video Sauter powered by Calumet Photographic GmbHSatz: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
„Now this is not the end.It is not even the beginning of the end.But it is, perhaps, the end of the beginning.“„Dies ist nicht das Ende.Es ist nicht einmal der Anfang des Endes.Aber es ist, vielleicht, das Ende des Anfangs.“
Winston Churchill
Gewidmet allen jungen Menschen, die unsere Zukunft gestalten.
Inhalt
Titelei
Impressum
Inhalt
Vorwort von Reinhold Messner
Teil I – Paradigma und Dilemma
1 Wie die Generationen miteinander umgehen und was sie voneinander denken
1.1 Vom frommen Wunsch zum Paradigma
1.1.1. Gesellschaftlicher Aufstieg als Hauptgewinn in der Lotterie des Lebens
1.1.2. Lebensentwürfe in der Renaissance
1.1.3. Schulpflicht als Schlüssel zu neuen Chancen
1.1.4. Karrieren für jedermann, aber nicht jede Frau
1.1.5. Frauen emanzipieren sich
1.1.6. Wohlstand: Lebensmodell für die breite Masse
1.2 Generationenwechsel im Wirtschaftswunderland
1.2.1. Als der Zenit überschritten war
1.2.2. Die Tragödie der Allmende
1.2.3. Große Versprechungen und gefühlte Wirklichkeit
1.2.4. Die Babyboomer-Epoche: Paradies auf Abruf
1.2.5. Warnzeichen Fachkräftemangel
1.2.6. Die Generation Z stellt sich vor
1.2.7. Stresstest für eine satte Gesellschaft
1.2.8. Perspektivlosigkeit oder Perspektivwechsel?
1.2.9. Unruhe durch Wertewandel
1.2.10. Bremser oder Tempomacher?
Teil II – Aufbruch in den Umbruch
2 Sind die Deutschen noch zu retten?
2.1 Stimmungstief
2.2 Nüchterne Bestandsaufnahme oder Schwarzmalerei?
2.3 Datenschutz: Bremsklotz der Digitalisierung?
2.4 Die Zeit als endlicher Produktionsfaktor
2.5 Bürokratie: hausgemachte Entwicklungsstörung
2.6 Staat und Wirtschaft im Widerspruch
2.7 Made in USA: Leadership Development à la McKinsey
2.8 Die europäische Dimension
2.9 Problemfelder einer Gesellschaft im Übergang
2.9.1. Das Generationenproblem
2.9.2. Das Verantwortungs- und Führungsproblem
2.9.3. Das Messgrößenproblem
2.9.4. Das Transparenzproblem
2.9.5. Das Toleranzproblem und die Cancel Culture
2.10 Es bleibt alles anders
3 Soziale Marktwirtschaft und Demokratie überdecken systemische Schwächen
3.1 Freie Märkte: Wohlstandsmotor oder Auslaufmodell?
3.2 Globalisierung: Heilsbringer oder Fluch?
3.3 Nagelprobe für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
3.3.1. Green Deal oder Greenwashing?
3.3.2. Neubewertung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen
3.3.3. Gut gedacht, aber nicht gut gemacht
3.3.4. Energiewende oder Energiebremse?
3.4 Rechtsruck: Wohlstandsvernichtung mit Ansage
3.4.1. Egozentrisches Weltbild vs. Gemeinsinn
3.4.2. Rückzug ins nationale Schneckenhaus
3.5 Vermögensumbau und Weltläufigkeit
3.5.1. Aufstieg der Erbengeneration
3.5.2. Erwerbsbiografien zwischen Primat und Prekariat
3.5.3. Globale Laufbahnen
3.6 Deutschland: Alterserscheinungen an allen Ecken
3.7 Peacenics und Wehrpflicht
3.8 Eingeschränkt attraktiv
3.8.1. Momentaufnahme aus dem Bildungsbetrieb
3.8.2. Bildung auf dem Nebengleis
3.8.3. Von den Skandinaviern lernen
3.8.4. Zwischen der Pax Americana und dem chinesischen Drachen
3.8.5. Asien und der „Krieg der Systeme“
4 Neureiche und arme Alte
4.1 Echter oder gefühlter Wohlstandsverlust?
4.2 Steile Karrieren
4.3 Start-ups: Keimzellen für die Erneuerung der Wirtschaft?
4.4 Schattenwirtschaft: die dunkle Macht
5 Entwicklungslinien
5.1 Systemische Sackgasse: das Peter-Prinzip
5.2 Führungsschwächen und höhere Bedürfnisse
6 Die junge Generation zwischen Krisen und Chancen
6.1 Generation Z: eine Bestandsaufnahme
6.2 Warum soziale Medien der psychischen Gesundheit schaden
6.3 Was die Generation Z zum Arbeiten motiviert
Teil III – Technik und Revolution
7 Die nächste technische Revolution und ihre Folgen
7.3.1. Das diffuse Gefühl der Unsicherheit
7.3.2. Urheberrecht
7.3.3. Energiesicherheit
7.3.4. Datenschutz, Cybersicherheit und Deepfakes
Teil IV – Einsichten mit Aussicht
8 Denkansätze
8.1 Die Neuerfindung der Arbeitswelt
8.1.1. Der Weg der „Spinner“
8.1.2. Projektorientiertes Arbeiten
8.1.3. Fließende Flexibilität
8.1.4. Kultur des Gedeihens
8.1.5. Age Diversity
8.2 Empowerment: Mehr Wohlstand für Millionen?
8.3 Entkopplung des Energieverbrauchs vom Wachstum
9 Zukunftsvisionen
9.1 Wohin entwickelt sich die Menschheit?
9.2 Symbiose zwischen Maschine und Mensch
9.3 Vielfalt in der Energiegewinnung
9.3.1. CO2-Kreislaufwirtschaft mit CCU und CCS
9.3.2. Deutsches Atom-Comeback mit Mini-AKWs?
9.3.3. Lieber gleich die Energie der Sterne
9.4 Die Rettung der Seele
9.5 Die Zukunft beginnt jetzt
10 Über Herbert Henzler
Ausgewählte Quellen
Im Jahr 1992 gründeten Reinhold Messner und Herbert Henzler die „Similauner“
Wir sind gerade vom heiligen Berg Kailash zurück, den wir auf der Kora1) umrundet haben, Herbert Henzler und ich. Wir kennen uns seit dreißig Jahren, er ist mir ein guter Freund, Ratgeber und vor allem Motivator. Auf 5000 Metern Meereshöhe, in einer kleinen Biwakhütte, haben wir in den Anden die Idee zu jener Seilschaft ausgebrütet, die seit damals die „Similauner“ sind: großteils Nachkriegskinder, die es zu Topmanagern, Unternehmern und Vorreitern gebracht haben. Mit dem Willen zu gestalten, mit Einsatzfreude und viel Disziplin.
Darum geht es in dem Buch meines Freundes Herbert Henzler. Wir zwei haben die tristen Nachkriegsjahre als Heranwachsende erlebt, haben erträumt und gesehen, ja erlebt, wie alles besser wurde, haben beobachtet, wie aus Wohlstand Dekadenz wurde und die Welt zu kippen begann: Umwelt, Klima, Wirtschaft, die Lebensbedingungen der einfachen Leute. Vor allem die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen.
Herbert erzählt in seinem Buch von diesem Wandel. Anhand vieler Beispiele aus Wirtschaft, Gesellschaft bis hin zu seinem geliebten Sport. Als ehemaliger Deutschland- und späterer Europachef der Unternehmensberatung McKinsey hat er einen analytischen Blick und jenes umfassende Wissen, das Übersicht erlaubt. Seine Stärken spielt er genial aus, wenn er Fehlentwicklungen nachspürt, das analoge Gestern mit der digitalen Revolution von heute verbindet und schonungslos aufzeigt, warum und wobei wir umdenken müssen: Sein Buch ist ein Plädoyer für ein Zusammenrücken der Generationen, insbesondere der Boomer und der Gen Z.
Herberts Buch ist für die Jüngeren zu empfehlen, für die Generation Z und jene, die nach ihr kommen werden. Es wird ihnen die Epoche der Babyboomer erschließen, die man verstehen muss, um die heutige Welt zu verstehen. Die Welt geht noch nicht unter, mit Protest allein aber ist sie nicht zu retten. Ich wünsche mir, dass die Jugend dieses Buch liest, auf dass sie erkennt, wie viel reicher unsere Welt sein kann, wenn es ein Miteinander zwischen den verschiedenen Generationen gibt. Aber dieses Buch ist auch den Älteren zu empfehlen, mehr Verständnis füreinander ist die Basis für ein gutes Miteinander!
Als ich 1949 meinen ersten Dreitausender bestieg, gab es kein Handy, aber viel unberührte Natur. Heute ist der Mount-Everest-Gipfel die höchste Müllhalde der Welt und die nepalesischen Behörden verlangen von Touristen, die dort Schlange stehen, sie mögen ihre Hinterlassenschaften selbst entsorgen. Ist dies das Brennglas, dass den Wandel unserer Gesellschaft in nur zwei Generationen zeigt?
Herbert hat die Kailash-Runde gemeistert: Mit über 80! Viele Jüngere hätten aufgeben müssen oder sie wären gar nicht erst losgegangen. Die Gabe, es zu wagen, Durchhaltevermögen und Leidensfähigkeit zeichnen ihn aus, wie die ganze Generation, die den heutigen Wohlstand geschaffen hat.
Winter 2024
Reinhold Messner
1 Das tibetanische Wort kora bezeichnet die rituelle Umrundung eines Heiligtums (Anm. d. Red.).
Woher stammt das Paradigma „Ihr sollt es mal besser haben“?
Wie hat es die Generation der Babyboomer geprägt?
Und welches Dilemma ergibt sich daraus für die Generation Z?
„Wenn ich weiter sehen konnte, so deshalb,weil ich auf den Schultern von Riesen stand.“
Isaac Newton(engl. Physiker und Mathematiker, 1643–1727)
Manche haben mich für verrückt erklärt, als ich im März 2024 wieder einmal zu einer Bergtour nach Osttirol aufbrach. „Sie sind schon über 80, Professor Henzler! Wollen Sie sich am Großglockner die Haxen brechen?“, meldeten sich einige besorgte Stimmen. Diejenigen, die mich besser kennen, sind von mir nichts anderes gewohnt. Ich wollte schon immer hoch hinaus – buchstäblich wie auch im Hinblick auf mein Lebenswerk.
Dieses bewegte Leben nahm seinen Anfang im November 1941 im schwäbischen Plochingen. Wenige Kilometer südlich davon, in der Hölderlin-Stadt Nürtingen, bin ich aufgewachsen. Dort, im mittleren Neckartal, lässt sich’s nett wandern. Aber wenn in deiner Brust ein Alpinistenherz schlägt, suchst du größere Herausforderungen.
Schon als Jungspund hat es mich deshalb in die Bergwelt der Alpen gezogen. Im zarten Alter von 17 jobbte ich zum ersten Mal als Reiseleiter im Reisebüro Ruoff in Stuttgart. So kam ich nach Tirol, das mir eine zweite Heimat werden sollte. Hier entdeckte ich in mir ein neues Faible: die Optimierung geschäftlicher Abläufe.
Auf dem Maierhof in Westendorf übertrug mir der Wirt das „Bier-Management“: Ich verhandelte mit der Brauerei Gösser, um unseren Nachschub an Gerstensaft zu sichern. Für die Küche optimierte ich die Speisekarte nach dem Prinzip „Klasse statt Masse“. Dank reduzierter Auswahl bekam die Kochmannschaft am frühen Abend endlich ihre verdiente Ruhepause. Außerdem ließ ich die verlotterten Sonnenschirme und -stühle reparieren und organisierte deren Verleih für zehn österreichische Schillinge pro Tag. Kurz: Meine Karriere als Unternehmensberater hatte begonnen.
Die meiste Zeit verbrachte ich damals allerdings an der frischen Luft als Skilehrer für den Jakobwirt. Um Wintersportnovizen erfolgreich vom Niveau spitzenkehrender Schneepflug-Praktikanten zu den höheren Weihen echter Pistenschrubber zu führen, muss man sich in Geduld üben. Eine Eigenschaft, die mir in meiner späteren Karriere noch sehr nützlich werden sollte. Vier unvergessliche Winter lang lehrte mich der Job in der Skischule, mich auf viele unterschiedliche Menschen einzustellen. Dabei lernte ich wunderbare Kameraden kennen.
Bild 1.1Die „Similauner“ als Gipfelkönige: 2021 erklomm die von uns gegründete Gruppe die Jakobsspitze in den Sarntaler Alpen. Mit von der Partie waren u. a. Ex-BASF-Chef Jürgen Hambrecht (gelbe Jacke), Herbert Hainer vom FC Bayern (l. mit schwarzer Cap), der ehemalige Intendant des Bayerischen Rundfunks Ulrich Wilhelm (blaue Jacke, Mitte), Ex-Airbus-Kapitän Tom Enders (r., graues Oberteil) und in der unteren Reihe (v. l.) ich, Ulrich Cartellieri (Ex-Deutsche Bank) und der ehemalige CEO der Post, Klaus Zumwinkel
Bild 1.209. Juli 2024: An meiner Seite Diane und Reinhold Messner, Thorlef Spickschen (Ex-Chef von BASF Pharma) und unser Expeditionsarzt Prof. Rudi Hipp; im Hintergrund das „kostbare Schneejuwel“ Kailash
Meine Leidenschaft für die Bergwelt ist dagegen ungebrochen. Während dieses Buch entsteht, plane ich mit meinem Freund Reinhold Messner und einigen anderen nicht mehr ganz taufrischen Draufgängern eine Trekkingtour nach Tibet. Das wird spannend. Jenseits der Marke von 5000 Meter schafft einem die kühle Luft einen klaren Kopf. Man sieht vieles anders als drunten im Tal des Alltäglichen.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, müssen nicht erst aufs Dach der Welt klettern, um die rapiden Veränderungen in allen Bereichen des Lebens wahrzunehmen. Wer genau hinsieht, erkennt die Umwälzungen auch in scheinbaren Nebensächlichkeiten. So geschehen, als wir auf der eingangs erwähnten Tour vom Lucknerhaus am Ende der Kalser Großglocknerstraße (1920 m) den Nationalpark Hohe Tauern erkundet haben. Da oben sind uns mehr Frauen als Männer begegnet. Es gibt fast keine Männerdomänen mehr. Warum soll das weibliche Geschlecht nicht genauso wie die „Buam“ auf halsbrecherischen Pfaden die Alpen durchstreifen? Oder als Bergführerin die Herren der Schöpfung durch ebendiese lotsen?
Die meisten Tourengeherinnen, denen wir begegnet sind, waren jünger als 30. Sie gehörten also mehrheitlich zur sogenannten Generation Z, den Zoomern, die in diesem Buch eine Hauptrolle spielen. Als wir in fast 2900 Metern Höhe den Gipfel des „Weißen Knoten“ erreichten, rasteten dort drei Männer und fünf Frauen. Tolle Quote!, dachte ich mir. Und wie mein Blick so über die erhabenen Gipfel hinweg in die Ferne schweifte, taten es auch meine Gedanken. Was werden wohl all die Gender-Aktivist:innen für einen Auftrieb veranstalten, wenn sie vom „Bösen Weibl“ hier in Osttirol erfahren? Ob der Berg dann seinen Namen ablegen muss? Werden sie die Gipfelstürmer mit einer Sitzblockade am Aufstieg hindern, bis man den Dreitausender in „Böses Mandt“ umbenannt hat?
Mir fallen da eine Reihe ziemlich ernster Probleme ein, in deren Lösung wir unsere Energie stecken könnten. So konnte ich in den sechs Jahrzehnten, die ich mittlerweile als Bergsteiger unterwegs bin, die weltweite Gletscherschmelze mit eigenen Augen mitverfolgen. Vor 30 Jahren gingen wir noch beim Aufstieg zum Similaunzipfel in Südtirol von der Similaunhütte durch Schnee und Eis. Zehn Jahre später machten die Bergsteiger an der Warnsdorfer Hütte noch Eiskletterübungen. Heute prägen nackter Fels, Geröll, Flechten und Gras die Landschaft. Eis und Schnee sind kaum zu finden. Ähnliches habe ich 2023 auf einer Trekkingtour in Bhutan beobachtet. Obwohl das „Land des Donnerdrachens“ eine positive CO2-Bilanz hat, macht die globale Erwärmung an seiner Landesgrenze nicht Halt.
Ja, die Veränderungen in den majestätischen Bergwelten sind eine treffende Metapher für die Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Politik – den „festen Größen“ der Vergangenheit. Einst waren diese so hoch und stabil wie die Berge in den Alpen und im Himalaya. Heute schwinden die Gletscher und Erdrutsche begraben ganze Bergdörfer unter sich. Ebenso instabil scheinen die metaphorischen Bergmassive geworden zu sein. Viele dieser Umwälzungen sind verstörend oder gar zerstörerisch.
Kurioserweise sprechen Unternehmen nicht ohne Stolz von „disruptiven Innovationen“, wenn sie mit neuen Produkten oder Dienstleistungen alles auf den Kopf stellen und dadurch bislang erfolgreiche Geschäftsmodelle pulverisieren. Amazon hat das mit dem lokalen Buchhandel getan und Booking.com mit den kleinen Reisebüros. Derzeit sehen wir den Aufstieg der KI, die in den kommenden Jahren wohl mehr, als wir es uns heute vorstellen können, unser aller Leben durchdringen dürfte. Die KI wird etliches optimieren, dabei vieles umkrempeln und manches verdrängen. Wird sie gar, wie von einigen befürchtet, zur nächsten dominanten Spezies unseres Planeten aufsteigen? Was für ein Leben wäre das dann für uns, den Homo sapiens, den „weisen Menschen“? Ein besseres?
Auf wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg zu hoffen, war in meiner Kinder- und Jugendzeit ganz selbstverständlich. Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Mein Vater war tagsüber Schlosser und abends und am Wochenende Landwirt. Er war also ein „schwäbischer Schaffer“, kein großer Redner. Das hat meine Mutter für ihn übernommen. „Ihr sollt es mal besser haben“, wünschte sie sich für meinen Bruder und mich. Als meine eigenen Kinder geboren wurden, dachte ich auch bei jedem Kind: Du sollst es mal besser haben!
In diesem Lebensmotto spiegelt sich die Weltsicht ganzer Elterngenerationen. Doch dieses für unsere Urgroßeltern, Großeltern und Eltern eherne Narrativ hat Rost angesetzt. Das Bruttosozialprodukt dümpelt um die Nullmarke herum. Fachkräftemangel bremst die Wirtschaft aus. Die Inflation knabbert am Wohlstand der mittleren Einkommensschicht und so schiebt sich ein Keil zwischen jene, denen die Preissteigerungen nichts ausmachen und den anderen, die den Gürtel enger schnallen müssen. Wer mit seinem Geld kaum noch über die Runden kommt, dem nützt es dann auch wenig, wenn Politiker den Wohlstand der Deutschen anhand von Durchschnittsgrößen bemessen. Er fühlt sich abgehängt und fragt sich: Wie soll es mit uns wieder aufwärtsgehen?
Obenauf kommen dann noch die multiplen Krisen unserer Zeit: die COVID-19-Pandemie, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Gazakonflikt, die Klimaerwärmung … All das verunsichert die Menschen und macht viele buchstäblich krank.
Wie verändert die zunehmende Erosion des Prinzips „Aufstieg“ das Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den führenden Industrienationen? Sie erleben eine Zeit, in der ihr Leben in vielen Belangen wohl nicht mehr besser sein wird als das ihrer Eltern. Was macht das mit der Generation Z, also mit denen, die nach 1996 bis etwa 2012 geboren wurden?
Das Narrativ „Ihr sollt es mal besser haben“ gilt heute so nicht mehr. Die Zoomer werden es sehr wahrscheinlich nicht besser haben, zu groß sind die Unsicherheiten. Heute können die Älteren den Jungen nur noch zurufen „Ihr solltet es eigentlich mal besser haben“.
Sollten Sie dieser „Gen Z“ angehören, liebe Leserinnen und Leser, fragen Sie sich vielleicht: „Will der alte Herr mir jetzt etwa erzählen, wie ich ticke?“ Nein, will er nicht. Ich möchte Türen öffnen, neue Zugänge schaffen für ein Miteinander der unterschiedlichen Generationen, vor allem der Generation Z und den Babyboomern, die in den Nachkriegsjahren bis Ende der 1960er zur Welt kamen. Denn frei nach dem großen Naturwissenschaftler und Denker Isaac Newton: „Nur, wer auf den Schultern von Riesen steht, sieht weiter als bis zur eigenen Nasenspitze.“
„Ihr solltet es eigentlich mal besser haben“ darf nicht zur Resignation führen, sondern muss uns dazu aufrütteln, das Ruder herumzureißen. Mit den vereinten Stärken beider Generationen können die Zoomer und die Babyboomer die Welt noch zu einem besseren Ort machen. Das setzt voraus, sich gegenseitig zu verstehen. Und dann kommt es auf das Miteinander an. Dazu möchte ich mit meinem Buch einen Beitrag leisten.
Der sinkende Lebensstandard führt zu Spannungen mit den Babyboomern, die nach Meinung vieler Vertreter der Gen Z auf ihre Kosten zu gut gelebt haben. Die Klimakrise ist nur eines von vielen Beispielen für die „Platz da, jetzt komm ich!“-Mentalität der Wirtschaftswunderkinder. Der Systemwechsel bei der Rentenfinanzierung ist auch so ein Problem, das nicht schrumpft, indem man die Augen davor verschließt. „Die Rente ist sicher“, hatte der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) im Wahlkampf 1986 versprochen und dabei den demografischen Wandel ausgeblendet. Die Zahl der Zweifler wuchs über die Jahre, aber sie konnten das Rentenreformgesetz vom 10. Oktober 1997 trotzdem nicht verhindern. Während der hitzigen Debatte an diesem Montag wiederholte Blüm vor dem Deutschen Bundestag ganz kühn sein Mantra: „Die Rente ist sicher.“
Damals finanzierten drei Beitragszahler die staatlichen Altersbezüge eines Rentners. Anfang der 2020er-Jahre waren es nur noch zwei Einzahler. Würde alles so weitergehen wie bisher, müssen 2030 1,5 Beitragszahler einen Rentenbezieher durchfüttern und 2050 sogar nur 1,3 Sozialversicherungspflichtige. Wenn da bei der Generation Z Frust aufkommt, muss sich niemand wundern.
Rückschritte erleben wir derzeit auf vielen Gebieten. Aber dies soll kein Jammerbuch sein, in dem ich den Finger nur in tausend offene Wunden lege und Sie dann mit dem Schmerz alleinlasse. Freilich wird es ohne eine ungeschönte Bestandsaufnahme auch nicht gehen. Vor allem möchte ich Ihnen jedoch ein Hoffnungsbuch in die Hände legen, das Handlungsfelder für ein Miteinander der Generationen aufzeigt. Wir greifen aktuelle Entwicklungen auf, um zu sehen, worauf wir uns in Zukunft einstellen können. Wo wir umdenken müssen. Und welche Zukunftsvisionen heute schon absehbar sind.
Allerdings: „Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.“ Getreu diesem Motto des französischen Schriftstellers und Politikers André Malraux wollen wir als Erstes einen Blick zurückwerfen und ein paar Puzzleteile aufnehmen, aus denen wir am Ende das große Generationenbild zusammensetzen.
1.1Vom frommen Wunsch zum Paradigma„Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.“
Thomas Mann, Joseph und seine Brüder(dt. Schriftsteller, 1875–1955)
„Ihr sollt es mal besser haben.“ Haben sich Eltern das nicht schon immer für ihre Kinder gewünscht? Das anzunehmen, ist nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Lassen Sie uns auf einem kleinen Streifzug durch die Menschheitsgeschichte herausfinden, wie und wann das Narrativ entstanden ist. Nehmen Sie bitte Platz in meiner Zeitmaschine und reisen Sie mit mir ein paar tausend Jahre zurück in die Vergangenheit.
1.1.1Gesellschaftlicher Aufstieg als Hauptgewinn in der Lotterie des LebensIm 15. Jahrhundert vor Christus lebte in Ägypten ein Junge, der es besser haben wollte als seine Eltern. Senenmut wächst mit seinen Brüdern und Schwestern etwa 25 Kilometer südlich von Theben auf, der einstigen Hauptstadt des Pharaonenreichs. Die Familie ist weder arm noch sonderlich reich. Das bedeutet normalerweise: Der Junge wird es niemals zu Rang und Namen bringen. Zu seiner Zeit ist es viel leichter, bei den Mächtigen in Ungnade zu fallen und alles zu verlieren, manchmal sogar das Leben.
Senenmut tritt im sogenannten Pagenkorps eine Ausbildung als Priester an, was ihn zumindest in den Dunstkreis einer mächtigen Gesellschaftsschicht bringt. Das Korps steht ausdrücklich auch Kindern einfacher Familien offen. Gemeinsam mit Prinzen und Prinzessinnen genießen sie eine höhere Erziehung, die sich ihre Eltern sonst nie leisten könnten. Heute würden wir diese jungen Nachwuchstalente aus einfachen Verhältnissen vielleicht Stipendiaten nennen.
Seinen nächsten Karrieresprung unternimmt Senenmut im Militär. Laut einer Grabinschrift macht er in Nubien reiche Beute und erhält dafür ein goldenes Armband als Ehrenabzeichen, das Pendant zu den heutigen Orden. Hiernach startet er eine Beamtenlaufbahn, die ihn schließlich bis in höchste Staatsämter trägt. Unter der Pharaonin Hatschepsut soll er nicht weniger als 88 Titel getragen haben. Bis heute hält sich sogar hartnäckig das Gerücht, Senenmut und die Herrscherin des Reichs seien ein Liebespaar und Hatschepsuts einziges Kind Neferu-Re sei seine leibliche Tochter gewesen. Belegt ist, dass er die Prinzessin erzogen hat und ihre Mutter ihn zum ersten Architekten, Baumeister und Obervermögensverwalter des Reichs ernannte. In seiner Machtfülle stand wohl nur noch die Pharaonin über ihm.
Rätselhafterweise verschwindet unser Held dann plötzlich ohne jedes Lebenszeichen. Sein Langgrab bleibt unvollendet, sogar sein Name wird mit Hammer und Meißel davon entfernt. Ähnlich verfährt man mit den meisten seiner Abbilder. Auch seine Mumie bleibt bis heute verschollen. Immerhin: Sein Sarkophag ist erhalten geblieben. Er steht heute im New Yorker Metropolitan Museum of Art, ein 3500 Jahre alter Zeuge für das Streben des Menschen nach einem besseren Leben – und für die Vergänglichkeit von Reichtum und Macht.
Senenmut ist nicht der einzige frühe Beleg klassenüberschreitender Lebensläufe, die bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft führten. Nach Ansicht einiger Ägyptologen war Haremhab, der letzte Pharao der 18. Dynastie, der Sohn eines armen Landpächters. Typisch sind solche Lebensläufe in der Vor- und Frühgeschichte der Menschheit allerdings nicht. Laut Historikern wie Kai Michel hatten Eltern in der Zeit der Jäger und Sammler vor allem den Wunsch, das Überleben ihrer Nachkommen zu sichern. Um die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern, lebte man als Gleicher unter Gleichen und half sich gegenseitig.
Später schufen Ackerbau und Viehzucht bessere Voraussetzungen für Privateigentum. Doch es etablierten sich auch gesellschaftliche und staatliche Strukturen, in denen es zu größeren Ungleichheiten kam. Regelmäßige Massaker und erste Kriege schufen Gewinner und Verlierer in großem Maßstab. Die Gewinner leisteten sich stehende Armeen, die Verlierer kamen nicht selten in Sklaverei. Gesellschaftlicher Aufstieg war für unfrei geborene Kinder in den meisten Kulturen die seltene Ausnahme.
Im antiken Rom übten einige Sklaven immerhin eine gewisse Macht und Autorität aus. Manche waren Erzieher und Lehrer für die Kinder hochgestellter Persönlichkeiten. Andere verwalteten die Besitztümer des pater familias, des Hausherrn. Wenn solche Familienvorstände dem Vermögensverwalter dann einen Teil der erwirtschafteten Zinsen zur freien Verfügung überließen, konnte er mit diesem peculium trotz seiner Unfreiheit beträchtlichen Reichtum anhäufen. Vereinzelt war es möglich, damit sich oder seine Kinder freizukaufen. Im Allgemeinen war das Hoffen auf Freilassung für Sklaven und ihre Kinder allerdings reine Illusion.
Ein klein wenig mehr Aussicht auf Erfolg bot Männern aus einfachen Verhältnissen der Cursus honorum, die Ämterlaufbahn oder wörtlich übersetzt der „Lauf der Ehre“: Wer seinen Militärdienst bei klarem Verstand überlebte, konnte ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. eine untergeordnete Verwaltungstätigkeit oder die Stelle eines Militärtribuns anstreben. Im besten Fall verlief die Karriere dann über mehrere Stationen bis zum Amt eines Konsuls.
Theoretisch konnte jeder römische Bürger die Ämterlaufbahn einschlagen. Da die damit verbundenen Funktionen aber reine Ehrenämter waren, konnten sich gewöhnlich nur Abkömmlinge wohlhabender Familien eine solche Karriere im „öffentlichen Dienst“ leisten. Später ergänzte Kaiser Augustus den Cursus durch eine Ämterlaufbahn für die Ritterschaft mit der Aussicht auf hohe militärische oder administrative Leitungsämter bis hinauf zur Position eines Statthalters in einer Randprovinz. Dokumentiert sind mehrere Fälle nicht adeliger Legionäre, die es bis zum ritterlichen Kohortenpräfekten gebracht hatten. Das wohl bekannteste Beispiel für diesen Karriereweg ist jener Pontius Pilatus, der als Präfekt in Judäa Kraft seines Amtes die Hinrichtung von Jesus Christus abgesegnet hatte.
Auch nach dem Untergang Roms als Weltmacht blieb ein von Geburt an vorbestimmtes Leben lange die Regel. Im Mittelalter schafften es einige Eltern, ihre Kinder in einem Kloster unterzubringen. Dort konnten sie Lesen und Schreiben lernen und innerhalb der kirchlichen Welt aufsteigen. Einigen gelang sogar der Sprung ins Bischofsamt.
Aber auch solche „Karrieren“ blieben die Ausnahme von der Regel, wie es sie zu allen Zeiten gegeben hat. Ein Leibeigener, der für seine Kinder ein besseres Leben erhoffte, war ein Träumer. Solche Wünsche rüttelten am Geschäftsmodell der Feudalherren, sie offen auszusprechen, konnte leicht am Galgen enden.
1.1.2Lebensentwürfe in der RenaissanceDie Renaissance bildet die Brücke vom Mittelalter in die Neuzeit. Diese Kulturepoche steht für die Wiederbesinnung auf die kulturellen Leistungen der griechischen und römischen Antike. Jetzt treten neben das Studium kirchlicher Texte die studia humanitatis, die „Studien der Menschlichkeit“, die sich mehr mit irdisch-menschlichen Angelegenheiten beschäftigen. Ihre Anhänger nennt man Humanisten.
Sie sind Geistesarbeiter aus geordneten Verhältnissen der Gesellschaft. Die Väter sind oft Schreiber oder Notare, was weit nobler klingt, als es damals war. Manche arbeiten auch bei wohlbetuchten Herrschaften als Privatlehrer oder -geistliche. Oder sie dienen in öffentlichen Ämtern: an Universitäten, in der Kommunalverwaltung, als Politikberater oder Diplomaten. Einige Humanisten der Renaissance stammen aus Kaufmannsfamilien. Anders als in den Familien der Leibeigenen gab es in solchen Haushalten Zeiten der Muße. In seiner ursprünglichen Bedeutung steht das Wort Muße für eine „Gelegenheit oder Möglichkeit, etwas tun zu können“: ein Buch zu lesen etwa oder mit seinesgleichen über Gott und die Welt zu plaudern.
Solche Verhältnisse sind ein günstiges Milieu für Lebensentwürfe, die lange Zeit fast nur Adligen vorbehalten waren. Unter dem Stichwort „Renaissance-Humanismus“ findet sich bei Wikipedia folgender Eintrag:
„Die Humanisten traten für eine umfassende Bildungsreform ein, von der sie eine optimale Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten durch die Verbindung von Wissen und Tugend erhofften. Humanistische Bildung sollte den Menschen befähigen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und durch Nachahmung klassischer Vorbilder ein ideales Menschentum zu verwirklichen.“
Das klingt so, als hätten erstmals eine nennenswerte Zahl von Eltern darauf hoffen können, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Das vielleicht bekannteste, wenngleich untypische Beispiel für einen märchenhaften wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg ist das Kaufmannsgeschlecht der Fugger. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind vor allem die Augsburger Fugger „von der Lilie“ so wohlhabend und mächtig, dass ihr Name ein Synonym für Reichtum ist. Heute sagt man: „Bin ich Bill Gates, dass ich mir das leisten kann?“ Damals hieß es: „Bin ich der Fugger? Mach’s billiger.“
Verbesserungen der Lebensverhältnisse, die sich wie im Geschlecht der Fugger über Generationen fortsetzen, bleiben allerdings die Ausnahme. Einfache, von der Zunft ausgebildete Handwerker sind um 1520 herum schon froh, 50 Wochen im Jahr beschäftigt zu sein. Dann kommen sie auf ein Jahreseinkommen von circa 50 Gulden, dem Gegenwert von etwa 125 Gramm Gold – nach heutigem Kurs etwa 8740 Euro.1) Wenn dann der Sohn als Handwerksgeselle in die Fußstapfen seines Vaters treten darf, kann er sich schon glücklich schätzen.
1.1.3Schulpflicht als Schlüssel zu neuen ChancenFür die meisten Menschen in der Renaissance sind die Ziele der Humanisten nur ein schönes, aber unerreichbares Ideal. Es ist völlig normal, als Leibeigener zur Welt zu kommen, als Leibeigener zu leben und als Leibeigener zu sterben. Ohne Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben.
Das ändert sich in Deutschland erst ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ein Lehnsherr kann einen Leibeigenen nun per „Freilassungsbrief“ aus der sogenannten Eigenbehörigkeit entlassen. Die Aussicht darauf weckt bei einigen Eltern den Wunsch, ihre Kinder könnten es einmal besser haben als sie. Doch nur langsam steigt die Zahl jener, die tatsächlich mehr Lebensqualität erlangen.
Mit der Einführung der Schulpflicht kommt allmählich Schwung in diese Entwicklung. Vorreiter ist hier das Herzogtum Württemberg, zu dem auch meine Heimatstadt Nürtingen gehört. Schwäbische Knaben müssen seit 1559 die Schulbank drücken und die Mädchen ab 1649. 1592 folgt das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken sowie 1598 das elsässische Straßburg. Preußen verordnet 1717 zunächst nur eine Unterrichtspflicht, und Sachsen vertrödelt die allgemeine Schulpflicht bis ins Jahr 1835. Erst 1919 findet sie dann Eingang in die Weimarer Verfassung und gilt somit deutschlandweit.
„Papier ist geduldig“, sagt eine Redensart. Und das bestätigte sich auch bei den staatlichen Regelungen zur Unterrichts- und Schulpflicht. Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einsetzende Frühindustrialisierung schafft neue Abhängigkeiten, die zu Ausbeutung und Massenelend führen, dem sogenannten Pauperismus. Zahlreiche Handwerksfamilien müssen sich nun als Tagelöhner verdingen, weil sie mit der Produktivität der neuen Maschinen nicht mehr mithalten können. Um die Familie sattzubekommen, müssen alle ran, auch die Kleinsten. Wer den Roman Oliver Twist von Charles Dickens gelesen hat, der weiß: Erbarmungslose Kinderarbeit war zu Beginn des 19. Jahrhunderts gang und gäbe.
Der Wunsch nach einem besseren Leben ist in vielen Tagelöhnerfamilien zu dieser Zeit bestenfalls eine schöne Illusion. Trotz Schulpflicht bleiben die Kinder oft dem Unterricht fern, um zum Überleben der Familie beizutragen. Wer von der Hand in den Mund lebt, für den sind Schulgeld und Bücher unerschwinglich. Unter solchen Verhältnissen gibt es für ein Tagelöhnerkind wenig Spielraum, gesellschaftlich aufzusteigen und einen gesicherten Lebensunterhalt zu erreichen. Ganz im Gegenteil übertragen die Eltern die Tagelöhnerei, standesamtlich beurkundet, auf die Kinder- und sogar die Enkelgeneration. In Sachsens Baumwollspinnereien stellen Kinder unter 14 Jahren in den 1830er-Jahren fast ein Drittel der Belegschaft.
Die Fabrikherren nutzen das Überangebot an Arbeitern, um rigide Arbeitsbedingungen zu diktieren. An sechs Tagen in der Woche 14 bis 16 Stunden lang zu schuften, gilt als normal. Um das Jahr 1870 herum sind die Bruttoreallöhne sogar unter das Niveau zu Beginn des 19. Jahrhunderts gesunken. Es sieht so aus, als würden es die Kinder jeder Generation immer noch schlechter haben als ihre Eltern.
1.1.4Karrieren für jedermann, aber nicht jede FrauVom alten Ägypten bis in die Neuzeit bot das Militär beste Aussichten auf ein gesichertes Einkommen, gesellschaftliches Ansehen und vielleicht sogar Ruhm. Im Königreich Preußen etabliert sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Vorstellung vom Staatsbürger als „Nationalkrieger“. Die allgemeine Wehrpflicht verwandelt das Heer in die „Schule der Nation“. Bisweilen erliegen sogar Frauen den Verlockungen des Heldentums in Uniform und geben sich als Männer aus, um an Preußens Glanz und Gloria teilzuhaben. Wie viele Damen es tatsächlich schafften, auf diese Weise ins Militär einzutreten, weiß heute niemand mehr. Etwa zwei Dutzend Fälle sind historisch belegt.
Einer von ihnen ist der Casus „Anna Sophia Detloff“. Die junge Frau aus einfachen Verhältnissen dient in der Armee Friedrichs des Großen. Zu Beginn des Siebenjährigen Krieges (1756–1763) hatte sie sich als Karl Heinrich Buschmann für das preußische Kürassier-Regiment rekrutieren lassen, „wobei ihr männliches Aussehen ihr ungemein sehr zu statten kam“, schrieb eine zeitgenössische Wochenschrift aus dem Jahr 1772.
In dieser Zeit tragen Männer, die etwas auf sich halten, einen Justaucorps. Schon der französische Name dieses frühen Herrenrocks, der „genau am Körper“ bedeutet, lässt erahnen, warum Anna Sophia mit ihrer Maskerade unerkannt bleibt: Der Justaucorps ist so eng geschnitten, dass er ihre Weiblichkeit im Brustbereich komplett einebnet. So schummelt sie sich in eine Männerdomäne, die ihr ein besseres Leben verspricht. Die „Heldenjungfrau“ verdient sich ihre Sporen in mehreren Schlachten – bekleidet mit Zweispitz, Waffenrock, Kürass (Brustpanzer), Hose und Reitstiefeln. Ihrem gesellschaftlichen Aufstieg steht, abgesehen von der Gefahr, Leib und Leben zu verlieren, scheinbar nichts mehr im Weg.
Dann aber, nach vier Jahren Blut, Schweiß und Tränen, kommt sie in Arrest. Ein feiges Lügenmaul hat sie des Diebstahls bezichtigt. Diesen Vorwurf der Ehrlosigkeit will Anna Sophia nicht auf sich sitzen lassen. Und so „ergreift sie halb aus Verzweifelung das Mittel, den Lieutenant der Kompagnie ihr Geschlecht zu bekennen und um Entlassung ihrer Dienste zuzusuchen“, berichtet 1784 ein anonymer Autor im Pommerschen Archiv der Wissenschaften und des Geschmacks. Damit endete Anna Sophias Traum, „eine glänzende Rolle in der Welt zu spielen“.
Der damals mit hohem Verletzungsrisiko verbundene Militärdienst galt vielen Patrioten zwar als Königsweg des gesellschaftlichen Aufstiegs, doch gab es auch andere Laufbahnen. Dank der staatlich verordneten Schulbildung können junge Männer einen Handwerksberuf erlernen oder im Handel arbeiten. Für manche ist dies das Sprungbrett zum Meister oder zu einem eigenen Geschäft. Damit ermöglichen sie ihren Kindern ein besseres Leben: Sie können eine Universität besuchen und als Lehrer, Arzt, Ingenieur oder Wissenschaftler in die geistige Elite der Gesellschaft aufsteigen.
Vergleichbare Aufstiegschancen haben Knechte und Landarbeiter eher selten. Ein Hof bleibt gewöhnlich nach dem Tod des Eigentümers in der Familie. Immerhin bieten sich auch hier Möglichkeiten, etwa durchs „Einheiraten“ in die Familie eines Hof- oder Gutsherrn. Manche junge Männer gelangten auf diese Weise sogar in den Adelsstand.
1.1.5Frauen emanzipieren sichFrauen haben es, teilweise bis in die Gegenwart, deutlich schwerer, ihr Leben zu verbessern. Lange bleibt ihnen dafür, wenn sie nicht gerade Hatschepsut, Nofretete oder Kleopatra heißen, fast nur die sprichwörtlich „gute Partie“. Doch es gibt sie, die Wissenschaftlerinnen, Entdeckerinnen, Künstlerinnen und Politikerinnen, welche die Plattitüde vom „schwächeren Geschlecht“ Lügen strafen. Oft fiel es ihnen jedoch schwer, sich in einer patriarchalischen Gesellschaft zu behaupten, in der Mann doch tatsächlich glaubte, Frauen seien der lebende Beweis für das schwache Geschlecht.
Mutig und nicht selten trickreich verschaffen sich Frauen trotzdem immer wieder die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit. Aus heutiger Sicht mag es befremdlich klingen, dass die Schriftstellerin Mary Ann Evans (1819–1880) ihre wahre Identität hinter dem Pseudonym George Eliot verbirgt, um nicht länger unsichtbar zu bleiben. Doch wenn man bedenkt, was junge Frauen heute alles anstellen, um sich auf TikTok zu inszenieren, ist Evans Tarnnamen geradezu visionär. Im Jahr 2015 nämlich wählten 82 internationale Literaturkritiker und -wissenschaftler ihren Roman Middlemarch „zum bedeutendsten britischen Roman aller Zeiten“.
An der langen Leine ihrer Ehemänner tragen Frauen schon seit Jahrhunderten zum Familieneinkommen bei. Manchmal sogar mit erstaunlich viel Eigeninitiative, wie ein Blick ins 31. Kapitel des Bibelbuchs Sprüche verrät. Es beschreibt ‚eine tüchtige Frau‘, die ‚von überallher Nahrung herbeischafft wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern‘ und die ‚ihre Aufgaben energisch anpackt‘. Sie ‚schaut sich nach einem Stück Land um und kauft es mit dem Geld, das sie selber verdient hat, und bepflanzt es dann mit Reben‘. Es gab also schon in vorchristlicher Zeit Frauen, die ihr eigenes Geld verdienten und damit eigenverantwortlich Geschäfte abwickelten. Global gesehen blieben solche Freiheiten allerdings lange den Männern vorbehalten.
Während des Pauperismus, der Zeit der zunehmenden Verarmung der Arbeiterschicht, sind viele Frauen als Heimarbeiterinnen tätig, oft für die Textilindustrie. In den 50 Jahren zwischen 1850 und 1900 geht der Anteil der Beschäftigten in der sogenannten Hausindustrie von 50 auf 2,7 Prozent zurück. Für die Frauen ein langsamer Abnabelungsprozess. Allmählich wagen sie sich aus der häuslichen Isolation heraus, um einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. So rekrutiert etwa die Deutsche Reichspost ab 1889 verstärkt unverheiratete Frauen für den Telefondienst als „Fräulein vom Amt“. Allmählich wachsen Strukturen, die es jungen Frauen ermöglichen, ihr Leben zu verbessern.
Dass Gott die Frau nicht dem Mann geschenkt hat, damit er mit ihr vor anderen Männern angeben kann, dringt so richtig erst während des Ersten Weltkriegs ins öffentliche Bewusstsein. Da die männliche Bevölkerung in großer Zahl damit beschäftigt ist, an der Front zu sterben, braucht man frischen Nachschub an der heimischen Arbeitsfront. Frauen drängen in die Fabriken und Büros und halten die Heimat am Laufen. Von nun an sind sie aus dem Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken.
1.1.6Wohlstand: Lebensmodell für die breite MasseIm 20. Jahrhundert tragen der weitere Ausbau des Bildungssystems, Sozialreformen, das Erstarken der Menschenrechte und Wirtschaftswachstum immer stärker dazu bei, den Lebensstandard der nachfolgenden Generationen stetig zu verbessern. Hand in Hand mit einer besseren Bildung gehen höher bezahlte berufliche Laufbahnen, der Aufbau von Vermögen, eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung, die soziale Absicherung für Krisenzeiten und eine allgemeine Verbesserung der Lebensqualität. Die Grenzen zwischen gesellschaftlichen Schichten, die jahrhundertelang so unüberwindbar wie Burgmauern waren, werden auf einmal durchlässig. Mehr und mehr Kinder aus der Arbeiterschaft schlagen jetzt eine akademische Laufbahn ein.
Allerdings kommt diese Entwicklung in der ersten Hälfte des Jahrhunderts nur stockend voran. Bremser sind die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er- und anfangs der 1930er-Jahre sowie der Zweite Weltkrieg. Danach liegt Deutschland in Trümmern. Doch der Marshallplan und die Währungsreform ermöglichen (West-)Deutschland einen fulminanten Neustart. Es produziert massenweise Waren – und Kinder: die Generation der Babyboomer.
„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt“, singt die Gruppe Geier Sturzflug 1982 in ihrem Nummer-eins-Hit. Eine ironisch gemeinte Hymne auf die Arbeitsmoral der Deutschen in der Nachkriegszeit. Auf die Epoche des blühenden „Wirtschaftswunders“. Die Menschen blicken optimistisch in die Zukunft. Wachsender Wohlstand entwickelt sich zum Lebensmodell der breiten Masse. „Ihr sollt es mal besser haben“ ist das neue Paradigma der Generationenfolge.
Auf dem Zenit dieser Entwicklung sieht es für viele so aus, als könnte es ewig so weitergehen. Aber nur weil die wenigsten ihren Blick zum Horizont wenden, an dem bereits dunkle Wolken aufziehen.
Zusammenfassung
Jahrtausendelang folgte eine Generation auf die andere, ohne dass sich die Lebensumstände der Menschen nennenswert verbessert hätten. Zwar war ein solches „Lebens-Upgrade“ immer schon möglich, es blieb aber stets einer Minderheit vorbehalten. Selbst als ein wachsender Lebensstandard gegen Ende des 19. Jahrhunderts für viele in greifbare Nähe rückte, verging noch ungefähr ein Menschenalter, bis aus der vagen Möglichkeit für die Mehrheit eine Selbstverständlichkeit geworden war. Gemessen an diesen Zeiträumen ist die Epoche, in der es den Kindern immer besser ging, erstaunlich kurz.
Während die Achtundsechziger mit ihren Studentenunruhen allmählich abklingen, blicken die meisten Menschen in den westlichen Industrienationen ungebrochen optimistisch in die Zukunft. Von einer Wende zum Schlechteren will kaum jemand etwas wissen. Doch 1972 sorgt eine Studie mit dem unerhörten Titel „Die Grenzen des Wachstums“ weltweit für Furore. Der Bericht entstand auf Anregung von Professor Eduard Pestel, einem deutschen Ingenieur, Ökonom und CDU-Politiker. Nebenbei ist Pestel Kuratoriumsmitglied der Volkswagenstiftung, die das Wissenschaftsprojekt mit 1 Million DM maßgeblich mitfinanziert hat. Herausgeber der Studie ist der Club of Rome, ein gemeinnütziger Zusammenschluss von Experten verschiedener Disziplinen aus mehr als 30 Ländern. Die Forscher hatten mithilfe von Computermodellen errechnet, wann sich die Ressourcen der Erde erschöpfen werden und wie sich die „thermische Umweltverschmutzung“ entwickeln wird. Gemeint war damit die vom Menschen verursachte globale Erwärmung.
Nicht wenige halten die düsteren Prognosen des „Clubs“ für überzogen. Henry Wallich von der Yale University nennt „Die Grenzen des Wachstums“ in einem Newsweek-Leitartikel vom 13. März 1972 gar einen „unverantwortlichen Unfug“. Heute wissen wir angesichts der eskalierenden Klimakrise, dass der Club of Rome zwar nicht in allen Details richtig lag, doch die Bedrohung durch die globale Erwärmung zutreffend beschrieben hat. 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung von „Die Grenzen des Wachstums“ haben die Autoren ihre Prognosen aktualisiert. Modernere Computermodelle sagen bis spätestens 2100 ein Überschreiten der Wachstumsgrenzen und einen anschließenden Kollaps voraus.
Um den Zusammenbruch zu verhindern, muss sofort gegengesteuert werden. Allein diese Notwendigkeit stellt das Paradigma „Ihr sollt es mal besser haben“ in Frage. Die vom Wirtschaftswunder am stärksten geprägte Generation der Babyboomer trifft diese Nachricht vielleicht am härtesten. Wie wir noch sehen werden, ist die heraufziehende Klimakatastrophe aber nicht der einzige Grund, die bisherigen Konzepte von Wachstum und Wohlstand neu zu denken. Viele Faktoren tragen zu der Entwicklung bei, die Hans-Werner Sinn, der langjährige Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, in fünf einfachen Worten zusammenfasste: „Der Zenit liegt hinter uns.“
„Is Germany once again the sick man of Europe?“ titelte das Wirtschaftsmagazin The Economist im August 2023. Einiges lässt darauf schließen. Obwohl zu dieser Zeit mehr als 54 Prozent der deutschen Bevölkerung (46 Millionen) erwerbstätig sind, deutet das Bruttosozialprodukt nach unten.
Das ist auch den nachfolgenden Generationen bewusst. Während dieses Buch entstand, habe ich an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) meinen Masterkurs „Internationales Management“ mit 30 Studierenden aus aller Herren Länder abgeschlossen. In einer E-Mail bat ich sie – weil „ihr ein wesentlicher Teil der Generation Z seid“ –, mir mehr über ihre Sicht auf die Welt zu verraten. Unter anderem schrieb ich:
„Über Generationen hinweg haben wir uns vom Narrativ ‚unsere Kinder werden ein besseres Leben haben‘ leiten lassen? Dieses Narrativ ist verblasst, wenn nicht sogar ganz verschwunden. Heute sehen wir in der industrialisierten Welt (insbesondere in Europa), dass die […] Generation der Eltern/Großeltern bereits einen hohen Lebensstandard genießt, besser ausgebildet ist als je zuvor, länger lebt als je zuvor und ein größeres Erbe weitergibt als je zuvor. […] Stimmt diese Annahme? Wie sieht die Geschichte heute aus?“
Die Antworten meiner Studierenden waren äußerst aufschlussreich. Stellvertretend für ihre wertvollen Kommentare hier einige Gedanken von Zelieus Namirian, einem Studenten aus Frankreich:
„Angesichts des beispiellosen Wohlstands und Fortschritts, den viele Gesellschaften erreicht haben, hat sich der Schwerpunkt von der bloßen Verbesserung des eigenen Lebens auf die Erhaltung und Verbesserung des Lebensstandards für künftige Generationen verlagert. Darüber hinaus hat die Generation ‚Alt und Weise‘ auch mehr Reichtum und Vermögen angehäuft als frühere Generationen und hinterlässt ihren Kindern und Enkeln ein größeres Erbe. Dieser Überfluss an Reichtum und Wohlstand stellt diese neue Generation vor eine neue Herausforderung: Sie muss sich überlegen, wie sie ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen kann, nicht nur in Bezug auf materiellen Wohlstand, sondern auch in Bezug auf persönliches Glück, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit.“
Während meiner beruflichen Laufbahn habe ich überwiegend mit jungen Menschen zusammengearbeitet. Bei McKinsey hatten wir einen Altersdurchschnitt von 32 und meine Studierenden an der Uni sind 20 bis 26 Jahre alt. Rückblickend auf die Jahrzehnte der Zusammenarbeit mit den Jüngeren erkenne ich einen deutlichen Trend hin zu dieser Weltsicht, wie Zelieus Namirian sie hier äußert. Die Zoomer sind keine Generation der Träumer. Sie wissen genau: Es wird für uns und unsere Kinder keinen immerwährenden Zuwachs an materiellem Wohlstand geben. Zunehmend spüren sie den Unterschied zwischen den wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bedingungen ihrer Eltern, Groß- und Urgroßeltern und der eigenen Lebenswirklichkeit. Sie haben begriffen, dass ein ewiges immer Höher und immer Weiter auch nicht mehr sinnvoll ist. Es ist eine Art kollektives Gefühl, das unabhängig davon ist, ob die eigene Perspektive sich wirklich zunehmend verschlechtert oder nicht. So wie Zelieus richten die Zoomer deshalb zunehmend ihren Fokus auf „persönliches Glück, Wohlbefinden und [ökologische] Nachhaltigkeit“.
Bild 1.3Lehren und Lernen hält jung: Wenn ich jungen Menschen wie hier 2015 den Studierenden an der Uni Heidelberg etwas gebe, bekomme ich immer auch viel zurück
Im Jahr 2024 arbeiten in vielen Unternehmen bis zu vier Generationen gleichzeitig: neben den Babyboomern die Generation X (Geburtenjahrgänge 1965 bis 1979), die Millennials (1980–1995) und die Gen Z (1996–2012). Zu dieser Zeit leben in Deutschland fast 30 Millionen Menschen, die 55 oder älter sind. Der stärkste Babyboomer-Jahrgang (1964) feiert gerade seinen 60. Geburtstag. Die zahlenmäßig größte Generation, die das Land je hatte, verabschiedet sich geradezu fluchtartig aus dem Arbeitsleben. Ihr gegenüber, erst am Anfang des Berufslebens, steht eine deutlich kleinere Generation Z. Ihre Zahl liegt bei nur etwa 11,5 Millionen Menschen. Von ihnen und den nachfolgenden Generationen ist kein zweiter Babyboom zu erwarten. Deshalb werden die sogenannten „Best Ager“, die über Fünfzigjährigen, bis zur Mitte des Jahrhunderts fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung stellen.
Sowohl die Generation Z wie auch die Babyboomer müssen sich auf eine eher ungewisse Zukunft einlassen, und jede Kohorte geht unterschiedlich damit um. Anders als ein Großteil der Boomer lebt die Gen Z nicht nur körperlich, sondern auch mental im digitalen Zeitalter. Zoomer nutzen die technischen Errungenschaften zwar ohne Berührungsängste, aber nicht unkritisch. Sie warnen auch vor Fehlentwicklungen.
Das Motto „Nach mir die Sintflut“ vieler Älterer können sie sich nicht leisten, weil sie zu jung dazu sind. Sie sehen die enormen Probleme, vor denen sie stehen, und sorgen sich um die bedrohten Meere, Wälder und Gletscher. Den politisch Verantwortlichen stehen sie oft kritisch gegenüber und zweifeln an der strategischen Ausrichtung von Institutionen. Sie haben schon zu viele uneingelöste Versprechungen gehört.
Generation
Die zeitliche Abgrenzung einzelner Generationen variiert in der wissenschaftlichen Literatur und bisweilen auch in unterschiedlichen Regionen der Welt. Die Ablösung der Babyboomer durch die Gen X etwa verorten manche Forschende um das Jahr 1965 herum, andere (so auch dieses Buch) erst Ende der 1960er. Mitunter gibt es dadurch eine Übergangsphase mit Überschneidungen von mehreren Jahren. Manche Wissenschaftler wie der Soziologe Martin Schröder vertreten den Standpunkt, es gebe keine Unterschiede zwischen den Generationen Y und Z. Da ich in diesem Buch die Abfolge der Generationen vor allem in ihrem wirtschafts- und sozialhistorischen Kontext betrachte, halte ich die Benennung der Generationen hier dennoch für sinnvoll. Ich benutze sie, um die für jedermann sichtbaren Veränderungen in der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft eingängig zu verdeutlichen. Bild 1.4 zeigt eine Einteilung in Generationen nach Cmglee.
Bild 1.4Acht Generationen und ihre zeitliche Einordnung im Kontext wichtiger geschichtlicher Epochen (Grafik: Cmglee, Wikimedia Commons, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Generation_timeline.svg#file; Lizenz CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de; Grafik wurde zur besseren Übersicht leicht verändert)
Unternehmen und Staaten sprechen in den Medien gern über ihr „Netto-Null-Ziel“. Sie wollen bis 2050, 2045 oder sogar noch früher den von Menschen verursachten Ausstoß von Treibhausgasen ins Gleichgewicht mit den aus der Atmosphäre entzogenen Emissionen bringen. Kurz: Global sollen die klimaschädlichen Gase nicht mehr zu-, sondern möglichst abnehmen. Aber nach jeder Dürre, jedem Orkan, jedem verheerenden Hagelschlag wachsen die Zweifel, wie glaubwürdig die vollmundigen Versprechen aus Politik und Wirtschaft sind.
Immer sehen wir, dass man Beschlüsse zum Klimaschutz aufweicht, weil sie für die große Mehrheit der Menschen zu schmerzlich seien. Da die zukünftigen Generationen nichts zu sagen haben, nimmt man ihre Interessen nicht ernst. Und deshalb funktionieren auch Klimaprotokolle nicht. Politiker nehmen bestenfalls ihre Wähler ernst und Unternehmen ihre Aktionäre, weil die ihnen spürbar Druck machen.
Verständlich, wenn da die Zoomer und die nachfolgende Generation Alpha sich beklagen, dass die Mächtigen klimabedingte Probleme und die damit verbundenen exorbitanten wirtschaftlichen Verluste einfach auf die Nachgeborenen abwälzen. Wie kann es sein, dass sich auf Klimakonferenzen die Entscheider auf wohlklingende Abschlussprotokolle einigen, dann aber die notwendigen Maßnahmen nicht durchsetzen oder sogar zurücknehmen?
Eine aufschlussreiche Erklärung dazu liefert Professor Stephen Gardiner von der University of Washington in Seattle auf einer Vorlesung in Oxford, an der meine Tochter teilnehmen durfte. Wie sie mir erzählte, nannte er den eben geschilderten Widerspruch die „Tragödie der Allmende“. Die Sozialwissenschaften verwenden diesen Begriff für Systeme, in denen frei verfügbare, aber begrenzte Ressourcen zum Schaden aller übernutzt werden. Soll heißen: Wenn alle denken, das Gemeingut (die Allmende) sei umsonst, greift sich die Mehrheit so viel davon ab, bis ein Mangel entsteht. Dann trifft die Notlage alle, selbst die wenigen, die sich aus Rücksicht auf ihre Mitmenschen zurückgehalten haben. Bekannte Beispiele für die Allmendeklemme sind die Überfischung der Weltmeere und eben auch die Aufheizung der Erdatmosphäre.
Die wenigsten Länder bestreiten den kollektiven Nutzen der Klimaziele von Paris. Deswegen können sich 2015 auch 195 Vertragsparteien darauf einigen, die globale Erwärmung auf „deutlich unter“ zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen und möglichst die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Aber wie sieht es bei den Unterzeichnern des globalen Klimaschutzabkommens von Paris aus, wenn sie im eigenen Land weniger klimaschädliche Gase ausstoßen sollen? Die Zahlen der Klimaforscher sprechen eine deutliche Sprache: Im Jahr 2024, dem bisher wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, liegt die globale Erwärmung 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt. Falls die Welt die Emission von Treibhausgasen nicht massiv herunterschraubt, werden wir bis 2030 die 1,5-Grad-Grenze deutlich überschreiten.
Die große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist ein Ausdruck der Allmendetragik. Der Meeresbiologe und Ökologe Garrett Hardin sprach 1968 in seinem Essay „The Tragedy of the Commons“ von einem unvermeidlichen Schicksal der Menschheit, würde man nur nach technologischen Lösungen suchen. Laut Hardin trägt jeder zum eigenen wie auch zum Ruin der Gemeinschaft bei. „Die Freiheit in einem Gemeinwesen bringt allen den Ruin“ (Hardin 1968).
So viel zur Technologieoffenheit, die einige Politiker wie eine Monstranz vor sich hertragen. Als könnte Technologieoffenheit auf wundersame Weise all unsere Probleme lösen! Sie ist zwar gut, kann die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft aber nicht aus sich selbst heraus meistern. Dazu sind Menschen mit Gemeinsinn nötig, die ihr Denken ändern und die Technologie zum Nutzen aller einsetzen.
Ohne eine CO2-Abgabe und andere Umweltsteuern wird es wohl trotzdem nicht gehen. Der Verbrauch frei zugänglicher, natürlicher Ressourcen muss einen Preis haben, der eine lenkende Wirkung ausübt. Sonst schaffen es die Interessen der zukünftigen Generationen nie weiter als bis in die unverbindlichen Absichtserklärungen von Debatten und Konferenzen.
Da verwundert es auch nicht, dass der Green Deal der EU – das Lieblingskind von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission – keine Wirkung entfaltet. Oder dass die Bundesregierung die deutschen Klimagesetze kippt, die für jeden einzelnen Emissionsbereich wie Verkehr, Energie und Wohnen gesonderte Klimaziele vorgaben. Das novellierte Klimagesetz spricht nur noch von einer „Gesamtverantwortung“. Alle Bereiche zusammen sollen beim Ausstoß klimaschädlicher Gase also ein kollektives Ziel erreichen. Da würde es nicht wundern, wenn nun jeder auf die Enthaltsamkeit der anderen Bereiche hofft und am Ende alle gemeinschaftlich das Klimaziel weit verfehlen.
Es klingt politisch kraftvoll, die deutschen Kohlekraftwerke „bis spätestens im Jahr 2038“ und die nordrhein-westfälischen Braunkohlekraftwerke sogar schon bis 2030 stilllegen zu wollen. Ebenso vorbildlich ist Deutschlands erklärtes Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein. Fragt sich nur, wie viel diese Bemühungen dazu beitragen, das Weltklima damit vor dem Kollaps zu retten. Der Treibhausgasausstoß von China, Indien und den USA ist wesentlich höher als der deutsche. Werden diese Staaten die „Tragödie der Allmende“ vollenden, oder gibt es doch noch ein Happy End?
1.2.3Große Versprechungen und gefühlte WirklichkeitNicht viel ermutigender als die Lösungsansätze der Politik sind die Anstrengungen der Global Player aus der Wirtschaft. Fakt ist, dass heute kein Unternehmen mehr ohne Sustainability Report auskommt, um seine Nachhaltigkeit zu belegen. Fakt ist aber auch, dass hier sehr viel getrickst wird, um sich ein grünes Mäntelchen umzuhängen. Immerhin: Greenwashing, also das Aufpolieren des eigenen Images durch Übertreibung oder Erfindung umweltfreundlicher Maßnahmen, kann inzwischen empfindliche Strafen nach sich ziehen. Das bekam die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen (DWS) schmerzlich zu spüren, als die US-Börsenaufsicht wegen eines Etikettenschwindels bei dem angeblich grünen Fonds „ESG“ gegen den Vermögensverwalter ermittelte. Um größeren Schaden abzuwenden, erklärte sich die Deutsche-Bank-Tochter zu einer Strafzahlung von 25 Millionen Dollar bereit.
Die Verantwortlichen hinter solcher Schönfärberei müssen mit persönlichen Konsequenzen rechnen, wie der Abgasskandal von 2015 zeigt. Der VW-Konzern und andere Hersteller hatten die Motorsteuerung ihrer Dieselfahrzeuge so manipuliert, dass sie auf dem Prüfstand Musterschüler und auf der Straße Schmutzfinken waren. „Dieselgate“ führte unter anderem zum Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Martin Winterkorn, sowie des ehemaligen Audi-Chefs, Rupert Stadler.
Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal von 2021 sehen wir einmal mehr, dass zu wenige Verantwortliche Schutzmaßnahmen proaktiv vorantreiben. Jedes Mal, wenn die Naturgewalten Menschenleben fordern, gibt es diesbezüglich volltönende Versprechen und nachher allzu oft nur minimale Fortschritte. In der öffentlichen Wahrnehmung ist Olaf Scholz das Paradebeispiel für einen Politiker, der Entscheidungen hinauszögert, den Status quo nur in kleinstmöglichen Schritten verändert, kritischen Fragen ausweicht und sich aus schwierigen Situationen herauswindet. Die Medien sprechen ironisch von „Scholzen“, um dieses Verhaltensmuster zu beschreiben. Wir müssen uns nicht wundern, dass solches Herumlavieren bei der jüngeren Generation schlecht ankommt. Auf lange Sicht untergräbt es ihr Vertrauen in Politiker und Wirtschaftsführer.
Statt sich in politischen Parteien und Gremien zu engagieren, demonstrieren die Teens und Twens lieber auf der Straße – oder kleben sich daran fest. Während Politiker uns jeden kleinsten Beschluss als ganz großen Wurf verkaufen, stehen den Generationen Z und Alpha die Haare zu Berge, weil der Schutz von Umwelt und Klima an allen Ecken und Enden stockt. Selbst die Grünen müssen erleben, wie ihr hehres Ziel mit Spitznamen „Heizungsgesetz“ an der politischen Realität scheitert. Wie der Absatz von Elektroautos nach Streichen der Förderprämien einbricht. Wie immer noch etwa zehn Prozent aller produzierten Lebensmittel im Müll landen.
Wie lassen sich die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern, ohne die Gesellschaft zu spalten? Die Preise für Fisch und Fleisch zu verdreifachen, wie von manchen Klimaschützern gefordert, würde den Konsum sicher zurückschrauben. Doch dann könnten sich die unteren Einkommensschichten solche Nahrungsmittel kaum noch leisten. Die Alternative wäre freiwilliger Konsumverzicht, bislang ein ziemlich stumpfes Schwert im Kampf gegen die Ausbeutung des Planeten. Von allen großen Problemen unserer Zeit lässt sich wohl kaum eines lösen, ohne dabei irgendjemandem wehzutun.
Es gibt keine einfachen Lösungen, obwohl Populisten das rund um den Globus unermüdlich behaupten. Das hat sich in China an der Ein-Kind-Politik gezeigt. Zwischen 1979 bis 2015 belegte das kommunistische Regime Eltern mit Geldstrafen und anderen Sanktionen, wenn sie sich mehr als ein Kind zulegten. Diese Politik hat mit dazu beigetragen, die Bevölkerungsexplosion einzudämmen. Laut Weltbank sank die Armutsquote in China von über 88 Prozent im Jahr 1981 auf weniger als 1 Prozent im Jahr 2019. Aber wie jede Medaille hatte auch diese eine unschöne Kehrseite.
Da sich chinesische Eltern zur eigenen Altersabsicherung traditionell einen Jungen wünschen, haben sie viele Mädchen einfach abgetrieben. Um sich ohne staatliche Sanktionen die Chance auf einen männlichen Stammhalter zu erhalten, verkauften manche ihre unerwünschten Kinder an Menschenhändler oder töteten sie gar. Auch brachte die Ein-Kind-Politik das Geschlechtergleichgewicht in Schieflage. 2009 kamen auf 120 Jungen nur 100 Mädchen.
Außerdem spürt China schon heute den Gegenwind der Überalterung, was sich so schnell auch nicht ändern lässt. Denn obwohl verheiratete Paare heute wieder bis zu drei Kinder haben dürfen, wollen viele keine große Familie mehr. Einige Forscher erwarten bis zum Jahr 2100 eine Halbierung der chinesischen Bevölkerung. Damit wäre China dann eines der am stärksten von demografischer Schrumpfung betroffene Land. Staatlich verordnete Schnellschüsse können also dramatische Folgen haben, die sich nur mit erheblichem Aufwand an Zeit und Geld wiedergutmachen lassen.
Zurück nach Deutschland. Wie weit die Versprechungen der Politik und die gefühlte Wirklichkeit der Menschen auseinanderliegen, haben wir in der sogenannten „Flüchtlingskrise“ erlebt. Während der Migrationsbewegungen ab 2015 steigt die Zahl der Asylsuchenden deutlich an. Da Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern vergleichsweise viele Menschen aufnimmt, sehen inzwischen nicht nur Populisten in der Situation eine Bedrohung für den Wohlstand und die Sicherheit des Landes. Weil ausländerfeindliche Hetze vielerorts einen Austausch sachlicher Argumente kaum noch möglich macht, droht die Migrationsfrage die Gesellschaft zu spalten.
Werfen wir einen Blick auf die nachprüfbaren Fakten: Die Integration der Flüchtlinge führt zu vielfältigen Herausforderungen, allerdings bei Weitem nicht in dem Umfang wie in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als etwa 14 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland kamen. 2023 sind im Ausländerzentralregister (AZR) 3,17 Millionen Schutzsuchende registriert und 1,18 Millionen haben seit 2015 die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Dadurch ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung gesunken und es gibt positive Impulse für den Arbeitsmarkt.
Gleichwohl zwingen die Hilferufe aus Städten und Gemeinden und der starke Zulauf am rechten Rand des politischen Spektrums die Bundesregierung 2023 zu neuen Regelungen für die „Begrenzung irregulärer Migration“. Und wieder einmal bauschen Politiker minimale Veränderungen groß auf. Olaf Scholz erklärt, dass abgelehnte Asylbewerber künftig „in großem Stil“ in ihre Heimatländer oder in sichere Drittstaaten abgeschoben werden sollen. Was bringt das sogenannte „Rückführungsverbesserungsgesetz“ tatsächlich?
Die Neue Zürcher Zeitung berichtet am 26. Oktober 2023 von 280 000 ausreisepflichtigen Asylantragstellern, von denen die meisten aber geduldet sind, also vorerst im Land verbleiben dürfen. Von dem neuen Gesetz erwartet man sich 600 zusätzliche Abschiebungen. Diese Steigerung von sage und schreibe 0,2 Prozent nennt der Bundeskanzler dann eine Entlastung „in großem Stil“.
Es gibt eine lange Liste minimaler Fortschritte, die Politiker, Wirtschaftsvertreter und Sprecher unterschiedlichster Interessengruppen uns in schöner Regelmäßigkeit mit viel Getöse verkaufen. Niemand verkündet gern unbequeme Wahrheiten, doch bei alldem dürfen wir nicht die Wirkung auf jene vergessen, deren Zukunft vom heutigen beherzten Anpacken der Probleme abhängt. Je mehr junge Frauen und Männer sich von den etablierten Parteien verladen fühlen, desto mehr wenden der Politik den Rücken zu oder wählen radikale Populisten.
Genau das haben wir in der Europawahl 2024 erlebt. Während bei der vorangegangenen Bundestagswahl „nur“ 7 Prozent der Wählerinnen und Wähler von 18 bis 24 bei der AfD ihr Kreuz machten, waren es drei Jahre später 16 Prozent der Jungwähler – mehr als doppelt so viele. „Soziale Ungleichheit ist ein Riesenthema“, deutet der Jugendforscher Simon Schnetzer diese Entwicklung, „und wenn junge Menschen das Gefühl haben, mit der aktuellen Regierung wird das nicht besser, dann suchen sie nach Alternativen.“
Es scheint, als würden populistische Parteien wie die AfD oder das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vor allem in den neuen Bundesländern immer mehr Jungwähler begeistern. Von einem deutschlandweiten Rechtsruck unter Jugendlichen und jungen Erwachsenden zu sprechen, wäre jedoch eine Verzerrung der Wirklichkeit. Wie die Shell Jugendstudie 2024 klar zeigt, kann „von einer generellen Resignation oder Distanz zu Demokratie und Gesellschaft […] nicht gesprochen werden“. Allerdings, auch das belegt die Studie, haben die befragten 12- bis 25-Jährigen im Osten Deutschlands weniger Vertrauen in klassische Medien wie das Fernsehen oder Zeitungen. Sie informieren sich lieber auf Onlinekanälen wie TikTok, Instagram oder X (vormals Twitter). Und gerade hier sind Populisten deutlich präsenter als die Parteien der demokratischen Mitte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: