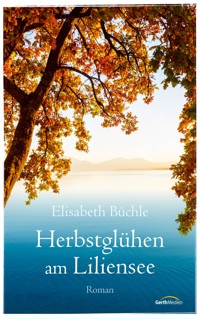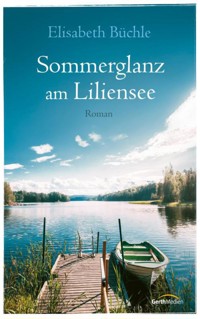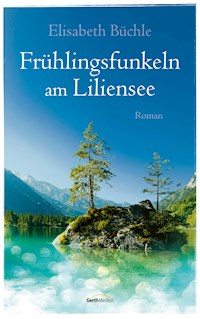8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei einem mysteriösen Unfall in den Wirren der Märzrevolution 1849 kommen die Eltern der zehnjährigen Antoinette ums Leben. Daraufhin wird sie quer über den Atlantik zu ihrem Patenonkel nach New Orleans gebracht. Dort erwartet Antoinette eine fremde Familie, eine fremde Umgebung und fremde gesellschaftliche Umstände. Vor allem die Sklaverei stößt auf ihr Unverständnis. Warum sollten Menschen das Recht haben, andere zu ihrem Besitz zu machen? Jahre später folgt sie ihrem Herzen und schließt sich heimlich einer Gruppe von Sklavenbefreiern an. Doch verhindert sie damit womöglich ihr Liebesglück? Und was ist mit dem Rätsel um den Tod ihrer Eltern? Wird sie jemals erfahren, was damals tatsächlich geschehen ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Über die Autorin
Elisabeth Büchle hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und wurde für ihre Arbeit schon mehrfach ausgezeichnet. Ihr Markenzeichen ist die Mischung aus gründlich recherchiertem historischen Hintergrund, abwechslungsreicher Handlung und einem guten Schuss Romantik. Sie ist verheiratet, Mutter von fünf Kindern und lebt im süddeutschen Raum.
www.elisabeth-buechle.de
Für Christoph
Vorwort
* * *
Es ist nicht einfach, mit den Begriffen, Regularien und Besonderheiten des alten amerikanischen Südens umzugehen, ohne in der heutigen Zeit Verwirrung zu stiften oder gar diskriminierend zu wirken.
Fast im gesamten 19. Jahrhundert wurden in New Orleans die Nachkommen der in die Vereinigten Staaten verschleppten Afrikaner streng nach Farbigen (Mulatten, Griffe, Quadroon, Octoroon usw.) und Schwarzen getrennt, ebenso wie die Kreolen (spanische und französische Nachfahren der Kolonialherren) ihre eigene weiße Aristokratenschicht streng in eine Hierarchie pressten (soziale Stellung, Ansässigkeitsdauer in New Orleans usw.). Heute wird der Begriff „farbig“ als diskriminierend angesehen.
Um das Flair und den unterschiedlichen Umgang der Weißen mit den versklavten oder auch freien Afroamerikanern nicht zu verwässern, habe ich in diesem Roman auf eben diese Unterteilung in Farbige und Schwarze zurückgegriffen, ohne jemanden damit verletzen zu wollen.
Der Schauplatz
New Orleans – eine Stadt, deren Geschichte sich nachzulesen lohnt – liegt an dem „Vater der Gewässer“, wie die Indianer den Mississippi nannten. Der gewaltige Strom, der sich von der kanadischen Grenze durch 31 Staaten der USA wälzt und sein Süßwasser schließlich in das Salzwasser des Golfs von Mexiko fließen lässt, war für viele flüchtige Sklaven ein Wegweiser in die sichere Freiheit.
Der große Strom, der immer wieder sein Flussbett veränderte, schuf vor allem um New Orleans und in der Küstennähe ein unüberschaubares, riesiges Sumpf- und Schwemmland mit unzähligen schönen Bayous1. Umgeben wurden diese Sümpfe von wilden, urwüchsigen Wäldern, denen im Laufe der Jahrhunderte immer mehr Nutzland, Land für Siedlungen, Plantagen und kleinere wie größere Städte abgerungen wurden. Vor allem in diesen Wäldern, auf den herrschaftlichen Plantagen und in dem alten französischen Viertel New Orleans spielt dieser Roman.
Die Zeit
1849: Die Revolutionen in Deutschland, Frankreich und anderen benachbarten Ländern gehen dem Ende entgegen. Eine neue Einwanderungswelle trifft daraufhin die Vereinigten Staaten.
1855: Das Leben im amerikanischen Süden ist – zumindest für die weiße, gehobenere Schicht – einfach, leicht und voller Vergnügungen und Feste, während die Sklaven – auch in den humaner geführten Häusern und Plantagen – mehr und mehr unter Druck geraten. Die Vorboten des Bürgerkriegs erreichen mit zunehmender Vehemenz New Orleans.
1859: Ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen stehen die Zeichen – vor allem auf den von der Sklaverei profitierenden Plantagen – auf Sturm. Dennoch lassen sich die stolzen Kreolen in New Orleans ihre Freude am Leben und am Feiern nicht nehmen.
1862: Der Krieg, der bereits seit einem Jahr im Gang ist und noch weitere drei Jahre andauern wird, findet im Frühjahr 1862 zumindest in New Orleans ein Ende. Die Stadt wird durch die Truppen der Nordarmee besetzt.
Hintergrundinformation zur Person von Carl Schurz
Carl Schurz (2. März 1829 – 14. Mai 1906) war während der Märzrevolution in Baden ein Verfechter demokratischer Ideen. 1852 wanderte er in die USA aus, wo er sich für die Sklavenbefreiung einsetzte. Als prominentes Mitglied der republikanischen Partei trat er seit 1858 so wirksam für Abraham Lincoln ein, dass dieser 1860 ins Weiße Haus gewählt wurde. Während des Sezessionskrieges war Schurz Generalmajor und kämpfte unter anderem in den Schlachten Second Bull Run, Chancellorsville, Gettysburg und Chattanooga. Nach dem Krieg wurde er unter Präsident Hayes Innenminister der USA (1877–1881).
* * *
In allen Epochen gab es immer wieder einzelne Personen und Gruppen, die sich durch ihre selbstlose Liebe, die beinahe an Selbstaufgabe grenzte, für andere Menschen einsetzten, ohne Rücksicht auf ihr Leben, ihre Sicherheit, ihre Bequemlichkeit oder ihr Ansehen zu nehmen. Ich bewundere diese Menschen – die Hebammen, die entgegen des Befehles des Pharaos nicht alle Israelitenjungen nach der Geburt töteten (2. Mose 1,15–22), die Menschen in den Vereinigten Staaten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den unterdrückten und geknechteten Sklaven einen Weg in die Freiheit zu ermöglichen, die Männer und Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland jüdische Mitbürger versteckten oder ihnen zur Flucht verhalfen, und die Missionare, die mit ihren Familien das doch recht sichere Leben in Deutschland hinter sich lassen, um den Menschen in anderen Ländern – teilweise von Verfolgung, Inhaftierung und Tod bedroht – das Evangelium unseres Herrn zu bringen.
Aus dieser Bewunderung heraus entstand die Idee für diesen Roman.
1 sumpfiger Flussarm
Teil 1
1849
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild;
auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen.
Psalm 28,7
Kapitel 1
Die Zweimastbrigg stob scheinbar wütend durch die aufgewühlte See. Die stolz geblähten Segel fingen den heftigen Wind ein und trieben das Schiff weiter voran, der neuen Welt entgegen. Die Wanten surrten unter der hohen Belastung, und die Holzverstrebungen knackten empört über die rüde Gewalt des Windes, der sie ausgesetzt waren, während die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika fröhlich vor sich hin flatterte. Auf dem gischtbespritzten Oberdeck stand ein etwa zehnjähriges Mädchen gefährlich weit über die Reling hinausgelehnt und ließ sich den Wind in das gerötete Gesicht wehen, während seine Zunge immer wieder über die Lippen leckte, um den salzigen Geschmack zu kosten, den das Meerwasser darauf hinterließ. Die braunen, runden Kinderaugen blickten fasziniert auf das Spiel der schnell dahinziehenden, weißgrauen Wolken und der gleißend hellen Sonne, die sich dazwischen immer wieder zeigte.
Dieses Spiel von Licht und Schatten schien sich im Herzen des Kindes widerzuspiegeln, welches zwischen freudiger Aufgeregtheit und verwirrendem Kummer hin und her gerissen war. Das Mädchen war gemeinsam mit einer ihm fremden Gouvernante und einer französischen Zofe auf dem Weg in sein neues, ihm vollkommen unbekanntes Zuhause. Le Havre lag bereits weit hinter ihnen, und nun pflügte der hölzerne Rumpf des Segelschiffes unbarmherzig voran und brachte das Kind fort von seinem bisherigen Leben, seinen Kameradinnen, der gewohnten Umgebung und – was noch viel schlimmer war – von seinen toten Eltern.
Die Kleine presste die Lippen aufeinander und wischte sich mit dem Ärmel ihrer Bluse die Tränen ab. Ihre Eltern waren jetzt seit einigen Wochen tot, und noch immer verstand sie nicht, wie diese beide auf einmal hatten ums Leben kommen können. Niemand hatte ihr eine Antwort auf diese Frage gegeben, und so hatte sie schließlich aufgehört, diese zu stellen. Bereits einen Tag nach dem Tod ihrer Eltern war sie aus ihrer Heimat Baden nach Paris zu ihren Großeltern mütterlicherseits gebracht worden. Ihre Mutter hatte ihr zwar die französische Sprache beigebracht, doch nun tat sie sich ein wenig schwer, diese tagtäglich zu gebrauchen.
Das Mädchen verdrängte alle schmerzlichen Erinnerungen und beugte sich noch ein wenig weiter nach vorne. Hatte sie sich getäuscht, oder war dort gerade ein schlanker, silberner Körper im Wasser gewesen, der sich einen Spaß daraus machte, in der Bugwelle des schnell vorankommenden Schiffes zu schwimmen? Neugierig stellte sie beide Füße auf die unterste Querverstrebung der Reling und blickte am Rumpf entlang nach vorne. Tatsächlich tauchten dort mehrere schmale, vom Licht der Sonne silbern beschienene Rückenflossen auf, und mit einem begeisterten Ausruf begrüßte sie vier Delfine, die das Schiff wie Wächter zu begleiten schienen.
„Antoinette!“
Der entsetzte Ruf entging ihr. Sie war es nicht gewohnt, mit ihrem richtigen Namen angesprochen zu werden, da sie zu Hause von allen immer nur Toni gerufen worden war. Erst als sich zwei Hände um ihre Oberarme legten und sie energisch von der Reling heruntergezogen wurde, zuckte sie zusammen und sah in das wütende Gesicht der älteren französischen Dame, die ihre Großeltern ihr als Gouvernante zur Seite gestellt hatten.
„Wollen Sie sich umbringen?“, stieß die Frau hervor und zog sie einige Meter weit hinter sich her in den Windschatten einer der Aufbauten. „Es ist gefährlich, auf die Reling zu klettern, und Sie haben nicht einmal ein Cape übergezogen, Antoinette!“, schimpfte die Frau auf das Kind ein, welches betreten, aber auch verwirrt zu ihr hinaufblickte.
„Haben Sie die Delfine gesehen, Mademoiselle Claire? Sie sind wunderschön und so schnell!“
„Delfine? Ich habe nur gesehen, dass das mir anvertraute Kind beinahe über Bord gefallen wäre! Was tun Sie alleine hier draußen auf der Reling – ohne Cape?“ Die Frau seufzte hörbar auf und blickte böse auf das Mädchen hinunter, das hilflos die schmalen Schultern nach oben zog.
„Sie sind sehr anstrengend, Antoinette!“
Toni senkte betrübt den Kopf. Allmählich begann sie, diesen Worten Glauben zu schenken, denn sie hatte diese Klage in den vergangenen Tagen immer wieder zu hören bekommen. Früher hatte es immer nur geheißen, dass sie ein wissbegieriges Kind sei und dass man sie liebe. Offenbar war sie ohne die Eltern, ohne die Freundinnen und ohne ihren besten Freund – ihr kleines Pony – sehr anstrengend für ihr Umfeld geworden.
„Entschuldigen Sie bitte, Mademoiselle Claire. Ich möchte Sie nicht anstrengen.“ Das Kind blickte betroffen auf seine Schuhspitzen hinunter, wusste es doch, dass sich sowohl die Gouvernante als auch die Zofe, die sie begleiteten, auf dem schwankenden Segelschiff sehr unwohl fühlten.
„Kommen Sie mit hinunter, Antoinette.“
Toni nickte gehorsam, warf einen letzten Blick auf die langsam im unruhigen Meer versinkende Sonne und folgte der Frau in das Innere des Oberdecks.
* * *
Eine Stunde später lag sie warm eingepackt in ihrer gemütlichen Koje und blickte über die dicke Steppdecke hinweg auf das warm schimmernde, polierte Messing an der Tür, in dem sich das Licht der Lampe aus der Nebenkabine spiegelte. Sie konnte die beiden Frauen, deren Obhut sie anvertraut worden war, nicht sehen, doch ihrer Unterhaltung konnte sie folgen, obwohl sie sehr leise sprachen.
„Wie bin ich nur dazu gekommen, diesen Auftrag der de la Rivières anzunehmen? Dich kann ich verstehen. Immerhin bist du noch jung und hast in diesem Land gute Aussichten auf eine weitere Anstellung. Doch ich? Wie konnte ich mich nur dazu überreden lassen, auf dieses permanent schwankende Schiff zu gehen und mich mit einem Kind auseinanderzusetzen, das nicht in der Lage zu sein scheint, die einfachsten Regeln zu akzeptieren. Na, immerhin werde ich ja wieder nach Frankreich zurückkehren.“
„Gehen Sie mit dem kleinen Mädchen nicht ein wenig zu hart ins Gericht, Mademoiselle Claire? Immerhin hat es erst vor wenigen Wochen seine Eltern verloren. Das Kind wurde praktisch über Nacht zu seinen Großeltern gebracht, die es in seinem Leben erst wenige Male gesehen hatte. Die wiederum schickten es dann innerhalb kürzester Zeit auf dieses Schiff, das es zu einem fremden Kontinent bringt, wo es dann bei einer Familie leben soll, die ihm vollkommen fremd ist.“
„Es ist ihr Patenonkel, und der hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, das verwaiste Mädchen bei sich und seiner Familie aufzunehmen. Monsieur und Madame de la Rivière sind einfach nicht mehr in der Lage, diesen ungehobelten Wirbelwind bei sich aufzunehmen.“
„Ungehobelt, Mademoiselle Claire? Das Kind ist nun einmal auf einem Landgut aufgewachsen, nicht in einer großen, kulturell lebendigen Stadt wie Paris.“
„Ein wenig Erziehung, wie sie die jungen Damen in Paris erhalten, hätte dem Kind nicht geschadet.“
„Nun, ich denke, das, was sie zu lernen hat, wird sie auch im französischen Viertel von New Orleans beigebracht bekommen. Meinen Sie nicht auch, Mademoiselle Claire?“
„Hoffen wir es, Marie, hoffen wir es.“
Toni blinzelte müde. Ihre Mutter hatte sie immer wieder gerügt, weil sie ein wenig wild sei, doch ihr Vater hatte ihr dann nur lachend über den Kopf gestrichen und gemeint, sein Mädchen sei so, wie es sei, ganz richtig. Stimmte das denn nicht? War sie so viel anders als die zehnjährigen Mädchen in Paris oder in dieser fremden Stadt New Orleans, die ihre neue Heimat werden sollte? War New Orleans wie Paris? Voller Häuser, voller Menschen, Kutschen, Regeln und ernst blickender Menschen? Beunruhigt drehte sie sich in ihrer Koje um und weinte leise in ihr weiches Federkissen. Sie trauerte um ihre Eltern und um das verlorene Leben zu Hause, und noch ehe die Angst vor dem Neuen und Unbekannten in ihr übermächtig werden konnte, schlief sie ein.
* * *
Toni drückte sich gegen die Holzwand und ließ ihren Blick über das dunkel schimmernde Unterdeck schweifen. Eine große Menschenmenge bewegte sich langsam über die feuchten Holzbohlen an ihrem Versteck vorbei. Der Wind war schwächer geworden, nachdem es mehrere Tage lang heftig gestürmt hatte, aber noch immer blies er kühl über das Schiff hinweg, sodass sich die Frauen, Männer und Kinder aus dem Unterdeck fröstelnd in ihre teilweise sehr fadenscheinigen Mäntel und Umhänge hüllten, um sich zumindest notdürftig warmhalten zu können. Doch keiner von ihnen würde aufgrund des kalten Wetters den täglichen Rundgang auf dem Schiff ausfallen lassen. Durch ihn entkamen sie wenigstens für kurze Zeit der drückenden Enge, der schlechten Luft und den unzähligen Krankheiten in ihren kleinen, überbelegten Kabinen.
Es dauerte nicht lange, bis der elfjährige Maximilian mit seiner Familie auf Deck erschien. Der Junge blinzelte mehrmals gegen das ungewohnte Sonnenlicht an, entdeckte jedoch sofort die schmale Gestalt am Aufgang zum Oberdeck. Sein mit Sommersprossen übersätes Gesicht wurde von einem fröhlichen Grinsen erhellt, und als die Matrosen sich nach einem heftig schreienden Säugling umdrehten, huschte er schnell aus der Reihe und drückte sich neben seine neu gewonnene Freundin unter den Treppenaufgang.
„Hallo, Max. Wie geht es deiner kleinen Schwester?“
„Besser, Toni! Viel besser. Die Medizin, die du besorgt hast, hat ihr gut geholfen.“
„Prima. Hier, das ist für euch.“ Toni drückte dem Jungen ein Bündel in die Arme, das dieser mit leuchtenden Augen und einem Grinsen entgegennahm.
„Was ist da drin?“
„Äpfel und Pflaumen, ein wenig Brot und vier Stücke Kuchen.“
„Hast du das irgendwo geklaut?“
„Wo denkst du hin? Im Salon auf dem Oberdeck stehen viele Schalen mit Obst, das teilweise vor sich hin fault, da wir ohnehin genug zu essen bekommen. Das Brot war gestern Abend an unserem Tisch übrig, und ich habe es eingesteckt, bevor der Steward es wegnehmen und als Fischköder oder als Zusatzfutter für die lebenden Tiere unter Deck verwenden konnte. Den Kuchen gab es heute zum Frühstück. Die Frauen an unserem Tisch fanden ihn ein wenig zu süß, aber ich fand ihn lecker und habe die übrig gebliebenen Stücke mit in unsere Kabine genommen.“
„Mama wird mich wieder fragen, wie ich an das Essen gekommen bin.“
„Dann erzähle es ihr eben. Sie wird dir den Umgang mit mir sicherlich nicht verbieten. Mademoiselle Claire hingegen …“
„Ist sie immer noch seekrank?“
„Sie erbricht nicht mehr so häufig, aber sie fühlt sich auch nicht wohl. Zumindest geht es Marie besser, seit der Wind sich etwas gelegt hat.“
„Das heißt, sie passt jetzt besser auf dich auf?“
„Ja, aber ich konnte ihr trotzdem entwischen. Eigentlich ist sie ganz nett. Vermutlich würde sie unsere kurzen Treffen nicht verbieten.“
„Sei dir da nicht so sicher. Die da oben nehmen doch an, dass wir alle krank sind und Läuse haben und so.“
„Viele von euch sind doch auch krank.“
Max nickte bekümmert und hob das Bündel mit dem Essen an seine Nase. Genießerisch nahm er den Duft des Kuchens in sich auf und erneut legte sich ein breites Grinsen über sein Gesicht. „Vielen Dank, Toni. Ich werde mich jetzt auch noch ein wenig bewegen, bevor wir wieder da unten eingesperrt werden.“
„Mach das.“
Toni beobachtete, wie Max sich wieder in die Schlange der langsam Vorbeimarschierenden einreihte, ohne von den Matrosen gesehen zu werden, und verlor ihn wenig später aus den Augen. Sie kauerte sich unter dem Aufgang zusammen und beobachtete die Menschen, die nicht die siebzig Dollar für das Oberdeck hatten aufbringen können. Viele von ihnen – vor allem die Frauen und Kinder – sahen ausgesprochen blass und dünn aus. Waren die Menschen vor der Abreise noch voller Erwartungen auf ihr neues Leben in dem verheißenen Land jenseits des Ozeans gewesen, so wirkten viele von ihnen nun krank, verhärmt und niedergeschlagen. Einige der Kinder waren ungewaschen und ungepflegt und von der mangelnden Ernährung, der Dunkelheit und der leidvollen Enge unter Deck gezeichnet.
Toni, die noch nie in ihrem Leben hatte Hunger leiden oder auf so herrliche Dinge wie frisches Obst oder frisch zubereitete Getränke verzichten müssen, runzelte bei dem Anblick von so viel Leid ihre Stirn.
Max’ Familie zog bei ihrem Rundgang ein weiteres Mal an ihrem Versteck vorbei. Ihr Freund hatte sich inzwischen bis zu seinen Eltern und Geschwistern vorgearbeitet. Unter seinem weiten, verschlissenen und an einer Stelle zerrissenen Hemd trug er ihren für Toni nun jämmerlich klein wirkenden Packen Lebensmittel. Er blickte nicht zu ihr hinüber, obwohl er wusste, dass sie in ihrem Versteck ausharren würde, bis das Deck wieder leer war, um ungesehen zum Oberdeck hinaufhuschen zu können.
* * *
Nach dem Essen wurde Toni von Marie zu einem Mittagsschlaf in ihre Koje gebracht. Noch immer aufgewühlt von den Erlebnissen des Morgens, wartete sie, bis Marie die vordere Kabine wieder verlassen hatte. Dann stieg sie leise aus dem Bett, zog sich eilig ihr Kleid über den Kopf, knöpfte ungeduldig die vielen kleinen Knöpfe zu und schlüpfte in ihre hohen Schnürstiefel, die sie hastig zuband. Der Holzboden knarrte unter ihren Schritten, als sie sich der vorderen Kabine näherte. Erschrocken blieb sie stehen und hielt die Luft an. Doch die gleichmäßigen Atemzüge, die bis zu ihr hinüberdrangen, verrieten ihr, dass Mademoiselle Claire noch immer fest schlief, und so wagte sie es, sich an ihr vorbei- und zur Tür hinauszuschleichen.
Toni blickte sich prüfend um und huschte dann einige Meter den schmalen Gang entlang, ehe sie sich aufrichtete und, als habe sie jegliches Recht, zu dieser Zeit hier spazieren zu gehen, davonschlenderte. Unbeeindruckt von diversen Verbotsschildern, die sie ohnehin nicht lesen konnte, da sie der englischen Sprache nicht mächtig war, betrat sie den Teil des Schiffes, der eigentlich nur der Mannschaft zugänglich war. Neugierig sah sie sich um und marschierte den dunklen, von vielen derb gearbeiteten Türen gesäumten Flur entlang, bis sie das Klappern von Schüsseln vernahm und ihr der Geruch von Waschlauge in die Nase stieg. Hier irgendwo mussten die hauswirtschaftlichen Räume sein.
Toni blieb stehen und blickte sich erneut prüfend um. Hinter welcher dieser Türen mochte sich wohl die Kombüse befinden? Direkt neben dem Mädchen öffnete sich eine Tür, und warmer, weißer Dampf quoll aus dem dahinterliegenden Raum in den Flur, in dem sich eine dunkle, nicht gerade große Gestalt abzeichnete. Als sich der feuchtwarme Dunst verzogen hatte, erblickte Toni einen Jungen, der kaum älter als sie selbst sein konnte.
Verwunderung machte sich in ihr breit. Noch nie hatte sie einen so dunkelhäutigen Menschen mit wilden, schwarzen Locken gesehen wie diesen Jungen.
„Bist du ein Afrikaner?“, fragte sie ihn in der für sie gewohnten deutschen Sprache.
Der Junge senkte wortlos seinen Kopf, blieb aber stehen.
Toni presste die Lippen aufeinander und wiederholte dann ihre Frage in perfektem, jedoch etwas zögerlichem Französisch, doch der Blick des Jungen blieb weiterhin auf den Boden gerichtet, und nur seine Schultern hoben sich, um anzuzeigen, dass er sie noch immer nicht verstanden hatte.
„Wahrscheinlich sprichst du nur Afrikanisch oder Englisch und Englisch kann ich noch nicht. Das werde ich in New Orleans erst noch lernen, obwohl Mademoiselle Claire meint, Französisch würde dort vollkommen ausreichen“, erklärte Toni der bewegungslosen Gestalt. Noch immer konnte sie ihre Augen nicht von der für sie außergewöhnlich interessanten und ungewöhnlichen Erscheinung abwenden.
Der Junge zog ein weiteres Mal entschuldigend die Schultern nach oben und schob sich dann an der Wand entlang an ihr vorbei, um zwei Türen weiter in einem Raum zu verschwinden.
Toni zuckte nun ebenfalls mit den Achseln und griff nach dem Knauf der Tür, durch die der Junge zuvor gekommen war, denn der Dampf, der daraus hervorgequollen war, ließ sie darauf schließen, dass sie ihr Ziel – die Bordküche – gefunden hatte. Sich der Tatsache, dass sie hier nicht erwünscht war und gewaltigen Ärger bekommen konnte, vollkommen bewusst, atmete sie mehrmals tief ein und aus, ehe sie vorsichtig die Tür öffnete.
Der Geruch von kalten Speisen und Waschlauge lag in der dampfenden, heißen Luft und die durcheinanderrufenden Männerstimmen, vermischt mit dem Klappern des Geschirrs, erzeugten einen gewaltigen Lärm.
Unter Deck schien das Schiff noch wesentlich mehr zu schlingern als oben, und mit den ungewohnten, nicht gerade angenehmen Gerüchen in der Nase spürte auch Toni zum ersten Mal, seit sie an Bord gegangen war, einen Anflug von Übelkeit.
Energisch straffte sie die Schultern und stapfte zu den arbeitenden Männern hinüber, die sie bisher nicht beachtet hatten. Vermutlich nahmen sie an, ihr schwarzer Helfer sei zurückgekehrt.
„Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun?“, rief sie, um den Lärm um sich herum zu übertönen.
Drei Köpfe fuhren in die Höhe und sie wurde verwundert gemustert. „Was ist das denn?“, murmelte einer der Köche und zeigte ein schiefes Grinsen auf seinem geröteten Gesicht.
Toni neigte den Kopf leicht zur Seite. Scheinbar sprachen auch diese Männer nur Englisch, und dies würde ihr Vorhaben ein wenig schwierig gestalten. „Ich wollte Sie um die restlichen Lebensmittel der Mittagsmahlzeit bitten – die, die auf den Platten und in den Schüsseln liegen geblieben sind“, versuchte sie dennoch zu erklären.
„Was ist das für eine Sprache? Deutsch?“
„Vermutlich.“
„Jag sie raus. Sie hat hier nichts zu suchen.“
„Sie kommt vom Oberdeck. Siehst du ihre neuen Schuhe und das gute Kleid? Keinesfalls ist sie eines der Kinder von unten.“
„Dennoch hat sie hier nichts zu suchen“, knurrte der Älteste von ihnen und wandte sich wieder seinen gewaltigen Kochtöpfen zu.
Da keiner der Männer reagierte, versuchte Toni ihr Glück mit Französisch und deutete dabei auf die noch nicht weggeräumten, halb vollen Schüsseln, die sich unordentlich auf einer langen Ablagefläche stapelten.
„Hat sie Hunger? Sie kommt doch von oben. Ob sie das Essen verschlafen hat?“, fragte der jüngste der Männer, zog seine geröteten Hände aus dem heißen Wasser und trocknete sie an seiner langen weißen Schürze ab.
„Vielleicht sollte man jemanden holen, der ihre Sprache spricht und ihr erklären kann, dass die Stewards oben für sie sorgen“, knurrte der Älteste wieder und begann, heftig mit einem Drahtgeflecht in seinem Kochtopf zu kratzen.
Unbeeindruckt von dessen mürrischen Worten, zog der Jüngere einen frisch gespülten Teller hervor und legte ein paar nicht mehr sehr warme Kartoffeln darauf.
Toni sah ihn an und schüttelte dann entschieden den Kopf. Offenbar hatte der freundliche Mann verstanden, um was es ihr ging, doch die Menge, die er fertig machte, würde höchstens für Max, jedoch nicht für seine Familie reichen.
Mit großen Schritten ging sie auf den Mann zu, nahm ihm den Teller aus der Hand und schüttete die Kartoffeln in eine der großen Schüsseln. Dann nahm sie eine weitere Platte und leerte die darauf verbliebenen Kartoffeln hinzu, ehe sie, noch immer ungehindert, nach einer dritten Platte griff und auch deren Inhalt in die Schüssel kippte. „Hat einen gewaltigen Hunger, deine neue deutsche Freundin!“, lachte der dritte Mann, der sich bisher aus der Diskussion herausgehalten hatte, und wandte sich wieder seinem Abwasch zu.
„Ich hab keine Ahnung, was sie will“, murmelte der Jüngere und beobachtete, wie das dünne Mädchen mit den langen geflochtenen Zöpfen nach einer weiteren Schüssel griff, in die es übrig gebliebenes Obst füllte.
„Wo steckt Tom? Der Junge soll sofort einen der Stewards holen“, murrte nun der Älteste ungehalten. Im selben Moment wurde vorsichtig die Tür geöffnet und der schwarze Junge trat ein. Er warf einen kurzen verwirrten Blick auf das Mädchen und senkte dann, wie es von ihm erwartet wurde, schnell wieder den Kopf. Toni beobachtete, wie der ältere Mann ihm einen harschen Befehl zuraunte, woraufhin der Junge sofort wieder davonstob.
Sie kümmerte sich nicht weiter um ihn, nahm die Schüssel mit den Kartoffeln und stellte die mit dem Obst darauf. Dann bedankte sie sich mit einem freundlichen Lächeln bei dem jungen Mann, der sie noch immer beobachtete, um sich mit der schweren Last umzudrehen und in Richtung Tür zu gehen, die in diesem Moment von außen geöffnet wurde.
Dankbar für diese unvorhergesehene Hilfe, wollte das Mädchen schnell zur Tür hinaus, wurde jedoch von einer entrüstet klingenden Stimme aufgehalten. „MademoiselleAntoinette! Was machen Sie hier unten?“
Toni blickte an den Schüsseln vorbei und sah in die grünen Augen des Stewards, der sie bei Tisch immer bediente. Sie wusste nicht, ob sie erleichtert darüber sein sollte, dass endlich jemand gekommen war, der sie verstand, oder vielmehr enttäuscht, da sie nun ihr Tun würde erklären müssen, und das, wo sie doch mit ihrer Beute beinahe schon auf dem Weg zum Unterdeck gewesen war. „Ich habe nur ein paar Reste besorgt, Jean. Ich gehe schon wieder“, erklärte sie knapp und wollte sich an dem Steward in seiner vornehmen Livree vorbeidrücken, doch dieser stellte sich ihr in den Weg.
Über ihren Kopf hinweg sprach er mit den drei Köchen, während Toni ungeduldig warten musste. Schließlich schüttelte er entschieden den Kopf. „Sie können hier nicht einfach Lebensmittel mitnehmen, MademoiselleAntoinette. Was haben Sie damit überhaupt vor?“
„Die werden doch ohnehin an die Schweine verfüttert oder über Bord geworfen. Sie werden niemandem fehlen, Jean“, erwiderte Toni leise.
„Und wohin wollten Sie mit den Lebensmitteln, MademoiselleAntoinette?“
Toni kniff die Augen zusammen und warf einen Hilfe suchenden Blick zu dem jüngsten der Köche, doch dieser hob, da er ihre Unterhaltung nicht verstehen konnte, nur die Schultern an. Unwillig erklärte sie dem Steward ihr Ziel, worauf dieser die Augenbrauen zusammenzog und ihr die beiden Schüsseln abnahm. „Das ist nicht für die Leute im Unterdeck gedacht, MademoiselleAntoinette.“
„Das weiß ich, aber dort unten sind viele Kinder, die Hunger haben, während dieses ganze Essen hier an die Schweine verfüttert wird.“
„Die Schweine brauchen auch etwas, bis sie in der Pfanne landen.“
„Aber doch nicht so gute Lebensmittel.“
„Darüber haben wir nicht zu entscheiden, MademoiselleAntoinette.“
Hilflos sah Toni zu, wie der Steward ihre beiden Schüsseln zurück auf die Ablagefläche stellte und sie mit einer zwar freundlichen, aber deutlichen Handbewegung aufforderte, den Küchenbereich zu verlassen.
Traurig und auch ein bisschen wütend ging sie durch die Tür hinaus in den dunklen Flur und warf dem dort wartenden dunkelhäutigen Jungen einen bösen Blick zu. „Warum hast du dich so beeilt?“, brummte sie, erhielt jedoch keine Reaktion. Sie drehte sich noch einmal um und schaute durch die noch offene Kombüsentür, dann ging sie, gefolgt von dem Steward, langsam den Gang entlang, den sie zuvor heruntergekommen war. „Wer ist der Afrikanerjunge?“, fragte sie schließlich.
„Afrikaner? Tom ist ein Sklave aus den Staaten.“
„Ein Sklave?“ Toni blieb stehen und wandte sich erneut um, doch der Junge war bereits verschwunden. „Ein Sklave, wie die Israeliten in Ägypten Sklaven waren?“
„Wie die Israeliten in der Bibel, genau“, bestätigte Jean.
„Aber das ist nicht schön“, murmelte Toni in Erinnerung an die traurigen, erschütternden Gedanken, die sie gehegt hatte, als ihre Mutter ihr das erste Mal die Geschichte aus der Bibel vorgelesen hatte.
„So ist das nun mal in den Vereinigten Staaten.“
„Dort gibt es Sklaven?“ Toni schüttelte den Kopf und blickte noch einmal in Richtung Kombüse, vor welcher kurz zuvor noch der Junge gestanden hatte. „Wo sind seine Eltern? Sind sie auch Sklaven hier auf dem Schiff?“
„Ich weiß nicht, wo seine Eltern sind. Wahrscheinlich weiß er es selbst nicht.“
„Warum?“, hakte Toni nach, während sie weiterging.
Der Steward zuckte mit den Schultern und entgegnete: „Sie sind vermutlich getrennt voneinander verkauft worden.“
„Er wurde von seinen Eltern getrennt?“
„Das ist nun einmal so, MademoiselleAntoinette.“
Unverständnis und Wut machten sich in Toni breit. Wie konnte dieser Mann mit einem Achselzucken sagen, dass dies nun einmal so sei, und nicht die Tragik hinter dieser Tatsache sehen? „Das ist nicht einfach nun mal so, Jean. Das ist traurig und gemein! Meine Eltern sind vor einigen Wochen gestorben und es ist schrecklich. Seine Eltern leben noch, und er könnte bei ihnen sein, wie es sich für ein Kind gehört, und andere Menschen haben ihm das genommen.“ Tränen schossen dem Mädchen in die Augen, und mit beiden Händen den Rock raffend, begann es zu laufen.
„Warten Sie doch, MademoiselleAntoinette. Ich begleite Sie nach oben.“
„Ich finde selbst hinauf!“, rief sie zurück. „Und ich will nicht in dieses Amerika!“
* * *
Toni hatte eine Stunde auf dem Deck zugebracht, sich die immer wärmer werdende Sonne auf ihr tränenüberströmtes Gesicht scheinen lassen und schließlich eine Entscheidung getroffen. Eigentlich sollte sie zurück in ihre Koje, damit Marie nicht bemerkte, dass sie heimlich aufgestanden war, doch ihr junges, empfindliches Herz wollte noch immer Max und seiner Familie helfen, und sie sah nicht ein, dass ihr dies nicht gelingen sollte. So schlug sie ein weiteres Mal den ihr nun bekannten Weg in Richtung Kombüse ein.
Vorsichtig öffnete sie die Tür zur Bordküche und sah sich um. Niemand war zu sehen, obwohl die Spuren des Kochens noch nicht vollständig beseitigt waren, und sie trat erneut in den noch immer in weißen Dunst gehüllten Raum. Eilig ging sie zu der Ablage hinüber, die bei Weitem nicht mehr so überfüllt war wie noch eine Stunde zuvor, und stellte erfreut, aber auch ein wenig erstaunt fest, dass ihre beiden Schüsseln noch immer dort standen, wo der Steward sie abgestellt hatte. Sogar das Obst und die Kartoffeln befanden sich noch in diesen. Begeistert ergriff Toni die schweren Gefäße.
Gerade in dem Moment, als sie sich umdrehen und gehen wollte, trat jemand in die Kombüse. Toni fuhr zusammen und blickte verzweifelt auf die große Gestalt. Es war der jüngste der Köche. Dieser musterte sie einen Augenblick lang, dann huschte ein Lächeln über sein Gesicht, und er murmelte: „Eines muss man ihr lassen – hartnäckig ist sie.“ Damit wandte er sich ab und hievte einen großen, verschmutzten Topf auf den Spülstein.
Toni beobachtete den Mann, und als sie feststellte, dass er sie nicht weiter beachtete, tat sie dasselbe und beeilte sich, die Kombüse mit den beiden Schüsseln im Arm schnell wieder zu verlassen.
Zufrieden lächelnd ging sie den Flur entlang zu einem der Abstiege, die hinunter zu der zweiten Klasse führten. Es war sehr schwierig für das Mädchen, die steilen und schmalen Stufen hinabzusteigen, ohne die Hände frei zu haben, zumal ihr langer, von Tüll und Taft aufgebauschter Rock sie in ihrer Bewegungsfreiheit hinderte. Doch es gelang ihr und sie drang zum ersten Mal in die Räumlichkeiten unterhalb des Oberdeckes ein.
Von einer Seite vernahm sie das leise Singen einer Frau, von der anderen drang ihr heftiges Husten entgegen und irgendwo schrie ein Baby. Toni ging mit unsicheren Schritten den Flur entlang, dennoch stolperte sie in der Dunkelheit über irgendetwas. Sie konnte sich nur mit Mühe auf den Beinen halten und dabei glitten ihr beinahe die Schüsseln aus der Hand. Hitze schoss durch ihren Körper, denn sie musste das wertvolle Porzellangeschirr auf jeden Fall unversehrt zurück in die Küche bringen.
Ängstlich sah sie sich um und ging zügig weiter, immer den dunklen, engen Gang entlang, von dem aus links und rechts türlose Räume abgingen. Wann immer ihr jemand in dem engen Gang entgegenkam, drückte sie sich gegen die Holzwand, wobei sie jedes Mal versuchte, die immer schwerer werdenden Schüsseln zwischen ihrem Körper und der Bretterwand zu verstecken.
In den kleinen, mit vielen Kojen ausgestatteten Räumen war es nicht heller als in dem engen Gang, und so konnte das Mädchen die Personen, die sich darin aufhielten, nur schemenhaft erkennen. Wie sollte sie hier nur ihren Freund finden?
„Max?“, fragte sie leise in die Dunkelheit hinein, doch sie erhielt keine Antwort. Während sie sich weiter durch den Schiffsbauch bewegte, wiederholte sie immer wieder den Namen ihres Freundes, bis sie schließlich eine Reaktion auf ihr leises Rufen erhielt. Eine heisere Frauenstimme rief ihr ein wenig ungehalten zu, dass der freche Lümmel zwei Kammern weiter zu finden sei.
Toni eilte weiter, ohne sich für die Auskunft zu bedanken, blieb schließlich zögernd bei dem genannten Durchgang stehen und versuchte, im Inneren der Kammer etwas erkennen zu können. Der bellende Husten eines sehr kleinen Kindes drang aus dem Raum. Hatte Max ihr nicht gesagt, dass es seiner kleinen Schwester besser ging? „Max? Bist du da?“, fragte sie leise.
„Toni? Bist du das?“
Toni hörte das Knarren von Holz, ehe zwei nackte Füße auf die Bodenbretter patschten und sich ihr ein dunkler, schmaler Schatten näherte. „Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe dir und deiner Familie etwas zu essen mitgebracht.“
„Psst. Still. Oder willst du hier einen Aufstand haben, Toni?“, zischte er ihr zu und zog sie in den dunklen, übel riechenden Raum hinein.
„Was ist denn, Maximilian?“, fragte eine weiche weibliche, erschreckend schwach klingende Stimme.
„Toni ist hier, Mama.“
„Das Mädchen, das dir immer die Lebensmittel gibt?“
„Ja, genau.“
„Sie sollte nicht hier sein“, murmelte die Frau atemlos und begann heftig zu husten.
Auch das kleine Kind hustete wieder und Toni verzog gequält das Gesicht. Sie hörte förmlich heraus, welche Schmerzen dieser Husten verursachen musste.
„Warum bist du hier?“, fragte Max.
„Ich habe Kartoffeln und Obst für dich und deine Familie.“
„Wir bekommen auch unsere Mahlzeiten, Kind“, wandte Max’ Mutter ein. „Du solltest nicht hier herunterkommen.“
„Aber Sie bekommen nur wenig und nicht viel Frisches. Sie brauchen Obst und auch einmal ein wenig Fleisch oder Kartoffeln“, verteidigte sich Toni.
„Es ist aber nicht deine Aufgabe, für andere Zustände zu sorgen“, mischte sich plötzlich eine andere, männliche Stimme mit ein. Toni vermutete, dass sie Max’ Vater gehörte.
Eine große Gestalt bewegte sich in die Mitte des Zimmers und kurz darauf wurde eine heftig schwankende Deckenlampe entzündet. Toni blinzelte gegen das Flackern der unruhigen Flamme an und stellte erleichtert fest, dass sie zum ersten Mal ein wenig mehr als nur dunkle Schatten erkennen konnte.
In dem kleinen Raum waren an jeder Wand jeweils drei Pritschen übereinander angebracht worden, sodass sich insgesamt neun Liegestätten darin befanden, die jedoch, wie sie mit einem Blick feststellte, teilweise doppelt belegt waren.
Wieder hustete das Kind, und jetzt konnte Toni einen etwa zweijährigen Jungen erkennen, der sich heftig wand und dann, als der Anfall nachließ, erschreckend bewegungslos liegen blieb. Der Junge hatte dieselben strohblonden Haare wie Max, und wie bei seinem großen Bruder war sein Gesicht von unzähligen Sommersprossen übersät, die allerdings seltsam blass wirkten.
Erleichtert, sich endlich der schweren Last entledigen zu können, stellte Toni die beiden Schüsseln auf einen nicht sehr stabil aussehenden Stuhl in der Mitte des Raumes. Dann trat sie an die Pritsche des kranken Jungen. Langsam hob sie die Hand und legte sie ihm auf die fieberheiße Stirn. „Max, deinem Bruder geht es sehr schlecht.“
„Ich weiß“, kam die einfache, leise Antwort.
„Warum hast du mir das nicht gesagt?“
„Wir wollten es nicht. Du solltest nichts mit uns zu tun haben“, entgegnete Max’ Mutter.
„Aber Max ist mein Freund.“
„Es ist aber nicht richtig, Toni. Du bist von oben.“
„Warum sollte es nicht richtig sein?“
„Das ist nun einmal so“, brummte der Vater und Toni verzog ärgerlich das Gesicht. Wie oft sollte sie diesen Satz denn heute noch zu hören bekommen?
„Ich hole den Arzt“, beschloss Toni.
Gerade wollte sie sich dem Ausgang zuwenden, als Max’ Mutter zweifelnd fragte: „Wird er denn herunterkommen?“
Toni drehte sich langsam zu der schmalen, ebenfalls sehr krank wirkenden Frau um. „Warum denn nicht? Er ist doch für alle Menschen auf dem Schiff da.“
Max’ Vater brummte etwas Unverständliches und widmete seine Aufmerksamkeit dann den beiden Schüsseln. Er schien Hunger zu haben, doch Toni vermutete, dass er einen großen Teil seiner Portion ebenfalls seinen Kindern geben würde.
Max trat nahe an seine Freundin heran. „Es ist prima, dass du uns versorgst, Toni, aber du musst aufpassen. Wenn die anderen bemerken, dass wir bevorzugt werden, können wir Ärger bekommen – und du auch.“
Toni nickte Max zu und blickte traurig in den nun noch dunkler wirkenden Gang hinaus. „Ich könnte versuchen, noch mehr Essen zu besorgen. Es war noch so viel übrig in der Küche.“
„Wie willst du das machen, Toni? Du wirst gewaltigen Ärger bekommen, wenn du heimlich Essen wegnimmst.“
„Ich habe es nicht heimlich genommen, Max!“, entrüstete sich Toni etwas zu laut.
Schnell drückte Max ihr seine schmutzige Hand auf den Mund. „Leise!“, zischte er und warf ihr einen drohenden Blick zu, der so gar nicht zu seinem sonst so frechen Grinsen passen mochte.
„Entschuldige“, flüsterte Toni erschrocken und beobachtete, wie Max’ Vater das Obst und die Kartoffeln unter den Kindern verteilte. Dabei versuchte er vergeblich, den kranken Jungen zum Essen zu bewegen.
„Kannst du den Arzt fragen, ob er herunterkommt?“, flüsterte Max leise in Tonis Ohr, woraufhin diese heftig nickte.
Sie nahm die leeren Schüsseln, verabschiedete sich kurz angebunden, huschte aus der Kammer in den langen Gang hinaus und lief diesen eilig entlang, bis sie die steile Treppe erreichte, die aus dem Bauch des Schiffes führte. Mit den leeren Schüsseln in der einen Hand konnte sie nun die andere zu Hilfe nehmen, um ihre Röcke beim Treppensteigen anzuheben.
In Windeseile hatte sie die Schüsseln in die nun verwaiste, ordentlich aufgeräumte Küche zurückgebracht und hastete weiter, um schließlich in das obere Deck hinaufzugehen. Dort ordnete sie ihr Kleid und eilte in einen der vielen Salons, um einen Steward zu finden, der für sie den Schiffsarzt ausfindig machen konnte.
* * *
Unruhig saß das Mädchen auf einem der gepolsterten Stühle und wartete, bis sich die Tür öffnete und der Steward mit dem älteren Arzt eintrat. Dieser stellte sich vor sie und strich sich fragend über den grauen Bart.
„Kleine Mademoiselle, sehr krank siehst du aber nicht aus“, bemerkte er freundlich und zog sich einen Stuhl heran.
„Mir geht es auch gut. Ich bekomme hier oben ja auch genug frische Luft und zu essen. Aber den Leuten da unten, denen geht es überhaupt nicht gut. Viele husten und der kleine Bruder von Max scheint sehr krank zu sein. Er hat hohes Fieber.“
„Der kleine Bruder von Max also.“ Der Arzt erhob sich wieder, griff nach seiner unförmigen Tasche, die er neben dem Stuhl auf den Boden gestellt hatte, und bot Toni seine große Hand an. „Kannst du mir zeigen, wo ich den Bruder von diesem Max finde?“
„Dann gehen Sie tatsächlich mit zum Unterdeck?“
„Selbstverständlich, Mademoiselle“, entgegnete der Arzt und Toni lächelte ihn strahlend an.
Sie selbst hatte dies nicht für selbstverständlich gehalten – nicht mehr, nachdem sie die Zustände dort unten kennengelernt hatte.
Toni führte den Mann zum nächsten Abgang und ging ihm bis zu den Unterkünften voraus. Er folgte ihr schweigend, und erst als sie mit der Hand in den Raum deutete, in dem Max’ Familie lebte, wandte er sich wieder an seine kleine Begleiterin. „Du scheinst dich hier erstaunlich gut auszukennen.“
„Ich habe Lebensmittel heruntergebracht, Herr Doktor. Reste von uns oben, die sonst einfach weggekippt werden, und das, wo die Menschen hier unten nur trockenes Brot, etwas Brei, und Dörrfleisch zu essen bekommen.“
„Das Schiff kann nicht mit unendlich vielen Lebensmitteln beladen werden. Die Menschen hier unten haben weniger bezahlt als ihr oben, deshalb bekommen sie auch nicht das gleiche Essen, kleine Mademoiselle.“
„Aber warum sollte man gute Lebensmittel wegwerfen, wenn sie hier unten doch dringend benötigt werden, Herr Doktor?“
Der Schiffsarzt zog die Augenbrauen hoch und bedachte das Mädchen vor sich mit einem nachsichtigen Lächeln. „Auf diesem Schiff sind die Regeln klar festgelegt, und die Menschen hier unten wussten, worauf sie sich einließen, kleine Mademoiselle. Sie wollen in das neue Land und nehmen die Strapazen der Reise freiwillig in Kauf. Ich habe bereits durchgesetzt, dass sie pro Tag drei geregelte Mahlzeiten und eine Stunde Bewegung an Deck bekommen. Damit geht es diesen Menschen hier wesentlich besser, als es auf anderen Schiffen der Fall wäre. Dort wären sie während der dreimonatigen Überfahrt die ganze Zeit unter Deck eingesperrt, bekämen nur eine Ration Essen und Wasser pro Tag und hätten keinerlei medizinische Betreuung. Also beruhige dich wieder, kleine Mademoiselle.“
„Ich heiße Toni, Herr Doktor, und ich kann immer noch nicht verstehen, warum diese Lebensmittel an die Schweine verfüttert oder über Bord geworfen werden sollen, wenn sie hier unten gut gebraucht werden können.“
Der Arzt gab ihr keine Antwort. Er sah sie nur traurig an, drehte sich um und betrat den kleinen Raum. Toni lehnte sich mit dem Rücken gegen das derbe Holz der Wand und lauschte den diversen Geräuschen des Schiffes und der darin befindlichen Menschen. Noch immer schrie irgendwo ein Säugling und nach wie vor war von allen Seiten vielstimmiges Husten zu hören, das sich mit dem Knacken und Knarren des Gebälkes vermischte.
Es dauerte sehr lange, bis der Arzt, gefolgt von Max, wieder in den Gang hinaustrat. „Du gehst mit mir nach oben, junger Mann, und nimmst die Medizin mit. Ich komme morgen wieder“, wies er Maximilian an und wandte sich dann Toni zu. „Und dann werde ich mir auch die anderen kranken Menschen hier unten ansehen. Zufrieden?“
„Sehr“, freute sich Toni und schenkte dem Mann ihr fröhliches, kindliches Lächeln.
„Es war gut, dass du mich geholt hast, Toni. Dem kleinen Jungen geht es tatsächlich schlecht, und ich weiß nicht, ob ich ihm noch helfen kann, doch zumindest seine Mutter und die Schwester kann ich retten.“
Toni blickte erschrocken zu Max hinüber, doch dieser hatte den Kopf abgewandt. Toni ahnte, weshalb. Er wollte seine Tränen vor ihr verstecken. Als er sich an ihr vorbeidrückte, um dem Arzt, der bereits in Richtung Aufstieg ging, zu folgen, traten auch ihr Tränen in die Augen.
* * *
„Warum können Sie dem Bruder von Max nicht mehr helfen?“, fragte Toni den Schiffsarzt, nachdem Max sich mit der Medizin wieder auf den Weg ins Unterdeck gemacht hatte.
„Er hat eine Lungenentzündung, Toni. Was soll ich da tun?“
Hilflos zog das Mädchen die schmalen Schultern nach oben. „Sie hätten ihm aber doch gerne geholfen, nicht wahr, Herr Doktor?“
„Selbstverständlich, Toni. Ich hätte dem armen, kleinen Burschen gerne geholfen.“
„Dann helfen Sie jetzt den anderen Menschen dort unten?“, bohrte sie vorsichtig weiter. Ein aufgeregtes Flattern breitete sich in ihrem Bauch aus. Konnte sie tatsächlich etwas für die bemitleidenswerten Menschen dort unten tun? Würde der freundliche Arzt ihr helfen? Immerhin hatte er auf dem Schiff bereits für einige wichtige, grundlegende Veränderungen gesorgt.
Der Mann lächelte sie amüsiert an. „Du gibst nicht so schnell auf, wenn dir etwas wichtig ist, nicht wahr, kleine Mademoiselle?“
„Toni“, murmelte sie und der Arzt nickte ihr freundlich zu.
„Ich mache dir einen Vorschlag, Toni. Nach dem Abendessen werden wir beide hinunter in die Kombüse gehen und uns ansehen, was übrig geblieben ist. Dann spreche ich mit dem Kapitän, und wir versuchen, eine Regelung zu finden. Einverstanden?“
* * *
Mademoiselle Claire war sehr ungehalten über die Eskapaden ihrer Schutzbefohlenen und gehörig böse auf Marie, die in ihren Augen nicht ausreichend auf das Mädchen achtgegeben hatte. Marie hörte sich die Vorwürfe an, entschuldigte sich und versprach, in Zukunft aufmerksamer zu sein. Dann brachte sie Toni in ihre Kabine, drückte sie herzlich an sich und schenkte ihr ein liebevolles Lächeln, was Toni zutiefst erstaunte.
Einige Tage später hatte sich der Kapitän schließlich dazu durchgerungen, dem Drängen seines Schiffsarztes und den Vorschlägen eines kleinen Mädchens nachzukommen und die noch brauchbaren Essensreste vom Oberdeck den Rationen der Menschen aus dem Unterdeck hinzufügen zu lassen.
An diesem Tag starb Max’ zweijähriger Bruder und wurde im weiten, endlos erscheinenden Ozean bestattet.
Kapitel 2
Wochen später durchpflügte die Brigg den Golf von Mexiko und näherte sich unaufhaltsam dem gewaltigen Strom Mississippi, der sich in einem breiten Band durch das Land Louisiana zog und seine braunen Wassermassen in den Ozean ergoss.
Seit sie den großen Kontinent erreicht hatten, waren viele der Passagiere von Bord gegangen, unter ihnen auch Maximilian und seine Familie.
An diesem Morgen stand nicht nur die kleine Toni aufgeregt an der Reling des Segelschiffes. Ihre beiden erwachsenen Begleiterinnen hatten sich zu ihr gesellt und betrachteten nun mit ihr den üppigen, beinahe wilden Uferbewuchs, der sich ihnen in farbenfrohen, exotischen Bildern eröffnete.
Die Sonne stand bereits warm am Himmel und unzählige Möwen, Kormorane und Pelikane zogen an diesem entlang oder ließen sich in den silber glitzernden Wellen auf und ab schaukeln.
Toni schüttelte mit einer bedächtigen Bewegung den Kopf, sodass ihre beiden geflochtenen Zöpfe langsam über ihre Schultern nach hinten auf den Rücken rutschten. Sie konnte nicht erfassen, wohin sie gebracht worden war. Für sie schien dieser neue Kontinent so unermesslich groß zu sein, dass sich ihrem Staunen ein wenig Angst beimischte. Zum ersten Mal seit Antritt ihrer Reise war sie erleichtert über die Begleitung der beiden Frauen neben ihr.
Sie blickte zu ihnen hinüber. Mademoiselle Claire stand mit weit aufgerissenen Augen da und umklammerte die Reling mit ihren Fingern. Sie wirkte noch immer sehr bleich und abgemagert, während Marie den Eindruck eines aufgeregten jungen Mädchens vermittelte. Toni musterte sie verwundert. Ihr war noch nie aufgefallen, wie jung Marie sein musste. Vermutlich war sie gerade einmal sechs oder sieben Jahre älter als sie selbst. Die Begeisterung im Blick der jüngeren Frau beruhigte Toni ein wenig und sie wandte sich wieder neugierig der vorbeigleitenden Landschaft entlang des großen Stromes zu.
Unendlich viele kleine Nebenflüsse schlängelten sich in das Hinterland, um dort zwischen den wild wachsenden Sträuchern zu verschwinden. Größere, vom Fluss gespeiste Seenplatten und Seitenarme schimmerten zwischen den teilweise überfluteten Wäldern zu dem stolzen Segelschiff herüber.
Über den stehenden Gewässern lag ein grünlicher Dunst und eine düstere, unheimliche Stille. Die dort wachsenden Sumpfzypressen mit ihren Moosbehängen überragten wie drohende Schatten die entwurzelten Baumstämme, die langsam im Wasser vor sich hin moderten.
Vor der Brigg weitete sich die Wasserfläche. Marie trat neben Toni und lächelte diese freundlich an.
„Das ist die Barataria-Bay“, erklärte sie leise.
Das Kind blickte interessiert zu seiner jungen Zofe hinauf. „Woher wissen Sie denn das, Marie? Sie waren doch auch noch nie in New Orleans, oder?“
„Nein, aber ich habe in der Bibliothek an Bord ein Buch gefunden, in dem einige interessante Informationen über diese Gegend stehen.“
„Und das haben Sie gelesen?“
„Ja. Ich lese sehr gerne, und ich war neugierig, wohin unsere Reise geht.“
„Meine Mama hat immer gesagt, ich sei zu neugierig. Das sei nicht gut für mich.“
„Eine gesunde Neugier ist wichtig, finde ich, Mademoiselle Antoinette. Ich möchte doch wissen, was auf mich zukommt und wo ich leben werde.“
Toni blickte zu den überfluteten Zypressenwäldern hinüber, beobachtete ein Reiherpärchen beim Fischen und nickte schließlich zustimmend. War sie nicht auch neugierig und zudem beunruhigt, weil sie sich ihr neues Zuhause überhaupt nicht vorstellen konnte? Schon jetzt, nachdem sie erst kurze Zeit in diesem großen, braunen, brodelnden Fluss unterwegs waren, schien alles so ganz anders zu sein, als sie es kannte oder sich jemals auszumalen gewagt hatte. „Erzählen Sie mir ein wenig von dem, was Sie in diesem Buch gelesen haben?“, bat sie.
„Gerne, Mademoiselle Antoinette.“ Marie lächelte fröhlich auf sie hinunter und deutete dann mit der Hand auf eine Insel. „Das ist Grande Terre. Und dort weiter hinten muss es eine kleine, schöne Bucht geben, in der eine Stadt liegt, die früher eine Piratenstadt war.“
„Eine Piratenstadt?“ Tonis Augen begannen erwartungsvoll zu glänzen.
„Marie, was erzählst du dem armen Mädchen für schauderhafte Geschichten? Es wird in der Nacht kein Auge zumachen können.“ Mademoiselle Claire ging an ihnen vorbei und verschwand in einem der Salons.
„Bitte, Marie! Bitte erzählen Sie mir, was Sie von den Piraten wissen. Gibt es die heute noch?“
„Das weiß ich nicht, Mademoiselle Antoinette. Aber ihr Anführer hieß Jean Lafitte und trieb im Golf von Mexiko und vor Westindien sein Unwesen. Er soll in der Stadt dort hinten ein wunderbares Haus gehabt haben, das mit allen Schätzen gefüllt war, die er erbeuten konnte.“
„Das würde ich gerne einmal sehen“, flüsterte Toni ehrfurchtsvoll und sichtlich aufgeregt. Die Abenteuerlust hatte sie gepackt.
„Ich denke nicht, dass es das Haus noch gibt. Aber eine großartige Geschichte rankt sich um diesen Jean Lafitte. Stellen Sie sich vor, als 1815 Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und England herrschte, boten die Engländer Lafitte sehr viel Geld, damit er ihre Truppen nach New Orleans führen würde.“
Toni warf einen Blick auf das undurchdringlich erscheinende Land entlang des Stromes und nickte.
Es war bestimmt ausgesprochen schwierig, sich in dieser bewaldeten und sumpfigen Landschaft zurechtzufinden.
„Aber das hat er doch nicht tatsächlich getan, oder, Marie?“
„Nein. Das hat er nicht. Er nahm das Angebot an und führte stattdessen die Amerikaner bis an das Lager der britischen Soldaten, sodass diese überrascht werden konnten.“
„Dafür waren die Menschen aus New Orleans dem Piraten sicher sehr dankbar“, überlegte Toni leise und wieder blickte sie mit blitzenden Augen zu der langsam entschwindenden Insel.
„Nicht nur die Menschen in New Orleans, Mademoiselle Antoinette. In dem Buch stand, dass der Präsident der Vereinigten Staaten höchstpersönlich dem Piraten alle seine Schurkereien vergeben und ihn von sämtlichen Strafen, die ihm eigentlich zustanden, befreit hat.“
Toni blickte verträumt zu den langsam vorbeiziehenden Bäumen mit ihren dunklen Moosbehängen am Ufer hinüber. Sie schloss für einen Moment die Augen und versuchte, sich den wilden Piraten vorzustellen, und eine angenehme Aufgeregtheit durchflutete sie. Für das Kind schien es im Moment nichts Erstrebenswerteres zu geben, als wie ein Pirat zu leben, dessen Freiheiten auszukosten und dennoch Gutes tun zu können.
Dann öffnete sie schnell ihre Augen wieder. Keinen Augenblick wollte sie von der Schifffahrt versäumen, die plötzlich so aufregend geworden war.
* * *
Toni zwang sich, während der Mahlzeit still zu sitzen, doch kaum war die Tafel aufgehoben, zog es sie – in Begleitung der ebenso aufgeregten Marie – wieder an Deck.
Die im Wasser stehenden Wälder waren zurückgewichen und auf dem frei gerodeten Land links und rechts des Stromes zeigten sich die unzähligen Blüten der Baumwolle und bildeten ein leuchtendes Meer aus weißen, schaumgekrönten Wellen.
„Wie eine schneebedeckte Wiese“, flüsterte Toni und bei der Erinnerung an ihre Heimat zog ein tiefer Schmerz in ihr auf.
Marie legte schweigend eine Hand auf die rechte Schulter des Mädchens, das ihr den Kopf zuwandte und sie dankbar anlächelte. „Anfangs, bis wir uns in dieser neuen Welt eingelebt haben, wird es schwer werden, doch ich denke, es wird Ihnen gefallen. Sie werden Schwestern und Brüder haben, eine Tante und einen Patenonkel, die für Sie irgendwann wie Mutter und Vater sein werden. Und denken Sie einfach immer daran, dass unser Vater im Himmel Ihnen der beste Vater sein will, wenn Sie nur auf ihn vertrauen.“
Toni nickte wortlos. Ihre Großeltern in Paris hatten sich in ähnlicher Weise geäußert, jedoch nicht den Schmerz über den Verlust ihrer Eltern und die Panik vor dem Neuen und Unbekannten in ihr vertreiben können. Vielleicht würde sie eines Tages ebenso empfinden können, doch im Moment wollte das Mädchen niemanden an die Stelle seiner geliebten Eltern treten lassen. Es vermisste sie einfach zu sehr. Toni kämpfte ein weiteres Mal erfolglos gegen ihre Tränen an. „Aber Sie werden mich nicht alleinlassen, oder?“, flüsterte sie gegen den Fahrtwind an.
„Ich werde für Sie da sein, bis Sie mich nicht mehr brauchen.“
„Das ist gut. Dann bin ich unter diesen fremden Menschen nicht ganz allein.“ Toni sah Marie lächelnd nicken und blickte wieder zu den endlos scheinenden, blühenden Baumwollfeldern hinüber.
Die Brigg glitt zwischen unzähligen anderen Schiffen flussaufwärts auf die Stadt zu, und Toni stellte sich auf die Zehenspitzen, um die ersten vorbeiziehenden Häuser und Straßenzüge sehen zu können. Fasziniert beobachtete sie die vielen Seemänner und Hafenarbeiter bei der Arbeit. „Sehen Sie nur, Marie. All diese vielen Anlegestellen und Handelsschiffe.“ Toni deutete auf das wirre Durcheinander von Frachtkarren, Kisten, Rollwagen, Schubkarren, Arbeitern, Zugpferden, herumstreunenden Hunden und Kindern.
Marie musste ihre Stimme anheben, um das Läuten, Schlagen, Klirren, die Rufe und die Geräusche der Fuhrwerke übertönen zu können: „Allein New York hat einen größeren Hafen und schlägt mehr Waren um als New Orleans. Hier wird neben Baumwolle und Zucker auch Whiskey, Tabak, Hanf und unendlich mehr ein- und ausgeladen, ge- und verkauft.“
„New Orleans ist aufregend und fantastisch, nicht wahr?“
„Bestimmt, MademoiselleAntoinette. Sie werden hier viel Neues kennenlernen.“
„Denken Sie, es wird mir hier gefallen?“
„Ich hoffe es, Mademoiselle.“
Das Schiff schrammte leicht an einer der Kaimauern entlang, und Seeleute sprangen von Bord, um es mit schweren Seilen zu vertäuen. Befehle wurden gebrüllt, und Toni spürte, wie ihre Aufgeregtheit und die Faszination dem Neuen gegenüber einer fast panischen Angst wichen. Sie fühlte sich fremd, klein und allein gelassen. Ihre schmale Hand tastete nach der von Marie, die diese nahm und fest drückte.
„Wir sollten in unsere Kabine gehen und uns darauf vorbereiten, von Bord zu gehen, MademoiselleAntoinette.“
* * *
Zwei Stunden später standen Mademoiselle Claire, Marie und Toni inmitten des geräuschvollen, verwirrenden Durcheinanders am Kai und blickten sich ein wenig hilflos um. Mademoiselle Claire hielt einen auffälligen roten, mit goldenen Fransen besetzten Sonnenschirm in der Hand, der für den Kutscher, der sie in das Stadthaus zu fahren hatte, als Erkennungszeichen dienen sollte. Nun standen sie bereits eine halbe Stunde auf der Kaianlage, doch niemand hatte sie angesprochen, ob sie die zu Erwartenden seien.
Toni war darüber nicht unglücklich. Jede Minute, die verstrich, schob sich zwischen diesen aufregenden Moment und den Zeitpunkt, an welchem sie ihre neue Familie kennenlernen würde, und somit auch zwischen das Jetzt und den voller Angst erwarteten Augenblick der ersten Begegnung.
Aufmerksam beobachtete sie die Verladearbeiten entlang der Kaimauern. Als sie sah, wie ein älterer schwarzer Mann von einem weißen Seemann einen Tritt bekam, da er die schweren Fässer mit Zucker angeblich zu langsam den wackeligen Steg zu einem der Schiffe hinauftrug, zogen sich die Brauen über ihren großen, dunklen Augen zusammen. Es dauerte keine Minute, da erhielt ein junger schwarzer Bursche mit kahl geschorenem Schädel von demselben Mann einen derben Schlag in den Nacken.
Toni brummte missmutig auf, was ihr einen ermahnenden Blick von Mademoiselle Claire einbrachte, auch wenn sich dieser der Grund ihrer undamenhaften Reaktion entzog, da sie in die entgegengesetzte Richtung zu den an- und abfahrenden Kutschen blickte.
Toni zog Marie an der Hand und wartete, bis sie ihre Aufmerksamkeit erlangt hatte. „Warum darf dieser Mann die schwarzen Arbeiter ungestraft schlagen, Marie?“
„Das sind Sklaven, MademoiselleAntoinette. Davon gibt es hier sehr viele, und ihre Besitzer dürfen mit ihnen machen, was sie wollen.“
„Das ist nicht richtig, Marie“, flüsterte das Mädchen.
Toni glaubte, ein schwaches, zustimmendes Nicken bei ihrer Zofe erkennen zu können. Dennoch erklärte die junge Frau: „Dieses Land hat seine eigenen Gesetze und Regeln, MademoiselleAntoinette. Wir werden sie erst einmal erlernen müssen, um die Menschen hier zu verstehen.“
„Ich habe keine Lust, irgendwelche Regeln zu lernen, die erlauben, dass ein Mensch einem anderen wehtun darf“, erwiderte Toni.
„Wenn man in ein anderes Land einreist und dort leben möchte, muss man sich den dortigen Gepflogenheiten anpassen, MademoiselleAntoinette. Sonst wird man nicht glücklich werden, immer ein Außenseiter sein und vielleicht sogar immer als Fremder und Feind betrachtet werden.“
„Ich werde lernen und mich anpassen, Marie. Aber das Benehmen dieses Mannes gefällt mir nicht. Sehen Sie hin, jetzt hat er den alten Mann schon wieder getreten. Beinahe wäre er gestürzt.“
Marie seufzte und wandte sich wieder Mademoiselle Claire zu, die immer ungeduldiger wurde.
Toni beobachtete mitfühlend den älteren schwarzen Mann mit den grauen, dichten Locken. Ihm wurde von einem hölzernen Lastenkarren herab ein weiteres Fass auf den Rücken gepackt, und mit unsicheren Schritten ging er auf den schmalen Steg zu, der den Kai vom Laderaum des Frachtschiffes trennte.
Plötzlich traten zwei junge Männer hinter einem Stapel Kisten hervor. Einer von ihnen stieß gegen den Schwarzen, der ins Taumeln geriet und mitsamt seiner schweren Last stürzte. Der Aufprall des Fasses ging in dem lauten Umfeld der Hafenanlagen unter, und Marie und Mademoiselle Claire waren so sehr in ihr aufgeregtes Gespräch vertieft, dass ihnen das Geschehen entging. Vorsichtig zog Toni ihre Hand aus der Maries.
Der Aufseher kam mit großen Schritten herangelaufen und trat dem Schwarzen, der noch immer am Boden lag, mit dem Stiefel in die Seite. Es folgte ein kurzer Wortwechsel zwischen den Weißen, während der Träger sich mühsam erhob und das Fass auf seinen Zustand prüfte. Plötzlich sauste die behandschuhte Hand des Aufsehers mehrere Male in das Gesicht, auf die Schultern und die Brust des alten Mannes.
Mit einem kurzen entsetzten Aufschrei raffte Toni ihren Rock in die Höhe und lief auf die vier Männer zu. „Aufhören, sofort aufhören!“, rief sie erst in Deutsch, dann besann sie sich und wiederholte ihre Aufforderung in Französisch. Drei Augenpaare starrten sie verwundert an, während der schwarze Mann geduckt und gedemütigt stehen blieb.
„Wie können Sie sich erdreisten, diesen Mann für etwas zu bestrafen, wofür er nicht einmal etwas kann?“ Toni blickte den Aufseher wütend an. „Er wurde angerempelt. Ihn trifft keine Schuld“, stieß sie aus, und als sie die wütend zusammengezogenen Augenbrauen ihres Gegenübers entdeckte, fügte sie schnell noch ein etwas höflicheres „Monsieur“ hinzu.
„Aber er war es, der das Fass hat fallen lassen, Mademoiselle“, kam die scheinbar logische, nicht eben freundliche Antwort.
„Wenn er aber doch nichts dafür konnte, Monsieur. Diesen Mann hier schlagen Sie doch auch nicht, dabei hat er ihn angerempelt.“
„Monsieur Deux schlagen?“ Der Mann lachte, drehte sich um und sah zu, wie dem Sklaven das unbeschädigte Fass erneut aufgeladen wurde.
Toni wandte sich dem jungen Mann zu, den der Aufseher Monsieur Deux genannt hatte. „Warum haben Sie dem armen Mann nicht geholfen? Warum haben Sie nicht gesagt, dass es Ihre und nicht seine Schuld war?“
Monsieur Deux lächelte seinen Begleiter an und wandte sich wieder dem aufgeregten Mädchen vor sich zu. „Es würde keinen Unterschied machen, kleine Mademoiselle. Dieser Schwarze ist und bleibt der Schuldige.“
„Weshalb?“
„Weil das in New Orleans nun einmal so ist.“
Toni bekam große Augen. Genau diese Worte hatte sie sich auf dem Schiff so viele Male anhören müssen, wenn sie sich nach den Sklaven oder den Menschen aus dem Unterdeck erkundigt hatte. Verwirrt schüttelte sie den Kopf und wandte sich ab, um zu ihren Begleiterinnen zurückzukehren, die sie inzwischen vermissten und riefen.
„Sie dürfen sich nicht einfach entfernen, MademoiselleAntoinette“, rügte Mademoiselle Claire sie sichtlich ungehalten.
Marie nahm die Stoffmassen ihres Kleides ein wenig beiseite und ging vor dem Mädchen in die Hocke. „Was haben Sie dort getan?“
„Der schwarze Mann wurde ungerecht behandelt, und die anderen Männer sagen, sie dürften das, weil das hier so üblich sei. Dabei hat mich meine Mama gelehrt, dass in Gottes Augen alle Menschen gleich viel wert sind.“
„In Gottes Augen wohl, MademoiselleAntoinette. Doch die Menschen machen da Unterschiede.“
„Aber ist es denn nicht unsere Aufgabe, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen?“
„Das ist es, MademoiselleAntoinette. Und das sollten Sie nie vergessen.“ Marie erhob sich, nahm das Mädchen an der Hand und führte es zu dem Fahrzeug. Der Chauffeur öffnete ihnen die Kutschentür.
Als Toni sich in das weiche, blaue Polster fallen ließ, hörte sie zum ersten Mal die Turmglocken der Kathedrale von St. Louis schlagen. Sie war in New Orleans angekommen.
* * *
Der Wind peitschte den Regen unbarmherzig durch die Häuserschluchten. Die Wassermassen fielen so dicht, dass der Montmartre nicht mehr zu erkennen war. Die Straßen von Paris waren ungewohnt leer.
Der bärtige Mann zog sich seinen Hut noch ein wenig tiefer ins Gesicht und versuchte erfolglos, sich unter einem der Bäume vor dem schräg herniederprasselnden Regen zu schützen. Fluchend schob er die Hände in die Taschen seines Jacketts, und er fragte sich, wo sein Informant nur steckte. Immerhin waren sie vor mehr als einer Viertelstunde hier verabredet gewesen. Ungehalten und frierend stampfte er mit den Füßen auf und wagte einen weiteren Blick an dem Stamm vorbei in Richtung der Treppen.
Tatsächlich näherte sich dort nun eine dunkle Gestalt, die die Schultern weit nach oben gezogen hatte und den Kopf notdürftig mit dem hochgeklappten Mantelkragen zu schützen versuchte. Unschlüssig blieb der schmächtige Mann stehen und sah sich um. Schließlich zuckte er mit den Schultern und wollte sich wieder den Treppen zuwenden, sodass dem Bärtigen nichts anderes übrig blieb, als aus dem relativen Schutz des Baumes hervorzutreten.
Der jüngere Mann zuckte zusammen, erkannte ihn schließlich und eilte herbei. „Ich habe Sie erst gar nicht gesehen, Monsieur.“
„Du bist verdammt spät.“
„Ich dachte, ich würde noch etwas mehr erfahren, doch der Mann war ein Wichtigtuer und wusste im Grunde nichts.“
„Was hast du also erfahren?“
„Sie hatten recht. Das Mädchen wurde vor dreieinhalb Monaten von Deutschland hierher zu seinen Großeltern gebracht.“
Der Ältere schüttelte verwundert den Kopf. „Dann müssen sie das Kind sofort nach dem Tod der Eltern fortgeschafft haben.“
Sein Gesprächspartner zog unwissend die Schultern nach oben.
„Sie ist also bei den de la Rivières?“
„Tut mir leid, Monsieur. Das weiß ich nicht sicher. Man munkelt, sie sei schon wieder abgereist, aber offensichtlich weiß niemand etwas Genaues.“
„Abgereist? Wohin? Warum?“
„Wie gesagt, es ist nur ein Gerücht. Auf jeden Fall hat niemand der Bediensteten im Bekanntenkreis der de la Rivières dieses Mädchen je zu Gesicht bekommen. Das muss jedoch nichts heißen. Immerhin gehen die beiden Alten nicht mehr viel aus und möglicherweise ist das Kind krank oder sehr verstört und wird nicht unter die Leute gebracht.“