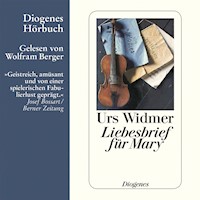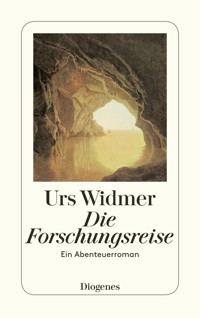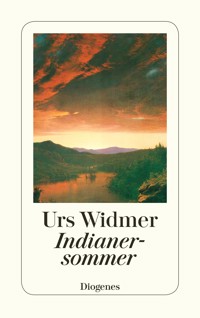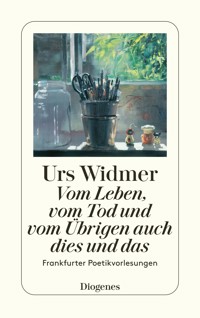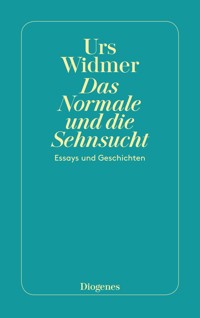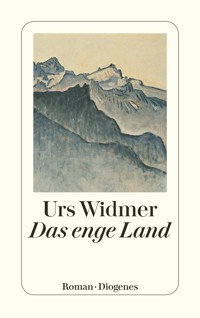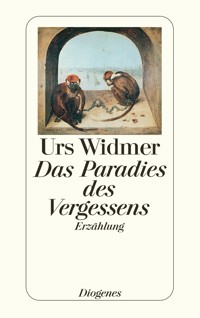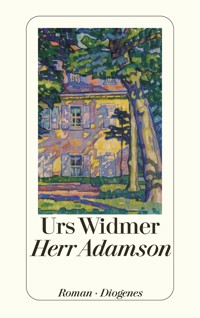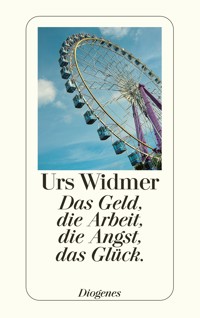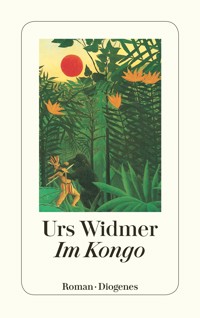
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Altenpfleger Kuno erhält einen neuen Gast: seinen Vater. Kuno glaubte immer, sein Vater sei ein Langweiler, ohne Schicksal und ohne Geschichte – bis er mit einemmal merkt, daß dieser im Zweiten Weltkrieg einst Kopf und Kragen riskiert hat. Sein greiser Vater hat ein Schicksal, und was für eins! Eine Reise in die eigenen Abgründe beginnt, in deren Verlauf es Kuno bis in den tiefsten Kongo verschlägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Urs Widmer
Im Kongo
Roman
Die Erstausgabe erschien
2009 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
Henri Rousseau, ›Paysage exotique avec un
gorille attaquant un indien‹, 1910 (Ausschnitt)
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23010 9 (8.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60580 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Norina Häberli gewidmet – und dem Andenken von Emil Häberli (1902–1984)
[7] I
[9] HINTER DEM HAUS, das mein Vater ein Leben lang bewohnt hatte und das er nun, um in meine Obhut zu kommen, als letzter verließ – meine Mutter war vor Jahren schon gestorben, und die Schwestern, die kleine und die große, leben längst mit Männern und Kindern –, hinter diesem wunderbaren, nun für immer verlorenen Haus war ein Wald: so groß, daß man, wußte man nur den Weg, von der Landesgrenze bis zu unserer Tür gehen konnte, ohne ihn zu verlassen. Bäume, nur Bäume, und keiner, der einen sah. Hie und da eine Wiese mit einem fernen Bauernhof, das ja!, die Lichter eines schlafenden Dorfs, ein paar Kühe, an denen man vorbeischlich, oder eine verlassene Landstraße, die man geduckt querte: sonst nur wegloses Unterholz, vom Ufer des Rheins bis zur Rückwand, die von Knöterich zugewuchert war. Es war ein langer Weg – mehr als fünfzig Kilometer; das Haus stand und steht in Witikon, hoch über der Stadt Zürich –, aber ein kraftvoller Mann konnte ihn gehen. Ich bin ihn gegangen. Im Sommer war der Rhein ein grüner Strom, im Winter war er schwarz, im Frühling braun und voller Eisschollen. Drüben war Deutschland. Denen, die – damals, meine ich – bei Neumond in schmalen Kähnen bei uns landeten oder im Mondlicht über das Eis sprangen, sah man nicht an, ob sie zum Morden kamen, oder ob sie vor dem Getötetwerden flohen.
Jener Wald stieg gleich an seinem Rand so steil an, daß ich, wenn ich auf einem gewundenen Pfad nach oben kletterte, mich an Wurzeln und Ästen festhalten mußte. Ich war ein Kind und konnte meine Haltegriffe kaum umfassen. Wenn es regnete, strömten Sturzfluten am Haus [10] vorbei. Aber immer schien die Sonne! Stets leuchtete der Wald. Kuckucke riefen, andere Vögel: Amseln, Pirole, Stieglitze. Auch eine Nachtigall sang. Wenn ich die Hintertür öffnete und einen Schritt tat, stand ich zwischen himmelhohen Stämmen. Efeu umschlang manche so, daß sie erstickten und tot aufrecht gehalten wurden, bis sie sich – in einem Sturm vielleicht – zur Seite neigten und zwischen wilde Reben, Brombeeren und Disteln stürzten. Geräusche lockten, ein Krächzen, ein Knacken, Jaulen. Drei, vier Schritte bergauf, und ich sah das Haus nicht mehr. Alte Sagen – oder solche der Familie – berichteten, daß viele schon, Kinder vor allem, Tage und Jahre durch den ewigen Wald geirrt seien, bis sie, erschöpft, nicht mehr weiterkonnten und selber zu einem Baum wurden. Einige der Baumriesen seien einmal solche wie ich gewesen. Hüpfende Winzlinge. Dennoch brach ich laut singend durch Gestrüppe und schlurfte durch Anemonen. Wenn ich zurückschaute: eine Rinne in den weißen Blüten. Tiere raschelten im Laub, Mäuse vielleicht, oder Wiesel. In den Steinen des Waldrands: Eidechsen. In einer Waldlichtung, die nur ich kannte, wohnten Zwerge, oder Gnome, tanzten und brachten mir, ihrem Häuptling, Geschenke, Zaubermittel, mit denen ich mich in einen Giganten verwandeln konnte, dessen Haupt die höchsten Wipfel überragte. Sie sangen so furchterregende Lieder, daß alle erschauerten, die sie hörten – nur ich nicht, denn ich hatte diese Gesänge erfunden.
Irgendwo, hinter einem Stamm verborgen, rief mich meine Mutter, und ich, der sie nicht sah, tappte in die Richtung ihrer Stimme. Stolperte über eine Wurzel und [11] kollerte bergab. Ich brüllte, aber der Waldboden roch so kühl, daß ich die Nase im Moos behielt. Natürlich wurde ich getröstet. »So, geht’s wieder, mein Held?« Nichts tat meine Mutter ohne mich. Ich rannte hinter ihr drein, den steilen Weg hinunter. Der Hund war auch irgendwo. »Wann gibt es Essen?« Ohne sich umzudrehen, antwortete sie: »Bald, mein Schatz. Bald.« Ich fegte ins Haus, wo die große Schwester, die kleine Schwester und der Vater am Tisch saßen. Auch Herr Harder, der Gärtner, war da. Wir aßen.
ICH WURDE ERWACHSEN und gab die Hoffnung auf, je noch einmal so einen Wald zu sehen. Der von einst war zu einem Nutzwald voller Forststraßen geschrumpft. Baumsägen überall, stets. Der Lärm der Autos. Und doch! Jetzt bin ich wieder zwischen Bäumen, unendlich vielen Bäumen, und sie sind schöner als einst. Baumungetüme, wohin ich schaue. Wilde Reben bilden bühnenbreite Vorhänge. Wasserfälle tosen. Manche Bäume sind so gewaltig, daß in ihren Kronen eigene Wälder wuchern. Tiere huschen. Andere springen von Ast zu Ast. Vögel flattern auf. Schreie.
Vor einem Jahr bin ich auf einer Graspiste, dort drüben, aus einem Flugzeug gestiegen, in dem, vom Piloten abgesehen, nur Kisten voller leerer Flaschen und ein paar Säcke gewesen waren. Eine Gluthitze! Es war Hochsommer wie jetzt wieder. Vielleicht deshalb – Jahrestag! – habe ich heute den Laptop, der eigentlich in die Buchhaltung gehört, in den Wald mitgenommen. Ein handliches Kästchen aus Kunststoff. Ich fülle den Bildschirm mit Buchstaben und schaue zu, wie sie im Gedächtnis der Maschine [12] verschwinden. Weg, mein Text. Ich, Sekunden später, könnte nicht mehr sagen, was er war; aber die Maschine merkt sich sogar Tippfehler. Eine Anzeige weiß, daß ich, obwohl ich doch noch gar nicht begonnen habe, bereits 4971 Zeichen gespeichert habe. 5001 jetzt. Ein unabweisbares und übermächtiges Gefühl – Dankbarkeit, und mehr – sagt mir, daß ich mich heute gewaltig anstrengen muß, ähnlich heftig wie die Götter, die mich hierhergeführt haben. Eben weil eine Art Gedenktag ist. Ich bin es ihnen schuldig. Was mir geschehen ist, geschieht nicht jedem. Einem auf eine Million vielleicht, optimistisch geschätzt. Wer weiß es denn, vielleicht waren es ja tatsächlich meine Gnome von einst. Geister sieht man nicht. – Es kann im übrigen durchaus sein, daß die, die mich hier ausgesetzt haben, von mir erwarten, daß ich ihnen mein Dankopfer auf ihre Weise darbringe. Daß ich mit meinem Blut auf Baumrinde schreibe, im Vollmondlicht, oder den Text mit einem Stichel in meine Haut einritze. Solche wie sie haben so Traditionen, und sie haben keine Körper, die schmerzen. – Immerhin will ich nichts essen, bis ich fertig bin. Drei Tage sollten mir genügen. Schreiben und Fasten. Wenn ich keine Pausen mache – höchstens für einen Schluck Wasser, und für die Notdurft –, sollte ich es in zweiundsiebzig Stunden schaffen, mich aus dem fernen Damals ins Jetzt vorzuschreiben. Ich freue mich auf die heilige Sekunde – vielleicht schreibe ich all das nur ihretwegen –, da ich mit unsicher gewordenen Fingern in meine Tasten tippen werde, daß ich am Ende sei. Daß mir der Hintern weh tue und ich einen schrecklichen Hunger hätte: und gleichzeitig tut mir der Hintern weh, und ich habe einen [13] schrecklichen Hunger. Erinnerung und Leben werden für den Hauch eines kostbaren Augenblicks eins sein. Danach ist eigentlich egal, wie ich das Werk abschließe. Ich werde finis operis oder so was drunter schreiben, Cunius Cunii filius fecit, und mich, wie ein Löwe aufbrüllend, auf das Brot und das Trockenfleisch stürzen, die jetzt schon, dort drüben, in einem Jutesack an einem Ast hängen. Auch zwei Flaschen Bier stehen bereit.
Was ich dann tun werde, weiß ich nicht. Vielleicht drucke ich das im Laptop Gespeicherte in der Buchhaltung aus. Da steht ein Drucker. Vielleicht schicke ich den Papierhaufen Willy. Vielleicht lege ich den Laptop in den Kühlschrank, ins Tiefkühlfach, für spätere Generationen. Oder ich lese, immer am Jahrestag, meine ausgedruckten Geständnisse, Blatt für Blatt. Trinke Bier dazu. Ich könnte die Papiere auch einzeln den Fluß hinuntertreiben lassen, wie Seerosen. Oder sie anzünden und über die Wipfel der Bäume des Waldes flattern lassen. Feuervögel.
ALLES BEGANN AM 29.Juli 1994. Einem Freitag. Mein Vater hatte eben, um ein Haar, einen Postboten erschossen, und ich kniete auf dem Fußboden eines Zimmers im Altenheim von Fluntern – Fluntern ist ein anderer Stadtteil von Zürich, zehn Autominuten von Witikon entfernt – und sagte zu Herrn Berger, eigentlich nur, um unser zäh dahinplätscherndes Gespräch in Schwung zu halten: »Ich bin jetzt sechsundfünfzig, Herr Berger. Seit meinem einunddreißigsten Lebensjahr arbeite ich hier. Ich bin der beste Pfleger im Haus. Mir kann niemand etwas vormachen, [14] nicht mal Schwester Anne. Und schauen Sie, was ich tue!«
Ich war damit beschäftigt, mit einem Küchenmesser die Kaugummis zu entfernen, die Frau Schroth, die Bewohnerin des Zimmers, in zwanzig Jahren auf den Fußboden gespuckt und flachgetreten hatte. Frau Schroth war am Vorabend gestorben, neunundneunzig Jahre alt. Ich war ja eigentlich Pfleger im Heim, Oberpfleger!, nicht Hauswart, aber so konnte ich das Zimmer einem neuen Bewohner nicht übergeben. Die Putzfrauen, zwei jobbende Studentinnen aus den USA, hatten den Dreck von zwei Jahrzehnten in einer knappen Viertelstunde weggefegt, mit so viel Chemie, als wollten sie Vietnam ein zweites Mal entlauben, und Schwester Anne hatte das Zimmer abgenommen, ohne eine Sekunde zu zögern. Trotz den Flecken, die den grünen Linoleumboden wie eine Blumenwiese im Mai aussehen ließen.
Normalerweise wären die Kaugummis auch mir egal gewesen, aber in dieses Zimmer sollte an diesem Abend noch mein Vater einziehen, mein eigener Papa. Eben wegen dem Schuß auf den Postmann. Es war aus mit dem Haus am Wald. Seinen Lebensrest mußte er, ob er wollte oder nicht, mit mir verbringen, mit einem Altenpfleger, der sein Sohn war. Er war inzwischen einundachtzig. Bis vor wenigen Wochen war alles gutgegangen – er allein in dem einsamen Haus, in dem einmal in der Woche eine Mitarbeiterin der Pro Senectute nach dem Rechten sah –, aber dann hatte er damit begonnen, Treppen hinunterzustürzen und in falsche Straßenbahnen einzusteigen. Er weigerte sich, einen kaum zigarettenschachtelgroßen Alarm [15] umzuschnallen, mit dem er, solange er bei Bewußtsein war, in jeder noch so mißlichen Lage Hilfe holen konnte. Er mußte nur auf eine Taste drücken, und schon piepste es in meiner Jackentasche. Einmal tat es das auch – ich war gerade dabei, Frau Schroth ihre Vitamintabletten zu geben –, und ich raste wie ein Wahnsinniger, bebend vor Angst, nach Witikon, toste den steilen Weg durch den Garten hinauf, klingelte und klingelte und hob gerade die Axt, um die Tür einzuschlagen, als sie aufging und mein Vater vor mir stand, mit einem Müllsack in der Hand. Er hatte mich nicht gehört und starrte auf die über ihm schwebende Axt. Es stellte sich heraus, daß der Alarm auf dem Küchentisch lag, unter einer Pfanne voller Kartoffeln, die auf die Taste drückte.
Daß er allerdings noch an diesem Abend kam, kommen mußte, hing mit dem beinah toten Postboten zusammen. Er war, an jenem Freitagmorgen eben, damit beschäftigt gewesen, seine Ordonnanzpistole zu reinigen, ein Monstrum aus dem Zweiten Weltkrieg, das aus irgendeinem Grund nach der Demobilisation den Rückweg ins Arsenal nicht gefunden hatte. Das war ein geheimnisvolles Ritual, dem er sich alle paar Monate unterwarf. Und obwohl die Waffe seit dem 8.Mai 1945 ungeladen war, löste sich ein Schuß, und die Kugel blieb in einem Paket stecken, das der Postbote, der dem alten Herrn wie jeden Tag die ganze Post die Treppen hochschleppte, erschrocken vor seine Brust hob, als er die Mündung auf sich gerichtet sah. Es enthielt ein Katzenfell, das mein Vater bei der Firma Calo Versand AG bestellt hatte, wegen seinem Rheuma. »Hoppla!« rief er.
[16] Der Postbote, ein sonst cooler Jüngling, war so geschockt, daß er die Polizei holte, und die holte mich; und die Lösung, die der Postenchef von Witikon und ich in der Küche fanden – mein Vater saß mit uns am Tisch –, bestand darin, daß der Vater sofort und unverzüglich in mein Pflegeheim kam. Unter meine Aufsicht. Ich rief, noch von Witikon aus, die Heimleitung an und erreichte, daß er auf der Warteliste vom Platz 112 auf die Eins vorgezogen wurde. Ein Geschenk des Hauses an ihren dienstältesten Mitarbeiter. Der Postenchef, der neben mir stand, drückte mir und dann auch meinem Vater die Hand und verzichtete auf eine Anzeige wegen illegalem Waffenbesitz und versuchtem Mord.
»In diesem Jahrhundert ist noch der letzte Depp bei der Landung in der Normandie mitgerannt oder in Hiroshima umgekommen«, rief ich. »Einzig ich habe kein Schicksal.«
Herr Berger, der das Zimmer nebenan bewohnte, lehnte, ein Bein angewinkelt, das andere fest auf dem Boden, im Türrahmen und sah mir bei meiner Arbeit zu. Ich hob den Kopf. »Schon mein Vater hatte keins.«
»Was?«
»Schicksal.«
»Ach so.«
»Jeden Morgen fuhr er mit dem Acht-Uhr-Bus ins Büro und kam jede Nacht so spät zurück, daß ich längst schlief! Den ganzen Krieg über, so weit ich mich erinnere, und nachher sowieso. Immer trug er einen grauen Anzug und eine einfarbige Krawatte. Dunkelrot oder blau. Im Winter einen ebenfalls grauen Mantel. Einen Hut, auch grau. So wie ich Tag für Tag diese Jeans und ein T-Shirt trage. Ich [17] habe nie etwas erlebt, und ich werde nie etwas erleben. Wie mein Vater.«
»Wäre das so schlimm?« sagte Herr Berger. Er lächelte. Er war auch schon seine Achtzig. Er trug, wie eigentlich immer, einen Anzug aus heller Rohseide, der in den dreißiger Jahren gewiß sehr teuer gewesen war und heute einem Spinnetz glich. Jedenfalls sah ich durch das fadenscheinig gewordene Gewebe der Hosen Flecken seiner roten Boxershorts. Auf dem Kopf trug er einen Panamahut, ein Gespinst auch dieser, und in der Hand hielt er einen Stock mit einem Gummipfropfen. Ich richtete mich auf den Knien auf. »Haben Sie ein Schicksal, Herr Berger?«
»Ich war Kaufmann«, sagte der. »Optische Geräte.«
Ich seufzte. Eine immer noch heiße Spätnachmittagssonne schien durch das Fenster, das die Putzfrauen zu reinigen vergessen hatten. Tote Fliegen, Staub, ein Stück Flügel eines Nachtfalters. Jenseits des Sees wetterleuchtete es. Eine einzige hohe Wolke stand am blauen Himmel. Die Luft war bewegungslos. Schweißbäche rannen mir über das Gesicht. Auch Herr Berger fächelte sich mit einer Hand Kühlung zu.
»Für wen schrubben Sie denn so besessen?« fragte er.
»Für meinen Vater. Sie werden ihn mögen.«
»Ich habe Frau Schroth überlebt«, sagte Herr Berger. »Schlimmer als sie kann er nicht sein.«
(ÜBRIGENS, IN KLAMMERN nur: Schwester Anne war meine Vorgesetzte, verantwortlich für das erste Stockwerk. Sie war strikt und bestimmt, das schon, aber sie war [18] keiner dieser Drachen wie etwa Schwester Helga vom zweiten Stock, sondern hatte eine sanfte Stimme und war hübsch. Atemberaubend schön, um die Wahrheit zu sagen, wenig mehr als dreißig Jahre alt, groß, ziemlich viel größer als ich zum Beispiel. Lange blonde Haare. Runde Augen. Alle, auch die ältesten Heimbewohner – gerade diese! –, sahen ihr mit offenem Mund nach, wenn sie durch die Korridore ging. Keiner, der nicht in sie verliebt war. Sogar die Frauen waren von ihr hingerissen. Vor Jahren einmal hatte ich mir ein Herz gefaßt – wir waren dabei, in der Apotheke die Medikamente zu inventarisieren, nur wir zwei – und gesagt: »Schwester Anne. Ich liebe Sie. Wollen Sie mich heiraten?« Sie stellte eine Schachtel voller Temesta-2,5-mg-Dosen ins Regal, drehte sich langsam um und sagte: »Da können Sie warten, bis Sie schwarz sind.« Wir zählten weiter, als sei nichts gewesen. Am Schluß fehlte eine Morphiumampulle, und wir fingen nochmals von vorn an. Es stellte sich heraus, daß Anne, ich meine, Schwester Anne sie die ganze Zeit über in der Hand gehalten hatte.)
MEIN VATER ARBEITETE im Elektrizitätswerk der Stadt Zürich; ich weiß bis heute nicht genau, wo und was. Seine Arbeit hatte irgendwas mit den Limmatschleusen und den Stauwerken im Einzugsgebiet der Stadt zu tun. Just vor dem Ausbruch des Weltkriegs – das weiß ich als einziges gewiß – hatte er das Alarmdispositiv ausgearbeitet, das die Bewohner Zürichs retten sollte, wenn der Damm des Sihlsees brach, ein damals blitzneues Staubecken in den Voralpen. Zwanzig Minuten, hatte er ausgerechnet, bräuchte die [19] Wasserfront, um sich durchs enge Sihltal zu wälzen, Kühe und Bauern ertränkend, bis sie den Stadtrand erreicht hätte. Wenn der See voll war und ganz auslief, stand das Wasser noch am Bellevue kopfhoch. Er bestückte also die Dächer der Häuser der Gefahrenzone mit Sirenen, die losheulen sollten, wenn der Sicherheitsbeauftragte, ein über dem Damm wohnender Bauer, auf einen Knopf drückte. Der erste Probealarm funktionierte prächtig, außer daß er vergessen hatte, die Bevölkerung zu informieren, und eine Panik auslöste. Alle rannten in Todesangst die Abhänge hoch, bis zu einer genau bezeichneten Höhe, und warteten händeringend, daß die Sintflut ihre Häuser verschlang.
MEINER MUTTER HALF dann kein Sicherheitsdispositiv und kein Probealarm. Auch nicht, daß wir am obersten Ende von Witikon hoch über der Überflutungsgrenze wohnten. Der Krieg war noch längst nicht zu Ende, da war sie schon tot. Es war ein heißer Sonnentag. Ich kam in den Garten gehüpft – fünf Jahre alt –, und sie lag in den Blumen und starrte in den Himmel hinauf. Blut an ihrem Hals. Neben ihr lag Herr Harder, zerfetzt. Ich dachte aber, sie schliefen, und schüttelte sie. Der Hund schnüffelte am Blut herum. Dann lief ich schreiend ins Haus. Da war niemand, kein Vater, kein Mensch. Ich schoß ein bißchen mit meinem Bolzengewehr auf die Klotür. Danach stand ich auf der Terrasse und konnte meinen Blick nicht von den Füßen meiner Mutter wenden, die weit unten – nackt, weiß wie Schnee – aus Rittersporn und Malven auf den Gartenweg hinausragten. Der Hund, wie eine Statue. [20] Endlich kam mein Vater, in einer Armeeuniform seltsamerweise. Ich erkannte ihn kaum, diesen Offizier mit seiner Mütze voller goldener Streifen, der mit gläserner Stimme einen ganzen Trupp Männer herumkommandierte. Sie stampften mit Meßbändern durch die Lauchbeete und zertraten Tomaten und Kürbisse, fotografierten mit Apparaten, die auf langbeinigen Stativen standen, und trugen die beiden Toten endlich in ein Auto. Die große und die kleine Schwester waren jetzt auch da. Das Auto fuhr los. Der Vater sah ihm bewegungslos nach, mit Augen, die Steine waren. Dann faßte er den Hund am Halsband, hob ihn hoch, ließ ihn wieder fallen, ging ins Haus, zog die Uniform aus, setzte sich an den Basteltisch und schnitzte, ohne ein Wort zu sagen, die ganze Nacht hindurch Kasperpuppen: einen Kasper, einen Polizisten, ein Krokodil, eine Prinzessin. Hatte er auch die Kleider genäht? Im Morgengrauen jedenfalls beugte er sich über mich – dachte, ich schliefe –, flüsterte: »Der ist für dich allein, Zwerg!«, und legte einen Zauberer mit einer langen Nase und einem Spitzhut auf meine Brust. Später verfertigte er noch einen Hitler und einen General Guisan, dem die Nase abbrach, als wir einmal eine Aufführung für die Kinder aus dem Dorf veranstalteten und er sich mit dem Krokodil balgte. – Bald ging der Vater wieder mit dem Morgenbus ins Büro und kam spät in der Nacht heim. Die große Schwester wurde die Mutter von uns allen und kochte. Wenn ich sie fragte, wann es zu essen gebe, antwortete sie: »Bald, du Esel. Bald.«
[21] DIE EINGEBORENEN DES Kongo wissen so sehr, daß die Menschen zum Leid geboren sind, daß sie nicht darauf achten. Es nicht erkennen. Sie wissen nicht, was Leid ist. Sie kennen kein Wort dafür. Für uns sind sie grausam, nur für uns. Ihnen ist das Töten selbstverständlich, das jähe Umkommen. Wenn sie die Abenddämmerung, wenn sie das Morgengrauen erleben, dann nur, weil die Waldgötter, weil die Teufel des Dschungels sie übersehen haben. Nicht beachtet für einen Tag. Sie kennen keine Dämonen, die lieben; es gibt sie auch nicht. Fühllos gehen sie über die Leichen, die die Opfer der Höheren wurden. Nachbarn, Verwandte. Sie sind wie die Tiere ihrer Wälder. Tragen den Tod in sich, wissen nichts von ihm. – Das ganze Land, das Herz Afrikas, ist Wald. Grün, feucht, ewig. Du kannst dich jahrelang mit dem Buschmesser vorwärts hauen, du bist immer noch im Wald. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt keine Erinnerung, es gibt keine Zukunft. Die Gegenwart ist bewußtlos. Bäume, Bäume, himmelhoch. Lianen, sich schlingend. In ihnen mag ein Raubtier verborgen sein. Im Gras eine Schlange. Wenn du, keuchend vor Anstrengung, am Abend deine Hütte erreichst: das ist dein Glück. Du hast auch kein Wort für Glück. Bist ahnungslos. In den Nächten des Vollmonds opferst du den Mächtigen Früchte; an den ganz heiligen Tagen, von denen nur die maskentragenden Zauberer wissen, den Vater. Ein Kind. Ach nein: du bist es, den die Magier zum Opferplatz schleppen. Während du dich wehrst, dir das Leben zu erflehen versuchst, dich ergibst, erkennst du sie unter den Masken: den Nachbarn, den Freund, den Bruder: fremd. – Es ist heiß. Das Wasser ist frisch. Die Frucht ist saftig. Morgen bist du [22] tot. Andere gehen über deinen Kadaver. Hunde verschleppen die Knochen deines Skeletts. Spielen mit ihnen, achtlos, bis ihnen ein Panther ins Genick springt.
NATÜRLICH SPRACH ICH – Herr Berger lächelte immer noch, weil mich das Schicksal so erregte – sofort von Willy. Wie anders! »Oder nehmen Sie meinen Freund Willy«, sagte ich. »Er bestand aus Schicksal!« Ich kniete immer noch. »Der beste Freund, den ich je hatte.« Schweißbäche rannen mir über Stirn und Wangen. »Mit den zwei Fingern seiner rechten Hand konnte er besser pfeifen als ich mit meinen fünfen.«
»Wo hatte er die andern drei gelassen?« sagte Herr Berger und wechselte das Spiel- und das Standbein.
Ich wußte, daß er auf seine heure de l’apéritif wartete, die Stunde des ersten Schlucks, wo er endlich zum Restaurant ›Zur Glocke‹ schlurfen durfte. Da bestellte er einen Campari oder, wenn das Monatsende nahte, ein Glas Rotwein. Die heure war um sechs, und inzwischen war es etwa halb fünf. Die anderthalb Stunden mußte er noch hinter sich bringen. Draußen stoben Schwalben über den Himmel, von Windböen geschüttelt. Die eine Wolke war größer geworden, und schwarz.
»Er hat sie sich abgesprengt«, sagte ich und rammte das Messer so in das Linoleum, daß es zitternd steckenblieb. »Sein Vater hat sie ihm –«
Das Telefon klingelte, im Korridor draußen. Mit Frau Schroth hatte Herr Berger regelrechte Wettläufe veranstaltet, wenn es schellte, und auch jetzt, wo seine Rivalin tot [23] war, rannte er die paar Meter. Hob ab und sagte: »Hier Schwester Anne. Ja, bitte?« Er sprach mit einer lächerlich hohen Fistelstimme, die der Annes in nichts glich.
Er lauschte. »Einen Augenblick!« fistelte er dann, sah den Hörer an, als bete er, hob ihn wieder ans Ohr und sagte mit seiner normalen Stimme: »Ja? Hier Berger.«
Warum tat er das? Er wurde nicht oft angerufen. Hatte zwei Söhne, niemanden sonst. Einer von denen war das jetzt wohl, denn Herr Berger strahlte übers ganze Gesicht. Er wurde regelrecht rotglühend. Vielleicht war’s der Sohn aus Amerika, der einmal im Jahr anrief, bestenfalls. »Was du nicht sagst«, sagte Herr Berger. »Achtzehn Franken für eine Portion Meringue.« Es war wohl doch eher der Sohn, der im Emmental wohnte.
Ich zog das Messer aus dem Linoleum. Ein klaffender Schlitz blieb darin. Ich mochte Herrn Berger. Verglichen mit manchen andern auf der Etage, Frau Zmutt oder Herrn Andermatten zum Beispiel, war er die Liebenswürdigkeit selbst. Gleich bei seinem Eintritt ins Heim, vor etwa fünf Jahren, hatte er mir erklärt, daß ihm schon klar sei, daß hier der Tod herumschleiche. Logisch, so viele Greise auf einem Haufen. Bei ihm allerdings habe sich der Knochenmann in den Finger geschnitten. Er habe es schon einmal versucht, vor einem halben Jahrhundert, mit null Erfolg. Wenn die Sense zische, springe er schneller als der Blitz weg. Er machte es vor. Wir lachten beide.
»So wart doch!« rief er jetzt in die Sprechmuschel des Telefons. »Kurt!«
Dann sah er den Hörer an, ähnlich wie zuvor, nur perplexer. »Hängt einfach auf!« Er tat den Hörer auf die [24] Gabel zurück. Seine Hände zitterten. »Der Kurt. Ich wollte ihm doch nur sagen, daß –« Er ging zum Fenster und öffnete es. Ich reckte mein Gesicht der neuen Luft entgegen, die zwar immer noch glühte, aber wenigstens nicht nach Putzmitteln roch.
»Willy wohnte im Haus gegenüber«, sagte ich zu Herrn Bergers Rücken. »An unserm Waldrand oben gab’s überhaupt nur drei Häuser. Als er in unserm Garten auftauchte, war er vier Jahre alt. Ich drei. Ich hing am Rocksaum meiner Mutter.«
»Ich wollte ihm nur noch sagen«, Herr Berger drehte sich zu mir um, »daß zu meiner Zeit eine Meringue einsachtzig kostete.«
»Wem?«
»Kurt.«
»Ich spreche von Willy!«
Irgend etwas in mir wollte, daß ich brüllte. Die Kaugummis wahrscheinlich, oder eher noch mein Vater, der jeden Augenblick die Treppe hochkommen konnte. Natürlich stänkerte er, kaum war er da, über die Möbel in seinem neuen Zimmer, oder daß die Tapete scheußlich sei. Wenn Herr Berger jetzt etwas gesagt hätte – egal, was –, hätte ich gebrüllt. Aber er sah stumm in den Garten hinunter.
»Von dem Tag an waren Willy und ich unzertrennlich. Wir gingen Hand in Hand in den Kindergarten, und Willy wurde von der Tante in den Arm genommen. In der Schule dann saß ich hinter ihm – er wiederholte eine Klasse, weil das erste Jahr nicht erfolgreich verlaufen war – und flüsterte ihm alles ein, bis er Klassenbester war. Er zündete die Hecke der Nachbarvilla an, und am Abend stand die [25] Polizei vor unsrer Tür. Ich blieb im rutschenden Kies eines Steinbruchs stecken, schrie um mein Leben, weil immer neue Kiesel nachrutschten und mir bald zum Hals reichten; er ging nach Hause. Wir teilten das Pausenbrot, er aß seins und meins. Wir fuhren Tandem, er hinten, ich vorn, und als wir ankamen, strotzte er vor Tatkraft, während ich keuchend ins Gras fiel. Er lieh mir seine Steinschleuder. ›Dort, triffst du das?‹ sagte er und gab mir seinen besten Stein. Ich ließ ihn wegzischen, und tatsächlich krachte er in die Gläser des Wintergartens der Villa. War ich stolz! Und schon kamen alle angerannt: der Gärtner, der Butler, sogar die Herrin des Hauses. Ich hielt immer noch die Schleuder in der Hand. Alles haben wir zusammen getan. Ich liebte ihn wie niemanden sonst. Sogar unser Hund, Ero, leckte ihn, statt ihn zu beißen. Er hatte einen tollen Vater. Da hätte sich meiner eine Scheibe abschneiden können.«
»Ist Ihr Herr Vater auch so laut?« fragte Herr Berger.
»Ich spreche von Willys Vater!« Endlich brüllte ich, so heftig, daß Herr Berger beide Arme hochhob. Ich schluckte und fuhr viel leiser fort: »Der war Violinist im Tonhalle-Orchester. Zweite Geige. Er wollte seinem Sohn, als der noch ganz klein war, die Wirkung von irgendwelchem Sprengstoff zeigen – Dynamit oder Schwarzpulver oder beides vermischt –, und sie kauerten also beide verzückt vor einer Nescafé-Büchse, der kleine Willy und der göttliche Papa, Zündschnüre montierend, verrückt!, und natürlich explodierte die Büchse und riß Willy drei Finger der rechten, dem Vater drei Finger der linken Hand weg. Wahnsinn. Es hat beiden nichts ausgemacht. Nichts! Sie waren heiter wie zuvor!«
[26] Herr Berger nickte.
»Für den Vater war es natürlich aus mit dem Spielen im Orchester.« Ich mußte lachen. »Ihm waren der Daumen und der Zeigefinger geblieben, und da der Daumen das Griffbrett stützen mußte, hatte er gerade noch einen Finger, um die Saiten zu drücken. Es ist nicht zu glauben, aber er spielte weiterhin jeden Tag. Wir hörten ihn durchs Fenster. Von ihm selbst arrangierte Stücke. Die Frühlingssonate von Beethoven zum Beispiel. Klang irgendwie modern, zum Weinen verzweifelt.«
»Hm«, sagte Herr Berger.
»Der Lebenstraum der Mutter war, eine Sängerin zu werden. Sie wurde aber keine. Den ganzen Tag hörten wir sie, wie sie Koloraturen trällerte. Und manchmal die Arie der Königin der Nacht. Willy erbte die Talente seiner Eltern. Er verwandelte noch den fadesten Tag in ein Ereignis. Er ging dann nach Afrika, Willy. In den Kongo, wo die Schwarzen am schwärzesten sind.«
Herr Berger ließ jetzt ein Bein zum Fenster hinaushängen und sah zum Himmel hoch. Wolken türmten sich. Donner grollte. Er holte seine Taschenuhr hervor und hielt sie ans Ohr.
»Zu meiner Zeit sagten wir Neger«, murmelte er. »Nicht Schwarzer.«
Ich war jetzt schon beinah wieder guter Laune. Versöhnt. Sollte er doch kommen, mein hirnweicher Papa, und herumschimpfen. Vielleicht kam er immerhin mit Herrn Berger aus. »Als Willy nach Afrika ging«, fügte ich an und seufzte oder lächelte, »nahm er die Frau mit, die ich liebte. Die erste und einzige, damals.«
[27] »Wie hieß die?«
»Sophie.«
»Sophie. Ein schöner Name.«
»Ich habe nie mehr von ihr gehört. Von Willy auch nicht.«
SOPHIE UND WILLY: Heute, natürlich, zerreißt es mir das Herz nicht mehr, wenn ich an sie denke. Nach all dem, was inzwischen geschehen ist. Aber früher! Vor einem Jahr noch, als ich mit Herrn Berger sprach! Wie Sophie, die in der Nacht bei mir gewesen war, mit einem toten Gesicht neben Willy im Taxi saß! Das ist jetzt siebenunddreißig Jahre her! Wir waren fast noch Kinder! Und trotzdem, Tag und Nacht fiel es mir ein. Sie trug ein weißes Kleid, Sophie, und am linken Fuß eine Sandale. Der rechte war nackt. Zwischen ihr und Willy, der als Afrikaforscher verkleidet war, saß eine Albinodogge. Sie geiferte, hatte rote Augen und war Willys Liebling. Ein Mördervieh. Es war früher Morgen. Tau auf allen Gräsern. Vögel lärmten, und die Sonne glühte über den Bäumen des Waldes. Ich stand da, mit Sophies anderer Sandale in der Hand. Willy, der ein blaues, nein, ein fast schon schwarzes Auge hatte, rief dem Fahrer zu, er solle losfahren. »Worauf warten Sie noch?!« Ich rannte, so wie ich war, zum startenden Taxi hin und schlug mir, als ich die Sandale durchs offene Fenster warf, die Hand so heftig am Metallrahmen an, daß ich dachte, alle Finger seien weg. Ein wahnsinniger Schmerz. Willy drehte sich nach mir um. Der Hund bellte. Sophie saß bewegungslos. Ich stand da, die Hand über dem Kopf, ohne [28] zu winken. Das Taxi bog um die Kurve beim Waldknick vorn. In der Sonne leuchtete Sophies Gesicht rot, obwohl es eben noch kreideweiß gewesen war.
So. JETZT HABE ich alle beisammen, die mich hierhergebracht haben. Bis auf einen. Dieser eine stand neben mir, als Willy und Sophie mich für immer verließen. Er trug einen dunkelroten Bademantel, schwenkte ein Taschentuch und rief: »Sind sie nicht prächtig, die zwei?« Er brach in ein Gelächter aus, verstummte ebenso plötzlich wieder, musterte mich von oben bis unten und sagte: »Wie sehen Sie denn aus?«
Ich hob die Schultern. »Ich komme direkt aus dem Bett«, sagte ich. »Und ich bin in die Brombeeren gestürzt.«