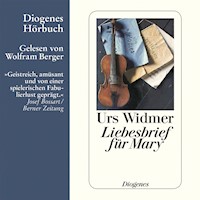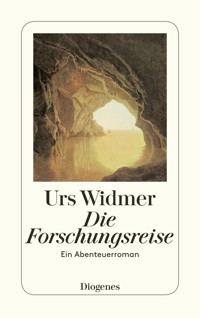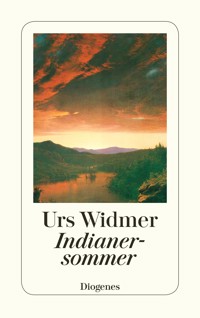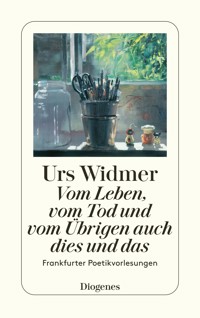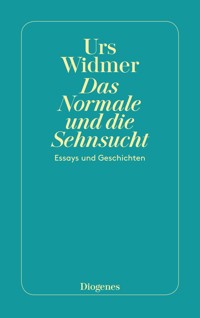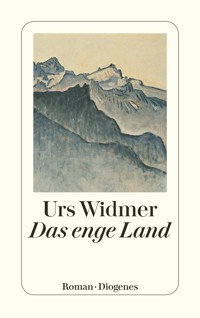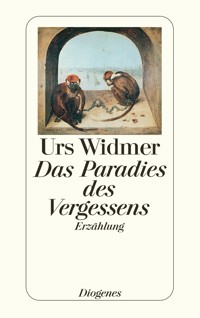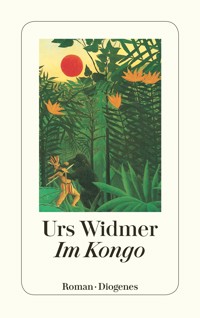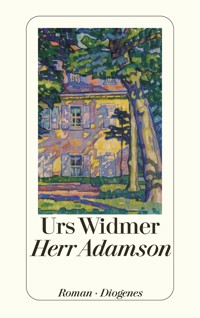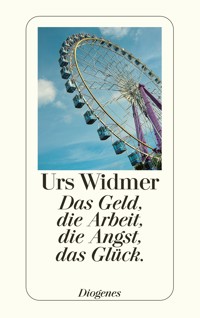22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wirklich berühmt wurde Urs Widmer mit seinem Spätwerk: ›Der blaue Siphon‹, ›Der Geliebte der Mutter‹ oder ›Das Buch des Vaters‹ finden auch heute noch viele begeisterte Leserinnen und Leser. Aber da ist viel mehr, wie beim berühmten Eisberg schlummert auch beim Zeitzeugen Urs Widmer vieles unter der Oberfläche und wartet auf Erkundung. Seine frühen Erzählungen sind der beste Anfang: anarchische Freude daran, das Gebälk der Literatur knarzen zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Urs Widmer
Wild Herbeigesehntes
Frühe Erzählungen
Diogenes
Urs Widmer hat mit Sprache gelebt wie kaum ein anderer. Zuspitzung und Übertreibung waren für ihn Mittel, aufzuzeigen, was ihm nahe ging. Dafür hat er Alltagssprache und Zeitgeist literarisch verarbeitet. Das beinhaltet auch den alltäglichen Rassismus, der ihm begegnet ist. So findet sich in den Erzählungen »Die Amsel im Regen im Garten«, »Gespräch mit meinem Kind über das Treiben der Nazis im Wald« und »Liebesnacht« das N-Wort, es zu streichen, hieße, den Autor in unangemessener Weise zu verfälschen.
Das Normale und die Sehnsucht
a)
Ist es eine Binsenwahrheit zu sagen, dass das, was normal ist, eine Abmachung ist? Hilft es uns etwas, zu wissen, dass in andern Gesellschaften, zu andern Zeiten, das, was für uns unverrückbar aussieht, zu den undenkbaren Dingen gehört? In welchem Maß ist die Wirklichkeit das, was wir denken, es sei die Wirklichkeit? Wie reagieren wir darauf, dass wir, obwohl diese Wirklichkeit wie eine nasse Seife nicht recht zu fassen ist, mit der Notwendigkeit ausgerüstet sind, uns an das Geflecht der Spielregeln anzupassen, das wir bei unserm Erscheinen auf der Welt vorfinden? Ist unsre individuelle Entwicklung nur ein Anpassungsprozess? Wie gern, wie ungern geben wir mehr und mehr die privaten Bedeutungen unserer Kinderwörter zugunsten des gemeinsamen Nenners auf, auf den sich die vielen vor uns schon geeinigt hatten? Ist die Sprache ein Anker, mit dem wir uns in der Außenwelt festhalten? Geben wir mit dem Annehmen von Sprache vor allem auch zu erkennen, dass wir bereit sind, die Realität und deren Spielregeln zu akzeptieren? Sind die elementarsten Gedanken, Sehnsüchte, Gefühle außerhalb der Sprache angesiedelt? Kollidieren die Sehnsüchte mit der Wirklichkeit? Lernen wir nur widerwillig, dass der Lehrer, wenn er »Öffnet die Bücher« sagt, damit ausdrücken will, dass wir die Bücher öffnen sollen? Kränkt es uns, dass wir uns auf Konzepte, die von den vielen andern und jedenfalls nicht von uns kommen, überhaupt einlassen müssen? Geben wir dem Druck von außen nach, weil wir gar keine andere Wahl haben, und verschließen wir uns dann schnell dem Gedanken, dass unsre Autonomie dadurch eine relative geworden ist? Hilft uns die Gesellschaft nur dann beim Überleben, wenn wir uns dafür in unsern Entschlüssen, Gedanken, Gefühlen von ihr beeinflussen lassen? Werden Ideologien als Betrachtungsmodelle einer gesellschaftlichen Wirklichkeit erkannt? Oder erheben sie in der Praxis bald einmal einen Ausschließlichkeitsanspruch? Wollen sie, dass wir sie für die ganze Wirklichkeit halten? Sollen wir, aus welchen Gründen auch immer, weiterhin im Zirkel unserer sieben Gedanken rotieren? Kann die Sprache unversehens zu einem Schutzgitter werden, an das sich die Beteiligten krallen? Bietet ein Sprachsystem, das sich vor die Wirklichkeit schiebt, Vorteile, die die Wirklichkeit nicht haben kann? Ist es, weil diese Sprache statisch, klar und überschaubar ist, während die Wirklichkeit dynamisch, fluktuierend und wenig fassbar bleibt? Soll diese Sprache nicht ein optimales Kommunikationsinstrument sein, sondern vor allem ein Schutz vor den diffusen Manifestationen der Außenwelt? Ist für den Ängstlichen die Ideologie eine Lebenshilfe, weil er sich so sicher in ihr fühlen kann? Kann das Kommunikationssystem zu einer Art Versicherung auf Gegenseitigkeit pervertiert werden, zu einer stillschweigenden Abmachung, dass alles so ist, wie man es sagt? Verursacht jemand, der etwas ›anderes‹ sagt (oder gar tut), deshalb heftige emotionale Reaktionen, weil er demonstriert, dass das ganze mühsam errichtete System der Ordnungen durchbrochen werden kann? Erinnert er daran, dass die Kommunikation zwischen den Menschen zusammenbrechen könnte? Ist das sogenannte Genie wirklich dem Wahnsinn nahe? Spielen sich die Vorstöße in irgendein Neuland (in der Wissenschaft, in der Kunst) in einem Grenzland zwischen dem Wahnsinn in uns und der bewussten, gesicherten Realität ab? Ist es ein Zufall, dass das Konzept der ›Kreativität‹ wie das des ›Genies‹ nicht viel mehr als ein Wort geblieben ist? Schützt das Konzept von den ›Kreativen‹ und ›Genialen‹ nicht vor allem vor der Bedrohung, die von denen auszugehen scheint, denen Veränderungen keine Angst machen? Sind Begriffe wie ›Kreativität‹, ›Genie‹, ›Kunst‹ als eine Abwehr derer entstanden, die Angst vor der Veränderung der Wirklichkeit haben? Unterscheidet sich der sogenannt ›Kreative‹ vom sogenannt ›Normalen‹ vor allem dadurch, dass er dessen Angst vor dem, was unvertraut ist, nicht hat? Ist das mit der bekannten Verwirrung vergleichbar, die man empfinden kann, wenn man vor einer bizarren Erscheinung steht, und mit der Erleichterung, wenn man dann hört, dass sie als Kunst anzusehen sei?
Könnte jeder kreativ arbeiten, der die Angst überwunden hat? Wären das dann Beutezüge irgendwo an der Grenze zwischen dem Sagbaren und dem Unsagbaren? Ist dann für die nächste Generation das, was eben noch ›wie Wahnsinn‹ war, ›normal‹? Oder ist der Begriff der Kreativität in der Praxis unserer Gesellschaft längst zum Gegenteil dessen, was er ursprünglich bedeutete, pervertiert? Meint er nun eine besonders entwickelte Begabung, die schon angelegten Trends zu verlängern? Ist er ein Euphemismus für besonders gute Anpassung an die Konzepte der Leistungsgesellschaft geworden? Wird heute kreativ geheißen, wer die Normen just nicht infrage stellt, sondern innerhalb der Gesellschaftskonzepte die Maschinerie funktionstüchtig erhält, durch einen Handgriff hier, einen Tropfen Öl da?
Spiegelt die Kunst dagegen vor allem die triste Tatsache, dass die menschliche Fantasie und die Wirklichkeit auseinanderklaffen? Entwickelt sie insgeheim die wahnsinnige Hoffnung, den Graben zwischen Wunsch und Realität zuzuschütten: sozusagen die Entfremdung abzuschaffen? Ist die Entfremdung das Thema der Kunst überhaupt, weil allein schon die Tatsache, dass die wie auch immer gearteten Sehnsüchte immer wieder aufgeschrieben werden statt gelebt, ein Hinweis auf den entfremdeten Zustand der Existenz aller ist? Möchte die Kunst, dass die Wirklichkeit sie einholt? Ist es ihr Ziel, sich selber abzuschaffen? Kann Kunst, weil die Realität stärker ist als die Sehnsüchte, nur sozusagen bewusst scheitern, mindestens solange die Spielregeln unserer Gesellschaft dem die größten Erfolge zuerkennen, der, mit welchen Mitteln auch immer, am meisten Dollars, Mark und Franken in sein Sparschwein tut?
Wäre die Sehnsucht erfüllt, wenn das Bild der innern Wirklichkeit mit der äußern zur Deckung gebracht würde? Würden, täten, hätten und könnten wir dann endlich?
b)
Es wäre warm, und da, wo das Grau in das Blau überginge, würden die schroffen Felsenschründe in den Himmel ragen. Über den eisblauen Viertausendern stünde die klirrende Kälte. Was für eine Luft wehte! Welch ein Licht schiene! Die Bergvögel zögen ihre Kreise. Das Stoppelgras knirschte, während die letzten Kühe durch den Raureif stapften. Die Herbstzeitlosen wären vom Wind zerfetzt, das Alpenrosenkraut wäre brandrot, die Arven, die Föhren, die Tannen stünden. Welcher Wind wäre! Was für ein Frost herrschte! Über dem Bergbach läge die erste Eisschicht, die Bretterbrücke wäre eine plötzliche Lebensgefahr. Wie still es wäre! Die uralte Forelle, die unter dem Stein schwömme, dächte, ihr letzter Winter ist da. Die Schwalben hätten die jähe Ahnung, werden wir die ersten Opfer der kommenden Schneestürme sein? Der Saumweg käme aus dem tiefen Tal den kalten Berghang hoch, zur Kapelle, in deren Gitter die Aster steckte, durch den Wald mit den vermoosten Baumstrünken, durchs Tobel, über den Wasserfall, am Schlund vorbei, unterm Bergsturz durch, über die Schwebebrücke, die Felsleiter hinauf, den glitschigen Abgrund entlang, über die Gletscherzunge, durchs Geröll, die steile Hochalpenwiese hinauf. Da wären sie endlich! Sie kämen in ihrer Einerkolonne den Pfad vom Gletschersee herab. Wie kräftig pfiffen sie das Lied! Sie wären noch immer sechs, der mit der blauen Joppe, der Mürrische, der mit der vernarbten Nase, der Dicke, der mit den kräftigen Füßen, der ohne Bart. Wie sängen sie! Zwischen dem Dicken und dem mit den kräftigen Füßen wäre eine Art Lücke. Sie wären klein, sie hätten ihre Bärte, Kappen, Joppen und Schuhe. Wie sie aussähen! Sie würden die Pfade des Gebirges kennen, die da begännen, wo jeglicher menschliche Fuß zurückschaudert. Es gäbe keine Wegmarkierungen da oben. Die Kühe und Ziegen wären ihre Geheimnisse. Sie wüssten, wer das höchstgelegene Kornfeld hätte, in Wirklichkeit. Sie hätten die Hutten auf dem Rücken. Sie hüpften fast, ihre Bergbeine sprängen von Fels zu Fels. Sie hätten das Brennholz gesammelt. Summend kämen sie zum Haus. Wie es dastünde! Wie es aussähe! Es hätte kleine Fenster und kleine Türen, ein Steinplattendach, einen Balkon ohne Geländer, es wäre arvenbraun, schwarze Holzbalken ragten aus den Ecken. Es hätte einen Felskeller, in dem das Trockenfleisch und der Weißwein lagerten. Welch ein Blick über das Tal wäre! Tief unten wäre das Dorf mit den tanzenden Bauern.
Sie beträten das Haus durch die Holzküchentür. Sie stellten ihre Hutten ab, sie holten sich die Flaschen, sie gössen sich jeder ein Glas Rotwein ein. Wie gut er ihnen täte! Sie redeten. Der mit der blauen Joppe hätte eine dunkle Stimme, der Mürrische brummelte, der mit der vernarbten Nase hätte eine Stimme wie ein junges Mädchen, der Dicke lachte beim Reden, der mit den kräftigen Füßen redete durch die Nase. Der ohne Bart spräche leise.
Sie fachten ihr Holzfeuer an. Im kupfernen Kessel über dem Feuer hinge die Polenta. Es röche. Der Dicke wäre der Koch. Die Falter surrten um die Lampe. Sie säßen da und täten Karten spielen, sie lösten Kreuzworträtsel und Rebusse. Wie warm es wäre in der Küche! Wie der Wind draußen heulte! Sie dächten an die Urzeiten. Um ihre Bergschuhe wären Pfützen entstanden. Die Nebelbänke zögen tief unten vorbei. Die Krähen stürzten tot ins Tobel, die Eise bildeten sich, die Felsspalten bärsten, die Lawinen donnerten. Die Sonne näherte sich den Bergkämmen des Horizonts.
Der mit der blauen Joppe säße am Tisch am Fenster. Die Sonne schiene schräg auf sein Gesicht. Er hätte den Wurzelvermouth und die Knoblauchzehe vor sich. Sein Gesicht wäre rosa, sein Bart weiß. Sein Blick ginge aus dem Fenster, auf die Dohlen, auf die Föhren, auf die Schatten der Felsen. Was er dächte! Wie er träumte! Er dächte an den unbekannten Siebenten. Wie sähe er aus! Welch glitzernde Hosen er hätte! Wie groß er wäre! Welche Wörter er sagte! Der mit der dunklen Stimme nähme einen Schluck und einen Biss. Bis hinab zu den Nebelbänken rührte sich nichts. Die Wolken ballten sich dichter. Ja, der Siebente, dächte der mit der blauen Joppe, der stünde in seinem Großstadtzimmer, der hätte ein Hemd, eine Hose und Schuhe, in seinen Geschichten kämen D-Marks und Dollars vor. Aber in seinem Innern wüchse eine Ahnung, nämlich die, das Leben gehe an ihm vorbei, dächte der mit der dunklen Stimme. Er nähme einen Aperitifschluck. Er dächte, es wäre dem Siebenten, ein unsichtbarer Riesenvogel flöge durchs Zimmer, der kalte Hauch streifte sein Gesicht. Mit heftigen Schritten stürzte er hinaus, er packte die Forscherschuhe und den Helm. Schon wäre er am Schiffssteg. Seufzend nähme der mit der blauen Joppe einen Schluck. Sein Blick ginge den Berg hinab. Hinten im Tal, wo die Staumauer wäre, bildeten sich die Regenwolken. Hier wäre noch die letzte Sonne. Der Mürrische und der mit der vernarbten Nase spielten ihre Schachpartie. Die Habichte flögen. Es wäre still. Auf dem Fensterbrett lägen die Versteinerungen und die Kristalle. Es wäre schon etwas, sich einmal einem dieser Vögel an die Beine zu hängen!
Der Wind rüttelte heftig an der Tür. Er heulte. In dem tiefen Tal läge die erste Dämmerung. Die Arven stünden schräg am Hang. Die Schatten der Wolken gingen über den Rübenacker. Der mit der dunklen Stimme nähme noch einen Schluck, diesmal einen heftigen. Welch ein Rumoren! Was für eine heiße Luft!
Da!, riefe er plötzlich. Alle sechs wären sie auf die Holzterrasse gerannt und starrten nach unten. Wie sie sich über die Augen wischten! Was für offene Münder sie hätten! Sie könnten es nicht glauben. Nur mechanisch tränken sie ihre Schlucke und bissen sie in die knoblaucherne Zeh. Ihr Blick hinge an dem, was da käme. Wer mag denn das sein, sagten die sechs zueinander, während sie den schwarzen großen Punkt nicht aus den Augen ließen. Insgeheim dächten sie alle, dass da endlich der Siebente käme.
Wie ihre Herzen klopften! Was für ein Zittern durch sie ginge!
Der Siebente stiege. Seine Beine schmerzten. Er wäre über die entfernte Industrieebene gekommen, über den ersten Berg, über die Steppe, durch das Sandtal, über das Hitzeplateau, den Bergkamm entlang, über den zweiten Berg, an der Wasserstelle vorbei, über den Schilfweg, über den dritten Berg, durch den Hohlweg, über die Schlingpflanzenbrücke, über den vierten Berg, durch den staubenden Kalk, über die Weide, über den fünften Berg, in die Klus, die Eiswand hoch, den Holzwasserleitungen entlang, über den sechsten Berg, über den siebenten Berg, ins Tal hinab, über den Talboden am Dorf mit den Häusern auf den Steinplattenpilzen vorbei, den Saumweg am kalten Berghang hoch, zur Kapelle, durch den Wald mit den vermoosten Baumstrünken, durchs Tobel, über den Wasserfall, am Schlund vorbei, unterm Bergsturz durch, über die Schwebebrücke, die Felsleiter hinauf, den glitschigen Abgrund entlang, über die Gletscherzunge, durchs Geröll, die steile Hochalpenwiese hinauf. Er bliebe schnaufend stehen. Er nähme sich die Kappe vom Kopf und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er sähe durch den Augenschleier am Berghang hoch, die tiefe Sonne blendete ihn, er keuchte und stellte den Rucksack beim stehenden Ausruhen auf einen Felsblock. Wie dünn die Luft wäre! Welche Wolken sein Atem machte! Noch nie wäre er so hoch gekommen. Hier wüchse das kurze dürre Gras, hier sprössen aus den Schneeflecken die kleinen Blumen. Ein eisiger Wind käme von den Bergkämmen herab. Die sechs, die er jetzt hoch oben als kleine schwarze Punkte sähe, schwenkten das Leintuch zur Begrüßung. Er winkte mit der Kappe. Die Dämmerung wäre da. Er sähe das Haus über sich nur noch undeutlich im Abenddunst, aber er erkennte, dass die sechs in gewaltigen leichten Sätzen bergab gerannt kämen. Sie riefen Sätze, die er nicht verstünde. Er bliebe stehen. Da wären sie. Sie lachten alle. Ein Luftzug striche über sie hinweg. Er würfe das Marschgepäck hin und zeigte ihnen die Mitbringsel aus dem Unterland. Sie hätten so etwas noch nie gesehen. Sie gingen los. Ganz automatisch nähme er den Platz zwischen dem Dicken und dem mit den kräftigen Füßen in der Einerkolonne ein, ganz von selbst pfiffe er den Beginn des Lieds. Wie es in ihm rumorte! Wie es klänge, zusammen mit den sechs andern Stimmen! Sie gingen bergauf. Er sähe die Kühe. Er schritte ganz leicht, entgegen jeder Regel lachte und spräche er beim Hochstieg. Wie viel würde ihm einfallen! Er spräche vom Schwimmen, vom Bergsteigen, von den Wettrennen, den Zehenkämpfen, den Holzbetten, dem Eisenbahnfahren, dem Abseilen, den Höhlen etc. Es wäre jetzt dunkel. Was freute er sich auf das Festessen! Er sähe die Kappen vor sich als schwarze Schatten gegen den Sternenhimmel. Er hörte das Geräusch der Lederschuhe. Sie pfiffen nicht mehr, aber sie wären schnell. Er sähe das Licht des Hauses über sich. Dann wäre es verschwunden. Die Farben der Joppen der sechs wären nicht mehr zu erkennen, aber er könnte sie sich vorstellen. Was hätten sie sich zu erzählen! Er sähe die Schatten der Tannen. Sein Fuß stieße an die unsichtbaren Felsbrocken. Die andern machten kaum Geräusche. Sie schwiegen jetzt mit ihren merkwürdigen Stimmen. Auf der Bretterbrücke merkte er, dass unter ihm der Abgrund wäre, aber es ginge gut. Er hörte, dass der Dicke zu dem mit den kräftigen Füßen etwas sagte. Er keuchte, denn sie gingen schneller. Er hielte das Tempo. Wie gesund sie wären! Wie sie sich auskennten in ihren Alpen! Das Eis knirschte unter seinen Nagelschuhen. Er spürte beim Ausglitt die Fäuste des Dicken und dessen mit den kräftigen Füßen unter den Achseln. Die ersten Regentropfen fielen auf sein Gesicht. Er stimmte, für sich, das Lied wieder an. Er bliebe stehen, er keuchte, er blickte sich um. Welch ein Sturm! Welche Kälte! Eis bildete sich an seinen Augenlidern.
Er sähe nichts in der Dunkelheit. Sein Herz stockte. Er sähe ihre Kappen nicht mehr. Er riefe, seine Stimme hallte über die tiefen Täler dahin. Er wäre auf einem Gipfel, mit den Händen spürte er die Gipfelsteine. Er dächte, da seien sie doch eben noch gewesen. Er schrie. Er tappte hin und her. Er suchte nach dem Licht des Hauses, wo sie sein mussten. Es wäre finster. Er rennte bergab. Er fiele in Löcher und Moore, er bräche durch die Schneebrüche, er zerkratzte sich das Gesicht an den Tannenästen. Er schlüge sich das Knie auf beim Purzelbaum. Nicht einmal die Sterne wären zu sehen. Er setzte sich, im dichten Nebel, auf den Stein. Er dächte, im eisigen Regen sitzend, sicher hätten ihnen die Geschenke keine Freude gemacht. Es fiele der erste Hagel. Es wäre zu spät. Wie traurig er wäre! Wie ihm die Tränen in den Bart rönnen! Ach, wenn sie da wären und ihm den Bart kraulten! Die Hagelschläge auf den Kopf schmerzten. Seine Hände wären starr, in den Bergschuhen wäre das Wasser. Der Eisregen dränge durch den Regenschutz. Er zitterte. Es wäre eine Frage von Stunden. Er torkelte. Er stürzte die Schlünde hinab und bräche durchs Unterholz. Er schluchzte. Er wüsste nicht wie, aber er käme ins Tal hinab. Wie hart sie gewesen wären! Wie ihre Augen geglüht hätten!
Es wäre ein rechtes Wunder, dass er dieses Abenteuer überlebte. Niemand verstünde, wie er den Abstieg durch Sturm, Nacht und Nebel geschafft hätte, auch die grölenden Bauern nicht, die über seinen erschöpften Körper am Dorfeingang gestolpert wären. Schlotternd säße er in der Wirtschaft. Die Bauern gäben ihm Tee und Schnaps in den Mund. Es ginge ein bisschen besser. Diese Säue, riefe er. In den trockenen Socken des Wirts säße er am Fenster und sähe am Berghang hoch. Der Mond schiene. Auf den fernen Gipfeln läge ein blaues Licht. Die weintrinkenden Bauern tippten sich mit den Zeigefingern an die Stirn, während sie zuhörten. Da oben, sagten sie, ist das Geröll und das Eis, in das seit Menschengedenken keine Seele den Fuß hineinsetzt. Er hätte einen roten Kopf, vom Schnaps und vom Hochsehen. Ganz hoch oben, im Mondlicht, wäre etwas, was der Rauch von ihrem Haus sein könnte. Er drehte sich um und redete mit seinen Freunden. Sie hätten Stimmen mit rollenden Rs. Er nähme den Wickenstrauß aus der Vase und böte ihn dem dasitzenden jungen Mädchen an, das ihn errötend annähme.
Alois
1
Aus meinem Kamin kommt Rauch, jetzt scheint die Sonne. Mein Haus ist groß und windschief, es ist aus Arvenholz gebaut, es hat rote Ziegel. Mein Rauch steigt senkrecht aus dem Kamin, auf meinem Kirschbaum sitzen Schwalben, bei Föhn sehe ich weit unten die Stadt, jetzt ist Föhn.
Wenn ich von dem Haus nachts übers Meer sehe, bewegen sich Lichter, ich bin aber nicht immer sicher, ob.
Ich komme jetzt mit meinem Paket unter dem Arm über den Kiesweg. Ich gehe ums Haus herum zum Scheunentor, ich stoße das Scheunentor mit dem Fuß auf, mein Haus hat eine Scheune. Mein Haus hat das letzte Schindeldach des Kantons, es ist geschützt. Wenn ich die Fensterläden gelb anmale, muss ich dem Heimatschutz schreiben.
Alois kauert am Boden. Er hämmert mit einem Hammer (ich lege das Paket auf den Tisch) und rollt von einer großen Spule eine Schnur ab. Bomben sehen aus wie Gasflaschen oder Zigarren, sie machen erst Ticktick und dann Schbrounz. Wer in Ballonen nicht rechtzeitig an der Leine zieht, erfriert in der Stratosphäre. Alois füllt jetzt weißes Pulver in den Trichter.
Die Scheune rutscht den Hang hinunter, es muss nur einmal richtig regnen, und die Scheune steht hundert Meter weiter unten. Auf meinem Bücherregal stehen der Gute Kamerad, Schloss Rodriganda, Was fliegt denn da, Große Schweizerschlachten, der Steuermann Ready, das Telefonbuch von Appenzell-Innerrhoden.
Alois nimmt Streichhölzer aus der Tasche. Meine Mutter, sagt er, sagte immer Mäuschen zu mir, komm, Mäuschen, komm, sagte sie, schau dir den schönen Kuchen an, den Frau Meier, unsere Nachbarin aus dem zweiten Stock, gebracht hat. Meine Mutter schnitt den Kuchen, sie schnitt und schnitt, nein, rief ich, nicht so viel, für mich nicht so viel. Mäuschen, sagte meine Mutter, du arbeitest zu viel, und du isst zu wenig.
Es ist gelb, weiß und blau. Es ist daumennagelgroß, aber größer gemeint. Es ist zweidimensional, aber dreidimensional gemeint. Es ist so groß gemeint wie ein Zwölfjähriger oder ein kleiner Vierzehnjähriger. Es ist vielleicht ein Symbol. Es ist am Boden abgestützt, es ist mit zwei Beinen am Boden abgestützt, der Winkel beträgt 90 Grad. Wenn es windet und wenn der Boden abschüssig ist, verändert sich der Winkel.
Es spricht nicht, man hört es nicht, es denkt vielleicht. Es ist nicht rund. Es trägt einen Matrosenanzug und, kein Zweifel, eine Matrosenmütze. Nie würde der Matros so den Stürmen trotzen. Es hat, zwischen Anzug und Mütze, zwei große Augen. Donald Duck. Sogleich habe ich ihn erkannt.
Donald Duck ist korpulent und ein Liebhaber der Ballonfahrkunst, ums Haar wäre er ein Pionier der Aviatik geworden. Donald Duck trägt Schuhe aus rostrotem Saffianleder, noch lieber den Zoccolo, das Schuhwerk Arlecchinos und Cinderellas. Donald Duck, von oben nach unten: Haarfedern, Stirn, Augen, Schnabel, Brusthaare, Nabel, Bauch, Genital, Oberschenkel, Kniescheiben, Unterschenkel, Knöchel, Schwimmhäute. Mit abgespreizten Armen, diese schwenkend, sieht Donald Duck wie Ikarus aus. Es ist schwierig, Donald Duck zu beschreiben. Vielleicht ist sein Name Eugen.
In Bodio hat es immer Rauch.
Eugen: rote Haare und eine rote Stirn, auf der Schweißperlen perlen. Es ist elf Uhr, Eugen kommt, den Rechen geschultert, von der Mahd. Er hat lustig zwinkernde Augen und ein markiges Kinn. Wenn Eugen die Mahd nicht nackt vornimmt, trägt Eugen Krawatten von Annas Onkel Donald, rufen Tick, Trick und Track: Onkel Dagobert.
Onkel Dagobert hat Augen wie Greta Garbo, nur größere. Er schaut Donald innig an.
Leck, sagt Tick oder Trick oder Track. Mich, sagt Trick oder Tick oder Track. Doch, sagt Track oder Tick oder Trick.
Liebe Lady Duck, schreibt Ed Mörike an Grandma Mary Duck: Ich ging im Walde so für mich hin, schbrounzz.
Donald nestelt seine Maske vom Gesicht: er ist Cäptn Hornblower. Er ist auch nicht jünger geworden.
Was für ein Ballon ist eigentlich in deinem Paket, sagt Alois. Ein malvenfarbiger, sage ich. Daniel Düsentrieb sitzt im Bad. Heureka, heureka, heureka, sagt er vor sich hin.
Panzerknacker-Joe lauert hinter dem himmelblauen Stein. Er ist 100 Kilo schwer, er hat den Charakter eines Elefanten und lächelt: höhehihu. Panzerknacker lächeln, wenn sie lächeln, so. Hochstapler lächeln so fein, dass man ihr Lächeln nicht sieht, man kann es erraten, man kann sich auch täuschen. Sie beherrschen den Karateschlag, den sie aber selten applizieren. Totschläger lächeln nicht. Sie sind humorlos. Sie haben überhaupt keine Jugend gehabt. Bankeinbrecher lächeln, wenn sie vor dem Schalterbeamten stehen, das Geld, aber dalli, sagen sie. Schalterbeamte lächeln, wenn sie auf die Alarmklingel treten, mit Schweiß in den Schuhen, denn sie scheuen den Browning. Lüstlinge lächeln, wenn sie das Mädchen, das Christa heißt, im Gebüsch haben. Kindergärtnerinnen lächeln, wenn sie während ihrer Arbeit einen Kindermund notieren.
2
Die weiße Dame stand hinter weißen Vorhängen und starrte in den Garten, sie bemerkte die geringsten Veränderungen, sie sah, wie ich einen Ast vom Kirschbaum brach, dass Schaubs Katze durchs Gras ging, sie sah, wenn das Mondlicht die Schatten veränderte.
Nur wenn die Alarmklingel losging, kam Leben in die weißen Gewänder der weißen Dame, dann rannte sie ans andere Fenster, von dem aus sie ihren eigenen Garten überblickte: Der Gärtner, der wie ein Storch durch den Flieder und die Pfingstrosenbeete stelzte, war an einem Stolperdraht hängen geblieben. Er sah nach oben.
Ich steige auf den Tisch. Die Sonne scheint jetzt ins Zimmer. Alois sieht mir zu.
Der Verkäufer sagte, sage ich, ganz recht der Herr, ich sehe, der Herr ist ein Kenner.
Wie selten sind Herren, die sich noch auskennen. Wir haben achtmal größere Umsätze mit Hundedrecken als mit Ballonen. Jaja, sagte ich, sage ich. Unglaublich. Der Verkäufer sah aus wie Kaiser Franz Joseph nach der Schlacht von Marengo.
Ich packe das Paket aus. Der Ballon ist gelb. Die Zündschnur brennt, nach zwei Seiten. Ich springe vom Tisch, ich renne hin und her und sammle meine Ballone ein, ich stürze hinaus. Du ungebildeter Trampel, ruft Alois.
In Pisa wird jedes Jahr gemessen, ob der Turm schiefer wird. Es gibt verschiedene Vorschläge, den Turm in seiner derzeitigen Schiefe zu konservieren. Man will ihn mit Kranen und Hubschraubern abheben und mit neuen Fundamenten versehen. Man will ihn, mit einem Riesengerüst, einfrieren. Damals wollte jeder Italiener den schiefsten Turm haben.
Gotthelf hieß in Wirklichkeit Bitzius, Johann Christoph Bitzius. Einstein sah aus wie Albert Schweitzer, aber er hatte ein sehr schweres Hirn. Wenn man sich schneller fortbewegt als das Licht, sieht man sich hinter sich selbst herlaufen.
Die Schweiz wurde 1291 gegründet. General Guisan versammelte 1940 die Offiziere auf dem Rütli. Er gab dem Krieg eine entscheidende Wendung. Wilhelm Tell ist eine Legende. Schweden sind auch Schweizer. Königin Astrid ist bei Küssnacht verunglückt. Die Österreicher ertranken, weil sie zu schwere Rüstungen trugen. Mir nach, rief Winkelried, wer ein wacker Herz sein Eigen nennt. Arnold Schick rief: Da, friss eine der Rosen. Baden war das Bordell der Eidgenossenschaft.
Die Ballone fliegen gegen die Stadt hin, ich winke. Jetzt lasse ich den letzten, den gelben, auch los.
Hier fliegt eine Jugendzeit dahin.
Was hast du denn auf dem Kopf, frage ich. Ein Salatsieb, sagt Alois und wirft sich zu Boden. Ich werfe mich auch zu Boden.
Ich habe einmal einem Mädchen, das Martha hieß, einen Roman erzählt, der so ging: Ein Vater findet, sein Sohn muss etwas von der Welt sehen. Der Sohn macht sich auf, er fährt mit der Eisenbahn, er geht durch ein Tal auf ein fernes Gebirge zu, er ist Geologe und sammelt Gräser in eine Büchse. Er kommt zu einem Haus, das ganz mit Rosen zugewachsen ist. Jetzt wirds spannend. Ein alter Mann öffnet die Pforte und sagt: Es wird bald regnen, Gewitter sind keine Seltenheit hier in dieser Region. Der Sohn und der alte Mann gehen in Filzpantoffeln durch das Haus, sie betrachten Steine, auch der alte Mann sammelt Steine. Der Sohn ordnet seine Marmore: Der alte Mann hat ihm neue Horizonte eröffnet. Es gewittert. Der alte Mann ist nervös. Zwei Frauen kommen in einer Kutsche, eine alte und eine junge. Jetzt wirds spannend. Der alte Mann geht mit der alten Frau ums Rosenhaus spazieren, der Sohn mit der jungen. In diesem Park, sagt er, gibt es Bäume, die jahrhundertealt sind. Ich heiße Martha, sagt sie. Die alte und die junge Frau fahren wieder ab. Warum haben Sie so viele Rosen, fragt der Sohn. Der alte Mann wischt sich mit der Hand über die Augen. Sie ordnen ihre Steine ganz neu. Sie fahren mit der Kutsche zur alten und zur jungen Frau, diese sind überrascht. Der alte Mann nimmt die alte Frau an der Hand und sagt: Es ist ein Geheimnis, sie ist meine Frau. Der Sohn schreibt einen Brief nach Hause. Im vierzehnten Kapitel fährt er mit der Eisenbahn wieder nach Hause. Seine Gesteine hat er im Rosenhaus vergessen.
Nichts, nichts, nichts, sagt Alois. Die Zündschnur ist schwarz, die umgestürzte Cognacflasche liegt daneben, der Cognac sieht nicht gut aus.
Aus, sagt Alois, es muss das Pulver sein. Nunu, sage ich. Ich sehe zum Fenster hinaus. Die Tour de Suisse hat sieben Etappen. Die erste führt von Zürich-Oerlikon über Schaffhausen und die Enklave Büsingen nach Herisau. Die Appenzeller sind die kleinsten Leute, sieben Berner gehen auf eine Kuhhaut, aber vierzehn Appenzeller. Am Vorabend werden die Räder plombiert. Im Hof der Sulzer AG stehen die Schulbuben und vergleichen die Bilder im Tip mit den Männern, die in Maßanzügen ihre Rennräder daherschieben, zum Tisch, wo die Offiziellen sitzen: drei Funktionäre des Schweizer Radsportbundes, der Obmann, der Kassier und der Aktuar. Der Obmann raucht einen Stumpen, er zeigt dem Rennfahrer, wo er unterschreiben muss, den Applaus der Schulbuben hört er nicht, nachts träumt er davon, noch einige Nächte lang. Fünfundneunzig Routiers haben sich angemeldet, vierundneunzig haben unterschrieben. Gianni Santarossa kommt nicht, er kommt eine Viertelstunde zu spät. Der Obmann, der Kassier und der Aktuar kennen das Reglement. Aber eine Tour de Suisse ohne Gianni Santarossa ist keine Tour de Suisse, und so lassen sie die Fünf gerade sein. Vor Gianni Santarossa haben sich eingeschrieben: Bruno Ziffioli (I), Rudi Altig (D), Fritz Binggeli (SZ), Aldo Fornara (I), Jacques Anquetil (FR), Jean Starobinsky (FR), Peter Post (HO), Gottfried Weilenmann (SZ), Eddy Merkxz (BE), Petro Santarossa (I), Rik van Steenberghen (BE), Fritz Schär (SZ), ich, Mario Cortesi (SZ), Jan Goldschmit (LX), Jan Jansen (BE), Federico Bahamontes (SP), Paul »leone« Zbinden (SZ), Vittorio Adorni (I). Vittorio Adorni schreibt Vittorio Adorni unter ein Foto von Vittorio Adorni, das ihm ein Schulbub hinhält.
Die zweite Etappe führt durchs Mittelland. Nach Aarau ist die Staffelegg zu nehmen, ich prüfe mit einem trockenen Antritt die Konkurrenz, aber Adorni steigt nach, mit ihm Bahamontes, der spanische Bergkönig, ich insistiere nicht. In dieser Reihenfolge holen wir uns die Bergpreispunkte: ich, Adorni, Bahamontes vor dem überraschend starken Goldschmit, der eigentlich ein Roller ist.
Ich bin ein Roller und ein Kletterer und ein Sprinter. Ich greife, bei der Dreihundertmetermarke, aus der letzten Position an, aber manchmal ziehe ich den Sprint auch von der Spitze aus durch.
Die Brüglingerstraße steigt steil an, Basel ist nichts für Hundertprozentsprinter. Fritz Schär, Jan Jansen und Vittorio Adorni suchen die Entscheidung in Gelterkinden (km 214), Mario Cortesi bolzt kräftig mit, kann aber das mörderische Tempo nicht halten. Bei Sankt Jakob presche ich vor, ich habe Santarossa, Santarossa und van Looy am Hinterrad, ich lasse ihnen im Spurt aber keine Chance. Ich kreuze das Zielband 1:14 hinter dem Sieger Adorni (256 km in 4:43:38,7, Mittel 35,203). Ich bin frisch für das Zeitfahren.
Das Zeitfahren ist das Rennen der Wahrheit. Wer im Rennen gegen die Uhr versagt, ist den Gummi auf seinen Felgen nicht wert.
Ferdy Kübler war ein Abfahrer, der Kopf und Kragen riskierte. Was machsch dänn du da, fragte Hugo Ferdy, als Ferdy nach Göschenen wieder in der Spitzengruppe auftauchte.
Ich gewinne das Zeitfahren.
Das Tragen des Goldtricots belastet die Nerven, vor allem vor der großen Alpenetappe. Adorni trinkt Ovomaltine, Santarossa trinkt Ovomaltine, Gianni Motta isst Redoxon. Ich bin sehr ruhig.
Bis Tirano lassen sich die Favoriten nicht aus den Augen. Ich habe immerhin ein Polster von 2:12, da kann ich ruhig abwarten. Nach Campocologno zieht Göpf Weilenmann das Tempo an, in Le Prese fällt er vom Rad, aber er hat das Feld gesprengt.
In Poschiavo holt sich Ziffiolo den mit zweitausend Franken dotierten Premio Cooperativa. Die ersten Rampen bis Sfazù werden geschlossen genommen. Da schau einmal zum Fenster hinaus, sagt Alois. Ich werde bei La Rösa angreifen. Ich muss bis Ospizio mindestens eine Minute dreißig auf Santarossa und Bahamontes herausfahren. Ich gewinne die Etappe. Damit ist die Tour gelaufen. Die Schlussetappe ist eine reine Formalität, Mädchen und Bauern stehen an den Straßen und klatschen.
Ja, sage ich, was ist?
Da kommt jemand, weit unten am Hang.
Nach der Wegbiegung, aber noch vor der Buche kommt ein schwarzer Punkt bergauf. Der Briefträger kanns nicht sein.
3
Eines Tages merkte ich, dass mein Vater sich die Hände wusch, immer häufiger, alle fünf Minuten. Niemand, sagte er und begann zu weinen, hat mich lieb. Um sechs Uhr früh fiel er um, er schlug mit dem Kopf gegen die Badewanne. Der Arzt trug Pantoffeln, eine blaugestreifte Pyjama-Jacke und einen Regenmantel.
Du, ruft Alois, der mit einer Angel durchs Wohnzimmer in die Küche kommt, kannst du Fischsuppe kochen?
Eine Fischsuppe lässt sich, zur Not, schon aus einem geschlachteten Goldfisch herstellen.
Wir nehmen die Barsche aus, einen nach dem andern, wir sehen zum Fenster hinaus, über mein äsendes Schwein hinweg ins Grüne.
Salz, frage ich.
Käse, sagt Alois.
Alois wirft die Barsche ins kochende Wasser, er summt vor sich hin, dann die Languste, dann den Hummer, die Krabben.
Ich gebe Petersilie hinzu, ein Ei, Salbei, Quendel, etwas Ketchup.
Nein, sagt Alois, keinen Ketchup, denk an Escoffier. Mein Vater trank jeden Abend einen Liter Milch, er ließ die Milch stehen, bis eine dicke Haut obenauf schwamm. Milchhaut, sagte er, ist gesund. Mein Vater wickelte einen Milchhautfetzen um einen Teelöffel, drängte ihn mir in den Mund und sagte, Iss, das ist gesund.
Ich rühre in der Fischsuppe, ich sage zu Alois: Einmal habe ich in Sankt Moritz Hildegard Knef zum Kaffee eingeladen. Hildegard Knef saß in der Bar des Hotels Carlton. Sie hatte einen ganz nackten Rücken.
Alois wirft etwas Käse in die Pfanne, wischt die Hände an der Schürze ab und sieht ins Grüne.
Schwalben versammeln sich auf den Drähten. Sie hatte einen nackten ganz weißen Rücken, sage ich.
Wir setzen uns an den Tisch.
Überhaupt zäpfelt Féchy nie, sage ich, er ist von Natur aus so, er kommt aus der Sonnenstube der Schweiz.
Alois beißt in einen Barsch, ich esse eine Kartoffel.
Es klopft.
Ich sehe Alois an.
Ich gehe, sage ich und gehe. Ich gehe durch den Gang, gehe auf Zehenspitzen an der Haustür vorbei, es klopft, nach links die zwei Stufen hinab in die Küche, auf Zehenspitzen durch die Küche, es klopft in meinem Rücken, zwei Stufen hinab in die Scheune, durch die Scheune zum Tor, ich öffne das Tor. Ich luge ins Freie. Vor der Tür steht eine Frau mit einem schwarzen Regenmantel und einem schwarzen Hut. Ich schließe die Scheunentüre wieder, sie quietscht. He, ruft die Frau, he, Sie.
Ja, sage ich und öffne die Tür wieder.
Die Frau kommt auf mich zugeschritten. Ich bin Frau Knuchelbacher, ich bin die Mutter, Frau Knuchelbacher, sagt sie. Sie sticht mit ihrem Schirm in meinen Boden. Ich sehe nach unten.
Ja, sage ich, was kann ich für Sie tun.
Eine Herbstzeitlose ist kaputtgegangen.
Ich bin Frau Knuchelbacher, sagt Frau Knuchelbacher.
Wo ist Alois?
Ich sehe in den Himmel, Schwalben, Schwalben, viel Schwalben, es wird schlechtes Wetter geben.
Es wird schlechtes Wetter geben, sage ich.
Hä, sagt Frau Knuchelbacher.
Die Schwalben, sage ich, jedes Jahr die Schwalben. Seit vier Jahren wohne ich nun hier oben, allein, da bin ich froh, wenn wenigstens die Schwalben im Frühling und im Herbst da sind, sonst habe ich ja nur das Schwein, ja, sage ich, und die Hühner.
Schön haben Sie’s hier, sagt Frau Knuchelbacher.
Ich knalle ihr die Faust unters Kinn schlage ihr das Nasenbein zu Mus die Ohren in Trümmer trete ihr ins Schienbein in den Bauch haue ihr eine schleudere sie an die Wand. Aber, aber. Ich nehme die Tomatenkiste und schleudere sie durchs Schaufenster, ich wische die Ölflaschen vom Regal, ich schmettere die Kaffeerahmflaschen in die Frischeier, werfe die Mütze des Beamten in den Dreck und trample darauf herum, ich zertrümmere alles haue alles kurz und klein und zusammen. Ich trete, schlage, schmettre, knalle, quetsche, schüttle, zerre, reiße, schieße schieße kchkch.
Ich mag Schwalben auch, sagt Frau Knuchelbacher. Sie atmet tief ein.
Im Haus knallt es.
Alois, ruft Frau Knuchelbacher, Alois. Rauch kommt aus der Scheunentür, aus der Küche, dem Wohnzimmer, dem Bad, wo Alois mit einem schwarzen Gesicht liegt.
4
Aus Mr. Henry Livingstones Kamin kommt Rauch, jetzt scheint die Sonne. Mr. Henry Livingstones Kraal ist groß und windschief, er ist aus Bambusstäben gebaut etc. Sein Rauch steigt senkrecht aus dem Kamin, auf seiner Palme sitzen Affen, nachts bewegen sich Lichter, aber Mr. Henry Livingstone ist nicht immer sicher etc.
Mr. David Stanley sieht weit unten den Tanganjika-See, im windstillen Morgen kann er Bab-es-Mala sehen, Bab-es-Mala, sagt Jim in seinem Pidgin-Kongolesisch und deutet auf Bab-es-Mala, I know, I know, sagt Mr. David Stanley, denn er spricht immer englisch, he is an Englisher.
Mr. Henry Livingstone kommt mit seinem Fliegenwedel unter dem Arm über den Kiesweg. Mr. David Stanley kommt mit der Flagge des United Kingdom in der Hand durch das Schilf, er stapft durch den Gemüsegarten, durch die Kakteen, er sieht Mr. Henry Livingstone, der im Palisadentor steht und nach der Sonne sieht, er schreitet nicht schneller, aber festen Schritts auf Mr. Henry Livingstone zu.
Mr. Livingstone, I presume, sagt Mr. David Stanley. I have a dog, his name is Snooks, sagt Mr. Henry Livingstone. Very pleased to meet you. How is your wife.
In den Palmen schreien die Affen. Die Sonne versinkt blutrot im Tanganjika-See.
Yes yes, sagt Mr. David Stanley, I must just quickly typewrite that I have found you.
Alois, sagt Frau Knuchelbacher, Alois, habe ich dich endlich gefunden, warum hast du nie angerufen. Frau Knuchelbacher nimmt aus der Handtasche ein Taschentuch, rennt zum Wasserhahn, legt das nasse Taschentuch auf Alois’ schwarzes Gesicht. Mäuschen, sagt Frau Knuchelbacher, was hast du wieder angestellt, das ganze Bad ist schwarz.
Ich setze mich auf den Tisch.
Frau Knuchelbacher wäscht Alois mit einem Wattebausch mit Alkohol aus einer Flasche mit einem roten Etikett. Ich sehe vor mir das Brotmesser, das Holzbrett, die Suppenschüssel, die Pfanne mit der heißen Fischsuppe und die Stühle und die Kohlenschaufel, den Schürhaken, das Fleischmesser, den Briefbeschwerer, ich stehe auf und nehme einen Apfel und beiße hinein, ich beiße auf den Bissen, schmeiße den Rest zum Fenster hinaus, gehe zur Tür, vors Haus.
Chhätschhächa, sage ich und gebe einem Stein einen Fußtritt.
Jetzt grunzt mein Schwein.
Pshaw, sage ich zu Sam Hawkins, das kann nur Tante Droll sein, thunderstorm.
Der kleine Sam Hawkins nimmt seine Rifle, schreitet breitbeinig zu seinem alten, treuen Klepper, streichelt ihn zwischen den Ohren und sagt: Wir beide werdens schon noch schaffen, wenn ich mich nicht irre, hihihi.
Will Parker und Dick Stone schauen zweifelnd zu mir, aber ich winke unmissverständlich mit den Augen. Es gilt weiterzureiten. Die Sonne erhebt sich über dem Llano Estaccado.
Wenn Winnetou stirbt, ruft Winnetou hinter mir, stirbt Winnetou als Christ.
Der Knieschuss ist der schwierigste aller Schüsse. Er ist was der Löwe unter den Tieren: der König der Schüsse. Ich sitze am Lagerfeuer, die Freunde dösen vor sich hin, Will und Dick würfeln, ich denke vor mich hin und trinke hin und wieder einen Schluck Brandy. Trapper sind auch unter Trappern einsam. Ich sehe die Sterne.
Da höre ich ein Geräusch, nicht einmal ein Geräusch, ein Nichts: Ein Westmann hat Ohren wie Suppenteller.
Der anschleichende Indianer, der sich nur auf zehn Fingerspitzen hält, um keine Spuren zu hinterlassen, verrät sich durch seine Augen. Sie sind zwei leuchtende Punkte im Gebüsch. Ich weiß: er oder ich. Wie im Spiel – oder als ob ichs reinigen wollte – greife ich zum Gewehr, und jetzt zeigt sich, ob der Mann im Gebüsch den Knieschuss kennt. Kennt er ihn, schließt er die Augen, und ich habe kein Ziel mehr, nur noch surrende Blätter im Schein des Lagerfeuers. Er schließt sie nicht, er ist ein ungebildeter Comanche. Ich winkle mein Knie an, sodass die Verlängerung des Oberschenkels den lauschenden Indianer trifft. Ich bringe das Gewehr, mit dem ich schon seit Minuten spiele, ohne es in eine dem Comanchen bedrohliche Position zu bringen, in eine dem Comanchen bedrohliche Position: an meinen Oberschenkel. Das Zielen, ohne Aug und Kimme, ist schwierig, der Finger muss unauffällig zum Abzug, auch Comanchen haben manchmal für mehr als zwei Unzen Grips. Dick und Will würfeln, ich rufe ihnen ein Scherzwort zu: Wer wagt, gewinnt, zounds.
Der Schuss kracht. Alle springen auf. Ich schnelle ins Gebüsch. Da liegt ein toter Sioux, mit einem Schussloch in der Stirn. Huhu, ruft Frau Knuchelbacher. Ich drehe mich um.
Alois hat jetzt ein kreisrundes weißes Gesicht. Wo habt ihr das Putzzeug, sagt Frau Knuchelbacher, ihr müsst doch Putzzeug haben, Alois weiß nicht, wo das Putzzeug ist, er hat alles schwarz gemacht, das ganze Bad ist schwarz. Ich sehe Frau Knuchelbacher nach, die aufs Haus zuschreitet. Übers Haus fliegen Schwalben, sie sehen mich und Alois, der sich auf den Baumstamm setzt. Ich gehe hin und her. Alois steht auf und schnäuzt sich, ich setze mich auf den Baumstamm. Alois setzt sich neben mich. Wir sehen Frau Knuchelbacher aus dem Haus kommen, in der Hand trägt sie den Schirm und die Handtasche, sie ruft etwas, doch welche Schwalbe versteht Frau Knuchelbacher.
Dann geht sie schnell den Abhang hinab, sie wird klein und kleiner, nach der Buche, aber noch vor der Wegbiegung ist sie ein schwarzer Punkt, der auch der Briefträger sein könnte.
5
Wie soll eine Amme beschaffen sein? 1. Eine Amme muss gesund und sauber sein. 2. Sie muss reichlich Milch haben, und ihre Brüste müssen eine Beschaffenheit zeigen, dass man von ihnen eine ausgiebige Produktion von Milch erwarten kann. 3. Die Amme muss vor allem gute Zähne haben. Darauf achte man unter allen Umständen, denn nur dann hat sie eine leichte und gute Verdauung. 4. Man hüte sich, die Amme zu überfüttern. 5. Kann der Säugling die ganze Milchmenge der Amme nicht konsumieren, dann bleibt ein Rest in der Brust zurück, und die Milchbildung geht zurück. Die Amme wird unbrauchbar.
Im Winter, wenn Schnee im Garten lag, sah die weiße Dame die Spuren im Garten, sie sah die Amseln, sie sah mich, ich hatte den Watutin auf.
Meine Ängste: unter Gewittern spazieren zu gehen. Irgendwo am Rückgrat auseinanderzubrechen. Nachts ums Haus zu gehen. Zwischen fünfzigtausend Leuten zu stehen. In einem Sinfoniekonzert plötzlich laut schreien zu müssen. Abends bei Regen in einer Kleinstadt anzukommen. Jemanden im Estrich hängend zu finden. Gebackene Nierchen essen zu müssen. (Meine Freuden: nach einer langen Reise einen halben Liter Fendant zu bestellen. Luftballone zu sehen, die größer sind als die Kinder unten dran. Männer in breiten Hüten über weite Ebenen reiten zu sehen. Pendelnde Saloon-Türen. Mortadella zu essen. Kalenderbilder mit Motiven aus der Südschweiz, etwa die Brissago-Inseln, zu betrachten. Auszuschlafen.)
Wie hat sie uns denn nur gefunden, sagt Alois, wie denn nur, ich verstehe nichts, ich verstehe kein Wort.
Ich stehe vom Baumstrunk auf und gehe ins Haus. Es wird jetzt langsam dunkel.
Die Besatzung einer zweimotorigen Fokker Friendship besteht aus zwei Männern im Cockpit, einem Steward und der Stewardess. Ich bin der Chef, Alois ist der zweite, aber bei ruhigem Wetter darf er auch einmal steuern. Starten und landen allerdings, das tue ich, das ist das Heißeste am ganzen Fliegen, man landet nur einmal pro Flug, und das lässt sich kein Flugkapitän entgehen. Ich habe eine Mütze mit viel Gold, während des Fliegens habe ich die Ärmel hochgekrempelt, in der Luft zählt der Mann und nicht die Uniform. Die Stewardess heißt Sonja. Ich kenne die Flugplätze dieser Welt, Rom, Bangkok, Karachi, Rio, Lima. Aber Piloten kennen nur die Flugsicherungsbüros und die Flughafen-Restaurants, ich kaufe Sonja am Duty-free-Shop einen Elefanten aus Elfenbein.
Ich muss den Frühkurs nach Athen fliegen, es regnet, man meldet mir eine Gewitterfront über den Alpen. Ich habe dreiundsechzig Engländer, da muss ich sehen, dass ich mit der Maximalbelastung gut wegkomme. Die Piste ist kurz.
Ich komme übers nasse Betonfeld, Alois ist schon im Cockpit und hakt die Checkliste ab. Benzin, sage ich und hänge den Kittel an den Haken, die Mütze werfe ich in die Bordküche. O.K., sagt Alois. Tausenddreihundert.
Dann wollen wir, sage ich und setze mich auf den Sitz des Kapitäns. Alois schnallt sich auf dem Copiloten-Sitz an. Ich schalte den Sprechfunk ein, alles klar, sage ich, wir könnten.
O.K., sagt der Mann im Turm, der Jean-Pierre heißt, vous pouvez partir wenn d’Whisky Nordpol drinn isch.
Rodger, sage ich.
Ich löse die Bremse, schiebe den Gashebel vor, die Fokker beginnt zu rollen. Die Sicht ist miserabel, ich werde nach Instrumenten fliegen müssen.
Ich steuere das Flugzeug auf dem Runway zum Pistenanfang, ich höre im Kopfhörer die Whisky Nordpol im Endanflug, jetzt sehe ich sie als Schatten im Regen, wie sie auf der Piste aufsetzt. Sie ist fast eine Stunde zu spät, manchmal reichts noch zu einem Jass. Meine Damen und Herren, sage ich ins Bordmikrofon, hier spricht Ihr Flugkapitän. Wir heißen Sie willkommen auf unserem Flug von Basel nach Athen. Bitte schnallen Sie sich an und rauchen Sie nicht mehr. Ladies and Gentlemen, this is your capt’n speaking. Please fasten your seat-belts and do not smoke.
Ich wende die Maschine am Pistenende, rechts und links verlieren sich die Pistenlichter im Nieselregen, ich schiebe die Gashebel für beide Motoren auf volle Kraft, ich halte die Maschine mit der Bremse, das Flugzeug zittert, jetzt löse ich die Bremse, das Flugzeug rollt los, noch steuere ich es mit dem Fahrwerk, jetzt – ich beobachte Tourenzähler und Geschwindigkeitsmesser – nur noch mit dem Seitensteuer, der Zeiger klettert auf Abhebegeschwindigkeit, ich ziehe das Höhensteuer gegen mich, die Maschine hebt ab, kurz vor dem Pistenende.
Sie ist rammelvoll beladen, in Rom muss ich nach unten, um Benzin nachzutanken. Ich gehe auf 5300 Meter.
Bider flog mit einem Fahrrad mit Flügeln von Luzern nach Mailand. Schwarze Herren mit weißen Kragen, Melonen und Spazierstöcken, Damen mit weiten Röcken und großen Hüten rannten auf der Piste hin und her, als er landete. Nachher zertrümmerten sie vor Freude das Flugzeug, sodass Bider mit der Alpenpost nach Hause musste.
Marcel Jeanvilliers flog vor achttausend Zuschauern dreißig Meter weit.
Auf der Schützenmatte flogen Ackermann und Weder mit ihrem Doppeldecker zwei Meter über dem Boden hin, zuerst mit den Köpfen, dann mit den Fahrradrädern nach oben, dann stiegen Ackermann und Weder knatternd nach oben, stachen nach unten, oh, schrien die Zuschauer, dann gingen sie in Seitenlage, hielten das Flugzeug so, schließlich gingen sie auf tausend Meter Höhe, Weder sprang mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug, aber der öffnete sich nicht.
Spinnst du eigentlich, fragt Alois.
Flugfeste waren wie Pferderennen, man sah bärtige Herren mit Ferngläsern und Damen mit Sonnenschirmen. Männer in Lederkleidern, mit Schutzbrillen und gewaltigen Flügeln sprangen von hohen Gerüsten und brachen sich die Beine, andere traten ein Tandem mit Flügeln wie verrückt, sie hatten rote Köpfe und große Hüte. Wenn das Tandem für einen Meter vom Boden abhob, klatschten alle Leute und warfen Blumen in die Luft.
Lass das doch, wie es ist, sagt Alois, und ich nehme das rosa Handtuch, hänge es an den Plastikhaken, er packt die rotweiße Ajaxbüchse, ich versorge die braune Schrubb-Bürste, er schiebt den braunen Hocker in die Ecke, er sieht sich sein rosa Gesicht im Spiegel an, und ich lege jetzt den roten Waschlappen auf den weißen Rand der Badewanne.
Im Fußball, im Fußball muss jeder ein Allround-Mann sein und ein Vollathlet. Ich spiele Libero, aber meine Flügelläufe sind gefürchtet. Der FCB spielt einen kompromisslosen Zweckfußball, der Ball wird steil gespielt, über wenige Stationen. Tore zählen, nicht artistische Schönheiten. Wir müssen auf den immer noch verletzten Benthaus verzichten, dreiundzwanzigtausend Zuschauer sind im Stadion Sankt Jakob.
Beide Mannschaften beginnen nervös, Internazionale muss auf seine Sturmspitze Santafini verzichten; wir haben Respekt vor dem berühmten Gegner aus der Lombardenmetropole und versuchen durch Ballhalten dessen Anfangskadenz zu brechen. In der 2. Minute schon bricht Riva gefährlich durch, Pfirter kann ihn nicht halten, doch Kunz lenkt den perfiden Innenristschuss zur Ecke. Ich gehe im Angriff mit, ich bin sehr schnell. Der Ball liegt mir auf dem Fußn als sei er angewachsen. Nur Haller und Pelè beherrschen diesen Trick gleich souverän. Feuer ist in Internazionales Verteidigung, auch Herreras Schützlinge kochen nur mit Wasser. Odermatt wird an der Strafraumgrenze hart gelegt, ich trete den Freistoß, der Ball saust hart an der gegnerischen Mauer vorbei an die Latte, Hauser erbt den Abpraller: 1:0. Ich bin die Seele des Angriffs. Eine Musterflanke setzt Odermatt an den Pfosten, eine perfekte Dreierkombination Michaud–Frigerio–Hauser kommt zu mir, ich tricke Schnellinger und Macciolo ab, dem Mailänder Schlussmann lasse ich mit einem trockenen Schuss in die rechte tiefe Ecke keine Chance.
Ich werde auch das Rückspiel in Mailand spielen müssen. Herrera macht mir, bei einem Glas Chianti in der Bar des Schweizerhofs, ein Angebot: achthunderttausend offiziell und hunderttausend unter dem Tisch. Er braucht einen Realisator, einen mit dem Torriecher, mit Goldfüßchen, einen Reißer, er braucht mich. Ich hätte, sagt Herrera, Dynamit im Stiefel, hai della dinamite nelle scarpe, sagt er augenzwinkernd zu mir.
Diese Schrift ist gewidmet:
Seppe Hügi,
Wyni Sauter,
Babette Zaugg, der noch nie etwas
gewidmet worden ist,
Eugen Gander, der vier Duke-
Ellington-Platten unter seinem Bett
versteckt,
Zoe und
Daniel Düsentrieb.
6
Huhu, ruft jetzt jemand. Ich sehe Alois an und sage: Das ist deine Mama.
Huhu, ruft eine andere Stimme.
Das ist meine Schwester, sagt Alois.
Ich gehe durchs Wohnzimmer, schiebe die Weinflasche hinter den Vorhang, gehe nach links durch den Gang zur Tür: Guten Tag.
Guten Tag, sagt die Schwester von Alois, ich heiße Miriam.
Miriam trägt einen olivfarbenen Regenmantel mit braunen Lederknöpfen, einen rostbraunen Pullover, einen beigen kurzen Rock, beige Netzstrümpfe, rostbraune Schuhe, einen schwarz-weiß karierten Büstenhalter, einen weißen Strumpfhalter, schwarz-weiß karierte Unterhosen, ich glaube, ich liebe Miriam schon.
Nehmen Sie Platz, sage ich, ich nehme die Flasche vom Fensterbrett.
Miriam trinkt nichts, sagt Frau Knuchelbacher. Und ich trinke auch nichts.
Sie lässt den Colt um den Zeigefinger rotieren. Ich setze mich und schenke mir ein, Miriam setzt sich mir gegenüber, Frau Knuchelbacher setzt sich nicht, sie streicht mit dem Zeigefinger übers Fensterbrett und sieht sich den Finger an.
Wollen wir nicht eine Partie Schach spielen, sage ich zu Miriam, ich spiele sehr gern Schach, ich habe einmal simultan an dreißig Brettern gespielt.
Ich habs mir ja gedacht, ich habs mir ja, sagt Frau Knuchelbacher im Bad.
Und haben Sie gewonnen, sagt Miriam, die ich jetzt liebe. Ich stelle die Figuren auf, schon das Aufstellen ist eine Kunst. Ich weiß nie, ob der König rechts von der Dame steht oder links.
Aber nein, das ist doch nicht wahr, sagt Alois im Bad.
Ich spiele Weiß, ich ziehe mit dem Königsspringer. Miriam zieht einen Bauern. Ich ziehe mit dem zweiten Springer. Miriam denkt.
Wenn ihr nicht wollt, kommt alles an die Luft, sagt Frau Knuchelbacher im Bad, du weißt das sehr gut. Das Wasser beginnt zu laufen, Miriam zieht einen Bauern. Ich mache eine Rochade. Aber natürlich, sagt Alois. Es windet, Zweige schlagen ans Fenster, jetzt, ich verschiebe meinen Läufer: Miriams Dame ist bedroht. Das Wasser läuft, die Leitungen glucken. Miriam schiebt den Läufer vor, zum Schutz der Dame. Aber sicher werdet ihr, schreit Frau Knuchelbacher. Ich ziehe den Turm, Miriam die Dame, Schach. Jemand schrubbt jetzt etwas im Bad.