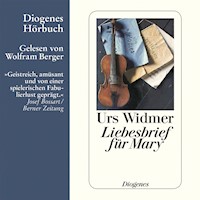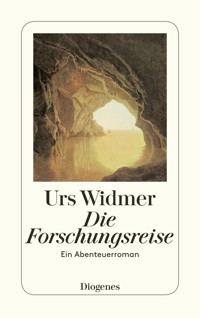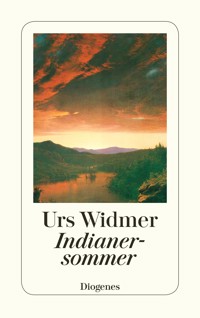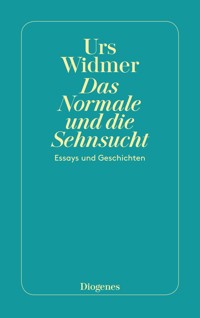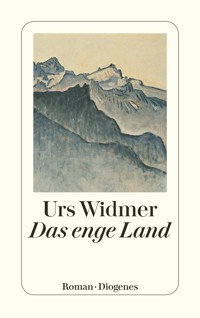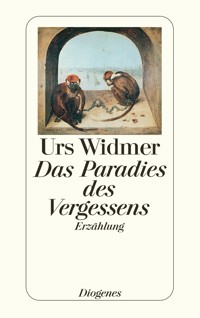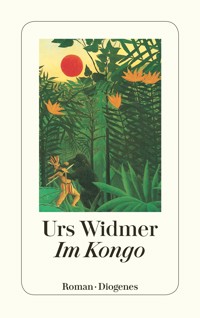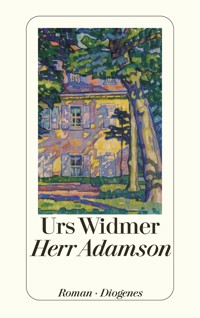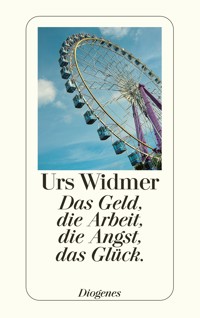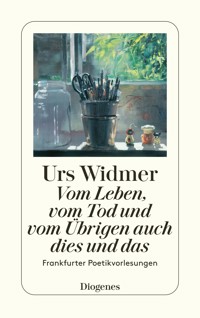
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Inhalt: Vom Abweichen von der Norm. Vom Leiden der Dichter. Vom Traum, namenlos mit der Stimme des Volks zu singen. Von der Phantasie, vom Größenwahn, vom Gedächtnis, vom Tod und vom Leben. Von König Ödipus und Sophokles. Diese fünf Vorlesungen sind die Summe der Erfahrungen Urs Widmers mit den Dichtern und ihren Büchern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Urs Widmer
Vom Leben, vom Tod und vom Übrigen auch dies und das
Frankfurter Poetikvorlesungen
Diogenes
Vom Abweichen von der Norm
Erste Vorlesung
Meine Damen und Herren,
ich freue mich, hier in Frankfurt Gast der Universität zu sein und die Poetikvorlesung dieses Winters halten zu dürfen. Ich habe zwar vor, eine weitgehend anekdotenfreie Vorlesung zu halten und auch eine, in der ich meine eigenen Bücher und Stücke draußen halte und lieber von den Schöpfungen anderer rede. Ich bin wohl einer, dem die Geständnisse leichter fallen, wenn ich über etwas Drittes spreche. – Zu Beginn muss ich Ihnen allerdings schon sagen, wie viel und wie viel für mich Entscheidendes mich mit Frankfurt und den Menschen, die hier lebten und leben, verbindet. Als ich, vor weit mehr als vierzig Jahren, zum ersten Mal nach Frankfurt kam, war ich nominell zwar volljährig und hatte sogar einen Führerschein, sah aber sonst eher wie ein etwas zu groß geratener Bub aus, den ein ungutes Schicksal gezwungen hatte, lange Hosen und einen Sakko zu tragen. Damals rüstete man sich nämlich mit einem Schlips und einem Sakko aus, wenn man es mit dem Fremden aufzunehmen versuchte, und an der Uni sagten die Studenten Sie zueinander.
Es waren meine Autofahrkünste, die meinen Vater dazu bewogen, über seinen Schatten zu springen – eigentlich war er ein Nesthocker, kein Nestflüchter – und mir von einer Minute auf die andere mitzuteilen, wir führen jetzt zusammen nach Frankfurt, jetzt sofort, zur Buchmesse, da gebe nämlich heute Abend Klaus Nonnenmann – wir waren mit ihm befreundet, und er seinerseits war mit dem Rest der literarischen Welt auf Du und Du – eine Party, die Mutter aller Partys, und da müsse er hin, und also ich und unser Auto auch. (Mein Vater, ein Intellektueller der alten Schule, konnte natürlich nicht Auto fahren.) – Wir fuhren also los. Unser Auto war ein 2CV der ersten Generation – die Scheibenwischer wischten nur, wenn man in hohem Tempo dahinbretterte; im Stadtverkehr quietschten sie nur noch todkrank hin und her; und wenn das Auto stand, blieben auch sie bewegungslos, Regenböen hin oder her. – Wir rasten, mit laufenden Scheibenwischern, mit einem Schnitt von glattwegs sechzig über die Autobahn. Neben mir mein zufriedener Papa, der als Mitbringsel einen Riesenklumpen Bündnerfleisch auf den Knien hielt. Ich erlebte zum ersten Mal Verkehr – das gab es damals in der Schweiz noch nicht, mehr als drei oder vier Autos zwischen dir und dem Horizont, das war undenkbar – und starb tausend Tode. In Frankfurt dann, bei Klaus Nonnenmann, der in der Nähe des Eschenheimer Turms in einer Dachwohnung wohnte, gab’s dann tatsächlich jenes Fest aller Feste, in dem ich auf einen Schlag die gesamte Nomenklatura der damaligen deutschen Literatur kennenlernte. – Klaus Nonnenmann, das nur nebenbei, war ein wunderbarer Schriftsteller, hatte nur noch eine Viertellunge (die anderen drei Viertel waren im Krieg kaputtgegangen) und rauchte zwei Päckchen Rothändle pro Tag. Er war der Autor eines Romans, der heute mehr oder minder vergessen ist und ihm dennoch einen Platz im Olymp der Literatur garantiert, Teddy Flesch oder die Belagerung von Sagunt, just damals erschienen. Ich glaube nicht, dass die Party deswegen stattfand, Promotion machte man damals noch nicht so wie heute. – Es wurde ein großartiges Fest, Wein, Weib, Gesang, ich lernte damals, dass die deutsche Literatur auch dazu fähig war. – Am nächsten Tag nahmen mein Vater und ich den Riesenklumpen Bündnerfleisch wieder mit nach Hause. Außer Max Frisch hatte niemand davon gegessen, weil die Deutschen damals noch, wie bei uns die Bauern noch immer, nichts aßen, was sie nicht kannten.
Als ich, nicht allzu viele Jahre später, hierher übersiedelte, war ich eine Spur erwachsener geworden. Ich fuhr nun einen R4, und ich hatte eine Frau. Siegfried Unseld stellte mich in seinem wunderbaren Verlag als Lektor für zeitgenössische deutsche Literatur an und raunte mir beim Einstellungsgespräch beiläufig zu, na ja, er sei ja nun auch nicht mehr der Allerjüngste, und dieser schöne Verlag brauche ja dann eines Tages einen Nachfolger, ja eben, daran solle ich immer denken, wenn ich mich für 1200 Mark netto ins Zeug legte. – Ich nickte, ich legte mich ins Zeug, aber irgendwie bin ich dann doch nicht sein Nachfolger geworden. – Ich blieb siebzehn Jahre in Frankfurt, siebzehn reiche und fruchtbare Jahre, und habe hier, wenn ich recht zähle, zehn Prosabücher und sechs Theaterstücke geschrieben. Ich habe hier jene wilden Jahre um 1968 erlebt, in denen die Abrissbirnen der Immobilienspekulanten so heftig durchs Westend tobten, dass ich, wenn ich einmal für ein, zwei Wochen woanders gewesen war, den Heimweg kaum mehr fand und froh war, dass wenigstens mein Haus noch stand. – Und ich habe auch an der Uni einem oder zwei meiner Poetikvorlesungsvorgänger zugehört, ohne dass mich damals der Gedanke auch nur gestreift hätte, dass ich auch einmal einer von ihnen sein könnte. – Damals wurden nur die ganz großen Tiere eingeladen. Entweder bin ich inzwischen auch so ein ganz großes Tier geworden, oder es dürfen inzwischen, nach den Löwen, Elefanten und Krokodilen, auch Feldhasen und Kirchenmäuse ran an den Speck. – Ende 1984 gingen wir – meine Frau, mein Kind, ich – in die Schweiz zurück. Ich tat dies mit einem merkwürdig gemischten Gefühl. Einerseits war ich in den siebzehn Jahren fast so etwas wie ein Frankfurter geworden, ein deutscher Dichter viel eher als ein helvetischer. Andererseits waren mir in diesen Jahren die Unterschiede immer deutlicher geworden. Zu Beginn hatte ich gedacht, mein Gott, wo soll der Unterschied zwischen einem aus Basel und einem aus Frankfurt sein? Gleiche Sprache, gleiche Kultur. – Der Unterschied lag natürlich in der je verschiedenen Geschichte. Ich lernte, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob man den Faschismus ganz wirklich jeden Tag leben und erleiden muss, den Krieg dann bald auch, oder ob man ihn, wie ich und meine Eltern, durch den Grenzzaun sieht und sich zu Tode fürchtet. Ihm aber eben doch nicht ausgesetzt ist, oder nur in jenen Spurenelementen, die der Wind des Zeitgeists auch in die Schweiz geweht hatte.
Dabei hatte ich eine Dissertation über dieses Thema geschrieben! Dass die Jahre des Faschismus, neben allem anderen, auch die deutsche Sprache regelrecht verheert hatten. Das einst so schöne weiche, gelenkige Deutsch war während jener zwölf mörderischen Jahre zu einer auf hohle Formeln reduzierten eindimensionalen Sprachattrappe geworden, in der schier jedes Wort von der Lügenwelt der Diktatur infiziert war. Jeder sensible Mensch spürte das, aber es waren die Schriftsteller, die Dichter, die am meisten unter der Verkommenheit ihrer Sprache litten, die jungen Schriftsteller am allermeisten, weil sie keine Erinnerung an ein Vorher hatten und die Energie in sich spürten, bei null anzufangen, um eine andere Zukunft zu schaffen. Sie ahnten, wie verrottet ihre Sprache war, aber sie kannten keine andere.
Die Generation derer, die nach 1945 zu schreiben begannen, war damit in einer Lage, in der sich die deutsche Literatur überhaupt noch nie befunden hatte. Sie verfügten nicht, wie dies alle Generationen zuvor getan hatten, über einen gesicherten Fundus des Sprechens und Denkens. Über eine selbstverständliche Norm, an der sie sich, wie jede neue Generation, reiben konnten oder mussten, durch Abweichungen, neue Zusammenhänge, durch Kühn- und Frechheiten, die aber eben doch, wie bisher immer, auf dem festen Fundament einer stabilen Tradition standen. (Natürlich hatte schon der Erste Weltkrieg die Welt von damals in Stücke geschlagen. Vielleicht müssen wir die Schäden nach 1914 und nach 1933 addieren.) Die jungen Schriftsteller nach 1945 jedenfalls hatten keine Sprache mehr. Jedes Wort erwies sich als, sagen wir, krank, und sie verfügten selber, aus eigener Kraft, über keine anderen, sagen wir, gesunden Wörter. (Das Wort »gesund« war eines der kränksten: Was im Faschismus »gesund« genannt wurde – das Volksempfinden, der Humor, das Denken –, war just die fühllose Bereitschaft zu Gewalt und Mord.) Es war eine Situation zum Verzweifeln, und viele sind denn auch verzweifelt. Immerhin waren die jungen Schriftsteller damals die, die die Aussichtslosigkeit der Lage überhaupt erkannten. Sie hatten keine Chance – um das Bonmot von Herbert Achternbusch zu gebrauchen –, aber sie nutzten sie. Sie waren, wie Wolfgang Borchert es nannte, eine »verlorene Generation«, und das war tatsächlich mehr als pathetische Rhetorik. So war es. Bei Ilse Aichinger, in ihrem ersten Roman Die größere Hoffnung, 1948 erschienen und das schier einzige bedeutende Prosawerk jener frühen Jahre des Neubeginns, versuchen die Kinder, aus eigenem Antrieb und als sei es der Lehrstoff einer Schule des Lebens, die deutsche Sprache zu verlernen. Aber auch das erweist sich als unmöglich. »Heute ist schon die zwölfte Stunde«, seufzt ein Kind. »Und wir haben noch kein einziges Wort verlernt.« – Aus diesem Bewusstsein sind die Konzepte des »Kahlschlags« – der Begriff stammt von Wolfgang Weyrauch – und der »Stunde Null« entstanden. Aber natürlich ließ sich die Zeit auch damals nicht anhalten und transportierte unerbittlich weiterhin den alten Schrott von früher mit sich.
Ich habe im Übrigen damals alle Autoren gelesen, die zwischen 1945 und 1948 ihr erstes Buch publiziert hatten. Es ist mir wohl der eine oder andere durch die Lappen gegangen: aber das war durchaus machbar. So viele waren es nun auch wieder nicht. Aber nur wenige versuchten überhaupt, sich zu jener Abweichung vom allgemeinen Sprachgebrauch vorzuarbeiten, die der Keim jener versprochenen neuen Sprache hätte werden können. Nur die Bewusstesten unter ihnen versuchten erst einmal, die belasteten Wörter radikal umzuwerten, weil sie ganz nicht auf sie verzichten mochten. So kämpften sie nun eben fanatisch für die Demokratie und nicht mehr, wie andere vor kurzem noch, für den Endsieg. Nur wenige schlugen regelrecht auf die Sprache selber ein, Wolfgang Borchert, der fast sofort starb, oder Wolfdietrich Schnurre, der zu Unrecht ziemlich vergessen ist. Heinrich Böll legte mir einmal sehr berührend, sehr eindringlich und sehr ratlos auseinander, wie sehr das Schreiben jedes einzelnen Satzes in den ersten Nachkriegsjahren schwer und belastet war. Es ist heute kaum mehr nachvollziehbar, dass es tatsächlich die Arbeit von etwa zwei Generationen brauchte, um der deutschen Sprache jenes Minimum an naivem Potential zurückzugeben, das die Dichter brauchen. (Das wir alle brauchen, natürlich.) Jene Prise Unschuld, ohne die das Schreiben nicht möglich ist. Wer heute sagt, dass sozusagen alle Bücher der ersten Nachkriegsjahre ziemlich schwach auf der Brust seien, hat recht und sollte dennoch bedenken, dass kein Pilot Loopings fliegen kann, wenn seine Maschine ohne Flügel am Boden steht. Auch die deutsche Literatur kennt ihre Geschichte des Wiederaufbaus. Es war eine mühselige Arbeit, wie das Steineschleppen der Trümmergeneration. Natürlich haben die, die just um 1933 anfingen, erwachsen zu werden, am meisten gelitten. Auch ein Heinrich Böll, der es ja immerhin zu einem Nobelpreis gebracht hat, war sich immer bewusst, dass er dieses Handicap nie ganz aufholen konnte. Dass er, als er den Kopf endlich wieder in den blauen Himmel recken und eine frische Luft atmen konnte, immer noch spürte, wie seine Füße im Schutt der Wörter von früher steckten. Günter Grass’ Blechtrommel hat, 1959 dann, auch darum eine so ungeheure Wirkung gehabt, weil sie ein Signal war – ein Trommelwirbel –, dass es in der deutschen Literatur mit den Sprachreparaturarbeiten langsam vorbei sein könnte und dass die Dichter auch bei uns wieder, wie anderswo seit immer, frei über ihre Wörter verfügten. Dass eine neue Norm zu wirken begann. Und wenn es nicht ganz so ideal gewesen war, so sah es für uns doch so aus.
So dass heute auch die deutschen Dichter – und mit ihnen jene aus Österreich oder der Schweiz – wieder ganz selbstverständlich in jener langen Kolonne gehen können, die aus deinen Vorgängern und Nachfolgern besteht. Wir gehen einer hinter dem anderen, ein unabsehbar langer Zug von Sonnenaufgang nach Sonnenuntergang. Diese Zottelkolonne, das ist die Tradition, und du bist, an einem Ort, den du dir nicht selber ausgesucht hast, ein Teil von ihr. Alle legen den vor ihnen Gehenden die Hand auf die Schulter und spüren auf ihrer Schulter die Hand derer, die hinter ihnen gehen. – Irgendwann einmal bist du, alt nun, der Vorderste der Lebenden geworden und gehst hinter dem jüngsten Toten. Nicht weit vor dir siehst du, ja, wen?, Robert Gernhardt, noch ganz so, wie du dich an ihn erinnerst, und dort Ernst Jandl und Reinhard Lettau und, tatsächlich, Wolfgang Hildesheimer, der, tot, Moses noch mehr gleicht, als er es lebend schon getan hat. Vor diesen, einiges weiter vorn, aber immer noch gut zu erkennen – von hinten halt – Franz Kafka und, direkt vor ihm, Rainer Maria Rilke. Reden die beiden tatsächlich ganz heiter miteinander? Ein lachender Kafka, das ja, das gewiss – aber ein grinsender Rilke? – Dann, immer ferner, immer schwärzer, der ewige Zug derer, von denen wir nur noch jeden Tausendsten kennen, bestenfalls. Büchner, Kleist, ja, und der Wuchtige dort, der so raumverdrängend geht, der muss Goethe sein. – Vor diesem sind natürlich immer noch welche, aber die meisten von diesen sieht sogar er wohl kaum mehr, jenen etwa, der sich einen falken zôch mêre danne ein jâhr, oder den Urschamanen aus der Gegend von Merseburg, der bên zi bêna heulend Arm- und Beinbrüche heilen wollte. Ja, ganz weit vorne verschmelzen die Ahnenkolonnen der Dichter und der Arzte ineinander, die Dichter wollten heilen, und die Heiler sangen magische Zauberworte. – Die Hand auf meiner Schulter könnte Sarah Kirsch gehören, vielleicht auch Elfriede Jelinek. Man sucht sich Vordermann und Hinterfrau nicht aus. Zuweilen wende ich natürlich schon den Kopf, aber es ist mühsam, nach hinten zu blicken, das Nach-hinten-Schauen während des Vorwärtsgehens klappt in meinem Alter etwa ähnlich gut oder schlecht wie beim Einparken. Aber ich sehe, nicht so weit hinter mir, die etwas Jüngeren schon noch. Den oder jene kenne ich. Dann die Jungen, deren Treiben ich auch noch manchmal mitkriege, und endlich die ganz Jungen, die, so weit hinter mir schon, alle ziemlich gleich aussehen. Ein fremder Indianerstamm mit unbekannten Bräuchen. Ein paar tanzen nebenab, und immer wieder verkrümelt sich einer oder eine, lässt die Kolonne im Stich, weil sie erschöpft sind oder eine Lebensabzweigung gesehen haben, die ihnen mehr zusagt.
Dichten ist nun auch in Deutschland wieder, was es immer war: Abweichen von der Norm. Ein anderes Sprechen, um einen Hauch anders, sehr anders. Dabei ist die Sprachnorm natürlich weder statisch noch unschuldig. Sie ist im Gegenteil in ständiger Bewegung, und sie transportiert den gesamten Glanz und Dreck der Geschichte. Sie ist so unvorhersehbar und eigenmächtig, dass auch die eifrigste Reformkommission, die schließlich fast nur noch die Gämse abschießen und ihr die gute alte Gams zurückgeben will, nicht den Hauch einer Chance hat, sie in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Die Sprache tut, was sie tut. Hier gibt irgendwer etwas in das System ein, dort stirbt ein Teil einen kaum bemerkten Tod. Mag sein, dass die Sprache Goethes und der Weimarer Klassik ihre Funktion als eine Art Urmeter der deutschen Sprache noch nicht ganz verloren hat: Gewiss ist nur, dass Goethes Sprechen von den Zeitgenossen keineswegs als das selbstverständlich Verbindliche, sondern als Verstoß gegen ihre Sprachnorm empfunden wurde.
Ich bin durchaus versucht zu sagen, dass alle Dichter im emphatischen Sinn des Worts jenes Abweichen vom Sprechen jener zeigen, die den größten gemeinsamen Nenner definieren. Und zwar, eben, unfreiwillig. Sie würden vielleicht sogar gern wie alle sprechen, aber sie können es nicht. Sie können, was sie können. Dichterisch schreiben ist kein freier Entschluss, es ist eine Verurteilung und eine bedrängende Notwendigkeit, die, wenn das Schreiben gelingt, zu einer Art Glück der zweiten Art werden kann. Der glückliche Beckett, wenn er wieder einmal besser gescheitert war. Oft und für viele ist das Schreiben ein Fluch, der erst für uns Leser (und dann doch ein bisschen auch für die Dichter selber) wie ein Segen aussieht, weil das entsetzlich Bedrängende Form und Struktur geworden ist.
Lassen Sie mich an meinem Landsmann Robert Walser, der sich zu meinen Lebzeiten aus einem regelrechten Nobody in einen Klassiker der Weltliteratur verwandelt hat, erläutern, was ich meine. Er wusste durchaus, dass er »anders« schrieb, aber er konnte nicht anders. Daher rührt seine stille Radikalität. Es war eben sein Sprechen. Es gibt kaum einen Satz Walsers, der mit einem »normalen« Sprechen deckungsgleich wäre. Walser ist stets ganz nahe an diesem normalen Sprechen dran, manchmal passt kaum ein Haar zwischen dieses und seines. Aber die Abweichung ist immer da, die Differenz unaufhebbar. Walsers Texte haben durchaus Inhalt – der Gehülfe etwa ließe sich brav nacherzählen –, aber man kann dennoch mit Fug und Recht sagen, dass Walsers eigentlicher Inhalt die Abweichung ist; nicht die wie nebenbei auch noch vermittelte